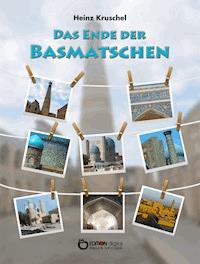7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Journalist Hans Pohnert, Leiter der Kulturredaktion der „Allgemeinen“ ist froh, dass er bei einer unabhängigen Tageszeitung arbeiten kann und platziert manchen kritischen Artikel. Als der von ihm geschätzte Kollege Salmund einen Artikel über neofaschistische Tendenzen in der Bundesrepublik Ende der 1950er Jahre nicht veröffentlichen darf, hält Pohnert das von Salmund beschriebene Beispiel für ein Einzelproblem, das in der Demokratie keine Chancen hat. Doch dann soll Pohnert an einem Soldatentreffen in Wurmfing teilnehmen und alle verdrängten Erinnerungen an die letzten Kriegstage im Wurmfinger Hochmeer, wohin er mit mehreren Klassenkameraden zum Werwolf kommandiert war, wurden wieder wach: Der Tod seiner ersten Liebe Christine und des Klassenprimus Manni, das sinnlose Gefecht gegen die Amerikaner und die Flucht durch das Moor. Hans will es gar nicht glauben, dass sein damaliger Stammführer Kalle Kozruk, der damals viel Schuld auf sich geladen hatte, bei dem Treffen als anerkannter Bundeswehroffizier die „alten Kameraden“ zu neuen Taten gen Osten aufruft. Ein spannender Roman von 1964 über den Beginn der Friedensbewegung in der Bundesrepublik und den Umgang mit der faschistischen Vergangenheit. INHALT: Sie lieben keine Entscheidungen um Kopf und Kragen Wurden wir nur geboren, um vergessen zu werden? Der Schild des deutschen Soldatentums ist rein, und fleckenlos sind die Offiziere der Bundeswehr Wir wollen die Wahrheit, nur die unbequeme Wahrheit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Das Kreuz am Wege
ISBN 978-3-95655-094-2 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1964 im Deutschen Militärverlag, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Sie lieben keine Entscheidungen um Kopf und Kragen
1. Kapitel
Im Theater erloschen die Lichter. Vor einem Seiteneingang stauten sich junge Leute, die auf ihre Lieblingsschauspieler warteten; Autos fuhren ab; ungetüme Busse, von Reisegesellschaften gechartert, ließen brüllend ihre Motoren an und setzten sich schwerfällig in Bewegung.
Stimmengewirr. Lachen, Flüstern. Verabschieden, Gespräche über die Garderobe, die nächste Verabredung, den neuen Schönheitssalon, die letzte Sensation (Alfred Hitchcocks Horrorfilm mit „metaphysischem Sex").
Hans Pohnert lächelte grimmig. Er blieb eine Weile auf der untersten Stufe der geschwungenen Treppe stehen und schlug den Mantelkragen hoch. Zwar hatte es aufgehört zu regnen, aber die Nässe lag noch in der Luft und war ein untrügliches Zeichen für das Herannahen der kalten Jahreszeit.
Vorsichtig trat er auf den feuchtglänzenden Asphalt und schritt, als beträte er eine spiegelglatte Eisfläche, über den sich leerenden Platz. Bei solchem Wetter fühlte er sich immer unbeholfen auf der kniehohen Beinprothese. Schließlich hätte er auch den Wagen nehmen können, aber das war gegen seine Gewohnheit. Nach einem Theaterbesuch liebte er es, allein durch die Straßen zu gehen, in Gedanken schon Einfälle, Beobachtungen und Werturteile sammelnd und ordnend, die er morgen in aller Frühe zur Kritik verarbeiten würde.
Er ging den Steinweg entlang und bog zur Ritterbreite ein, die zum Schloss führte. Gelbgrün zuckten die Firmenzeichen der bienenwabigen Geschäftshäuser, ein Nachtkabarett pries in mannshohen Leuchtbuchstaben die Pariser Revue „L'air de la nuit“ an, vor dem City-Theater auf der gegenüberliegenden Straßenzeile drängten sich Halbwüchsige zur Nachtvorstellung von Olle Hellboms Film „Die Hemmungslosen".
In der Wallstraße war es ruhiger. Einzelne Paare kamen Pohnert entgegen, und einen kleinen Augenblick empfand er seine Einsamkeit schmerzlich, und er tastete nach dem zerknitterten, oft gelesenen Brief in der Manteltasche, aber er bezwang sich schnell und rekapitulierte die Aufführung im Theater.
Es ist leider immer seltener geworden, dass die Stücke der deutschen Autoren zu sehen sind, die Ausländer dominieren. Woran mag das liegen? Da haben wir den problematischen Thornton Wilder gehabt, die Todesfestspiele Monsieur Anouilhs, den Rührreißer „Eine Familie", das vortreffliche Schauspiel „Leuchtfeuer" und zwischendurch einen Rehfisch.
Es ist nicht einfach, Weisenborn in dieser Reihe unterzubringen, die Aufführung war wirkungsvoll gemacht. Aber „Babel" kann doch nur einen mittleren Rang behaupten.
Hans Pohnert blieb vor einem Schaufenster stehen, sah uninteressiert auf die Ratenzahlungsangebote für Küchengeräte und nahm mechanisch die randlose Brille ab. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich solche Stücke begeistert gesehen und gelobt, dachte er und wischte mit einem weichen Lappen, den er aus seiner Westentasche gefingert hatte, die Augengläser blank. Aber das ist vorbei, überholt, denn der Kapitalismus hat viel von seinem Schrecken verloren.
Dieser Fleischkrösus Gamboa war widerwärtig und abstoßend auf der Bühne, wollte um jeden Preis seine Silos fertiggebaut haben und verzichtete merkwürdigerweise auf die geforderte Lohnerhöhung. Wer tut das schon noch? Schließlich setzt er Sparsamkeit und Existenz an falscher Stelle aufs Spiel! Natürlich sind die Finanzwölfe hartherzig, aber doch immer zu ihrem Vorteil und nicht zu ihrem Nachteil, natürlich sind Aktionäre brutal, aber doch nicht dumm!
Der Beifall war mäßig gewesen, zwei Vorhänge für eine Premiere sind fast ein Durchfall.
Die Leute wollen so was nicht mehr sehen! Sie lieben keine Entscheidungen um Kopf und Kragen! Sie vermuten dann gleich — und das mit Recht — die leidige Politik. Die Zeit, in der man mit solchen Stücken Publikumserfolge erntete, ist vorbei.
Pohnert lächelte, als sich die Straße vor ihm erweiterte und er sich auf dem Hagenmarkt sah. So war er im Kreise gelaufen. Er sah zur Uhr. Dreiviertel zwölf. Eine angebrochene Nacht, dachte er und trat in ein Lokal, das er gern und oft aufsuchte, hier gab es weder eine Musikbox noch Radiomusik, noch Krakeeler. Zwei Tische waren besetzt, er erkannte undeutlich durch die beschlagene Brille einige Männer und Frauen, die Biergläser vor sich stehen hatten, und setzte sich an seinen Stammplatz.
Der Ober half ihm aus seinem Mantel und brachte einen Kaffee und einen Weinbrand, Marke Bal paré; auch so eine alte Gewohnheit.
Die Dorsch hat das Mädchen Kat mit Höchsthingabe gespielt, aber die Figur schien dennoch ohne Leben zu sein, sie passte nicht zum Milieu. Lediglich die beiden Handlanger des Gamboa wirkten aufs Publikum und spielten mit ihrem zynischen Humor, den ihnen Weisenborn mitgegeben hatte, die Hauptpersonen an die Wand!
Es gab gekonnte Passagen, den Selbstmordmonolog zum Beispiel, aber jeder Zuschauer wusste doch, dass sich der Mann nie erschießt.
Vielleicht lässt sich so ein Fazit aus dem Abend ziehen: Da meint ein Autor, etwas sagen zu müssen, und dann hat er nichts gesagt, weil es besser ungesagt bleibt.
Pohnert trank den Kaffeerest aus und fuhr sich durch das schüttere Haar. Er griff nach einer Zigarette, der Ober reichte ihm Feuer. Pohnert dankte lächelnd.
Er wirkte älter, als er eigentlich war. Die meisten Menschen hielten ihn für vierzig, aber er war erst dreiunddreißig. Vielleicht machten ihn die schmalen, klugen Augen hinter der Brille älter, vielleicht auch die gemessenen, überlegten Bewegungen, zu denen ihn seine Beinprothese zwang.
Er sah sich um. Man beachtete ihn nicht. Zwei Tische weiter saß ein Mann in einer breitgesteppten Lederjacke, ein Mädchen neben sich, dem der Unterrock unter dem Kleid zipfelte, ein hellblauer Unterrock mit weißem Spitzenrand. In der Nähe der Tür tuschelten zwei ältere Damen.
Die Aufführung war für Pohnert vergessen. Er würde morgen in der Redaktion die Formulierungen und Satzkonstruktionen aneinanderreihen wie bunte Fähnchen an einer Schnur, die ein Zauberkünstler in einem Varieté aus einer papiernen Tüte mit doppelter Einlage hervorzieht. Ein altes, oft geübtes Spiel, das ihm Freude bereitete und das er nicht missen könnte.
Seit sechs Jahren saß er in der Feuilleton-Redaktion der „Allgemeinen Zeitung" und berichtete über Theater und Museen, Konzerte und Ausstellungen. Das war es nicht, was ihm das Leben schwer machte.
Seit fünf Jahren war er verheiratet. Marlis, seine Frau, hatte Dramaturgie studiert und war dann Schauspielerin geworden.
So hatte er sie auf einer Generalprobe kennengelernt.
Zwei Jahre ging die Ehe gut, bis Marlis es aufgab, am Theater kleine Rollen zu spielen, und nur noch die Frau des geachteten Kritikers und Journalisten sein wollte. Aber das war nur ein Vorwand gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt traten andere Männer in ihr Leben.
Es gab Aussprachen, gefühlvolle und aggressive, dann blieb es wie eine stille Vereinbarung zwischen ihnen, dass jeder seine eigenen Wege ging, ohne es den andern merken zu lassen.
Pohnert rief den Ober, griff in die Tasche und legte ein Zweimarkstück auf den Tisch.
„Danke sehr, danke verbindlichst. Bis zum nächsten Male, eine gute Nacht wünsche ich, Herr Pohnert", murmelte der graugesichtige Ober und hielt den Mantel bereit.
Hierher wäre Marlis nie mitgekommen, dachte Pohnert, hier wäre ihr die Luft zu profan, das Lokal zu leise, die Stühle wären zu plump und die Leute zu aufdringlich.
Er nahm sich eine Taxe und fuhr durch die stillen, von kaltem Licht starrenden Straßen der Innenstadt zur Siedlung Wabenkamp. Als der Wagen vor der flachdächigen Villa hielt und Pohnert den Fahrer entlohnte, bemerkte er Licht im Wohnzimmer. Brennt es schon oder brennt es noch, dachte er müde und klinkte die Tür zum Vorgarten auf.
Seitdem Marlis nicht mehr am Theater war, besuchte sie auch keine Vorstellungen mehr, sondern verbrachte ihre Zeit auf Gesellschaften und mit Verabredungen. Das interessierte ihn nicht. Marlis Pohnert blätterte gelangweilt in illustrierten Zeitschriften und Tagesblättern.
In Japan war der Vorsitzende der Sozialistischen Partei, Asanuma, ermordet worden.
40 000 Mensdien wurden in dem indischen Staat Uttar Prasdesh während einer furchtbaren Hochwasserkatastrophe obdachlos.
Nachdem Chruschtschow vor den Delegierten der UNO-Vollversammlung zur vollständigen Abrüstung aufgerufen hatte, wurde angekündigt, dass der amerikanische Starreporter David Süßkind ein Fernsehinterview mit ihm führen werde.
Die Bevölkerung Korsikas protestierte gegen die Absicht der französischen Behörden, unmittelbar vor der Küste der Insel 65 000 Fässer mit 20 000 Tonnen radioaktiven Abfällen ins Meer zu versenken.
Eine Wahrsagerin aus einem Dorfe in der Nähe Bonns, die Dame Buchela, sagte einen Krieg für den Herbst des Jahres 1963 voraus.
Sie las über die Meldungen hinweg. „Aufgrund seelischer Sorgen" betitelte sich ein authentischer Bericht über den amerikanischen Hiroshimaflieger Major Claude R. Eatherly, den man in ein Irrenhaus eingesperrt hatte, weil er angeblich schizophren geworden sei. Das war aus dem Manne geworden, den das amerikanische Volk einmal als Nationalhelden verehrt hatte, dachte Marlis mit müder Verachtung, legte sich auf der hellgrauen Liege zurück und schloss die Augen.
Marlis Pohnert war nicht schön; ihre Beine waren zu stark und der volle Mund zu breit, aber es ging von ihr ein eigenartiger Reiz aus, der die Männer fesselte. Sie trug das tiefschwarze Haar wie eine Krone und überbetonte dadurch das schmale Gesicht mit den schrägen Augen, die immer ein wenig spöttisch wirkten. Sie hatte eine Figur wie tausend andere Frauen auch, doch verstand sie es, in einer Art die breiten Hüften zu betonen oder den runden Hals, dass sie auffiel.
Sie wusste es, und sie wusste auch, dass den Männern ihre Schlagfertigkeit gefiel, ihr sarkastischer Witz, ihr Esprit.
Sie hatte die früh verstorbene Mutter nicht mehr gekannt; der Vater, Gemüsehändler und Naziamtsleiter in einer niedersächsischen Kleinstadt, hatte sich 1945 eine Kugel durch den Kopf gejagt, ihr aber einige Grundstücke hinterlassen, deren Erlös zum Studium ausreichte. So war ihr Leben recht unkompliziert verlaufen. Kleine Liebschaften während der Ausbildung, der fortwährende Ärger mit der Intendanz am Theater, die Bekanntschaft mit dem Kritiker Pohnert, von dem sie schon viel gehört hatte, weil man seine Feder auch in Kreisen der berühmten Kollegen fürchtete.
Die Enttäuschung über diesen Mann, den sie nach kurzer Zeit geheiratet hatte, war Jahre später gekommen. Sie war geblendet von seiner exakten Logik, seinem großen Kunstverständnis und seiner ritterlichen Höflichkeit. Dann war alles anders, nachdem sie Robert Matheus kennengelernt hatte, den saloppen, eleganten Vertreter einer großen Bank; und die Entfremdung zwischen den Eheleuten hatte sich ständig verstärkt, obwohl Marlis wusste, dass Robert verheiratet war.
Marlis Pohnert öffnete die Augen. Draußen fuhr ein Wagen an, die Flurtür wurde aufgeschlossen, sie hörte den schweren Schritt ihres Mannes im Korridor und richtete sich auf. Die alte Abmachung gilt nicht mehr, dachte sie, man darf sich nicht vorkommen, als wate man im Schlamm.
Als Hans ins Zimmer trat und gewohnheitsmäßig die Brille von den Augen nahm, sah sie ihn ernst an. In der ersten Zeit hatte sie ihn bemitleidet, ihm geholfen, wenn er mit dem halben Bein unbeholfen hantierte, aber er mochte das eigentlich nicht, er wollte kein Mitleid.
Dann aber, vor zwei Jahren, nachdem sie Robert auf einer Geschäftsreise begleitet hatte, war sie manchmal an der Seite ihres Mannes aufgewacht, von Ekel und Widerwillen erfüllt, wenn sie seinen Beinstumpf an ihrem Oberschenkel spürte. Natürlich hatte das Hans gemerkt, aber kein Wort darüber verloren. Und seitdem war es nur noch selten vorgekommen, dass sie sich einander genähert hatten.
,.Du bist schon zurück", fragte er, „hat es dir nicht gefallen bei den Rendahls?" Er setzte die Brille wieder auf und ließ sich auf einem Sessel nieder.
„Du weißt ja, dass bei diesen Leuten nur getratscht wird. Das Niveau ihrer Unterhaltung entspricht dem Angebot eines Zeitungsstandes auf der Straße!"
Er lächelte nicht über diesen Vergleich, denn er hatte den Brief in der Hand und wunderte sich, dass er ihn beunruhigte, dass er sich gekränkt fühlte. Heute früh hatte der Brief auf seinem Schreibtisch gelegen.
Er legte ihn zusammengefaltet auf das niedere Tischchen und blickte seine Frau bedeutungsvoll an. Sie achtete nicht darauf.
„Wie war es im Theater?"
Er wusste, dass diese Frage nur Höflichkeit war, und sagte einige einschätzende Sätze über das Stück, die Schauspieler und schielte dabei auf das zerknitterte Blatt Papier, das zwischen ihnen lag. „Lies bitte“, forderte er sie auf, „ich hätte dich damit nicht behelligt, aber diesmal ... So geht es nicht weiter. Marlis.“ Er griff nach einer Zigarette, brannte sie, während die Frau zögernd den Brief entfaltete, an der dicken, brennenden Kerze an, die auf einem schmiedeeisernen Gestell steckte.
Es gibt doch einen Zufall, dachte sie, da wollte ich ihn vorbereiten, möglichst schonend, und er legt diesen Brief auf den Tisch, dieses Geschreibsel über meine Beziehungen zu einem verheirateten Bankkaufmann. Sie sagte: „Tut mir leid, Hans, dass du es auf solche Weise erfahren musstest, ehrlich, es tut mir leid!"
Der Mann sah sie an. Die Kerze flackerte ungleichmäßig und tönte das blasse Gesicht der Frau.
„Wir hatten zwei Jahre hindurch schon getan, was wir wollten, und keinen Anstoß daran genommen. Das ist falsch gewesen. Weißt du, Hans, es geht mir eigenartig. Ich glaube, zu früh geheiratet zu haben. Ich bin noch zu jung!"
Hans nickte. Sie hat sich wieder eine bequeme Philosophie zurechtgelegt, dachte er, aber ich habe mich nicht viel um sie gekümmert und alles dem Selbstlauf überlassen, Sie hatte Anlagen, gute Seiten, aber sie sind verkümmert, sie ist oberflächlich geblieben, und ihr so gepriesener Esprit ist nichts weiter als Tünche der Mittelmäßigkeit.
Leise sprach Marlis weiter: „Ich habe irgendwann einmal eine Geschichte gehört über eine Frau, deren Verlobter im Kriege geblieben ist. Sie hatte keine Fotografie mehr von ihm und sammelte deshalb aus illustrierten Zeitungen Gesichter, zerschnitt sie in kleine Teile und wollte sie zusammensetzen, um das Bild des Geliebten zu erhalten. Als sie nach zwölfjähriger Arbeit starb, hatte sie bei ihrem mühseligen Tun erst die Stirn gefunden, aus vielen Teilen gebaut. Vielleicht geht es mir ähnlich. Du bist nur ein Teilchen gewesen, das immer für sich blieb. Ist es da ein Wunder, dass man solche Erkenntnis erst später gewinnt? Vorher klebt man nur an einer Besonderheit, die man zu verallgemeinern sucht."
„Geht es nur darum, Marlis", sagte der Mann, „sicherlich leben viele Ehepaare wie wir nebeneinander. Warum auch nicht. Aber es sollte nicht dazu kommen, dass andere zu wühlen beginnen, dass Klatsch und Skandal aufflackern. Weißt du, dass dieser Matheus verheiratet ist?"
Sie glaubte, einen Vorwurf in seinen Worten zu spüren. Das liebte sie nicht. „Ich weiß, und ich wusste es schon lange", sagte sie hart und wischte sich eine Haarsträhne zurück, „er will sich scheiden lassen von seiner Frau. Sie ist krank. Darum hat er es bisher unterlassen. Aber du siehst, wohin Rücksichtnahme führt!"
„Ja. Und da willst du auch ..."
Sie nickte. „Es ist besser so. Für beide Teile. Was bin ich dir denn noch?"
Der Mann dachte: Wenn ein Kind da wäre, brauchte diese Unterhaltung nicht zu sein, bestimmt nicht. Dann wäre es nie so weit gekommen. Aber das sagte er nicht. Er sah sie an. „In der Tat", sagte er bitter, „es scheint das Beste zu sein. Wir sprechen noch darüber, es eilt ja nicht. Morgen sehen wir weiter, ich habe noch zu arbeiten."
Sie hatte die vollen roten Lippen nach innen gezogen und hielt den Kopf geneigt, als teste sie die Wirkung ihrer Worte.
Aber der Mann blieb ruhig, erhob sich und ging ins Arbeitszimmer. Marlis lehnte sich aufatmend in die Kissen zurück. Sie war enttäuscht, weil sie Widerspruch erwartet hatte.
Die Kerze blakte nicht mehr.
2. Kapitel
Das hässlich-sachliche Hochhaus der „Allgemeinen Zeitung" lag im Zentrum der Stadt. Tag und Nacht brannten die Neonröhren in den Verlagsräumen, die „Allgemeine" hatte die größte Auflagenhöhe aller Zeitungen im Ostteil des Landes und war stets darauf bedacht, den Leserkreis zu erweitern — sehr zum Leidwesen einiger Redakteure, die darin eine Qualitätsminderung des Blattes zugunsten der Sensationshascherei sahen.
Der Gier des Publikums könne sich auf die Dauer auch die seriöseste Zeitung nicht entziehen, hatte der Chef auf einer- Redaktionssitzung erklärt; und so brachte die „Allgemeine" seit einem halben Jahr auch sogenannte amüsante Klatschgeschichten aus dem Villenviertel der amerikanischen Filmstadt von Beverly Hill. Kulissengeschwätz über die Stars der Paramount-Filmstudios und sachliche Berichte über den Wert und Unwert der Roben, die man auf dem Bedvord-Drive, der teuersten Straße von Bel Air, zur Schau stellte. Das alles wurde vermischt mit seichten Geschichten einheimischer Autoren, und so konnte der Leser auch Selbstmordaffären lesen und daneben das Kapitel aus den Schah-Memoiren, das der Exkaiserin Soraya gewidmet war.
Eingeweihte Redakteure wussten mehr. Aber sie sprachen nicht darüber, und so wucherten die Gerüchte zwischen Stenotypistinnen und Setzern wie üppiges Unkraut.
Soviel stand fest: Die „Allgemeine", bisher stolz auf ihre Unabhängigkeit, musste aus unerfindlichen Gründen gestützt werden, und da blieb nichts weiter übrig, als die inhaltlichen Änderungen wie eine Konzession zu tragen.
Am ärgerlichsten waren die lukrativen Inserate, die halb- und ganzseitig erschienen und den Platz gefräßig schluckten. Aber sie brachten viel Geld, zwei-, drei- und fünftausend Mark, und stützten damit die Auflagenhöhe des Blattes ...
Hans Pohnert parkte seinen Wagen vor dem Geschäftseingang des Verlages, grüßte den lesenden Pförtner im gläsernen Vorbau und trat in den Paternoster, der ihn in den sechsten Stock brachte.
Klappernde Schreibmaschinen hinter dünnwandigen Türen, polternde Männerstimmen an Telefonen, der schnarrende Lautsprecher eines Bandgeräts — das waren die Geräusche, die Pohnert auf dem langen, nüchternen Gang umfingen. Er liebte dieses Fluidum eines großen Redaktionsbetriebes, aber heute wäre ihm Ruhe lieber gewesen, denn er fühlte sich müde und zerschlagen.
Im Vorzimmer seines Büros hockte Angela Peters, die hellblonde Sekretärin, auf dem Schemel vor der Schreibmaschine.
„Hallo, Angela", sagte Pohnert und hängte den Trenchcoat auf einen Garderobenhaken, „ich brauche noch ein paar Minuten, dann diktiere ich in die Maschine. Haben Sie die Sachen für die Morgenausgabe fertig?"
Angela schwenkte den Drehstuhl herum. Sie wies auf den Schreibtisch und lächelte. Sie kleidete sich sehr vorteilhaft, nach Pohnerts Ansicht zu modern. Heute trug sie einen hautengen schwarzen Pullover über der vollen Brust und eine Hose mit roten Streifen auf schwarzem Grund. Sie hatte Pech gehabt im Leben, vor zehn Jahren hatte sie ein Mann vor der Hochzeit sitzen lassen.
Sie musste sehr jung gewesen sein damals. Pohnert kannte die Geschichte auch nur als Redaktionstratsch; Angela hatte selber nie davon gesprochen.
Sie war eine Frau, mit der Pohnert gerne zusammenarbeitete, doch wurde er aus ihr nicht klug. Ihre Arbeit erledigte sie sehr selbstständig und ausgezeichnet, sie war höflich, und doch konnte sie an manchen Tagen launenhaft sein. Dann sprach sie kaum und setzte eine Miene auf, als hätte man sie beleidigt.
Pohnert wusste nicht, wie sie lebte und woher sie kam, und er scheute auch davor zurück, sie danach zu fragen. Manchmal, wenn er diktierte und eine kleine Pause einlegte, konnte sie wie geistesabwesend blicken, und Pohnert schien, als blinkten dann ihre Augen feucht.
Angela Peters war bei aller Höflichkeit ein verschlossener Mensch. Das meinten auch die anderen Sekretärinnen der Redaktion, an deren Klatschrunden sie sich nie beteiligte.
„Alles fertig, Herr Pohnert", sagte Angela mit hoher Stimme, „ich habe gestern zwei Stunden länger gemacht!"
Die Tür öffnete sich, ein junger, hagerer Mann trat ein, grüßte flüchtig und legte ein Schriftstück auf Angelas Schreibtisch. Dann ging er wieder, so still, wie er gekommen war. Es war Gebhardt, ein fähiger Journalist, der in Pohnerts Abteilung arbeitete. Aber Hans Pohnert mochte ihn nicht sonderlich; Gebhardt stieß ihn schon von Äußerlichkeiten her ab — das blasse Gesicht unter falbem Haar, die krallenartig-knochigen Finger mit den langen Nägeln. Aber der Mann war begabt. Pohnert nickte beiläufig.
Er wollte die Tür zu seinem Zimmer öffnen, da sagte Angela schnell: „Fühlen Sie sich nicht wohl?" Ihr Gesicht war erwartungsvoll.
Er schüttelte lächelnd den Kopf. „Es geht, danke. Ein wenig abgespannt, wissen Sie."
„Übrigens sitzt Herr Salmund schon eine Weile bei Ihnen im Zimmer, er war ganz aufgeregt und wollte lieber warten als wiederkommen!"
„Und das sagen Sie erst jetzt?"
Sie hob zur Antwort die runden Schultern und rückte ihren Stuhl zurecht.
Alfons Salmund saß vor dem ovalen Rauchtisch und besah sich Aufnahmen der letzten Theaterproben. Es gab Journalisten, die hielten den untersetzten, rundlichen Mann für bequem und träge und gaben nicht viel auf seine Meinung, aber Pohnert gehörte nicht zu ihnen.
Salmund war schon lange bei der Presse, er arbeitete in der Kommunalredaktion, wo er völlig fehl am Platze war, denn er konnte geistreich schreiben und musste sich da mit Hausbesitzersorgen herumschlagen. Einige Jahre älter als Pohnert, wirkte er meist befangen und scheu. Salmund war ein kluger Mensch, der vielseitig interessiert war und mit dem Hans Pohnert schon manchen gemeinsamen Strauß auf den Redaktionssitzungen ausgefochten hatte. Sie waren befreundet, ohne sich das gegenseitig zu versichern.
„Ich muss mit dir reden, Hans", sagte Salmund nach kurzer Begrüßung abgehackt, „ich bin enttäuscht und weiß nicht, was ich tun soll."
Pohnert drückte den Freund in den Sessel zurück, aus dem er sich halb erhoben hatte, und dachte: Enttäuscht bin ich auch. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll, und es ist nur gut, dass andere Menschen auch ihre Sorgen haben, sonst bemitleidet man sich nur selbst.
Alfons Salmund legte Ellbogen und Hände fest auf den Tisch, als wollte er die Ruhe des Gegenstandes auf sich selbst übertragen. „Da habe ich einen Artikel, einen guten Artikel, veröffentlichen wollen, er war schon im Satz und wurde wieder zurückgezogen. Ein guter Artikel, wohlgemerkt, ich bin schließlich lange genug dabei und weiß, was man in einer Zeitung bringen kann und muss."
„Und?"
„Abgelehnt. Rundweg abgelehnt. Solche Artikel wünsche man nicht, man sei unabhängig, sagte man mir im Vorzimmer des Chefs. Einfach lächerlich — diese Unabhängigkeit!"
„Der Grund?"
„Man wolle nicht Schwarzen Peter spielen!"
„Darf ich den Artikel lesen?"
„Ich bitte sogar darum. Sage ehrlich deine Meinung, vielleicht lege ich die Arbeit nochmals vor." Salmund reichte ihm den Bogen und wischte sich mehrmals über die Glatze, als klebten dort Spinnweben.
Pohnert überflog die Zeilen.
Der Artikel war spritzig und scharf geschrieben, ein wenig zu bissig für seinen Geschmack.
Dem Konfektionshändler Honigbaum in der Bammelsburger Straße war ein Schaufenster beschmiert worden. Mit Judenstern und Inschrift „Juden 'raus!" Den Tatbestand stellte der Autor an die Spitze seiner Betrachtung und schloss mit der Frage: Was muss man tun, wenn die Vergangenheit wieder Gegenwart zu werden droht?
Er geht weit mit seinen Behauptungen, dachte Pohnert, man sollte einen Einzelfall nicht verallgemeinern. Er ließ das Blatt sinken. „Nicht schlecht geschrieben", sagte er vorsichtig.
„Das weiß ich. Was sagst du zur Ablehnung?"
„Du ereiferst dich um eine Kleinigkeit, Alfons. Was ist schon passiert? Ein dummer Junge sieht in irgendeinem Buch den Judenstern, hört etwas von Erwachsenen und ahmt eine längst vergessene Parole nach, die Wahnsinnige aufgestellt hatten. Das ist alles. Man sollte sich gerade in unserer Zeit vor Verallgemeinerungen hüten, besonders wir, Alfons!"
Salmund stand auf und ging zum Fenster. Er trommelte nervös auf das Fensterbrett.
Pohnert verstand den Freund nicht. Gewiss, es war nicht angenehm für einen Redakteur, eine Arbeit nicht durchzubringen, aber das sind schließlich alltägliche Leiden für einen Zeitungsmenschen.
„Kennst du diesen Honigbaum?"
Salmund schüttelte den Kopf.
„Kennst du den Täter?"
Kopfschütteln.
„Was liegt dir an dem Artikel? In dieser Fassung stiftet er mit seiner scharfen Polemik nur Unruhe!"
Langsam drehte sich Salmund um.
Pohnert erschrak. Der Freund war grau im Gesicht.
„Was liegt dir an dem Artikel, fragst du, Hans? Du kannst es nicht wissen, das hatte ich vergessen. Alle könnt ihr es nicht wissen, alle redet ihr von ‚Einzelfall' und von Stürmerparolen, die längst überwunden sind.
Doch vor jeder Auseinandersetzung mit diesen Dingen hütet ihr euch! Wie viele ‚Einzelfälle' gibt es denn schon wieder?"
Pohnert zog die Brauen zu einem dünnen Strich zusammen. „Man bringt nicht bei einem Umgraben alles Unkraut aus dem Boden", sagte er.
„Was nützt das Umgraben, wenn der Boden noch verqueckt ist. Du besuchst Konzerte, Museen, Theater, aber du musst auch zwischen den Zeilen der Artikel deiner Kollegen von der Wirtschaft lesen, auch die Artikel auf der ersten Seite. Du sprichst von Einzelfall. Aber es gibt verwüstete Judenfriedhöfe, geschändete Synagogen, Boykott gegen Geschäftsleute. Und es gibt noch mehr: Es gibt Regierungsbeamte, deren Namen noch heute einen schrecklichen Klang für uns Juden haben!"
Pohnert sagte schroff: „Das Alte stirbt nur langsam ab. Solche Auswüchse verschwinden mit der Zeit. Du aber meinst, die Fälle seien symptomatisch für uns. Da irrst du. Wozu Auseinandersetzungen führen, wenn kein Grund vorliegt. Eine sachliche Meldung über den Vorfall wird jederzeit gebracht, unser Blatt ist immer objektiv gewesen. Aber diese Polemik ... Die Polizei wird den Täter fassen, das Gericht wird ihn bestrafen, wie sich das für Rowdys gehört, die die Normen unseres Lebens verletzen. Das trifft auch für die anderen Fälle zu. Damit ist alles in Ordnung!"
„Ist damit alles in Ordnung?"
Sollten die Kollegen doch recht haben, die Salmund für einen Querkopf hielten, für einen Mann, der zu sensibel war für die Pressearbeit?
Gewiss, manche Ausschreitungen sind bedenklich, aber der aufgewühlte Schlamm einer Pfütze kommt nur langsam zur Ruhe. „Sieh mal, Alfons", sagte Pohnert, „wir kennen uns schon lange Jahre, solange ich bei der Zeitung bin. Aber wir haben doch manches geschafft in der Bundesrepublik. In der Welt spricht man wieder von unserer wirtschaftlichen Stärke, unser Wort gilt. Und die Politik? Wen kümmert die schon, wenn es bergauf geht. Damit will ich nicht sagen, dass man gleichgültig sein darf, keinesfalls, aber es wachsen neue Menschen heran, die alten werden abtreten eines Tages ..." Salmund schwieg.
Fast schien es Pohnert, als wäre Salmund nur gekränkt und beleidigt, weil man eine von ihm empfohlene Arbeit abgelehnt hatte. „Schließlich verlangst du bei einem Autounfall mit Fahrerflucht auch nicht, dass alle Autos verschrottet werden!"
„Aber ich mache mich mitschuldig, wenn ich die Wagennummer des geflüchteten Fahrers nicht notiere und melde!"
Die beiden Männer schwiegen lange. Nebenan surrte das Telefon. Auf dem nahen Bahnhof pfiff eine Lokomotive.
Salmund starrte auf ein Bild an der Wand, auf ein zartes Aquarell. Frühlingsmotiv. Er begriff es nicht, nahm es nicht einmal bewusst wahr. „Ich will versuchen, dir alles zu erklären, Hans. Ich habe die Geschichte in mir getragen wie in einem Tresor. Du bist der erste Mensch seit langen Jahren, der sie erfahren soll, denn ich will, dass mich ein Mensch in dieser Mühle versteht, nur einer!"
Pohnert sah erstaunt auf. Ich bin ein Abladeplatz für Sorgen, dachte er flüchtig. Vielleicht beklagt sich auch noch Gebhardt, und Angela Peters erzählt mir ihr letztes Wochenenderlebnis. Ich selbst erledige zwischendurch die Scheidung meiner Ehe. Aber sogleich schämte er sich seiner Gedanken, als er das ausdruckslose Gesicht seines Freundes sah.
„Ich fürchte mich, Hans", sagte Salmund leise. „Als Hitler an die Macht kam, war ich knapp zehn Jahre alt und nahm vieles nur aus Schulbubensicht wahr: die Fahnen, die Aufmärsche, das Heilgeschrei, die hochgereckten Arme.
Es war mir zu laut, denn ich war immer ein stilles Kind gewesen, das am liebsten für sich allein war. Dazu kam, dass ich andere Sorgen hatte, als mich um das Treiben auf der Straße zu kümmern. Meine Eltern hatten lange zu verheimlichen versucht, dass es zwischen ihnen nicht mehr stimmte, aber das gelingt ja Erwachsenen in den seltensten Fällen, weil Kinder kritische Augen haben.
Ich wusste seit Langem, dass ein fremder Mann meine Mutter besuchte, wenn Vater nicht da war, und ich litt darunter, denn ich liebte sie wie meinen Vater. Vielleicht noch mehr. Es gab keine hässlichen Szenen zwischen ihnen, aber wenn man als Kind am Tisch sitzt und sich die Eltern nichts zu sagen haben und sich nur zusammenreißen, dann möchte man am liebsten weglaufen!“
Salmund machte eine Pause und strich sich über die Augen. „Ich will mich nicht verlieren, kurz und gut: Mutter war Jüdin, Vater Arier, wie man damals sagte. Ich hatte den Geliebten meiner Mutter nie gesehen, aber ich hasste ihn. Mutter drängte selbst auf Scheidung, und Vater reichte die Scheidungsforderung ein. Da kamen die Nazis an die Macht. Als sie den Druck gegen die Juden verstärkten, verschwand eines Tages der Geliebte, denn die Verbindung mit einer jüdischen Frau schien ihm wohl doch zu gewagt. Mutter zerbrach fast daran, sie schämte sich vor Vater, der aber zog die schon eingereichte Scheidungsforderung wieder zurück, weil er seine Frau, die ihn betrogen hatte, vor den Nazis schützen wollte. Ich weiß nicht, was alles zwischen den beiden Menschen damals vorgegangen ist, aber ich habe eine grenzenlose Hochachtung vor meinem Vater, und ich bewundere ihn. Mutter fühlte das und litt unter dem Ehrbegriff ihres Mannes. Dann begann es. Auf der Straße riefen die Pimpfe ‚Judenbastard' hinter mir her, ich wurde verprügelt, Parolen wurden ans Haus geschmiert, und Mutter konnte es schließlich nicht mehr verlassen. Ich träumte nachts von den Schreien und Schlägen der Hitlerjungen. Vater wurde häufig aufgefordert, die Ehe zu lösen, aber er setzte allen Versuchen sein Nein entgegen. Mich schickten die Eltern auf eine Internatsschule. Kurz vor Kriegsausbruch erhielt ich von einer Tante die Nachricht, dass die SS meine Eltern weggeholt hätte. Ich kam zum Arbeitsdienst. Meine Eltern habe ich nie wiedergesehen; ich habe nie eine Zeile von ihnen erhalten, weiß nicht einmal, in welchem KZ sie ermordet worden sind. Vielleicht sind sie schon vorher getötet worden. Man hatte sie in das Judenhaus der Stadt gebracht.“ Salmund schwieg erschöpft. Schweißtröpfchen standen auf seiner Stirn.
Pohnert blickte zu Boden, dann erhob er sich und legte dem Freund den Arm auf die Schulter. „Verzeih mir", sagte er leise, „wer konnte das wissen. Du hast noch nie darüber gesprochen." Wer spricht auch gern über diese Zeit, dachte Pohnert. Ich will selbst nicht daran erinnert werden. Was hat sie uns alles genommen: Jugend und Träume, Menschen und Werte. Für einen Augenblick wollte ihn die Erinnerung übermannen, die Erinnerung an ein Dorf am Rande des Hochmoors, in dem er als Werwolf die letzten Tage des Krieges erlebt hatte, die Erinnerung an Freunde und an Christine, aber er riss sich zusammen.
„Verstehst du jetzt, warum mir so viel an dem Artikel liegt?", fragte Salmund tonlos. Du stellst eine falsche Verbindung her, fuhr es Pohnert durch den Sinn. „Die Transplantation der Vergangenheit in die Gegenwart ist nicht möglich, stimmt einfach nicht, denn die Zustände haben sich grundlegend geändert, und wir haben einen demokratischen Staat aufgebaut.“ Er sagte das vorsichtig und behutsam dem Freunde, aber Salmund sah ihn nur verständnislos an und schüttelte den Kopf. Pohnert schien es, als wäre der Freund enttäuscht.
„Wir müssen uns davor hüten, einen Einzelfall, und um den handelt es sich schließlich, heute aufzubauschen. Das war in der Hitlerzeit üblich", mahnte Pohnert. „Schreibe deine eigenen Gedanken dazu nieder, in einem Feuilleton zum Beispiel, appelliere an das Recht in unserem Staate, und es wird dir Recht werden, glaube mir, Alfons. Der Antisemitismus ist doch kein Zeichen unserer Zeit!"
Salmund sah ihn an, rote Flecke auf den breiten Wangen. „Du liebst es auch schon, dich zu belügen, Hans, wie viele andere.“
„Nein. Ich sehe nur nüchtern und real." Pohnert forschte in den Zügen des Freundes, aber er fand keine Antwort darin, seine Augen blickten an ihm vorbei, und Pohnert hatte den Eindruck, als bereute Salmund bereits, die Tragödie seiner Eltern erzählt zu haben.
Als Angela Peters gegen die Tür klopfte, ging Salmund durchs Zimmer und sah den Freund nicht an.
3. Kapitel
In den folgenden Tagen musste Pohnert oft an das traurige Gesicht des kleinen Salmund denken, und er legte sich die Frage vor, ob er wohl die richtigen Worte gefunden hatte, den Freund zu überzeugen, aber er kam zu keiner befriedigenden Antwort. So überrollte schließlich der eintönige und rasche Trubel in der Redaktion das Gespräch.
Mit Marlis war eine Veränderung vor sich gegangen, die sich Pohnert nicht erklären konnte. Sie erwähnte das nach dem letzten Theaterbesuch geführte Gespräch mit keiner Silbe.
Er wunderte sich darüber. Er wusste zwar, dass Marlis launisch war und sprunghaft ihre Ansichten wechseln konnte, aber ihre Forderung nach Scheidung schien ihm doch ernst gewesen zu sein. Oder sollte sie es sich schon wieder überlegt haben?
An einem Freitagnachmittag suchte sie ihn sogar in der Redaktion auf, was seit Langem nicht mehr vorgekommen war. Angela Peters zog ein böses Gesicht, als Pohnert mit seiner Frau ins Kasino ging. Marlis trug ein dunkelrotes Kostüm und war nur leicht geschminkt.
Er bestellte für sie einen Cinzano Rosso „on the rocks", ihr Lieblingsgetränk, und für sich einen Mokka.
„Ich möchte dich bitten, unser Gespräch zu vergessen, Hans", sagte sie unvermittelt und schüttelte das Becherglas, dass die Eiswürfel klapperten. Sie sah das Befremden des Mannes; es zuckte spöttisch in seinen Mundwinkeln, und sie ahnte, dass er kombinierte: Ist es schon vorbei, mein Mädchen? Das Mosaikbild von einem Manne, das du dir zusammenschneiden wolltest, stimmt wieder nicht mehr?
Ihre Augen bekamen harten Glanz. „Ich errate deine Gedanken", sagte sie böse, „aber du irrst dich, das kann schließlich auch passieren. Seine Frau ist plötzlich gestorben. Da ist es unmöglich geworden, in dieser Situation ... Herr Matheus fühlt sich der Toten gegenüber natürlich verpflichtet, das Trauerjahr einzuhalten. Und ich billige sein Verhalten!"
Rücksichtsvoll seid ihr, dachte Hans bitter, aber ich verstehe eigentlich nicht, warum du dich nicht trotzdem scheiden lassen willst. Doch er ließ seine Gedanken nicht laut werden.
Sie fragte: „Bestehst du auf Scheidung?"
Jetzt müsste ich ja sagen, dachte er, tausend andere Männer würden das in meinem Falle tun. „Ich habe es nie verlangt", entgegnete er leichthin und fühlte, dass ihre Frage berechnet gewesen war, und er meinte auch zu wissen, warum sie von einer Scheidung absehen wollte. Marlis war eine verwöhnte Frau, an einen gewissen Luxus gewöhnt, den sie nicht aufgeben wollte, solange eine feste Verbindung mit ihrem Geliebten ungewiss war. Diesen Zug hatte sie mit meiner Mutter gemeinsam. Er dachte einen Augenblick an die alte Dame mit Fischbeinstäbchen und sorgfältig geglätteten Spitzen um den Hals, die in einer Altbauwohnung in Wolfenbüttel lebte. Mit ihr hatte sich Marlis immer gut verstanden.
„Und wie denkst du dir ein gemeinsames Leben?", fragte er.
Sie legte ihre linke Hand leicht auf seinen Arm und sagte: „Morgen möchte ich mit dir auf die Party des Chefs gehen, wie früher, weißt du?"
Er zuckte belustigt die Schultern. Meinetwegen, hieß das, das Leben mit dir ist keineswegs langweilig, du sorgst für Abwechslung.
„Soll das eine Antwort sein? — Es wird zu keinem anonymen Brief mehr kommen. Ahnst du, wer ihn geschrieben haben könnte?"
Er lächelte. Sorgen hast du, dachte er. „Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht!"
Sie spitzte den vollen Mund. Ein Kollege kam an den Tisch und unterbrach das Gespräch.
So blieb manches unausgesprochen zwischen den Eheleuten, aber Pohnert war es zufrieden. Er neigte zu Bequemlichkeit in privaten Dingen und war nicht zur Eifersucht geschaffen. Er wollte nie die Seele und Widersprüchlichkeit einer Frau ergründen auf Biegen und Brechen. Das kam ihm sogar frevelhaft vor.
4. Kapitel
Unweit des alten Domes Sankt Blasii lag an einer Einbuchtung des Lessingplatzes die Villa des Chefredakteurs der „Allgemeinen Zeitung". Hohe Bäume schirmten diesen idyllischen Winkel vom Lärm der Großstadt ab.
Als im Jahre 1944 die ehrwürdigen Fachwerkhäuser der Innenstadt im Phosphorregen amerikanischer Bomben verglühten, war dieses im altenglischen Country-Stil errichtete Gebäude unversehrt geblieben. Die Bürger wussten davon zu erzählen, dass es schon immer im Besitz der Rüttgers gewesen war; der alte Konsul hatte es nach dem ersten Kriege gegen Frankreich bauen lassen, und der Urenkel, Dr. Georg Rüttgers, hatte nur wenige Veränderungen vornehmen lassen.
Das Untergeschoss der Villa, in dem in regelmäßigen Abständen die berühmten Partys stattfanden, war ein einziger riesiger Raum, nur durch halbe Zwischenwände gegliedert und von viereckigen, glatten Säulen getragen.
Hier gab es weder Tand noch Nippes, noch Protz, die Einrichtung zeugte von hohem Geschmack und Kunstverständnis. Eine ganze Wand war von doppelmannshohen Bücherregalen bedeckt, in denen sich bibliophile Kostbarkeiten befanden, die jede Universitätsbücherei sofort gekauft hätte. Darauf war der Doktor besonders stolz. Er stammte aus einer alten Verlegerfamilie, seine Vorväter hatten Campe gekannt, und sogar Ricarda Huch war in diesen Räumen zu Gast gewesen. Nur hatte man damals die geselligen Abende nicht Partys genannt, man hatte keinen „Mumm- Cordon Rouge" vom Jahrgang 47 getrunken und nicht nach amerikanischen Schlagern getanzt. Die Zeiten hatten sich geändert und die Sitten auch.