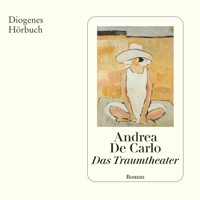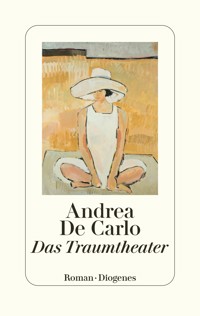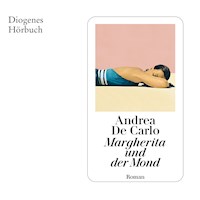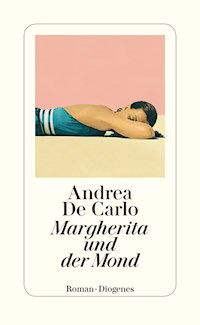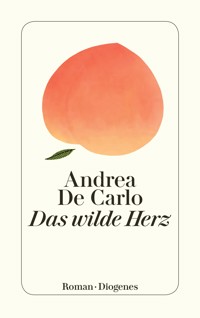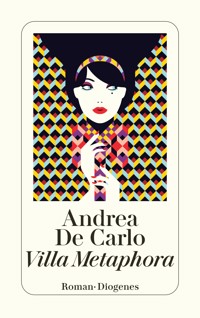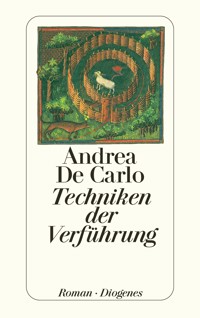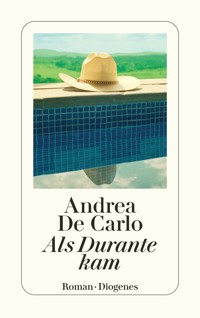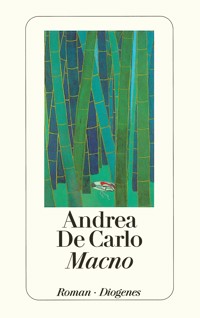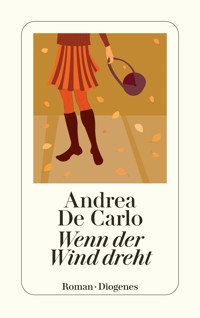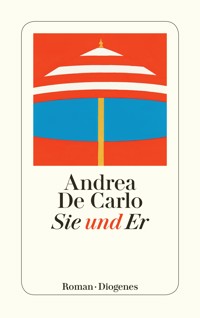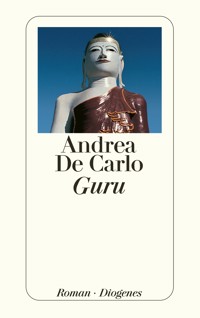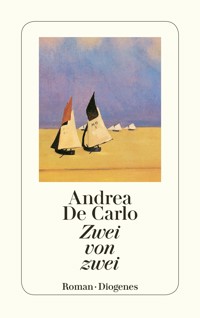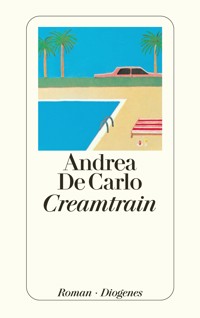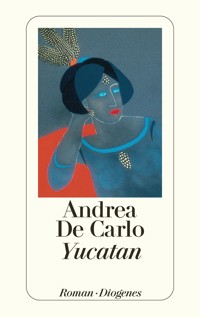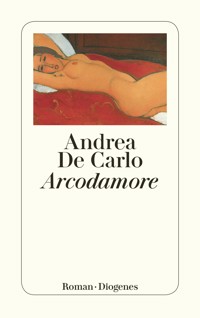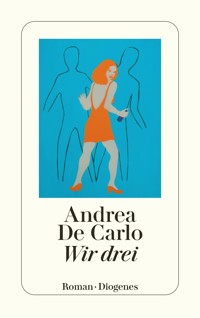9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Tag im Spätherbst erhält Lorenzo einen Anruf von seinem Bruder Fabio: Ihr
Vater, der international geschätzte Virologe Teo Telmari, ist gestorben. Lorenzo verlässt bestürzt sein Haus in der apenninischen Wildnis und reist nach Rom, wo er erfährt, dass sein Vater Hüter eines hochbrisanten Geheimnisses war.
Während Fabio dadurch seine politische Laufbahn gefährdet sieht, möchte Lorenzo fortführen, was der Vater begonnen hat. Mit dem Auftauchen einer mysteriösen jungen Dänin eskaliert der Bruderzwist"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andrea De Carlo
Das Meer
der Wahrheit
Roman
Aus dem Italienischen von
Maja Pflug
Die Originalausgabe erschien 2006
bei Bompiani, Mailand,
unter dem Titel ›Mare delle verità‹
Copyright © 2006 by RCS Libri S.p.A.
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2008 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Copyright © Linda Braucht/
Getty Images
Die Übersetzerin dankt
dem Übersetzerhaus Looren
für die Förderung ihrer Arbeit
an diesem Buch
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24033 7 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60231 9
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]
[7] Am Morgen des 24. November
Am Morgen des 24. November lagen draußen mindestens vierzig Zentimeter Schnee, und mein Bruder rief an, um mir zu sagen, dass unser Vater gestorben war.
Nach dem Aufwachen hatte ich die Fensterblenden geöffnet und eine Weile das Weiß betrachtet, das Bäume und Felder und ferne Häuser einförmig zudeckte bis zum Horizont, wo die welligen Hügel mit dem sehr hellen Grau des Himmels verschwammen. Ich hatte der Stille gelauscht, tief die eisige Luft eingesogen, Atemwölkchen ausgestoßen. Einige Schneeflocken hatten sich mir auf Stirn, Brust und Hände gelegt, die Kälte war über meine nackte Haut gestrichen. Zwar schneit es hier in der Gegend zu häufig, als dass man das gleiche Gefühl von Verzauberung wie in der Kindheit empfinden könnte, dennoch fasziniert es mich jedes Mal, wie die Geräusche gedämpfter und die Entfernungen länger werden, wie dürres Holz, Dornengestrüpp, Steine, Löcher und Risse im Boden unter der weißen Oberfläche verschwinden und die Illusion einer einheitlichen Landschaft erwecken. Ich wusste, dass das Staunen über die Verwandlung nicht lange anhalten und schon bald etliche praktische Schwierigkeiten auftauchen würden, doch in den ersten Minuten ließ ich mich verzaubern, während ich mehrere Schichten Baumwolle und Wolle übereinander anzog.
[8] In der Küche hatte ich Tee aufgesetzt und Haferbrei zubereitet, hatte Knie- und Armbeugen gemacht, um mich aufzuwärmen. Beim Frühstück hatte ich in einem Aufsatz über Ozeanströmungen geblättert, den ich brauchte, weil ich an einem Buch über das Überleben auf offenem Meer nach einem Schiffbruch schrieb. Dann hatte ich prüfend das Telefon abgehoben, und es war absolut stumm. Ich hatte es nicht anders erwartet, denn die Leitungen laufen ein paar Kilometer lang durch einen Wald, ein Gewitter oder ein Windstoß oder eben Schnee genügt, damit die Verbindung ausfällt. Es dauert jedes Mal tagelang, bis jemand kommt und sie repariert, vorausgesetzt, man hat die Geduld, mehrmals täglich die Störungsstelle anzurufen und zu mahnen. Andererseits jedoch missfiel es mir nicht, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein: Ich fühlte mich vor den drohenden Anforderungen der Welt geschützt, sie rückten in so weite Ferne, dass sie beinahe unverständlich wurden.
Ich zog mein Handy aus der Tasche des Anoraks, in dem ich es aufbewahrte, neben der Eingangstür: Ich hatte vergessen, es aufzuladen, auf dem Minidisplay blinkte das Batteriesymbol. Auch das Symbol »verpasste Gespräche« leuchtete, aber noch bevor ich nachsehen konnte, wer denn angerufen hatte, erklang die pseudokaribische Melodie, die ich im Ausschlussverfahren unter den verfügbaren Klingeltönen ausgewählt hatte. Ich stieg in die hohen Gummistiefel und ging vors Haus in den Schnee hinaus, zu dem Baum, wo man einen besseren Empfang hat. Bei jedem Schritt sank ich ein, es war, als bewegte ich mich auf einem anderen Planeten.
Mein Bruder Fabio war aufgeregter als gewöhnlich: [9] »Lorenzo«, sagte er, »seit gestern Abend versuche ich dich zu erreichen, auf dem Festnetz und auf dem Handy.«
»Das Festnetztelefon funktioniert nicht bei Schnee, und das Handy hat im Haus keinen Empfang«, erwiderte ich im leicht schleppenden Tonfall dessen, der schon weidlich verfügbare Informationen wiederholt.
»Papa ist tot«, sagte mein Bruder.
»Was?«, fragte ich, im Kopf ein Bild unseres Vaters bei sich zu Hause im Wohnzimmer, während er sich mir zuwendet, um etwas zu sagen. Der Schnee reichte mir bis zum Knie, die Lorbeersträucher bogen sich unter der weißen Last, die sie zu zerbrechen drohte.
»Ja«, sagte mein Bruder.
»Wann?« Eine der vielen, halb formulierten Fragen, die mir durchs Hirn schossen.
»Gegen zehn.« Fabio hatte es eilig, wie immer: Abgesehen von unserem Telefongespräch gab es andere, mindestens ebenso wichtige Fragen, die auf ihn warteten.
»Aber wie ist es passiert?« Auch wenn ich nie gedacht hatte, dass unser Vater buchstäblich ewig leben könnte, gehörte er doch seit meiner Geburt zu meiner geistigen Landschaft, durch alle Perioden und Phasen hindurch: Eine Welt ohne ihn neu zu gestalten war nicht leicht.
»Myokardinfarkt«, sagte mein Bruder.
»Wo?«
»Zu Hause, in seinem Arbeitszimmer. Luz hat sofort den Notarzt gerufen, aber als sie gekommen sind, war nichts mehr zu machen. Sie haben ihn nicht einmal mitgenommen.«
»Aha.« Ich griff nach einem langen Stock unter dem [10] Vordach und begann, die niedergedrückten Lorbeerzweige zu bearbeiten. Die Schneemasse löste sich in pulverigen Klumpen, die Äste schwankten. Ich schlug kräftiger zu: Einige Äste schnellten befreit nach oben und schleuderten mir dabei Schnee ins Gesicht, in die Haare und in den Ausschnitt des Pullovers.
»Darf man erfahren, was du da machst?«, sagte mein Bruder. »Was ist das für ein Radau?«
»Nichts. Das ist der Schnee.«
»Wann meinst du, dass du kommen kannst?«, fragte er, die Ungeduld saß ihm im Nacken.
»Sofort. Jetzt.« Ich fühlte mich schuldig, dass ich nicht schon dort war, unabhängig vom Tonfall meines Bruders, dennoch konnte ich nicht widerstehen und schlug noch ein paar Mal mit dem Stock auf die Zweige, um sie zu befreien. Kleine Lawinen glitten zwischen Wolken von Pulverschnee über die grünen Blätter und versanken in der weichen weißen Schicht, die den Boden bedeckte.
»Beeil dich«, sagte mein Bruder. »Ich kann mich nicht allein um alles kümmern.«
»Bin schon unterwegs. Muss ja nur zweihundertsechzig Kilometer fahren, dann bin ich da.«
Ich hätte gern noch etwas über den vermutlichen Zustand der Straßen hinzugefügt, aber mein Handy war leer und ging aus. Ich kehrte ins Haus zurück, um mir die Zähne zu putzen und ein paar Sachen in einen Rucksack zu packen. Mir standen noch einige andere Bilder meines Vaters vor Augen, nicht aus allerjüngster Zeit, denn es war ungefähr zwei Monate her, seit wir uns zuletzt gesehen hatten: Immer sah er mich mit einem unschlüssigen Ausdruck [11] zwischen Neugier und Ratlosigkeit an. Ich lief wieder hinaus, schloss die Haustür ab und stieg rutschend den Abhang zu dem offenen Vorplatz hinunter.
Der Pick-up war unter der dicken Schneedecke kaum erkennbar. Mit einer Schaufel begann ich ihn wütend auszugraben. Ich fühlte mich von der Materie behindert, und gleichzeitig wurde ich den Gedanken nicht los, dass eigentlich keine Eile geboten war. Das ist eine der Nebenwirkungen des Lebens außerhalb der Welt, ohne Uhren und mit instabilen Telefonverbindungen, und das, was passiert war, verstärkte sie noch. Deutlich spürte ich die Belanglosigkeit von Absichten und Zeitplänen, Konzepten, Kalendern, Terminen und Erwartungen.
Als das Auto weit genug freigeschaufelt zu sein schien, setzte ich mich ans Steuer und ließ den Motor an, der Scheibenwischer beförderte Schneebrocken über die Windschutzscheibe. Der Sitz war kalt, die Scheiben beschlugen sich sofort; meine Knie schlotterten, und ich klapperte mit den Zähnen, während sich der einfache Dieselmotor erwärmte.
Ohne viel zu sehen, fuhr ich die kleine Straße hinunter, und an der ersten Kurve hielt mich eine Masse quer über die Fahrbahn gestürzter, schneebedeckter Bäume auf, denen die noch belaubten Kronen und die auf dem abschüssigen Lehmboden nur schwach greifenden Wurzeln zum Verhängnis geworden waren. Ich stieg aus und versuchte sie wegzustoßen, aber es war hoffnungslos, also musste ich zurückstapfen, den Abhang wieder hinaufklettern und die Motorsäge aus dem Geräteschuppen holen. Natürlich war ihr Tank leer, ich musste erst Öl und Benzin mischen und [12] die Mischung dann mit einem Trichter einfüllen, alles mit vor Kälte und Hast starren Fingern. Ich zog an der Anlasserschnur, aber aus irgendeinem Grund sprang der kleine Einzylinder-Motor nicht an. Immer wieder riss ich an der Schnur, versuchte, die Luftzufuhr zu schließen, wieder zu öffnen: nichts. Ich warf die Motorsäge in den Schnee, sie versank darin. Dann holte ich die Handsäge aus dem Schuppen und lief, vor Aufregung schlimmer stolpernd und rutschend als zuvor, zu den Bäumen zurück.
Ast um Ast sägte ich ab, zerlegte anschließend die Stämme und warf die Stücke einzeln zur Seite. Der Schnee stäubte mir in die Stiefel, die Augen und die Ohren, machte mir durch die zerschlissenen, aufgeplatzten Lederhandschuhe hindurch die Finger nass. Ich plagte mich so sehr, dass mein baumwollenes Unterhemd und der unterste Wollpullover in Minutenschnelle durchgeschwitzt waren, dennoch hatte ich weder Zeit noch Lust, eine Pause einzulegen, nicht einmal, um mir den Anorak auszuziehen. Ich sägte, bis mir die Armmuskeln schmerzten, und die Augen tränten vor Anstrengung. Ab und zu trat ich einige Schritte zurück, um das Ergebnis zu begutachten, und hatte nicht den Eindruck, dem Ziel, mir einen Durchlass zu eröffnen, näher gekommen zu sein. Völlig in die mechanische Systematik meiner Räumaktion vertieft, arbeitete ich immer weiter, bis mir irgendwann bewusst wurde, dass die Durchfahrt frei war. Nass von geschmolzenem Schnee und Schweiß, wie ich war, sprang ich in den Pick-up, ließ den Motor wieder an und fuhr das Sträßchen hinunter, wobei ich mich mehr auf mein Gedächtnis als auf die Sicht stützte.
Es war nicht leicht, die dreihundert Meter bis zur [13] Landstraße zu überwinden, weil ich mit der Kühlerhaube eine ständig höher werdende Schneemauer vor mir herschob und die Ränder der Fahrbahn nur erahnen konnte, dauernd musste ich das Steuer herumreißen, um nicht umzukippen und zwischen den Bäumen im Wald zu landen. Als ich schließlich mit einem letzten Ruck die vom Schneepflug geräumte Straße erreichte, empfand ich ein flüchtiges Gefühl der Erleichterung, das sogleich von wachsender Angst verdrängt wurde.
Die Überquerung des Apennins gestaltete sich schwieriger als vermutet: die Straßen von knirschendem Schnee bedeckt, der sich unter den Reifen ballte, Schneewände rechts und links, mit Schaufeln bewaffnete alte Männer vor den zugeschneiten Türen ihrer Häuser, kleine steinerne Dörfer, die es um mindestens ein Jahrhundert zurückgeworfen hatte, dichter Rauch aus den Schornsteinen, auf den Seitenstreifen oder den Parkplätzen an den Tankstellen stehende große Lastwagen, alle Farben ausgelöscht. Hätte ich es nicht so eilig gehabt, wäre es sogar stimmungsvoll gewesen. Ab und zu kamen mir weitere Bilder meines Vater in den Sinn: Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln, mitten in einer Geste aufgenommen, zwischen einem Ausdruck und dem anderen.
Auf der kurvigen Strecke zwischen Gubbio und Perugia waren die Scheibenwischer irgendwann so vereist, dass ich beim Lenken den Kopf aus dem Fenster strecken musste, um die Umrisse der Straße zu erkennen. Ich blieb stur im dritten Gang, während der Dieselmotor röhrte und das Heizungsgebläse ununterbrochen dröhnte; an den [14] schwierigsten Stellen bewegte ich instinktiv die Schultern und das Becken, wie um dem Pick-up zu helfen, die Spur zu halten und weiterzufahren.
Ab Perugia wurde die Schneedecke dünner, schütterer und zog sich nach und nach von der Landschaft zurück, bis an der Grenze zu Latium keine Spur mehr davon übrig blieb. Der Himmel war hier blassblau, leicht gelbliches Licht überflutete von Westen her die Felder und die Gebäude an der Schnellstraße. Die Gründe für meine Verspätung lösten sich rund um mich auf, während ich das vibrierende Steuer umklammerte und immer wieder auf die an meiner Höchstgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern zitternde Tachonadel blickte.
[15] Bei meiner Ankunft in Rom
Bei meiner Ankunft in Rom empfand ich das gewohnte Gefühl von Verwirrung angesichts dieser Stadt, die unbefangen das Privileg ihres Klimas genießt. Alle liefen in leichten Jacken und Mänteln herum, ohne einen Gedanken an den brutalen Winter zu verschwenden, der in nur zwei Stunden Entfernung wütete. Ich betrachtete die Leute in den Autos und auf den Bürgersteigen mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Verdruss; ich hätte gern das Fenster heruntergekurbelt und etwas hinausgeschrien oder gehupt, um Alarm auszulösen.
Die nun ehemalige Wohnung meiner Eltern lag in einem der ersten Vororte Roms, auf die man trifft, wenn man von Norden kommt, einem Luxus-Vorposten aus balkonbewehrten hohen Gebäuden, die Anfang der siebziger Jahre den Eindruck einer unerwartet modernen Entwicklung der Stadt erweckt haben mussten. Das Haus stand beinahe direkt am Ufer des Tibers, der dort manchmal ein reißender Fluss ist, am Rand dieses Viertels, das bewohnt ist von schrecklich verzogenen Muttersöhnchen, kalt blickenden Paaren um die vierzig, reichen Notaren und Rechtsanwälten und Admiralswitwen samt den in ihrem Dienst stehenden Filipinas und Filipinos, die Kinder oder Hunde an der Leine spazieren führen. Meine Eltern waren dorthin [16] umgezogen, als ich zwölf und mein Bruder zehn Jahre alt war, aus abstrakt gesehen praktischen Gründen (mehr Grün, bessere Luft, mehr Platz im Vergleich zu der Straße im Zentrum Roms, aus der wir kamen), aber ohne im Geringsten zu berücksichtigen, wie sich dieser Ort auf uns Kinder auswirken könnte. Und sie hatten dann weiter dort gelebt, als ob weder das Haus noch das Viertel, noch Rom überhaupt sie sonderlich viel anginge, und zwar zur Miete, weil meine Mutter immer gegen jede Art von Wohnungskauf gewesen war.
Daran dachte ich, während ich im Lift nach oben fuhr und das kleine Messinggitter der Sprechanlage betrachtete, dem man, wie ich als Kind entdeckt hatte, Töne entlocken konnte, wenn man mit den Fingernägeln an den Stäbchen zupfte. In diesem Lift hatte ich, wollte man alle Male, die ich hinauf- und hinuntergefahren war, zusammenzählen, vermutlich ganze Tage verbracht, in seinem Spiegel hatte ich unendlich oft mein Aussehen überprüft, als mein Leben noch keinerlei Form besaß. Verschiedene Arten zu stehen, Körperhaltungen von vorn und von der Seite, Haarschnitte, Hosen und Schuhe in diesem oder jenem Stil, Gesichtsausdrücke geübt, lange bevor ich sie in die Praxis umsetzen konnte. Verschlafen, hungrig, gelangweilt, verliebt hatte ich hier drin gestanden; mit Fahrrad, mit Schulbüchern, mit Schulfreunden, mit Lieblingsbüchern, mit kostbaren Schallplatten, mit ersten Freundinnen, mit Gepäck, um zu verreisen, mit einer Frau, um sie meinen Eltern vorzustellen, mit Blumen für meine Mutter, mit Argumenten, um Streitgespräche beim Mittagessen anzufachen. Ein paarmal war ich auch wegen eines Defekts damit steckengeblieben, [17] zwischen dem siebten und dem sechsten Stock, überzeugt, nicht lebend herauszukommen.
Im achten Stock stand die Wohnungstür offen; man vernahm gedämpftes Stimmengewirr, vorsichtige Bewegungen. Ich sagte: »Hallo?«, und trat mit meinen feuchten, schmutzigen Stiefeln in den Vorraum, wo die Hüte und Spazierstöcke meines Vaters hingen. In dem großen, hellen Wohnzimmer mit den vielen Fenstern standen mein Bruder Fabio und seine Frau Nicoletta, Luz, das Dienstmädchen aus Ecuador, Nadine Lemarc, die Assistentin und Exgeliebte meines Vaters, sein Kollege und alter Freund Dante Marcadori, Gianni, der Portier, und zwei oder drei andere Personen, die ich nicht kannte. Sie unterhielten sich, verstummten aber, als sie mich sahen, und gingen zur Seite, wobei sie sorgsam darauf achteten, wohin sie traten. In dieser seltsamen Leere kam mein Bruder auf mich zu und umarmte mich, doch sein Gesichtsausdruck und seine Gesten wirkten mindestens teilweise aufgesetzt, sie passten gar nicht zu seinem Ton wenige Stunden zuvor am Telefon. Gleich darauf umarmte mich Nicoletta, hauchte mir einige Worte zwischen Ohr und Hals und zog sich in einer Wolke von Vanilleparfüm wieder zurück; dann umarmten mich alle anderen.
Anschließend standen wir uns der Reihe nach mit hängenden Armen gegenüber, den Blick knapp unter der Augenlinie, und machten kleine seitliche Schritte auf dem Marmorfußboden.
Fabio fragte mich halblaut: »Willst du ihn sehen?«, während er schon Richtung Flur vorausging.
Unser Vater, oder besser gesagt, sein Körper lag [18] zurechtgemacht und sorgfältig angekleidet auf dem Bett in dem Zimmer, das nach dem Tod unserer Mutter das seine gewesen war. Mein Bruder deutete auf die Tür; ich sagte: »Bleib ruhig da«, doch er schlüpfte trotzdem hinaus. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, daher beugte ich mich hinunter, um die Stirn unseres Vater zu berühren: sie war kalt und glatt. Sein Gesicht wirkte ziemlich heiter, abgesehen davon, dass ich mich nicht erinnern konnte, ihn je schlafend oder mit geschlossenen Augen gesehen zu haben. Außer auf das Timbre seiner Stimme hatte er stets auch auf die Intensität seines Blickes gesetzt: Er hatte diese Art, durchs Zimmer zu gehen, ohne dich aus den Augen zu lassen, um den Druck seiner Worte zu verstärken. Er war anspruchsvoll und ungeduldig gewesen, völlig auf das konzentriert, was er gerade tat, und erkannte sehr schnell die Gründe für mögliches Interesse und mögliche Langeweile bei den anderen. Kein leichter Vater, während ich heranwuchs und auch später, bis es mir gelang, meinen eigenen, von dem seinen gänzlich unabhängigen Weg zu finden. Wir hatten nur wenige echte Gespräche geführt, und noch seltener waren meine Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse, abgesehen vielleicht von einer strammen Bergwanderung und zwei oder drei Angeltouren. Als Kind hatte ich häufig die Eifersucht gespürt, die er mir und meinem Bruder gegenüber empfand, weil wir ihm einen Teil der Aufmerksamkeit unserer Mutter wegnahmen; und als Jugendlicher war mir sein Unmut über meine körperliche und geistige Unsicherheit nicht entgangen. Doch ansonsten hatte sich sein Leben fast gänzlich außerhalb der Familie abgespielt, zwischen Klinik und Universität, Wissenschaft, Assistenten und Schülern. Er hatte [19] immer eine Gruppe junger Gesprächspartner um sich gehabt, die viel dankbarer waren als wir zwei Söhne: eher geneigt, ihn zu bewundern, und viel weniger fordernd auf der Gefühlsebene. Wahrscheinlich konnte er die Vorstellung nicht ertragen, dass wir ihn als unseren Vater ganz selbstverständlich nahmen, und interessierte sich deshalb nicht allzu sehr für uns. Im Nachhinein finde ich das keinen Makel, angesichts seines und meines Charakters.
Ich setzte mich auf einen Stuhl und betrachtete ihn eine Weile. Es war keine besonders schmerzliche Situation; mir schien, als hätte ich nur eine nach dreiundachtzig Jahren intensiven Gebrauchs abgestreifte körperliche Hülle vor mir. Bei meiner Mutter hatte ich zwei Jahre zuvor das gleiche Gefühl gehabt, und noch ein Jahr vorher bei einem Hund, den ich sehr liebgehabt hatte. Ich weiß noch, dass ich, während ich den toten Hund aus der Nähe betrachtete, deutlich spürte, dass sein Geist mit all den Lebens- und Gefühlsäußerungen, deren er fähig war, einfach anderswohin entschwunden war und seine alte Form auf der Wiese zurückgelassen hatte. Dennoch fiel mir die Trennung keineswegs leicht, denn immer wieder plagte mich die Vorstellung, wie endgültig starr dieser Körper nun dalag, der einmal sehr beweglich gewesen war und auf dessen Beweglichkeit sogar ein großer Teil seiner Kommunikationsfähigkeit beruht hatte. Ich dachte an die irdischen Dinge, die im Laufe seines Lebens durch den irdischen Körper meines Vaters hindurchgegangen waren: an die Luft, die er geatmet hatte, an die Speisen, die er gegessen und jedes Mal nach ihrem Geschmack unterschieden hatte, an die warmen und kalten Flüssigkeiten, die er bis zum Tag zuvor getrunken hatte. Ich [20] dachte an die Anzüge, die er getragen hatte, an die unterschiedliche Beschaffenheit der Stoffe, ihre tierische oder pflanzliche Herkunft, die Bedeutung, die er Schnitt und Farbe beigemessen hatte. Ich dachte an seine Kleider, die in den Schränken hingen oder gestapelt waren und denen plötzlich jeder Nutzen abhandengekommen war.
Während ich solchen Grübeleien nachhing, kam mein Bruder Fabio wieder ins Zimmer herein. Schweigend betrachtete auch er ein paar Minuten unseren Vater, dann sagte er brüsk: »In einer halben Stunde muss ich zu einer Sitzung der Kulturkommission. Es ist ein schwieriger Moment, ich kann sie nicht ausfallen lassen.«
»Natürlich nicht«, erwiderte ich. Seine Art, sich in die Rolle eines Spitzenmannes des Mirto Democratico zurückzuziehen, einer jener Parteien des Mitte-Links-Bündnisses, die sich in den letzten Jahren Pflanzennamen zugelegt hatten, irritierte mich nicht, sondern rührte mich beinahe. Allmählich hatte er sich von einem in der Politik engagierten Mediziner zu einem Vollzeit-Politiker mit wachsender Bedeutung gewandelt. Unterdessen war er in die zweite Riege aufgestiegen, kam gleich nach dem Parteisekretär und dem Vorstand; es brauchte nur einer von ihnen nach den nächsten Wahlen zum Minister ernannt werden, schon würde er voll ins Rampenlicht treten. Dementsprechend hatte er im Laufe weniger Jahre eine neue Art sich zu bewegen, zu sprechen, zu schauen, sich zu kleiden, zu telefonieren, zu lesen und zu denken angenommen. Er lebte in permanentem Alarmzustand, hielt es nicht länger als einige Sekunden an einer Stelle aus vor Angst, dass woanders gerade etwas grundlegend Wichtiges passierte. Er konnte sich mit aller [21] Intensität, zu der er fähig war, auf ein Thema konzentrieren und dann plötzlich die Augen und die Aufmerksamkeit abwenden, um sie auf etwas anderes zu richten: Schlagartig hörte er dir nicht mehr zu, sah auf die Uhr, zog das Handy aus der Tasche wie einer, der dringend lebenswichtige Nachrichten empfangen oder weitergeben muss. Er kam mir vor wie einer, der um jeden Preis auf ein Fest zurückkehren will, von dem man ihn aus belanglosen Gründen weggeholt hat, und da er weiß, dass das Fest inzwischen woanders stattfindet, versucht er sich ständig auf dem Laufenden zu halten, damit ihm die Rückkehr gelingt. Der Umstand, dass das Fest langweilig und eintönig und ohne Musik ablief, gestattete es ihm wahrscheinlich, seine unerschöpfliche Anspannung als Engagement zum Wohl des Landes zu sehen, ohne jede Spur von Selbstgefälligkeit oder anderen egoistischen Motivationen.
Ich kehrte mit ihm ins Wohnzimmer zurück, wo seine Frau Nicoletta Nadine an der Schulter streichelte, die hinter ihrer Brille mit dem feinen roten Rand weinte, während Dante Marcadori den anderen Besuchern den genauen Ablauf eines Myokardinfarkts erklärte. Als sie mich und Fabio sahen, verstummten sie; ein paar Minuten verharrten wir in dem neuen Schweigen, mit Blicken und Händen, die nicht wussten, wo sie hin sollten.
Mein Bruder sagte: »Bitte entschuldigt mich, aber ich muss leider weg« – auch dies in einem Ton und mit einem Gesichtsausdruck, die einstudiert waren, um Bedauern und Achtung der Regeln und Engagement und größte menschliche Sympathie für alle Anwesenden auszudrücken. Es handelte sich um eine weitere Auswirkung seiner [22] Verwandlung zum Politiker, das Bedürfnis, im großen Kreis einen guten Eindruck zu hinterlassen, jede Erwartung zu erfüllen. Er umarmte alle, dankte allen, winkte allen, während er auf die Wohnungstür zuging, wo ihn sein Assistent erwartete. Mir schien dieses Verhalten extrem anstrengend, doch sein permanenter Alarmzustand jagte ihn durch die Anstrengung und alles Übrige, seinem Fest ohne Musik hinterher, das ständig woanders stattfand.
Etwa eine Stunde blieb ich mit den anderen im Wohnzimmer sitzen. Ich lauschte den halblaut geäußerten feierlichen Betrachtungen, den von tiefer Zuneigung und langer Bekanntschaft diktierten Sätzen, den Erinnerungen an schon oft gehörte und andere, weniger vertraute Vorfälle. Nadine stellte Daten und Namen von Personen und Orten richtig und besprach mit Nicoletta organisatorische Einzelheiten. Nicoletta antwortete am Telefon, das Luz ihr reichte, und schwankte zwischen der Rolle der guten, tief betrübten Schwiegertochter und der einer Journalistin, die auch unter schmerzlichsten Umständen nicht den Überblick verliert. Sie gab mir den Nachruf zu lesen und den Text für die Presseagenturen, den sie gemeinsam mit meinem Bruder verfasst hatte, beide schon abgeschickt. Sanft und präzise wie immer, unermüdlich. Zwischen ihr und Nadine bestand eine offensichtliche Konkurrenz, es war aber auch deutlich, dass sie sich die Rollen auf eine Weise aufgeteilt hatten, die für beide akzeptabel war, was auch die Blicke und Zärtlichkeiten bestätigten, die sie gelegentlich austauschten.
Für mich dagegen, schien mir, gab es nicht viel zu tun, außer anwesend zu sein, daher wanderte ich durchs Wohnzimmer und betrachtete die Stiche und Gemälde von [23] Fischen an den Wänden, die Fische aus Porzellan, aus Glas und geschnitztem Holz in den Regalen. Ich dachte daran, wie stolz mein Vater auf seine bei seinen Reisen durch die Welt erworbene und durch Geschenke von Freunden, Geliebten und Bewunderern ergänzte Sammlung gewesen war, und daran, wie absurd und unerklärlich sie jetzt wirkte. Es war nie ein behagliches Wohnzimmer gewesen, da meine Mutter bürgerliche Formen ablehnte, obwohl sie in einem durch und durch bürgerlichen Haus in einem noch viel bürgerlicheren Stadtviertel lebte. Die Einrichtung bestand aus einem Sammelsurium nicht zusammenpassender Sessel und Sofas, die zu niedrig oder zu hoch oder zu hart oder zu rutschig waren und mit denen mein Vater sich abgefunden hatte, wenn er auch nicht müde wurde zu wiederholen, dass er gern in einer gemütlicheren Wohnung gelebt hätte. Ich dachte daran, dass der untergründige Disput meiner Eltern über die Bequemlichkeit des Lebens mir ebenso dauerhaft erschienen war wie ihre Charakterzüge und die Natur ihrer Beziehung. Nun aber hatte er sich zusammen mit ihnen aufgelöst und war im Nichts verschwunden: Meine Ursprungsfamilie hatte sich überraschend mit zunehmender Geschwindigkeit im Lauf von drei Jahren aufgelöst. Vor einem Augenblick noch waren beide Eltern da, achtzigjährig und in erstaunlich guter körperlicher und geistiger Verfassung, im nächsten Augenblick war die Mutter plötzlich sehr gebrechlich, im nächsten Augenblick war sie tot, im nächsten Augenblick der Vater allein und mitgenommen, er fängt sich jedoch mit der Kraft eines Löwen wieder, als könnte er noch wer weiß wie lange so weitermachen, im nächsten Augenblick ist der Vater tot; Ende.
[24] Ich irrte durch das Wohnzimmer, in dem jedes Möbelstück, jede Lampe und jeder Gegenstand von ihren Gesten, ihren Vorlieben, ihren Reisen und ihren fixen Ideen zeugten, hier hatte ich sie, aus der Perspektive eines Kindes, eines Jugendlichen und eines Erwachsenen über die Welt diskutieren gehört und zugesehen, wie sie sich bewegten und Bücher und Zeitungen lasen und Schallplatten hörten. Ich dachte daran, dass der Raum in Kürze von einem oder mehreren Umzugsunternehmen geräumt und dann gesäubert und gestrichen werden würde, um einem anderen Paar oder einer anderen Familie zu gestatten, eine Zeitlang die Komödie ihrer Dauerhaftigkeit darin aufzuführen.
Einige weitere Bekannte kamen zum Trauerbesuch, Dante Marcadori und Gianni, der Portier, verabschiedeten sich.
Nicoletta sah auf die Uhr und sagte: »Ich muss jetzt nach Hause, Tommaso kommt gleich vom Nachhilfeunterricht. Außerdem sollte ich noch was zum Abendessen einkaufen.«
»Geh nur«, erwiderte Nadine, ganz Herrin der Lage.
Nicoletta berührte mich an der Schulter und fragte: »Was machst du, Lorenzo, begleitest du mich? Du schläfst doch ohnehin bei uns, nicht wahr?«
Ich blickte mich um, unsicher, wie meine Sohnespflichten unter diesen Umständen aussahen. Nadine sagte: »Geh ruhig, geh. Hier gibt es bis morgen früh sowieso nichts zu tun.«
Wieder fand ein Austausch ritueller Umarmungen und Küsse statt, dann folgte ich Nicoletta in den Lift, in dem ich alles in allem ganze Tage meines Lebens verbracht hatte.
[25] Draußen wurde es allmählich dunkel
Draußen wurde es allmählich dunkel, im Osten durchzogen violette Streifen den Himmel über der Großstadt, die vibrierte und dröhnte von Millionen von Motoren, die über all ihre Straßen verteilt waren. Die Luft war nicht so eisig wie im Apennin, dafür aber viel feuchter.
Nicoletta sah mich an: »Stört es dich, wenn wir ein paar Sachen einkaufen, bevor wir nach Hause gehen?«, fragte sie und deutete zum anderen Flussufer hinüber; sie war nervös in ihren Schuhen mit den flachen Absätzen eines wohlerzogenen Mädchens.
Ich folgte ihr über den Platz, der keine richtige Piazza war, und über die stark befahrene Straße zur Fußgängerbrücke über den Tiber. Auf der viel größeren Brücke zu unserer Rechten, die aus Rom hinausführt, flammten Straßenlaternen nacheinander auf wie riesige Streichhölzer, zu unserer Linken glitzerten zahllose Lichter von Häusern, Schaufenstern, Schildern und fahrenden Autos. Ich trat ans Geländer und betrachtete den Fluss, der mit seinen dunklen, bedrohlichen Gewässern unter uns dahinfloss. Tatsächlich machte ganz Rom einen bedrohlichen Eindruck auf mich. Es war, als hätte das lange Leben auf dem Meer und dann in der Abgeschiedenheit auf dem Lande nach und nach die Kräfte meines Immunsystems abgebaut, die mir erlaubt [26] hatten, hier aufzuwachsen und einen großen Teil meines Lebens hier zu wohnen und zu arbeiten und Freundschafts- und Liebesbeziehungen aufzubauen. Dieses Gefühl war mir nicht neu, aber diesmal traf es mich härter als früher und lähmte meine Schritte, als hätte ich Blei in den Stiefeln.
»So ist das Leben eben«, sagte Nicoletta.
»Dass es zu Ende geht, meinst du?«, fragte ich.
»Ja.«
Ich sagte: »Geht es dir immer noch gut hier?«
»Wo?« Sie ging rasch, warf ab und zu einen prüfenden Blick auf das Handy, ganz ähnlich wie mein Bruder.
»In Rom« – ich deutete vage auf das Panorama. Wir waren in der Mitte der Brücke angelangt, nahe bei den Lichtern, die sich auf der von Bäumen gesäumten breiten Straße und der Piazza gleich jenseits des Flusses blitzend und in Leuchtstreifen vervielfachten.
»Wieso?«, fragte sie und sah mich misstrauisch an. Sie war viel römischer als mein Bruder und ich, da unsere Familie aus Città di Castello stammte, während ihre seit jeher in Rom gelebt hatte. Obwohl wir an den gleichen Orten aufgewachsen waren, die gleichen Schulen besucht und beim Sprechen einen sehr ähnlichen Akzent hatten, verfügte sie über einen Reichtum an Nuancen im Denken und Verhalten, die man in einer einzigen Generation einfach nicht erwerben kann. Ich meine den automatischen Widerhall der Orte, der Wörter hinter den Wörtern, der Namen hinter den Namen; das Wissen, noch bevor man etwas hört, das Dasein, bevor man ankommt.
»Ach nichts«, sagte ich. Wir kamen genau an der Stelle vorbei, wo ich mich mit sechzehn stundenlang mit einem [27] Mädchen geküsst hatte. Mir fiel ein, dass es mir damals so vorgekommen war, als sei ich das einzige bewegliche Element in einer starren Landschaft, zu der die Stadt und das Haus mit den Balkonen auf der anderen Seite der Brücke und die Wohnung meiner Eltern und ihr Rollenspiel und meine Beziehung zu meinem Bruder gehörten. Ein Typ fuhr mit Vollgas auf seinem Moped vorbei und hinterließ eine Lärmspur, die bis zum Verkehr auf der breiten Straße führte.
Nicoletta sagte: »Euer Vater wird eine gewaltige Leere hinterlassen. In der Welt der Wissenschaft, in der Kultur, in Rom, in unserer Familie. Es gibt nicht viele solche Männer in diesem grässlichen Land.«
Ich nickte, obwohl ich ihre Worte sehr allgemein fand, sie klangen beinah wie eine Presseerklärung.
Ich folgte ihr über die Straße und durch das Gedränge auf den Bürgersteigen der Piazza in eine große Bäckerei, wo sehr gutgekleidete Leute einkauften, die alle Stammkunden zu sein schienen. Nicoletta wählte Ravioli mit Nussfüllung aus der Auslage, Brot, Focaccia und Süßigkeiten. Sie deutete mit dem Finger darauf und sagte dem Verkäufer, was sie wollte, in der teilweise vertraulichen, teilweise arroganten Art, die auch die meisten anderen Kunden an den Tag legten. Der Verkäufer wiederum bediente sie mit einer Mischung aus Gleichmut und Unterwürfigkeit: »Darf es noch etwas sein, Signora Telmari?«
»Danke, Franco, das wär’s«, sagte Nicoletta. »Ach, nein, warte, davon auch noch ein paar!« Wieder deutete sie mit dem Finger, in ihrem halb konservativen, halb legeren Outfit, scheinbar zerstreut, in Wirklichkeit aber auf jedes [28] geringste Detail achtend. Ich betrachtete ihre regelmäßigen weißen Zähne, ihre durch fein aufgetragenen Eyeliner und einen fast unmerklichen Hauch von Lidschatten betonten nussbraunen Augen, die halblang geschnittenen Haare mit kastanienfarbenen Strähnchen. Ihre falsche Einfachheit störte mich, doch gleichzeitig beeindruckte es mich, wie solide sie war, dass sie keinerlei Zweifel hegte; das musste beruhigend für meinen Bruder sein.
Wir gingen noch in einige andere Geschäfte, und wenn wir wieder heraustraten, war der Himmel jedes Mal dunkler, das Licht der Straßenlaternen, Schaufenster und Autoscheinwerfer immer greller. Die Einkaufstüten in der Hand, gingen wir nebeneinander her, ab und zu hakte sich Nicoletta bei mir unter. Mir war, als spielte ich bei der Simulation eines bourgeoisen römischen Paares mit, im Grunde war ich genau davor immer davongelaufen, jedes Mal mit Streit, Trennung, Auszug und Aufgabe der Arbeitsstelle, auf der Flucht zu anderen Ufern. Dennoch empfand ich in diesem Augenblick einen uneingestandenen Wunsch nach Stabilität, beinahe so heftig wie das Bedürfnis nach Entdeckungen und Überraschungen und ständigen Veränderungen, das mich so viele Jahre lang umgetrieben hatte. Ich dachte an die Mädchen und Frauen, mit denen ich es so hätte einrichten können wie mein Bruder mit Nicoletta: an die Angebote von Organisation und Rollenteilung, die ich halbherzig in Betracht gezogen und dann abgelehnt hatte, als ginge es dabei um mein Überleben.
Als alle Einkäufe getätigt waren, überquerten wir erneut die Brücke, stiegen in meinen Pick-up und fuhren zur Wohnung meines Bruders. Nicoletta schien sich zu wundern, [29] wie viel Erde, Steine, Blätter und kleine Zweige in meinem Auto lagen, sie sagte: »Wie lebst du denn?« Ihr verhaltenes Lächeln hing nicht nur mit dem Tod meines Vaters zusammen: Es war ihr Stil, das Maß, das sie in ihren Beziehungen zur Welt anwandte. In der Zeit, die wir bis nach Hause brauchten, machte sie drei, vier Telefonate; sie gab und erhielt Informationen, in unterschiedlichen Abstufungen von Ehrlichkeit. Aus dem Augenwinkel nahm ich ihre hektischen, gezielten Gesten wahr, wie sie ihre Tasche öffnete und wieder schloss, sich mit der Hand die Haare zurückstrich.
Nicoletta und mein Bruder wohnen im obersten Stockwerk eines Hauses aus der Jahrhundertwende, im Stadtteil Prati: eine Wohnung mit langen Fluren, um einen leicht orientalisch anmutenden Hof gebaut, in dem einige Palmen wachsen. Kaum traten wir aus dem Aufzug, eilten Harry und Emily, die philippinischen Dienstboten, herbei, um uns die Einkaufstüten abzunehmen. Nicoletta gab ihnen einige Anweisungen, dann fragte sie nach ihrem Sohn Tommaso. Er lümmelte im Wohnzimmer auf einer Couch vor einem großen Bildschirm, über den die Bilder eines Fußballspiels flimmerten.
»Sag deinem Onkel guten Tag, du Flegel«, ermahnte ihn Nicoletta und gab ihm eine liebevolle Kopfnuss.
»Mmmciao«, knurrte er kaum hörbar, fast ohne mich anzusehen.
»So ein ungezogenes Kind«, sagte Nicoletta nicht ohne eine gewisse Befriedigung, während sie hinausging, um den Anrufbeantworter abzuhören. Ein paar Minuten später kam sie mit einer der kleinen Pizzas, die wir gekauft hatten, [30] wieder herein, gab sie ihrem Sohn und fragte, wie die Nachhilfe gelaufen sei.
Tommaso brummte: »Wmguhut«, biss in die Pizza und rückte sich auf der Couch zurecht, um klarzustellen, dass ihm einzig das Fußballspiel wichtig war. Sein völliger Mangel an Interesse oder Neugier für mich oder irgendwen oder irgendwas, das nichts mit Fußball zu tun hatte, beeindruckte mich jedes Mal, ich fragte mich, ob er ausschließlich mechanische Verbindungen im Kopf hatte oder noch eine andere Dimension besaß, die er sorgsam verbarg.
Nicoletta ging mir durch den Flur voraus und öffnete die Tür zu dem Zimmer, in dem ich schon bei anderen Gelegenheiten geschlafen hatte. Sie erklärte mir, dass sie das Bett hatte überziehen lassen, und deutete auf die sauberen Handtücher auf einem Stuhl.
Ich dankte ihr und stellte meinen kleinen Rucksack ab.
Sie fragte: »Ist das dein ganzes Gepäck?«
Ich nickte.
Leicht kopfschüttelnd sagte sie: »Vagabundierender Seemann, echt«, und lächelte ihr halbherziges Lächeln.
Ich wollte ans Fenster gehen, und durch eine fahrige Bewegung meinerseits stießen wir zusammen. Sie legte mir eine Hand auf die Hüfte, lehnte ihre Stirn an meine Schulter und sagte: »Es tut mir unendlich leid um deinen Vater.«
Ich drückte sie sacht an mich, ein wenig verlegen wegen der körperlichen Nähe und der Spürbarkeit anatomischer Einzelheiten bei dieser Trauerumarmung zwischen Schwager und Schwägerin. Ich versuchte, so wenig wie möglich an ihre Brüste und ihren Bauch und ihre Schenkel zu denken, die sich an mich drückten; ich nahm ihren Atem und [31] ihr inneres Zittern wahr, betrachtete die kastanienfarbenen Schattierungen ihrer Haare, roch ihr Vanilleparfüm.
Gleich darauf schaute Tommaso zum Zimmer herein und fragte: »Wo zum Teufel sind meine neuen Frotteesocken hingekommen? Ich brauche sie für das Schulspiel morgen!« Er zeigte keinerlei Reaktion, als er mich mit seiner Mutter dastehen sah, ein weiterer Beweis für sein völliges Desinteresse an Ereignissen, die nichts mit Fußball zu tun hatten.
Nicoletta löste sich sofort von mir: »Was weiß ich, frag Harry.« Sie verfügte über eine erstaunliche Fähigkeit, übergangslos von einem Zustand zum anderen zu wechseln, denn wenn man sie so betrachtete, fand man keine Spur der Rührung oder was immer sie sonst gerade eben noch übermannt hatte. Mit einem völlig unbeteiligten Seitenblick auf mich ging sie auf den Flur und rief nach dem Filipino.
Ich schloss die Tür, trat ans Fenster, schaute auf den orientalischen Hof hinunter. Dann, nach einigen Arm- und Kniebeugen, stellte ich mich unter die Dusche. Wie jedes Mal, wenn ich in die Stadt kam, beeindruckte es mich unglaublich, dass bei der einfachen Drehung eines Hahns scheinbar unerschöpflich heißes Wasser aus der Leitung sprudelte. Ich fragte mich, ob die Entscheidung, unter ziemlich primitiven Bedingungen auf dem Land zu leben, mich wirklich freier machte oder ob sie mich eher in dem dichten Netz der für das tägliche Überleben notwendigen Handgriffe gefangen hielt. Ich fragte mich nach dem Sinn jeglicher Art von Lebensentscheidung, sei sie nun instinktiv oder reiflich überlegt, zufällig improvisiert oder mit größter Sorgfalt geplant, wenn es das Los jedes Lebens war, von einem Augenblick auf den anderen zu Ende zu gehen, wie es bei meinem [32] Vater geschehen war. Ich schaute durch das mattierte Glas der Dusche und fragte mich nach dem Sinn von Nicolettas unerwarteter Umarmung: Ich fragte mich, ob es hinter der glatten, unangreifbaren Fassade ihres Sozialverhaltens auch aufrichtigere Bestrebungen, Unsicherheiten, Langeweile, das Empfinden von Sinnlosigkeit gab. Ich war verständlicherweise in keiner sehr positiven geistigen Verfassung, aber auch nicht deprimiert; ich bewegte mich langsam im Widerschein eines brüsken Szenenwechsels.
[33] Ich zog mich wieder an und trank ein Glas Rotwein
Ich zog mich wieder an und trank ein Glas Rotwein in der Küche, wo Harry und Emily das Abendessen zubereiteten, dann kam mein Bruder Fabio nach Hause.
Er sprach mit jemandem am Handy, auf dem Flur hörte ich ihn sagen: »Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Wichtig ist, dass sie wissen, dass sie sich die Hörner abstoßen, wenn sie so weitermachen. Und sowieso, wenn man zwei Komma vier Prozent hat, auf wie viel Zuwachs kann man dann überhaupt hoffen?« Bei der Küche angekommen beendete er das Gespräch; mein Anblick schien ihn zu erstaunen, er sagte: »Hey«, und steckte das Handy ein.
»Ciao«, erwiderte ich, das Glas Wein in der Hand.
Harry und Emily hinter mir sagten: »Guten Abend, Signore.«
Er sagte: »Warte«, aber weder zu mir noch zu ihnen, sondern zu einem seiner Taschenträger, der ihm auf dem Flur gefolgt war. Der Taschenträger und ich beäugten uns mit gegenseitigem Misstrauen, während mein Bruder irgendwo in der Wohnung verschwand. Kurz darauf kam er mit einigen Umschlägen zurück: »Ihm persönlich, verstanden? Wir sehen uns morgen früh um sieben«, sagte er. Der Taschenträger nahm die Umschläge, sagte: »Okay, okay«, und ging [34] rasch davon, als müsste auch er einem Fest nachjagen, das ständig woanders stattfindet.
Fabio nahm das Glas Mineralwasser mit einer Zitronenscheibe, das Harry ihm hinhielt, und winkte mir, ihm zu folgen. Er nahm einen tiefen Schluck, dann sagte er: »Alles in allem ein ganz schön schwerer Tag.« Dennoch wirkte er nicht besonders mitgenommen in seinem gutgeschnittenen Anzug aus dunkelblauem Wollstoff: Er schien bereit für weitere familiäre Notfälle, weitere Kommissionssitzungen, weitere Interviews und weitere Telefonate, bereit, weitere entscheidende Informationen zu empfangen oder zu geben.
Politik machen, dachte ich, ist zwar eine großenteils abstrakte und verbale Tätigkeit, verlangt aber das psychische und physische Training eines Marathonläufers und eines professionellen Pokerspielers zugleich. Ich konnte verstehen, dass Fabio auf diesem Gebiet gute Resultate erzielte, denn ihm fehlte weder Ausdauer noch Entschiedenheit. So war er schon als Kind, wenn er sich auf dem Spielplatz oder am Strand leicht hinter mir hielt und aus der Distanz die anderen Kinder beobachtete, um herauszufinden, wer für und wer gegen ihn sein könnte, noch bevor er mit ihnen in Verbindung trat. Einen größeren Bruder zu haben hatte ihn davor bewahrt, sich sofort ins Getümmel stürzen zu müssen, und ihm einen Spielraum gelassen, um sich zu wappnen und Strategien zu erarbeiten.
Sein Sohn Tommaso lümmelte immer noch auf der Couch vor dem riesigen Bildschirm. Fabio sagte: »Hey, wie geht’s?«, den Blick zum Bildschirm statt zu seinem Sohn gewandt. Der Sohn brummte etwas zum Gruß, so ähnlich wie vorher bei mir.
[35] Fabio sagte: »Entschuldige vielmals, aber wir müssen jetzt die Nachrichten sehen.« Er nahm die Fernbedienung und schaltete um, vom Satellitenkanal zum ersten Programm des staatlichen Fernsehens, wo man Bilder von dem Schnee- und Kälteeinbruch in Mittelitalien sah, der die Verbindung zwischen Norden und Süden beinahe lahmgelegt hatte.
Tommaso sagte überraschend deutlich: »Gib sie wieder her!«, sprang auf und riss ihm die Fernbedienung aus der Hand.
»Spinnst du?«, antwortete Fabio in zu gedehntem Tonfall, als dass er etwas hätte bewirken können.
Tommaso schaltete zurück zum Fußballspiel auf dem Satellitenkanal, machte es sich wieder zum Zuschauen bequem.
Fabio schnauzte ihn an: »Gib her, dein Vater muss viel wichtigere Dinge anschauen!«
Vater und Sohn rangen um die Fernbedienung: Der Vater hatte den Vorteil, größer zu sein, der Sohn dagegen war gelenkiger. Mich beeindruckte, dass sie wirklich gar keinen körperlichen Spaß an ihrem Kampf hatten: Beide hatten die gleiche Entschlossenheit im Blick, die gleiche Art, die Brauen zu runzeln und die Kiefer zusammenzubeißen und wütend mit Händen und Armen zu rudern, aber ins Leere. Mein Neffe trat außerdem mit seinen großen Füßen in den aufgeschnürten Techno-Sneakern um sich; irgendwann traf er meinen Bruder am Kopf.
Fabio fasste sich mit der Hand an die Stirn und wich zurück: »Sag mal, ist dir klar, was du deinem Vater angetan hast?«
[36] Angeödet ließ Tommaso die Fernbedienung auf die Couch fallen. Fabio hob sie auf, konnte aber vor Empörung das richtige Programm nicht finden. »Außerdem ist dein Großvater gestorben, aber das ist dir ja sowieso scheißegal!«
Nicoletta trat ein. Sie hatte einen Hosenanzug angezogen, wieder ganz im Stil eines groß gewordenen braven Schulmädchens. »Was ist denn los?«, fragte sie.
»Er wollte mich die Nachrichten nicht sehen lassen«, brüllte Fabio.
»Und er wollte mich das Fußballspiel nicht sehen lassen«, brüllte Tommaso.
»Hört jetzt auf mit den Kindereien, alle beide!«, sagte Nicoletta, eine Hand auf Fabios Arm. »Wir können die Nachrichten genauso gut bei uns im Zimmer sehen.«
»Das ist doch absurd!«, sagte Fabio. »Es geht mir ums Prinzip! Die Anmaßung deines Sohnes ist schlichtweg unerträglich geworden! Er benimmt sich wie einer dieser Hooligans aus der Südkurve des Stadions!«
»Er ist doch auch dein Sohn, oder?«, sagte Nicoletta.
»Aber du bist es, die ihn so verwöhnt!«, antwortete Fabio. »Immer gibst du nach! Selbst wenn es grade einen Todesfall in der Familie gegeben hat und man jedes Recht hätte, ein anderes Benehmen zu verlangen!«
Nicoletta legte sich einen Finger auf die Lippen, als wollte sie sagen, man solle vor dem Jungen nicht über diese Dinge sprechen.
»Siehst du? Siehst du?«, ereiferte sich Fabio, hatte aber schon aufgegeben: Er reichte die Fernbedienung Nicoletta, die sie Tommaso zurückgab, der sofort wieder auf sein Fußballspiel umschaltete.
[37] Nicoletta verließ das Wohnzimmer, Fabio sah auf die Uhr und folgte ihr; mir bedeutete er mitzukommen.
In ihrem Schlafzimmer sahen wir erst auf einem Fernseher von normaler Größe noch mehr Bilder von Naturkatastrophen, dann kam die Politik. Fabio erstarrte, mit einer Handbewegung brachte er uns zum Schweigen. Es begann eine Art hektischer Reigen von Politikern, die Erklärungen abgaben, erst das eine Bündnis, dann das andere, je einer pro Partei, alle umgeben von einem Wald aus Mikrophonen, die ihnen von drängelnden Journalisten entgegengestreckt wurden, als könnten sich ihre Worte auf die Geschicke der ganzen Welt auswirken. In den meisten Fällen wurden ihre Stimmen durch eine rasche, gewissenhafte Zusammenfassung des Studiosprechers ersetzt, doch bei zwei oder drei Politikern wurde der Originalton beibehalten. An einem bestimmten Punkt sah man Fabio, der mit direkt in die Kamera gerichtetem Blick und im Ton standfester Gelassenheit noch einmal die Position des Mirto Democratico zu der betreffenden Frage erläuterte. Hinter und neben ihm drängten sich ein halbes Dutzend Personen ins Bild, die ins Leere starrten und leise mit dem Kopf wackelten, als Zustimmung zu Fabios Worten oder vielleicht nur wegen des hypnotischen Effekts der Kamera.
Ich fragte: »Wer sind die?«
»Wer?«, fragte Fabio zurück, viel zu sehr mit seinem eigenen Bild beschäftigt, um noch andere Signale aufzunehmen.
Eine Sekunde später war der hektische Reigen von Erklärungen aller politischen Repräsentanten Italiens beendet. Auf dem Bildschirm erschien der Petersplatz mit [38] herumstehenden Gruppen von Gläubigen, und gleich danach der Papst, der in seinem harten deutschen Akzent systematisch die nicht durch den Bund der Ehe geheiligten Lebensgemeinschaften und die Ansprüche der homosexuellen Paare und die kriminelle Anmaßung derjenigen geißelte, die auf welche Weise auch immer die Vermehrung neuen gottgewollten Lebens zu behindern suchten.
Fabio sah Nicoletta an: »Wie war ich?«, fragte er.
»Gut«, erwiderte sie. »Gut.« Sie reichte mir einige Fotos, die auf einer Kommode lagen: Sie beide lächelnd am Steuer eines Segelbootes in einer winterlichen Bucht.
»Wo wart ihr?«, fragte ich.
»Am Argentario«, sagte Nicoletta. »Ermino Kovanich hat die Aufnahmen gemacht, für Navigare. Sie geben uns fünf Seiten in der Januar-Nummer.«
»Habe ich nicht zu starr geradeaus geschaut?«, fragte Fabio, immer noch zum Bildschirm gewandt.
»Nein«, sagte Nicoletta. »Besser geradeaus als den Kopf hin und her drehen wie ein Roboter.« Ihre Worte kamen automatisch, als schöpfte sie aus einem Vorrat früherer Ermutigungen, um jeden Zweifel, jede Unsicherheit ihres Mannes auszuräumen, ohne wirklich darüber nachdenken zu müssen.
Fabio wurde nun per SMS und mit Anrufen auf dem Handy mit Kommentaren zu seinem kurzen Auftritt bombardiert. Er antwortete, im Zimmer auf und ab gehend, dann ging er auf den Flur, indem er sagte: »Danke. Ja. So lala. Dir auch, dir auch.«
Nicoletta warf mir einen nicht leicht zu deutenden Seitenblick zu, machte eine halbe Drehung, als wollte sie mir [39] den Weg zur Tür abschneiden. Ich kam ihr zuvor und verließ das Zimmer als Erster. Vielleicht zum Ausgleich überholte sie mich im Flur mit den Worten: »Ich sehe mal nach Tommasos Abendessen, wenn der nicht früh genug isst, geht er überhaupt nicht mehr schlafen.«
[40]