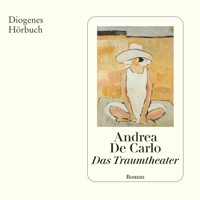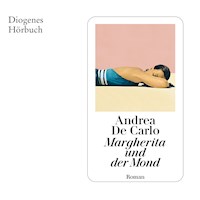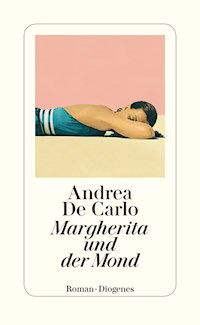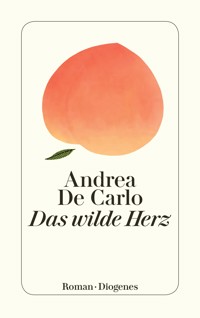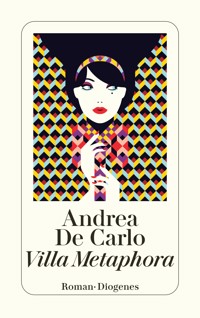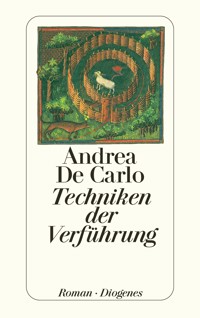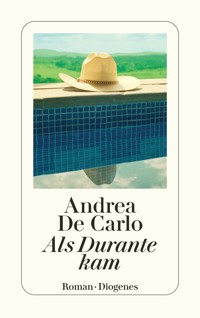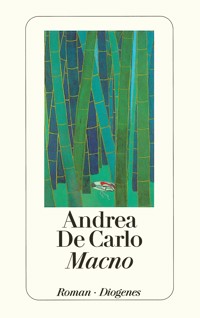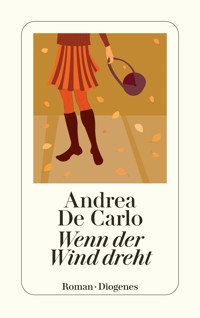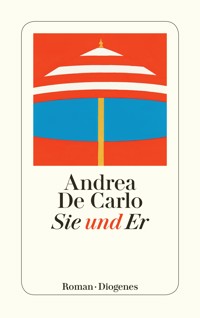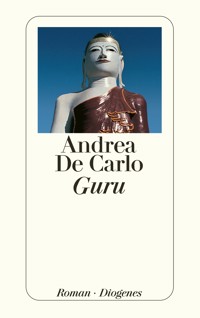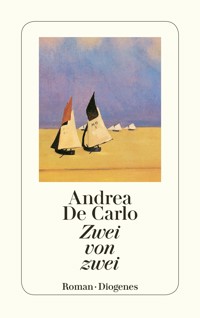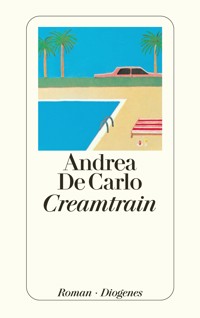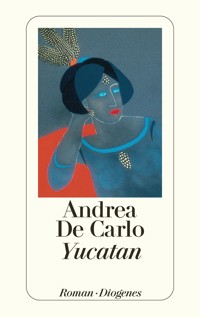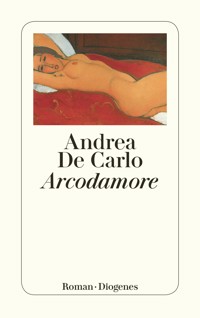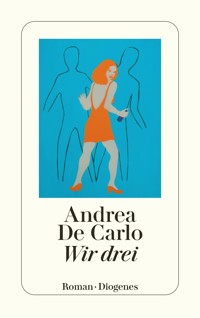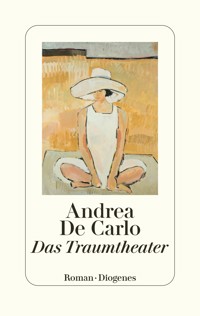
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Veronica droht in einem Café an einem Stück Brioche zu ersticken. Kaum ist sie wieder zu Atem gekommen, lässt ihr Retter durchblicken, dass er eine wichtige historische Stätte entdeckt hat, gleich hier in der italienischen Stadt Cosmarate – eine willkommene Story für die Fernsehfrau. Die Sensation des antiken Theaters zieht schnell weite Kreise, ruft Politik und Wissenschaft auf den Plan. Bis der Traum vom Theater platzt und alle ihr blaues Wunder erleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Andrea De Carlo
Das Traumtheater
Roman
Aus dem Italienischen von Petra Kaiser
Diogenes
Eins
Würde man Veronica Del Muciaro nach ihrer größten Angst fragen, würde sie garantiert sagen, am meisten fürchte sie sich davor, den richtigen Augenblick zu verpassen. Bis Mitte zwanzig hatte sie davon nämlich schon eine Unmenge verpasst: Millionen Momente, die ohne jede Vorwarnung plötzlich wie aus dem Nichts auftauchten und dann so blitzschnell vorbeirauschten, dass sie gar nichts davon mitbekam, geschweige denn sie zu nutzen vermochte.
Aber mit fünfundzwanzig kam dann endlich der Durchbruch. Wann genau, weiß sie gar nicht mehr, sie kann sich an kein spezielles Ereignis mehr erinnern: Irgendwann hatte sie es einfach satt, dauernd fassungslos dazustehen und sich zu grämen, weil sie auf eine Bemerkung, einen Blick, eine sich bietende Gelegenheit wieder einmal nicht schnell genug reagiert hatte. Bis dahin war sie durch tausend Unsicherheiten gehemmt, durch die Erwartungen der Eltern, die Angst, verurteilt zu werden; in der Schule, um nur ein Beispiel zu nennen, stotterte sie. Heute, wo sie in ihren Livereportagen für Tutto qui! losrattert wie ein Maschinengewehr und perfekt artikuliert, kann sich das gar keiner mehr vorstellen. Dennoch war dieses Stottern für sie lange Zeit eine Quelle unsäglicher Erniedrigung. Es reichten wenige Zuhörer, drei oder vier Mitschüler, gar nicht mal die ganze Klasse, und schon verhedderte sie sich, die Worte stockten und kamen nur ruckartig heraus. Deshalb wurde sie nicht nur von ihren Mitschülern aufgezogen, sondern auch von den Lehrerinnen, später auch von den Profs. »D-d-del Mu-mu-mu-cia-ro«, sagten sie. »Mu-mu-mu!« Superwitzig, schallendes Gelächter. Wenn so etwas heute passierte, würden die Eltern gleich zum Anwalt laufen und die Presse einschalten, der Vorfall käme in die Zeitung und ins Fernsehen. Roberta Riscatto beispielsweise würde so einen Fall sofort aufgreifen, sie zu einer Livereportage losschicken und Psychologen, Soziologen und Logopäden ins Studio einladen. Die Schulleitung müsste die Mitschüler rügen, sich von den Lehrern distanzieren und sich öffentlich entschuldigen. Aber damals, kein Gedanke; natürlich war sie auch nicht nach Hause gelaufen, um gleich alles zu erzählen, denn sie schämte sich, als wäre es ihre Schuld. Zum Glück fand sie selbst die Lösung, ohne fremde Hilfe: einfach loslegen, statt wie gelähmt zuzusehen. Die Methode war simpel: Sag einfach, was dir gerade einfällt, nicht lange überlegen, nicht erst nach den richtigen Worten suchen. Die kommen dann von ganz allein. Bloß keine Hemmungen, vergiss, was andere wohl davon halten, pfeif auf die Folgen. Stell einfach eine unbequeme Frage, ein bisschen heikel vielleicht, hau irgendeinen frechen Spruch raus, schneid eine Grimasse, äff jemanden nach, wirf die Haare zurück, ganz egal, Hauptsache Action. Und keine Einstellung länger als ein paar Sekunden: dauernd wechseln, ungeduldig sein, aufdringlich. Lauf herum, beweg dich. Und es funktionierte, wenn auch vielleicht nicht in allen Lebensbereichen; jedenfalls verpasste sie nun keinen Augenblick mehr, so viel war sicher.
Man braucht sie nur anzusehen, wie sie jetzt an diesem kalten Morgen, der so kalt gar nicht ist, schließlich haben wir den ersten Januar, das älteste Café im Zentrum von Suverso betritt, noch halb benommen von dem enttäuschenden Silvesterabend in Mailand und der nächtlichen Rückfahrt in ihrem Mini mit Vollgas. Man braucht nur ihr Spiegelbild an der Wand hinter dem Tresen anzusehen, während sie den Blick über die Auslagen schweifen lässt: Die Haare haben den richtigen Blondton, etwas dunkler am Ansatz und nach unten heller, die Ringe unter den Augen sind angesichts der Umstände minimal, der schwarze Pashmina-Schal ist weich und flauschig, die silberne Daunenjacke schön eng in der Taille, die schwarze Stretchhose umspannt formvollendet die Beine, die Stiefel mit hohen Absätzen machen zwar nicht größer, geben aber Schwung. Natürlich ist sie nicht mehr zwanzig, sieht aber immer noch gut aus, das bestätigen auch die wohlgefälligen Blicke der Männer, als sie sich über die Theke beugt, um der Bedienung mit Schürze und Häubchen die Brioche mit Creme und Puderzucker zu zeigen, die sie sich ausgesucht hat. Dann eine halbe Drehung, um beim Barista einen Cappuccino zu ordern, dabei entgehen ihr auch nicht die Blicke einiger Frauen, die sie erkannt haben, eine unterschiedlich dosierte Mischung aus Bewunderung, krankhafter Neugier, Widerwillen, Neid.
Sie holt das Handy heraus, schaltet die Selfie-Funktion ein, wählt wie immer den Filter soft focus; sie neigt leicht den Kopf, sieht das Lächeln, das bei dieser Beleuchtung fast strahlend wirkt, öffnet ihr Social-Media-Profil. Sie nimmt das Handy in die linke Hand, streckt die rechte aus, um die Brioche zu nehmen, tunkt die Spitze in den Cappuccino, setzt ein komisches Gesicht auf. »Da wären wir also, am ersten Tag des neuen Jahres!« Sie beißt ein ordentliches Stück ab, kaut aber kaum, um auf keinen Fall das Lächeln zu gefährden und womöglich wie ein Mümmelweib auszusehen. Sie hat noch einen weiteren Filter eingeschaltet, der über ihrem Kopf automatisch ein goldenes Krönchen mit dem Schriftzug 2020 einblendet. Na ja, ein bisschen kindisch vielleicht, aber inzwischen machen das alle ihre Kolleginnen und die Hälfte der männlichen Kollegen, sogar ihre Mutter. Na und, was ist denn schon dabei, wenn man sich ein bisschen aufhübscht und die Nachricht ein bisschen witziger macht? Nichts, absolut gar nichts. Aber jetzt ist ihr der unzerkaute Bissen in der Speiseröhre hängen geblieben und rutscht nicht runter, sodass sie kaum noch lächeln kann. Sie versucht ihn runterzuschlucken, aber es geht nicht, sie versucht ihn wieder hochzuholen, aber auch das klappt nicht: Schlagartig wird ihr klar, dass sie im Begriff ist zu ersticken, vor all den Leuten, wie kann man nur so blöd sein.
Erschrocken weicht sie ein paar Schritte zurück, versucht sich zu beruhigen, versucht den Brocken runterzuschlucken oder ihn wieder herauszuwürgen, in die Papierserviette, aber keine Chance, sie bekommt keine Luft mehr, fängt an zu japsen, gerät in Panik. Während ihr Kopf sich mit den Gesichtern all der Menschen füllt, über deren schreckliches Ende sie vom jeweiligen Unfall-, Unglücks- oder Tatort berichtet hat, taumelt sie in Panik durch das älteste Café von Suverso.
Das Schlimmste an der Situation, abgesehen von dem Gefühl zu ersticken und sich schon als Leiche am Boden liegen zu sehen, ist, dass die anderen Gäste reglos dasitzen mit demselben Ausdruck von Bewunderung, krankhafter Neugier, Widerwillen oder Neid wie zuvor. Vielleicht können sie die Verzweiflung in ihren Bewegungen und die wachsende Panik in ihren Augen nicht erkennen, vielleicht denken sie aber auch, dass eine Fernsehreporterin, die auf Skandale und Verbrechen spezialisiert ist, mehr oder weniger unsterblich sei.
Veronica lässt Brioche und Handy fallen, reißt sich den Pashmina-Schal vom Hals, torkelt mit den Händen am Hals herum, und noch immer denkt niemand daran, etwas zu unternehmen. Beispielsweise die ältere Dame mit Nerzmantel und bläulich schimmernden Haaren, oder die Fünfzigjährige im Collegelook mit Strassreif im Haar, oder der große dünne Typ mit Brille, der aussieht wie ein Spion aus den Sechzigerjahren, oder der Fettwanst, der seinen Kamelhaarmantel fast zum Platzen bringt, oder die beiden aufgetakelten Freundinnen mit identischen Kaninchenaugen, oder der junge Mann mit Stachelfrisur neben der Mutter in schwarzer Designer-Lederjacke mit Nieten. Mit ihrem beschissenen Anstandsgetue, bigott und voller Argwohn, typisch für das gutbürgerliche Suverso, sitzen alle nur da und glotzen, als würde hier ein Theaterstück aufgeführt, nur für sie. Auch der Barista und die Frau hinter der Theke scheinen eher neugierig als besorgt, während sie verzweifelt nach Luft schnappt, ihr Herz rast und das Blut gefriert, ihr die Tränen in die Augen steigen, angesichts dieses bevorstehenden unglaublich dämlichen und erniedrigenden Endes vor einem Dutzend Unbekannter, die glauben, sie zu kennen, weil sie ihre Berichte auf Tutto qui! gesehen haben.
Plötzlich spürt sie einen heftigen Stoß im Rücken, einen Griff um die Taille und einen Druck auf das untere Ende des Brustbeins, dabei wird sie so heftig geschüttelt, dass die Füße vom Boden abheben. Am liebsten würde sie laut protestieren, um das demütigende Schauspiel nicht noch schlimmer zu machen, aber es geht nicht, und wer immer es ist, der sie packt, schüttelt und hochhebt, macht energisch weiter, bis sie spürt, wie das festsitzende Stück Brioche wundersamerweise freikommt, durch die Kehle nach oben rutscht und aus dem Mund herausschießt. Unglaublich, aber plötzlich kann sie wieder atmen, die Lunge mit Luft füllen! Sie hustet, schluckt, bewegt sich mit einem berauschenden Gefühl der Erleichterung, das durch den ganzen Körper fließt und in den Kopf steigt wie Alkohol. Sie dreht sich um, kann endlich ihrem Retter ins Gesicht sehen.
Der Mann hat einen eindringlichen Blick, graugesprenkelte unordentliche Locken, trägt einen herrlich weich fließenden schwarzen Mantel, einen Seidenschal in Violett und Orange, verschmutzte Reitstiefel. Eine eigentümliche Mischung aus Eleganz und Härte, Ruhe und Spannung: ziemlich verwirrend, in diesem ohnehin schon reichlich unsicheren Moment.
»Da-da-danke!« Veronica Del Muciaro merkt, wie sie sich wieder verhaspelt, aber ihr Atem geht immer noch schwer und das Herz klopft heftig, auch wenn sich beides langsam normalisiert. Sie setzt ein Lächeln auf, dreht sich zu den anderen Gästen um, auch die Koordination der Bewegung läuft nicht optimal, und zeigt ihren Retter diesen ignoranten Gaffern, die ihr gerade noch tatenlos beim Ersticken zugesehen haben und jetzt fast enttäuscht wirken, weil ihnen die Neujahrstragödie entgangen ist. »D-d-der Herr hier hat mir d-d-das Leben ge-gerettet!« Die Stimme kommt stockend, aber vielleicht ist das ja unter diesen Umständen auch normal. Sie klatscht in die Hände, um alle zu einem Applaus aufzufordern; aber nur der junge Mann mit der Stachelfrisur und seine Mutter in der Lederjacke stimmen ein. Dafür bringt der Barista ihr ein Glas Wasser, wenigstens etwas.
Sie trinkt einen großen Schluck, wischt sich die Tränen aus den Augen, fasst sich an den schmerzenden Hals. Natürlich ist die Wimperntusche verlaufen, doch das gibt dem Ganzen einen hübsch dramatischen Anstrich. Auch das Brustbein und die Rippen, wo ihr Retter sie so energisch und entschlossen gepackt, gedrückt und geschüttelt hat, tun weh.
Ihr Retter bückt sich, sammelt Handy und Schal vom Boden auf und reicht sie ihr.
»T-t-tausend D-dank!« Sie hebt die Stimme, um sich von dem peinlichen Vorfall zu distanzieren und zugleich den anderen Gästen vor Augen zu führen, dass sie, wäre es nach ihnen gegangen, jetzt mausetot wäre, aber die Aussprache ist immer noch grauenhaft, wie peinlich.
»Keine Ursache.« Seine Bemerkung klingt höflich, aber auch ein wenig schroff, vielleicht ist ihr Retter ja schüchtern, vielleicht aber auch das Gegenteil. Er zeigt auf einen freien Tisch. »Vielleicht sollten Sie sich kurz hinsetzen.«
»D-d-darf ich Ihnen we-we-wenigstens etwas b-b-bestellen?« Wieder verhaspelt sie sich, wie peinlich, hoffentlich ist das bald vorbei.
»Nein, danke.« Wieder ziemlich schroff.
Sie setzt sich, legt sich wieder den Pashmina-Schal um, kontrolliert, ob das Handy beim Runterfallen kaputtgegangen ist: Nein, alles in Ordnung, zum Glück hat die durchsichtige Plastikhülle mit den Sternchen ihren Zweck erfüllt.
»Also dann, ich muss jetzt gehen, auf Wiedersehen, und alles Gute.« Ihr Retter hält ihr die Hand hin.
»N-n-nein, bitte bleiben Sie doch noch, setzen Sie sich doch einen Augenblick zu mir!« Sie deutet auf den freien Stuhl, doch jetzt macht ihr dieses posttraumatische Stottern fast mehr Angst als der Erstickungsanfall zuvor: Plötzlich sind all die alten Ängste wieder da und verdrängen im Nu die Erleichterung angesichts der überstandenen Gefahr.
Er setzt sich, wenn auch widerwillig.
Um auf diesen Rückfall ins Stottern zu reagieren, nimmt sie das Handy, streckt den rechten Arm so weit wie möglich von sich und rückt lächelnd an ihren Retter heran. »Uff, das war knapp, gerade noch gerettet von diesem Herrn hier, ein echter Schutzengel!« Zweites Wunder: Die Worte kommen flüssig, zackig und deutlich artikuliert!
Ihr Retter sieht sie verständnislos an. »Verzeihung, was machen Sie denn da?«
»Ein kleines Video!« Sie richtet sich die Haare, lächelt erneut.
»Für wen?« Ihr Retter wirkt zu dreißig Prozent neugierig, zu siebzig genervt, auch wegen der anderen Gäste, die jetzt ebenfalls ihre Handys gezückt haben und die Szene filmen.
»Für meine Follower!« Ohne den Blick vom Handy abzuwenden, legt sie ihm vertraulich die Hand auf den Arm (gilt als ausgesprochen hilfreich, um widerspenstige Gesprächspartner zum Reden zu bringen). »Dürfen wir vielleicht erfahren, wie er heißt, dieser Herr, der sich so großartig geschlagen hat?«
»Guiscardo Guidarini, aber hören Sie auf zu filmen.« Offenbar versteht ihr Retter nichts von diesen Dingen, denn statt ins Objektiv sieht er sie an.
»Guiscardo, wow!« Ungerührt geht sie über seine Bitte hinweg, hält ihm, halb naives Mädchen, halb verführerische Frau, die schon viel erlebt hat, die Hand hin. »Veronica Del Muciaro. Angenehm.«
Auch als er den Namen hört, erkennt er sie nicht, anscheinend gehört er zu jener Minderheit der Italiener, die sie noch nie im Fernsehen gesehen haben. Er drückt kräftig ihre Hand, zeigt aber sofort wieder auf das Handy. »Würden Sie das jetzt bitte ausmachen?« Er hat eine schöne Stimme, einen leicht fremdländischen Tonfall; konnte man sich ja denken, bei dem Namen, ganz normal war der sicher nicht.
»Aber Signor Guiscardo, das ist doch nur für meine Follower!« Veronica Del Muciaro hält den rechten Arm weit ausgestreckt und achtet sorgfältig darauf, dass sie beide gut zu sehen sind.
»Ist mir egal, für wen das ist, bitte schalten Sie das jetzt ab.« Er hält sich die Hand vors Gesicht und bedeckt die Augen.
»Nicht aufregen, Signor Guiscardo!« Dass einer partout nicht gefilmt werden will, kommt ausgesprochen selten vor, einer von hundert höchstens, die absolute Ausnahme, aber sie weiß genau, wie man damit umgeht. Sie sieht ihn flehend an, quengelt ein bisschen wie ein nass gewordenes Küken. »Es ist nur, um den Schock zu überwinden! Nur dreißig Sekunden, bitte!«
»Ich rege mich nicht auf, es stört mich einfach.« Wieder die schroffe Höflichkeit. »Ich finde es lächerlich.«
»Und was machen Sie beruflich, Signor Guiscardo? Außer Damen in Schwierigkeiten zu retten?« Erneut ignoriert sie seinen Protest, versucht einen unverfänglichen Ton anzuschlagen.
»Ich bin Archäologe.« Er sagt es nur widerstrebend, sieht dabei zur Tür.
Sie reagiert übertrieben, aber ein bisschen überrascht ist sie. »Wow, Archäologe!«
»Ja.« Er wendet sich zur Kasse, scheint kurz davor, aufzustehen.
»Was für ein interessanter Beruf!« Veronica drückt seinen Arm, um ihn im Bild zu halten. »Erforschen Sie ägyptische Pyramiden, geheimnisvolle Tempel?«
»Kommt drauf an.« Ein bisschen aufgeschlossener könnte er ruhig sein, aber offenbar gehört er in die Kategorie des scheuen Helden, der daran gewöhnt ist, unter widrigsten Bedingungen zu arbeiten, hartnäckig und wild entschlossen. Mit diesem bohrenden Blick macht er jedenfalls einen hartnäckigen und wild entschlossenen Eindruck.
»Und haben Sie schon mal eine bedeutende Entdeckung gemacht?« Vielleicht kann sie die Episode mit ihrem Fast-Ersticken und der folgenden Rettung ja sogar in der Sendung unterbringen, wenn es ihr gelingt, Roberta Riscatto die Sache schmackhaft zu machen.
»Die eine oder andere.« Seine Lust, davon zu erzählen, tendiert gegen null, aus natürlicher Bescheidenheit oder warum auch immer.
»Zum Beispiel? Können Sie mir vielleicht eine nennen?« Veronica drängt ihn, denn an diesem Punkt kann es leicht passieren, dass Livezuschauer die Lust verlieren.
»Lieber nicht.« Er hat absolut keine Lust, irgendein Detail zu verraten, nicht die geringste.
»Eine einzige nur, Signor Guiscardo!« Sie drückt seinen Arm noch fester, rückt noch näher an ihn heran, lächelt.
Er versucht sich loszumachen, schüttelt den Kopf.
»Bitte, Signor Guiscardo!« Eigentlich müssten die Blässe einer, die gerade dem Tod entkommen ist, und das tränenverschmierte Make-up helfen, ihn zu erweichen. »Erzählen Sie mir doch wenigstens von Ihrer letzten Entdeckung!«
»Na ja, dafür musste ich jedenfalls nicht weit reisen.« Jetzt antwortet er, wenigstens etwas, und lächelt: Seine Zähne sind in tadellosem Zustand.
»Wo war das?« Veronica Del Muciaro kneift die Augen zusammen, um Aufmerksamkeit zu zeigen.
»Das möchte ich nicht sagen, tut mir leid.« Er schüttelt erneut den Kopf.
»Aber Sie müssen es mir sagen! Bitte, Signor Guiscardo!« Sie bedrängt ihn, inzwischen ist es eine Frage des Prinzips.
»Nein.« Mit wachsender Ungeduld dreht er sich zu den anderen Gästen um, die sie anstarren.
»Dann sagen Sie mir wenigstens, in welcher Provinz, Signor Guiscardo. Ich flehe Sie an!« Gleichzeitig versucht sie festzustellen, ob an der Geschichte mit der Entdeckung etwas dran ist, natürlich kann sie hier und jetzt nichts überprüfen, aber Gesicht und Stimme wirken authentisch. Vor allem die Weigerung, darüber zu reden.
»Hier, in dieser Provinz.« Das klingt jetzt fast provokativ.
»Wahnsinn! In der Provinz Suverso! Und darf man fragen aus welcher Epoche?« Mühelos schaltet Veronica Del Muciaro jetzt auf typisches Reportergefasel um, eine ungute Mischung aus »Sensationsgier, Schadenfreude und einer gehörigen Portion Unverfrorenheit«, die von Flavio Scuffi letzten Oktober in seiner TV-Rubrik Televedendo schonungslos kritisiert wurde.
»Na ja, ein paar Jährchen hat sie schon auf dem Buckel.« Wieder schaut er zur Tür.
»Stammt sie vielleicht aus römischer Zeit?« Sie versucht ihm klarzumachen, dass sie durchaus weiß, was eine archäologische Ausgrabung ist.
»Nein.« Er mauert, scheint erneut kurz davor aufzustehen.
»Älter, jünger? Wenigstens ungefähr, nur um einen Anhaltspunkt zu haben.« Jetzt zieht Veronica Del Muciaro das Register für die schwierigsten Fälle. Klar, immerhin hat der Herr hier ihr gerade das Leben gerettet, aber auch Rücksicht hat ihre Grenzen.
»Ein paar Jährchen, habe ich doch schon gesagt. Und jetzt machen Sie endlich das Ding aus!« Je mehr sie insistiert, desto weniger rückt er mit der Sprache heraus: echt nervtötend, aber irgendwie auch ziemlich reizvoll. Sonst hat sie nämlich nur mit Leuten zu tun, die sofort die intimsten Dinge erzählen, sobald sie gefilmt werden.
»Sie sind wirklich unmöglich, wissen Sie das?« Wenn das hier eine echte Liveschalte wäre, müsste sie jetzt noch eins drauflegen, um ihn zu nötigen, alles zu sagen. »Und wie kommt es dann, dass niemand in der Provinz etwas davon weiß?«
Er zuckt die Schultern und lächelt dann wieder. »Denken Sie an Angkor Wat in Kambodscha, oder an Palenque in Mexiko, die waren auch Jahrhunderte verschwunden und wurden dann wiederentdeckt. Und das waren ganze Städte.«
»Sicher, aber das war mitten im Dschungel, nicht wahr?« Ganz sicher ist sie zwar nicht, meint aber, sich vage zu erinnern.
»Hier gibt es dafür Unachtsamkeit, Ignoranz, Vernachlässigung.« Er schüttelt bedächtig den Kopf, schaut weg. »Generationen gleichgültiger, desinteressierter Familien, Generationen unredlicher, unfähiger Verwaltungen. Das ist entschieden schlimmer als der Dschungel.«
»Jetzt machen Sie mich aber richtig neugierig, Signor Guiscardo!« Sie versucht es noch mal: Nie klein beigeben, das war ein Grundzug ihres Wesens, mehr noch als ihrer Berufsauffassung. »Geben Sie mir wenigstens einen Tipp! Kalt oder warm! Bitte!«
Er steht auf, reicht ihr die Hand. »Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Und keine Videos mehr beim Essen. Und auch nicht, wenn Sie mit Unbekannten reden.«
Das war’s, schon ist er aus dem Bild. Womöglich hat es ihn verstimmt, eine Unbekannte retten zu müssen, wo er doch nur einen Kaffee trinken wollte; aber vielleicht ist er immer so: ein interessanter Typ, aber ein miserabler Interviewpartner.
Zwei
Massimo Bozzolato, Bürgermeister von Cosmarate di Sopra e di Sotto, sitzt in seinem Büro im ersten Stock des Palazzo Podarengo am Schreibtisch und ist gerade dabei, sich zum dritten Mal das Video der unerhörten Protestaktion anzusehen, die er beim großen Silvesteressen über sich ergehen lassen musste, inszeniert von diesen Flegeln vom sogenannten Breitband©. Eine richtige Sauerei, und alles nur, weil der Polizeikommandant Covazzani, dieser Sesselfurzer, vergessen hatte, am Eingang ein paar Uniformierte zu postieren, und selbst dann noch nicht eingriff, als diese Penner den Saal stürmten und Parolen grölten wie »Unser Geld für Fressgelage, Bozzolato ist ne Plage!«, oder »Spekulation grassiert wie toll, Bozzo kriegt den Hals nicht voll!« Und das ausgerechnet ihm, der den Beginn seiner politischen Karriere damit verbracht hatte, den korrupten, verfilzten Vertretern der traditionellen Parteien fast dieselben Parolen entgegenzuschleudern. Ihm wurde abwechselnd heiß und kalt, heiß vor Zorn und kalt wegen des unabsehbaren politischen Schadens. Wann hatte sich denn das Rad gedreht, er wunderte sich, wie schnell man vom Kritiker zum Kritisierten werden konnte.
Außerdem nervt ihn dieses anhaltende toc toc toc, das ihm zunächst zum Geschrei der Protestierenden zu gehören scheint, doch bei genauerem Hinhören merkt er, dass es von der Tür kommt.
»Wer ist da?« Seine Stimme klingt wie ein Reibeisen, aber wer wollte unter diesen Umständen eine Samtstimme erwarten.
»Ich bin es, Herr Bürgermeister!« Es ist Enzo Lovato, sein Stadtrat für Urbanistik, der schon den Kopf durch die Tür steckt, schon drin ist.
Auch hier gibt es, wie man sieht, keinerlei Schutz, und das, obwohl er dieser affig gekleideten Sonia, seiner Sekretärin, schon tausendmal gesagt hat, sie soll jeden, der zu ihm will, erst ankündigen, bevor sie ihn reinlässt. Aber nichts zu machen: Jeder ausgeflippte Breitbändler könnte hier ungehindert reinschneien, um ihn erneut zu beschimpfen, sogar irgendein Verrückter mit Messer, nichts würde sie aufhalten.
Schon steht Lovato vor dem Schreibtisch und reckt den Hals, um auf sein Handy zu sehen. »Was siehst du dir da an?«
»Nichts.« Bozzolato schließt die Datei.
»Das Silvesteressen?« Seine Augen glitzern boshaft hinter der runden Brille. Er ist der Aufdringlichste und Unverschämteste aus dem Gemeinderat: Ihn sollten sie mal lieber aufs Korn nehmen, diese Breitband©-Fanatiker.
»Hm.« Bozzolato denkt gar nicht daran, irgendwas mit ihm zu teilen, er hat ihm schon vorher nicht getraut, und jetzt erst recht nicht.
»Das war wirklich gemein.« Lovato mimt den Verständnisvollen, reichlich spät. »Vielleicht sollte man eine Stellungnahme abgeben, im Namen des gesamten Gemeinderates.«
»Das wäre schon gestern fällig gewesen.« Bozzolato bemüht sich, möglichst sarkastisch zu klingen. »Vor allem von dir, wo du doch die Baugenehmigungen erteilst.«
»Aber an Neujahr hätte das sowieso niemand mitbekommen.« Natürlich hat Lovato eine gute Ausrede parat. »Gerade dir solche Vorwürfe zu machen. Das sind doch alles nur nichtsnutzige Muttersöhnchen.« Die Empörung nimmt man ihm nicht ab, denn wenn einer davon profitiert, was auf Gemeindegebiet gebaut wird, dann er.
»Genau.« Bozzolato war vor zwei Jahren gewählt worden, nach einem knallharten Wahlkampf gegen die moralische Verkommenheit und Unfähigkeit der vorigen Amtsinhaber. Am Ende hatten die wirklich jeden vergrätzt, egal welcher Couleur, überall im Land herrschte grenzenloser Verdruss. Aber ihm waren die Wähler gefolgt, er hatte es geschafft, die Verbitterung über die traditionellen Parteien zu kanalisieren und ein Abdriften in gefährliche Formen der Politikverdrossenheit zu verhindern. Dazu hatte ihm der Vorstand der Wende® persönlich gratuliert. In einer Glückwunschmail nicht aus Rom, sondern aus Mailand, direkt von der Gusmondi LLC, der Eigentümerin der Marke. Auch die lokale Presse hatte ein paar wohlwollende Artikel gebracht, darin wurde er als unbelasteter politischer Neuling bezeichnet, der es geschafft habe, die verkrustete Machtstellung der alten Parteien hinwegzufegen, mit der simplen, aber zündenden Parole von Sauberkeit, Sauberkeit und noch mal Sauberkeit! Einer der, bevor er Bürgermeister wurde, Landmaschinen verkaufte und nicht einmal im Traum daran gedacht hätte, in die Politik zu gehen, geschweige denn die Führung der Gemeinde zu übernehmen, in der er geboren und aufgewachsen war, wo seine Eltern, sein Bruder, seine Schwester, seine Schwägerin, sein Schwager, seine Schwiegereltern seit jeher wohnten und arbeiteten.
»Verwöhnte Schnösel, die bloß großspurig daherreden.« Lovato schüttelt den Kopf, kann aber das Glitzern in den Augen nicht verbergen. »Und ein paar unverbesserliche Altkommunisten.«
»Ich weiß.« Keiner wusste das besser als Bozzolato. Die Wende® war eine formidable Gelegenheit, neue Kräfte in ein stagnierendes System einzubringen, all jenen eine Stimme zu geben, die bisher keine hatten. Endlich eine postideologische Kraft, weder rechts noch links, offen für alle. Welche andere Partei hätte so einen wie ihn denn sonst jemals zur Wahl aufgestellt, ohne mehr dafür zu verlangen als die Garantie von ein paar Stimmen (praktisch nur die seiner Familie und von einem Dutzend Freunden)?
Klar, das war natürlich eine tolle Sache, konnte aber auch ganz schnell wieder vorbei sein, da brauchte man sich nur die landesweiten Umfragen anzusehen, oder das unsägliche Tamtam am Silvesterabend hier in Cosmarate. Schuld daran waren einerseits diejenigen, die sich Gott weiß was davon versprochen hatten und jetzt enttäuscht waren, aber auch die, die mithilfe der Wende® unversehens auf Machtpositionen in Rom gelandet waren, aber nicht die leiseste Ahnung hatten, was sie damit anfangen sollten. Ehrlich gesagt fast durchgängig Leute, die vor ihrer Wahl nicht mal eine ordentliche Arbeit hatten, jedenfalls nichts Solides. Die fühlten sich gleich wie die Maden im Speck, fanden augenblicklich Geschmack an schicken Maßanzügen, feinen Hemden und Krawatten, teuren Friseuren, genossen die respektvolle Behandlung, dauernd hieß es Onorevole hier, Onorevole da, und die ungeteilte Aufmerksamkeit der Journalisten, die sie beim Betreten und Verlassen des Parlaments mit ihren Mikrofonen belagerten, während der Kontakt zum Wähler zusehends auf der Strecke blieb. Es war leicht, etwas aufzubauen, aber genauso leicht konnte es wieder zerbröseln. Wie gewonnen, so zerronnen. Abends gehst du noch als König von Italien zu Bett, und am nächsten Morgen liegst du vielleicht schon auf der Straße wie ein Penner.
»Scheiß Breitbändler.« Lovato schüttelt den Kopf. »Oder wie auch immer die sich nennen mögen.«
»Ist doch vollkommen egal, wie die sich nennen.« Am liebsten würde Bozzolato das Gespräch beenden und allein sein.
»Die haben doch gar keine Vorstellung davon, was Politik eigentlich ist.« Lovato lässt nicht locker. »Es ist leicht, große Töne zu spucken, wenn man selbst sich noch nie die Hände hat schmutzig machen müssen.«
»Wie wahr.« Vor ihrem Wahlsieg hatte man ihnen, ehrlich gesagt, genau dasselbe vorgeworfen. Das war erst zwei Jahre her: Es kam einem vor wie gestern, es kam einem vor, als wäre es eine Ewigkeit her.
»Die haben doch überhaupt kein Programm.« Lovato legt die Hände auf die Lehne des Besucherstuhls, um sich selbst zum Platznehmen einzuladen.
»Na gut, was wolltest du mir sagen?« Bozzolato denkt gar nicht daran, den ganzen Vormittag mit Geschwätz über Belangloses zu verbringen, schon gar nicht mit einem, der garantiert nicht zögern würde, ihm bei der erstbesten Gelegenheit in den Rücken zu fallen.
Lovato rückt den Stuhl ab und lässt sich häuslich nieder, unaufgefordert natürlich.
»Mach’s dir ruhig bequem.« Bozzolato setzt alles daran, möglichst gereizt zu klingen.
Aber natürlich merkt der Blödmann gar nichts davon; er holt sein Handy heraus, tippt auf dem Display herum, hält es ihm hin. Zu sehen ist ein reicher Wirrkopf, der leise mit einer blonden Frau spricht, man versteht gar nicht, was sie sagen.
»Wer ist denn das?« Am liebsten würde Bozzolato ihn schnell abwimmeln. Doch andrerseits ist er auch auf ihn angewiesen, denn einen gewissen Rückhalt im Gemeinderat braucht er schon, vor allem jetzt, wo er unter Beschuss steht, da kann er jeden Verbündeten, auch wenn er nicht besonders zuverlässig ist, gut gebrauchen. So ist das halt in der Politik, verdammter Mist!
»Der Herr Marchese Guidarini.« Lovato schlägt einen ironischen Tonfall an. »Du weißt schon.«
»Der, der uns dauernd in den Ohren liegt, damit wir den Spielsalon und andere sogenannte Bausünden abreißen?« Den kennt Bozzolato natürlich, leider.
»Genau der«, bestätigt Lovato. »Den letzten Gemeinderat hat er auch schon in den Wahnsinn getrieben, mit tonnenweise E-Mails, Einschreiben, Petitionen, Eingaben.«
»Und was will er jetzt schon wieder?« Vielleicht, schießt es Bozzolato durch den Kopf, hatten die Eingaben von diesem Guidarini ja auch den blöden Breitbändlern die Munition für ihre Attacken geliefert. Das hatte gerade noch gefehlt, ausgerechnet der verwirrte, idealistische Marchese, der sich als Retter der Colli Cosmaratesi aufspielt.
»Offenbar hat er sich jetzt darauf verlegt, Fernsehreporterinnen zu retten.« Lovato grinst. »Im Netz ist er praktisch zum Helden geworden.«
»Von mir aus, solange er uns in Ruhe lässt.« Bozzolato will vor allem seine Ruhe haben, damit er seinen zweiten Kaffee trinken und sich ungestört noch mal das Video von der unsäglichen Silvesterattacke ansehen kann.
Lovato macht ein skeptisches Gesicht. »Covazzani sagt, dass es an seinem Grundstück bis kurz vor Weihnachten regen LKW-Verkehr gegeben hat.«
»Ja und?« Schon allein beim Namen dieses unfähigen Polizeikommandanten kommt Bozzolato die Galle hoch.
»Das bedeutet, dass der Marchese mit der Ausgrabung weitergemacht hat.« Lovato kratzt sich den Bart, die Augen glitzern hinter den Brillengläsern.
»Was denn für eine Ausgrabung?« Bozzolato traut weder ihm noch Covazzani, die beiden Frettchen, die kannten sich bestens aus und wussten genau, wie sie ungeschoren zum Hühnerhof kamen und wieder zurück in den eigenen Bau.
»Keine Ahnung, ich habe da nur was läuten hören.« Typisch Lovato, erst was behaupten und dann sofort wieder einen Rückzieher machen.
»Na gut, und weiter?« Bozzolato senkt den Blick auf den Schreibtisch, um ihm klarzumachen, dass er zu tun hat, um die Sache abzukürzen.
»Man könnte Covazzani zum Kontrollieren hinschicken.« Umsonst erfährt man von dem gar nichts, immer und überall wittert er ein Geschäft, lässt sich keine Gelegenheit entgehen.
»Hör mal, das scheint mir nicht der richtige Augenblick.« Bozzolato hat schon genug Scherereien am Hals, da braucht er nicht noch was Neues. »Später vielleicht.«
Lovato nickt, ein bisschen enttäuscht vielleicht, aber auch nicht allzu sehr. An Gelegenheiten mangelt es ihm nun wahrlich nicht: Die Gemeinde Cosmarate ist wohlhabend, jede Menge mittlere, kleine und kleinste Unternehmen. Da will immer einer dringend etwas bauen, eine Werkhalle oder ein Lager oder ein Silo oder eine Villa, ohne in den Maschen der Bürokratie hängenzubleiben. Der eine will ein bereits existierendes Gebäude umbauen, eine Etage oder einen Anbau anfügen, einer braucht eine Erschließungsstraße, eine Rampe, eine Garage, einen Pool. Und Lovato, das kann man ruhig so sagen, der findet immer einen Weg, mit gutem Willen lässt sich immer eine Lösung finden. Aus diesen Dingen hält Bozzolato sich raus, weil er langfristig denkt und auch weil er niemandem auf die Füße treten will. Aber richtig sauer wird er, wenn man ihm vorwirft, was andere verbockt haben; das bringt ihn echt auf die Palme.
»Danke jedenfalls für den Hinweis.« Er starrt Lovato an, um ihm klarzumachen, dass das Gespräch beendet ist.
Endlich macht Lovato Anstalten, sich zu erheben, aber seine Augen haben noch immer dieses Glitzern. »Nichts zu danken, Bürgermeister. Schönen Tag noch.«
»Dir auch, tschüs.« Bozzolato wartet, bis er draußen ist, macht eine empörte Geste und drückt sofort die Taste des Sekretariats.
»Sonia, habe ich dir nicht schon hundert Mal gesagt, du sollst jeden Besucher erst ankündigen, bevor er in mein Büro kommt?«
»Aber, Herr Bürgermeister, das war doch nur der Stadtrat!« Nie und nimmer würde die einen Fehler zugeben, die blöde Kuh.
»Aber, aber, aber!« Bozzolato spult sich auf, wie soll man denn da ruhig bleiben? »Aber, aber, aber, verdammt noch mal!« Er steht auf, marschiert auf dem knarrenden Parkett auf und ab. Dann setzt er sich wieder, sieht sich noch einmal das Video der unsäglichen Störaktion vom Silvesterabend an. Unglaublich, was für Slogans sich diese Breitbändler immer ausdachten, und dann diese Reime. Aber bei aller Wut ist er doch verblüfft, wie vertraut alles klingt, alles schon mal da gewesen, alles schon mal selbst erlebt. Auf jeden Fall, so dämmert ihm plötzlich, wird es kein Kinderspiel, die Wende®-Partei dauerhaft zu etablieren, egal, ob mit oder ohne Markenzeichen, denn es gibt immer Leute, die dich kritisieren, weil du nicht radikal genug warst oder nicht schnell genug, Leute, die mehr umkrempeln wollen als du. Doch am Schluss ist alles nur heiße Luft, während du dir hier Tag für Tag die Zähne ausbeißt.
Natürlich hat ihm das Amt auch Befriedigung verschafft. Insbesondere die Wertschätzung der Leute, die man als Vertreter für Landmaschinen sonst nicht so ohne Weiteres bekommt, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber konnte er deshalb darauf hoffen, am Ende seiner Amtszeit wiedergewählt zu werden, vor allem wo die Wende® jetzt auf nationaler Ebene derart schwächelte? Und selbst wenn er wiedergewählt würde, was dann? Noch mal fünf Jahre, aber dann war es endgültig vorbei, denn nach Art. 51 der Gemeindeordnung konnte man nach zwei Amtsperioden nicht wiedergewählt werden, mit Ausnahme von Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern, gemäß Gesetz Nr. 56 vom 7. April 2014 (das kann er inzwischen auswendig, weil er es kürzlich noch einmal nachgelesen hat). Aber Cosmarate di Sopra e di Sotto zählt nun mal 5824 Einwohner, was soll man da machen? Etwa die Hälfte der Bevölkerung in eine andere Gemeinde verschleppen, nur damit man ein drittes Mal antreten kann?
Von außen betrachtet könnte man vielleicht meinen, je höher man in der politischen Ämterhierarchie aufsteigt, desto schwieriger würde es, aber wenn man einmal drin ist, wird einem klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Händel, mit denen du es als Bürgermeister zu tun hast, sind viel ernster als die eines Abgeordneten, denn auf lokaler Ebene geht es immer um verdammt konkrete Sachen, und alle, die dich gewählt haben, geben keine Ruhe und kontrollieren dich ununterbrochen. Einer mahnt die Ausbesserung der Gemeindestraße an, ein anderer verlangt, dass der Hochspannungsmast umgesetzt wird, weil er die Gesundheit beeinträchtigt, einer will, dass die Grundschule bleibt, obwohl es nur noch zwölf schulpflichtige Kinder gibt, der andere verlangt einen Landeplatz für Rettungshubschrauber, einer fordert superschnelles Internet, jeder erwartet dies und das. Ein Parlamentsabgeordneter kennt natürlich nicht jeden einzelnen Wähler, ein Bürgermeister in einer Gemeinde wie Cosmarate schon, er kennt jeden persönlich und weiß, wie er aussieht. Den Giovazzi, den Tuciari, den Pandagnosi, den Bugnato, den Trevisan, die Zampanaro, die Sulci, den Signorato, den Muffis, den Combiati, die Rossignotto, den Paone, den Burcino, die Neppi, den Longarin, er kennt die Berufe, die Wohnungen, die Angehörigen, die Autos, die Erwartungen, die Bedürfnisse, die Ansprüche. Dauernd rücken sie dir auf die Pelle und lassen nicht locker, bis du ihnen gewährst, was sie wollen, sie geben keine Ruhe, nicht einen einzigen Tag. Auf höherer Ebene dagegen, wem musst du da schon Rechenschaft ablegen, es sei denn, du bist Parteivorsitzender oder Minister? Als normaler Abgeordneter oder Senator, welcher Wähler ruft dich da abends an oder passt dich mit drohender Miene vor deiner Haustür ab? Dieser Wähler weiß gar nicht, was du machst oder ob du überhaupt etwas machst, er hat keine Ahnung, wo du isst oder schläfst. Und falls sich doch mal einer zufällig nach deiner Leistung erkundigt, kannst du immer sagen, es sei nicht deine Schuld, wenn ein bestimmtes Gesetz nicht verabschiedet wird, wenn eine bestimmte Maßnahme sich jahrelang verzögert oder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Du findest immer leicht einen Schuldigen, den Koalitionspartner, der nicht mitzieht, die Opposition, die alles torpediert, die staatliche Bürokratie, die alles blockiert, Europa, das dir die Hände bindet. In einer kleinen Gemeinde wie Cosmarate hingegen wenden sich alle mit ihren Wünschen und Forderungen direkt an dich, Massimo Bozzolato. Du kannst höchstens versuchen die Schuld auf deine Vorgänger abzuwälzen, aber sehr weit kommst du damit gewöhnlich auch nicht.
»Er lügt uns die Hucke voll, Bozzolato treibt’s zu toll!« In dem Video dirigiert eine Breitbändlerin mit spitzer Nase den Sprechchor ihrer blöden Freunde und zuckt dabei so furchterregend, als wäre sie von der Tarantel gestochen. »Bozzolato hat gepennt, unser Ort ins Unglück rennt!«
Die haben gut reden, weil sie keine Ahnung haben, wie schwer es ist, eine Gemeinde zu regieren und es dabei allen recht zu machen. Aber machen wir uns nichts vor, Fehler sind gemacht worden, und zwar nicht zu knapp, in Rom vor allem, seit die Wende® mitregiert, und die Enttäuschung der Wähler fällt vom Zentrum auf die Peripherie zurück, zu Lasten der Lokalpolitiker, die ordentliche Arbeit geleistet haben. Wie er, das sei ohne falsche Bescheidenheit mal gesagt.
Jetzt kommt der schlimmste Augenblick, wo dieser dämliche zwei Meter große Typ sich die Fettuccine mit weißem Trüffel schnappt, sie direkt in die Kamera hält und den Chor anstimmt: »Bozzolato stopft sich voll mit Trüffel, dafür gibt es einen Rüffel!« Da haben sie sich natürlich gleich draufgestürzt, die wussten genau, dass weiße Trüffel beim einfachen Bürger Entrüstung hervorrufen, da denkt doch jeder gleich an Amtsmissbrauch und systematische Selbstbereicherung. Und die einfachen Gerichte wie Maltagliati mit Entenragout oder Ravioli mit Butter und Salbei, die haben sie natürlich nicht gezeigt. Denn diese Breitbändler geben zwar gern die harmlosen Spinner, aber was die Nutzung der Kommunikationsmedien angeht, sind sie unheimlich ausgefuchst, ne richtige Pest. Dauernd nehmen sie mit ihren Handys jeden Mist auf, und eine Minute später steht alles schon im Netz, und zehn Minuten später haben es schon Zehntausende angeklickt. Dieselbe Taktik, die sie bei der Wende® bis vor ein paar Jahren auch angewendet hatten, das stimmt, nur dass die hier noch flotter sind und mit ihren schwachsinnigen Sprechchören auch noch kreativer.
Aber jetzt ist Schluss, Bozzolato will das Video nicht noch einmal bis zum Ende ansehen. Er steht auf, geht auf und ab, sieht sich die Trikolore und die blaue Europaflagge mit den gelben Sternen an. Dann tritt er ans Fenster und betrachtet das Panorama, mit großen Häusern, Einfamilienhäusern und Minihäuschen, die sich über die hügelige Landschaft ausbreiten, Fabrikhallen, Lager, Depots. Dabei kommt ihm der Gedanke, dass er in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr in diesem Büro sitzt, sondern wieder Kilometer um Kilometer runterreißen muss, um Traktoren, Ernte- und Pflanzmaschinen, Heuwender, Pflüge, Jätmaschinen, Eggen, Fräsen und Ackerwalzen an Leute zu verkaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchten oder gar nicht das Geld dafür hatten. Zuletzt liefen die Geschäfte nämlich ausgesprochen schlecht, das lag jedoch nicht an ihm, sondern an der globalen Krise der Landwirtschaft, an den Banken, die keine Kredite mehr vergaben, an den Fehlern früherer Regierungen. Keine schönen Aussichten. Denn das Bürgermeisteramt war doch etwas ganz anderes als das Verkaufen von Landmaschinen, das durfte man auf keinen Fall vergessen.
Und genauso wenig durfte man vergessen, dass sie sich in einer Phase großer politischer Unsicherheit befanden und die allgemeine Lage ziemlich wackelig war, wo das enden würde, wusste keiner. Du springst auf einen politischen Zug auf und gibst dein Bestes, überzeugt und loyal und alles, was du willst, aber wenn der Fahrer von der Straße abkommt und in den Graben fährt, landest auch du recht unsanft auf dem Hintern. Ehrlich gesagt kein schöner Gedanke, im Graben zu landen wegen einer Bande unfähiger Dilettanten, die trotzdem ziemlich arrogant waren, nur weil sie die Wahllotterie in Rom gewonnen haben. Natürlich hat er ihnen einiges zu verdanken, klar, ohne ihre Liste wäre er nie gewählt worden und so weiter, aber bei dem Gedanken, dass sein politisches Schicksal in den Händen solcher Leute lag, wurde ihm richtig schlecht. Leute wie Sante Ciuparo zum Beispiel, der Justizminister ist, eigentlich aber nicht mal die Qualifikation mitbringt, als Bote im Gericht von Benevento zu arbeiten, mit seinem dümmlichen Grinsen. Oder Gennaro Zecchillo, der Außenminister ist, obwohl er noch keinen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet hat und eigentlich gar nichts kann, außer mit starrem Blick seine Sprüche abzuspulen und dabei ungelenk mit den Händen zu fuchteln wie eine Marionette. Manchmal schossen sich diese Typen auf irgendein internationales Projekt ein, vielleicht weil irgendwelche Fanatiker an der Basis darin eine Gefahr witterten, ritten ohne Sinn und Verstand auf Kürzeln wie MUR, CUR oder SRA herum, bis es niemand mehr hören konnte, und schworen Stein und Bein, dass sie dem niemals zustimmen würden, selbst wenn es Geld in die Staatskasse brachte und den Leuten half. Diese Typen waren gegen Hochgeschwindigkeitszüge, weil sie nirgendwohin wollten, gegen landwirtschaftliche Maschinen, weil sie immer noch den Großvater mit Sense und Esel auf dem Feld vor Augen hatten, gegen Kraft-Wärme-Kopplung, weil sie ihren Müll ohnehin hinter der nächsten Straßenkurve abluden, waren dagegen, dass Supermärkte sonntags öffneten, weil ihr Cousin, der dort arbeitete, sonntags lieber ausschlafen wollte (nachdem er die ganze Nacht in der Disco war). Bei so was würden die Wähler hier im Norden auf die Barrikaden gehen. Solange es darum ging, die Fehlentwicklungen schlechter Regierungsarbeit anzuprangern und die Privilegien der alten Politikerkaste abzuschaffen, stand er voll und ganz hinter dem Programm der Wende®, aber jetzt?
Bozzolato geht wieder zum Schreibtisch und drückt die Taste der Sekretärin. Gute zehn Sekunden muss er warten, denn garantiert ist Sonia wieder einmal damit beschäftigt, irgendwem eine SMS zu schicken oder irgendein Video zu gucken, womöglich das unsägliche Silvestervideo. Als sie sich endlich meldet, schnauzt er sie ziemlich ungehalten an: »Kann man vielleicht einen doppelten Espresso Macchiato bekommen? Und möglichst nicht erst in einer Woche?«
»Okay, Bürgermeister.« Das klingt, als täte sie ihm einen Riesengefallen: Dabei braucht sie doch nur anzurufen, verlangt ja keiner, dass sie selbst runtergeht.
Eine derartige Respektlosigkeit bringt ihn jedoch auf den Gedanken, dass er sich die unverschämten Beleidigungen dieser dahergelaufenen Breitbändler mit ihren idiotischen Reimen auf keinen Fall bieten lassen darf. In der Politik musst du dir Respekt verschaffen, davon hängt dein Ruf ab, und nur mit einem guten Ruf hast du eine Zukunft. Wenn es auf nationaler Ebene bergab ging und die Partei deshalb Gefahr lief, bei den nächsten Wahlen sang- und klanglos von der Bildfläche zu verschwinden, auf wen sollte man denn dann noch setzen, wenn nicht auf die Kommunalpolitiker? Auf die, die vor Ort gute Arbeit leisteten, weit weg von den Großstädten, wo die Arbeit der Wende®-Bürgermeister, ehrlich gesagt, ein Desaster war! Irgendein wichtiger Posten könnte dabei durchaus abfallen: nicht gleich als Staatssekretär (immer langsam), aber vielleicht als Abteilungsleiter oder Ausschussvorsitzender oder etwas in der Art. Und dann würde man weitersehen, so Gott will. In der Politik konnte man nie wissen.
So wie die Dinge standen, fühlte er sich jedenfalls relativ ungebunden: Würde sich eine gute Gelegenheit bieten, könnte er sich durchaus vorstellen, mit Sack und Pack in ein anderes Lager zu wechseln. Zur Nationalunion beispielsweise. Die Beziehungen mit Suverso, wo die Union allein die Regionalregierung stellte, waren natürlich alles andere als rosig, im Gegenteil, eigentlich war man seit Generationen verfeindet, wegen der unerträglichen Arroganz der Suversesen. Und Mirko Noseletti, der Parteichef, brachte ihn schon in Rage, wenn er ihn nur im Fernsehen sah, mit seiner blonden Mähne und den wässrigen Augen eines Russen, zur Hälfte ein Mann der Vernunft, zur Hälfte Extremist, ein dreister Lügner wie nur wenige andere, ein Faulpelz erster Güte, außer wenn es darum ging, durch Italien zu reisen und die Massen aufzustacheln. Und ein erbärmlicher Feigling war er auch, erst große Töne spucken, dann aber jammern, als wäre er das Opfer, erst einen Stein werfen, dann aber blitzschnell die Hand verstecken. Allerdings war es auch so, dass Massimo Bozzolato damals in unverdächtigen Zeiten, als die Union noch Nordunion hieß, zu den Sympathisanten der ersten Stunde zählte. Denn die Begründung dafür, warum der produktive Norden gegen den parasitären Süden war, fand er schon immer richtig. Genauso wie die Kampagne gegen die römische Fettlebe, die den Unionisten dann allerdings so gut gefiel, dass sie dabei inzwischen selbst hemmungslos mitmachten. Außerdem gab es auch noch andere politische Gruppierungen, die in den Umfragen momentan zwar nicht besonders gut dastanden, aber deshalb keineswegs von vornherein wegfielen. Für den Fall, dass jemand nach Ablauf seiner Amtszeit Interesse zeigen sollte, wer wollte ihm verbieten, seine Fähigkeiten als guter Kommunalpolitiker samt Stammwählerschaft an den Meistbietenden zu verkaufen?
Drei
Mit schnellem Schritt geht Guiscardo Guidarini von den Säulen der Skene zur Plattform des Proskenion und erklimmt die Stufen des Koilon: Die regelmäßigen halbkreisförmigen Ränge aus grauem Stein geben ein harmonisches Bild ab, an diesem klaren, kalten Morgen, jetzt wo der Nebel aus der Ebene sich gelichtet hat. Die Hunde Tanganika, Timor und Gui II laufen neben ihm her, wetteifern mit erstaunlicher Gelenkigkeit darum, wer am höchsten springt. Tanganika und Timor sind reinrassige Basenji mit langem Stammbaum, die beiden waren schon da, als er wieder hier einzog, aber Gui II ist vermutlich das Ergebnis eines Seitensprungs, obwohl man sich das bei der hohen Mauer, die den gesamten Besitz umgibt, nur schwer vorstellen kann. Jedenfalls hat er im Vergleich zu seinen Eltern mehr Ähnlichkeit mit einem Wolf, sein Fell ist eher grau-schwarz als braun-weiß. Deshalb konnte Guiscardo nicht anders, als ihm seinen Namen zu geben, und jetzt gibt es in der Villa Guidarini Valgrande zwei Guis, beide ein wenig aus der Art geschlagen.
Als Guiscardo ungefähr auf halber Höhe ist, hört er ein elektronisches Brummen in der Luft und entdeckt beim Hochsehen eine Drohne mit vier Propellern, die durch die Hügelmulde schwirrt wie ein außerirdisches Insekt. In einer Höhe von etwa dreißig Metern dreht sie ein paar Runden und sinkt dann langsam, aber unaufhörlich auf ihn zu. Die Hunde verfolgen ihre Flugbahn, spitzen die Ohren, Timor stößt ein langes Heulen aus. Als die Drohne etwa zehn Meter über seinem Kopf ist, erkennt Guiscardo das Objektiv der Videokamera, die darunter befestigt ist, die Linse reflektiert das Licht. Dann steigt sie wieder auf, und es sieht aus, als würde sie abdrehen, aber stattdessen fliegt sie einen großen Kreis, sinkt dann wieder und kommt direkt auf ihn zu. Er nimmt einen Stein und schleudert ihn mit aller Kraft: knapp daneben. Er nimmt einen zweiten Stein, aber die Drohne schnellt hoch, flüchtet Richtung Himmel und verschwindet hinter der Hügelkuppe.
Als er mit den Hunden oben auf dem flachen Rasen ankommt, klopft sein Herz schneller, wegen der Steigung und aus Wut über den fliegenden Eindringling, aber das Brummen ist weg. Vom Haus kommt ihm Agnese in ihrer dunkelgrünen Winterjacke entgegen, läuft mit geschmeidigen Bewegungen auf ihn zu und ruft: »Gui!«
»Ich hab’s gesehen.« Da sie ziemlich aufgelöst wirkt, versucht er abzuwiegeln. »Ich habe einen Stein danach geworfen, aber ich hätte eine Zwille gebraucht.«
»Wonach denn?« Seit Jahren ist Agnese seine beste Freundin und eine hervorragende Mitarbeiterin, aber sie neigt nun mal dazu, sich Sorgen zu machen. Um ihn, um die anderen, um die Welt; manchmal zu Recht, manchmal nicht.
»Nach der Drohne!« Er deutet auf den Himmel, wo jetzt ein paar Wolken aufziehen, aber kein mechanisches Gerät mehr zu sehen ist. »Die ging hoch und runter, um zu filmen oder Fotos zu schießen, ist auf mich zugeflogen, als wollte sie mich provozieren!«
Jetzt guckt Agnese noch besorgter, wirft sinnlos einen Blick nach oben. Wache grüne Augen, charakterstarkes Profil, weizengelbe Haare, mehr recht als schlecht geschnitten (von ihm, denn sie haben sich angewöhnt, sich gegenseitig die Haare zu schneiden). »Und wer kann die geschickt haben?«
»Irgendwer, der uns ausspionieren will, natürlich«, sagt Guiscardo empört und überlegt dabei, dass er sich unbedingt etwas ausdenken muss, eine Art Luftabwehr, für den Fall, dass die Drohne noch einmal zurückkommt.
»Aber wer macht denn so was?« Ihr Blick verrät wachsende Besorgnis.
»Keine Ahnung. Aber worüber wolltest du eigentlich mit mir reden, wenn nicht über die Drohne?« Auch er geriet leicht in Panik: Als er sie so rennen sah, waren ihm gleich Bilder von Kriegen, Erdbeben, Feuersbrünsten, verheerenden Tsunamis, ausufernden Epidemien durch den Kopf geschossen.
»Darüber.« Agnese zeigt ihm ihr Handy, wo sich eine ihm irgendwie bekannt vorkommende blonde Frau mit weichgezeichneten Gesichtszügen und einer goldenen 2020 über dem Kopf lachend und Grimassen ziehend mit irgendjemand unterhält.
»Ja, und weiter?« Irritiert über die Belanglosigkeit der Bilder, guckt er zu den Hunden, die ihn erwartungsvoll ansehen, und will schon weitergehen.
»Jetzt warte doch mal!« Agnese hält ihm weiter das Handy hin, aber man kann nichts erkennen.
»Man sieht ja nichts.« Er geht in Richtung Haus, die Hunde rennen los.
»Warte, Gui!« Agnese folgt ihm und hält ihm weiter das Handy hin.
Auf dem Display steht ein Satz in rosa Großbuchstaben: Von einem Helden und Archäologen durch Heimlich-Manöver gerettet!
»Ach so.« Jetzt erinnert sich Guiscardo an den Vorfall gestern in dem Café in Suverso; dann sieht man die Frau in leicht mitgenommenem Zustand, mit verlaufener Wimperntusche. Und neben ihr am Tisch sitzt er.
»Uff, das war knapp, gerade noch gerettet von diesem Herrn hier, ein echter Schutzengel!« Die Frau zieht Grimassen, grinst in die Kamera und redet wie ein Wasserfall.
»Ich weiß schon, den Rest kannst du dir sparen.« Am liebsten würde er die Sache abhaken und einfach ins Haus gehen.
Aber Agnese sieht ihn fragend an, studiert seinen Gesichtsausdruck und wartet auf eine Erklärung.
»Die wäre fast an ihrer Brioche erstickt, was hätte ich denn machen sollen?« Langsam reicht es, er ärgert sich über den Vorfall, ärgert sich, dass man ihn gefilmt und in die Öffentlichkeit gezerrt hat, ärgert sich über Agnese, die nicht lockerlässt. Kurz entschlossen wendet er sich ab und spurtet los, damit auch die Hunde mitrennen.
»Warte!« Agnese läuft mit dem ausgestreckten Mobiltelefon hinter ihm her. »Das Beste hast du ja noch gar nicht gesehen!«
»Schluss jetzt, ich habe genug gesehen!« Guiscardo weiß schon, was sie meint, bleibt aber trotzdem stehen. Und tatsächlich: Da sitzt er, beantwortet widerwillig die Fragen der blonden Frau, die er gerade gerettet hat. So was Blödes, wieso in aller Welt hat er sich bloß darauf eingelassen und ist nicht auf der Stelle abgehauen.
»Achtundzwanzigtausenddreihundertzwei Klicks!« Agnese guckt ungläubig, empört, alarmiert.
»Wirklich?« Er versetzt dem Gras einen Tritt. »Wieso das denn?«
Agnese wirft ihm einen tadelnden Blick zu. »Wusstest du denn nicht, dass sie beim Fernsehen arbeitet? Und sehr bekannt ist.«
»Nein, wusste ich nicht! Und überhaupt, wenn eine vor meinen Augen um ihr Leben kämpft, dann frage ich nicht erst nach, was sie beruflich macht!«
»Natürlich nicht. Wahrscheinlich hält sie das Ganze für eine angemessene Würdigung deiner Heldentat.« Jetzt stichelt sie. »Und es ist ja auch richtig, wenn ein echter Schutzengel öffentlich gewürdigt wird! Guck dir nur mal an, wie viele Likes du hast! Und wie viele Hände, die dir applaudieren! Und die Kommentare erst, soll ich dir vielleicht ein paar vorlesen?«
»Lass gut sein!« Er wendet ihr den Rücken zu, um nicht auf die Provokation hereinzufallen.
»Hör dir das mal an: Lucky Veronica! Nur du allein weißt, wo sie zu finden sind, die Ritter ohne Furcht und Tadel! Oder hier: Echt heldenhaft! Oder hier: Ein Gentleman wie aus einer anderen Zeit, und sexy noch dazu! Oder: Wow, ist der heiß! Na?«
»Was hätte ich denn machen sollen?« Er sieht sie böse an, sie hat es geschafft, ihn zu provozieren. »Hätte ich sie vielleicht ersticken lassen sollen?«
»Natürlich nicht. Bei deiner Veranlagung zu Heldentaten bleibt dir ja gar keine andere Wahl.« Das war typisch Agnese, immer diese Mischung aus Beschützerinstinkt und Kritik, Bewunderung und Empfindlichkeit, mit stark variierenden Anteilen von Mitgefühl und Abgrenzung.
»Schluss jetzt!« Er will unbedingt das Thema wechseln. »Verrat mir lieber mal, wie du es findest, da unten.« Er zeigt zum Rand des Rasens, wo die Mulde im Hügel beginnt, die man von hier aus nicht sieht.
Agnese nickt, weiß aber offensichtlich nicht, wie sie es ausdrücken soll. »Schön.«
»Na vielen Dank, das klingt ja echt begeistert.« So läuft das immer: Entweder provoziert sie ihn, oder er sie.
»Nein, wirklich, Gui. Es ist unglaublich.« Agnese legt mehr Überzeugung in ihre Stimme. »Ein Traum, ans Licht gebracht.«
»Finde ich auch.« Er wirft den Hunden einen Lindenzweig hin, die reagieren aber nicht.
»Und jetzt?« Agnese sieht ihn fragend an, hin- und hergerissen zwischen Vertrauen und Skepsis.
»Jetzt müssen wir uns wohl eine neue Beschäftigung suchen.« Liebend gern hätte er eine genauere Vorstellung der Zukunft, aber wenn eine Arbeit getan ist, die einen drei Jahre fast ohne Pause beschäftigt hat, ist ein Gefühl der Leere wohl unausweichlich.
Vier
Veronica Del Muciaro sieht zu der Badewanne hinüber, die sie mit kaltem Wasser gefüllt hat. Nach der Wolf-Methode sollte die Temperatur zwischen acht und fünfzehn Grad Celsius liegen: Jetzt waren es vielleicht zehn oder zwölf, an einem kalten Januarmorgen alles andere als verlockend. Blieb man bei unter fünfzehn Grad zu lange im Wasser, konnte das fatale Folgen haben. Pro Grad eine Minute weniger, bevor der Körper unterkühlt wurde. Das heißt bei einer Temperatur von zehn Grad höchstens zehn Minuten drinbleiben. Hatte man wie sie wenig Körperfett, wurde es natürlich schneller kritisch. Obwohl sie noch in den dicken taubengrauen Bademantel gehüllt ist, glaubt sie schon, die Kälteschauer zu spüren. Als sie die Haare zu einem Dutt hochbindet, damit sie nicht nass werden, sieht sie zwangsläufig in den Spiegel: Sie überlegt kurz, ob sie vielleicht ein Selfie machen soll oder ein kleines Video, ach nein, lieber nicht, sie hat einfach keine Lust. Für ihr Image als tough und unerschrocken wäre es allerdings super und würde garantiert eine Menge Klicks bringen.
Ihr Problem war, dass sie sich gerade noch als Heldin gefühlt hatte, die sich durch nichts abschrecken lässt, dann aber im Spiegel das blasse, leicht eingefallene Gesicht einer blonden Frau erblickte, die ziemlich mitgenommen aussah, weil sie mal wieder schlecht geschlafen hatte (trotz anderthalb Schlaftabletten). Eine, die von der Arbeit gestresst war, weil sie dauernd wie eine Flipperkugel kreuz und quer durch Italien flitzte, je nachdem, wo man sie gerade hinschickte, und zwar von jetzt auf gleich. Die Arbeit machte ihr großen Spaß, darauf verzichten wollte sie auf keinen Fall, aber wie lange hatte sie schon keine richtige Beziehung mit einem Mann mehr gehabt? Auf wie viele Wochenenden hatte sie schon verzichten müssen, seit sie als Korrespondentin für Roberta Riscatto arbeitet? Wie oft hatte sie Verabredungen mit Freundinnen zum Aperitif absagen, wie oft einen unbeschwerten Einkaufsbummel plötzlich abbrechen müssen? Weil man sie Knall auf Fall nach Siena schickte, weil dort beim Palio zwei Pferde umgekommen waren, oder nach Crotone, wo zwei rivalisierende Restaurantbetreiber sich gegenseitig umbringen wollten, oder nach Padua, um Zeugen aus dem schlimmsten Drogenmilieu zum Reden zu bringen, oder nach Bozen, um den Background des Polen zu recherchieren, der Chopin auf Gläsern spielt? Wie lange war es ihr schon nicht mehr gelungen, mehr als drei Tage hintereinander in ihrer kleinen Single-Wohnung in Mailand zu verbringen? Oder hier in diesem Zimmer im Haus ihrer Eltern in Suverso? Um ein Buch zu lesen, sich mal einen ganzen Film am Stück anzusehen, sich mal ein bisschen um sich selbst zu kümmern oder einfach auch mal nichts zu tun? Stand ihr das denn nicht zu? Einmal die Woche vielleicht, oder wenigstens alle vierzehn Tage?
Wieder schaut sie zur Badewanne hinüber, versucht krampfhaft, sich auf die Intention zu konzentrieren, wie Wolf das nannte. Aber es fällt ihr unsagbar schwer, sich zu überwinden, lieber schnell noch einen kurzen Blick in den Spiegel, die Verlockung ist einfach zu groß; und kaum gibt sie der Versuchung nach, sind sämtliche Fragen und Zweifel wieder da. Zweifel an sich selbst, an ihrer Rolle bei Tutto qui! und in der Fernsehwelt allgemein; an ihrem Platz in der Welt.
Schon komisch, wenn sie sich auf dem Monitor oder dem Handy sah, war das überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Aber Spiegel sind einfach schrecklich, die haben nun mal die blöde Eigenschaft, dir dein Bild ungefiltert zurückzuwerfen, ungeschönt und erbarmungslos. Es war nämlich so, dass es in ihrem Leben immer mal wieder Phasen gab, als Kind, als Jugendliche und auch kürzlich noch, da hatte sie der Anblick der eigenen Gesichtszüge zutiefst irritiert. Inzwischen ist es zwar schon viel besser geworden, das verdankt sie dem Fernsehen, aber ganz verflogen ist diese Verunsicherung nie: Sie lag immer auf der Lauer, mitunter genügte eine winzige Kleinigkeit, und schwups, war sie wieder da. Manchmal reichte ein Blick auf die Form der Stirn, der Augen, der Nase, die ihr natürlich vertraut waren, doch manchmal war diese Vertrautheit urplötzlich weg, und dann drängte sich ihr die Frage auf, wer sie eigentlich wirklich war.
War sie die Ve-ve-ro-nica D-del Mu-mu-mu-ciaro, die von ihren Mitschülern, aber auch ihren Lehrern unerbittlich gehänselt wurde, weil ihr die Worte im Hals steckenblieben, wie neulich das Stück Brioche? Oder war sie die Veronica Del Muciaro, die sich nach einem Master in Journalismus an der Universität Bologna absolut blauäugig schon als Reporterin aus Krisengebieten wähnte, in Boots, Cargo-Weste mit vielen Taschen und mit Helm, an vorderster Front? Oder die Veronica Del Muciaro, die mit dem Diplom in der Tasche nach Rom und Mailand fuhr und schockiert war, als sie feststellen musste, dass man ohne Beziehungen, ohne Parteibuch, ohne die Tochter oder Enkelin oder Geliebte eines hohen Tiers zu sein, so gut wie keine oder besser gesagt überhaupt keine Chance hatte, beim staatlichen Fernsehen oder den großen Privatsendern einen Job zu finden? Oder die Veronica Del Muciaro, die für TeleSuverso bereitwillig und ohne Honorar über lokale Ereignisse berichtete, dabei stundenlang in der stickigen Hitze kommunaler Gebäude, dem ohrenbetäubenden Krach in Fabrikhallen oder dem eisigen Nebel auf den Ausfallstraßen ausharrte, um über irgendwelche Initiativen von Kommunalpolitikern oder irgendwelche Erfolge einheimischer Unternehmen oder irgendwelche Verkehrsunfälle in der Provinz zu berichten? Oder die Veronica Del Muciaro, die es einmal durch Zufall oder Glück geschafft hatte, den ehemaligen Stadtrat Zambon vor laufender Kamera davon abzuhalten, sich vom Balkon des Palazzo Guanti zu stürzen, als gegen ihn wegen Korruption, Erpressung im Amt, Urkundenfälschung, Hehlerei und Manipulation öffentlicher Ausschreibungen ermittelt wurde (wobei sie fast selbst abgestürzt wäre, weil das Ganze keineswegs inszeniert war, wie manch einer später behauptet hat)? Oder die Veronica Del Muciaro, die wegen dieser Episode kurzzeitig zu nationalem Ruhm gelangte und so von Tito Calpa entdeckt wurde, dem Produzenten von Tutto qui!, der ihr einen Job als Sonderkorrespondentin bei Roberta Riscatto anbot, die sich einen Spaß daraus machte, Veronicas Namen zu verhunzen, indem sie das Del wegließ und Muciaro auf dem a statt auf dem u betonte. (Muciàro, das hörte sich doch blöd an. Inzwischen betont sie zwar richtig, lässt aber das Del immer noch weg, richtig gemein, die blöde Kuh.)
War sie die Veronica Del Muciaro, die man jedes Jahr Anfang August zur Mautstation in Rimini schickte, um über den Massenexodus zu Beginn der Sommerferien zu berichten, und Ende August zur Mautstation in Melegnano, um dieselben Massen bei Ferienende auf dem Rückweg zu zeigen? War sie die Veronica Del Muciaro, die man im Hochsommer mit ihrer Mini-Crew nach Bologna schickte, um über die unerträgliche Hitze zu berichten, oder nach Ferrara an den Po, um über den besorgniserregenden Wassermangel Bericht zu erstatten, und ein paar Monate später über das ebenso besorgniserregende Hochwasser? War sie die Veronica Del Muciaro, die die Leute auf der Straße wiedererkannten, weil sie im Fernsehen gesehen hatten, wie sie sich unerschrocken in eine wüste Schlägerei zwischen verfeindeten Verwandten stürzte oder am Tatort eines grauenhaften Verbrechens Überlebende und Zeugen interviewte, in Direktschaltung mit Roberta Riscatto, die aus dem Studio in Rom nachfragte und Lebensweisheiten von sich gab? War sie die Veronica Del Muciaro, die davon träumte, unerbittlich betrügerische Machenschaften und Missstände aufzudecken, ohne irgendjemand zu verschonen, ganz dem Geist eines unabhängigen investigativen Journalismus verpflichtet, der sich von niemandem etwas sagen lässt? War sie die Veronica Del Muciaro, die bereit gewesen wäre, sich unter Beschuss, zwischen Maschinengewehrsalven und explodierenden Bomben, bis an die vorderste Front vorzuwagen, um live über regionale Konflikte zu berichten, die ihre italienischen Kollegen sonst nur aus sicherer Entfernung von mehreren hundert oder tausend Kilometern verfolgten? Welche von diesen vielen möglichen Veronicas war nun diese blonde, ein bisschen mitgenommene Frau, deren Bild der Spiegel jetzt ungeschönt zurückwarf? Wie weit lagen Traum und Wirklichkeit eigentlich auseinander?
Sie taucht eine Hand ins Badewasser, auch wenn man das eigentlich nicht tun soll: Die Kälte schießt durch den Arm, über die Schulter, den Hals hinauf, bis sich die Gesichtsmuskeln verkrampfen. Das Wasser war schon ziemlich kalt, als es aus dem Hahn kam, doch zusätzlich hat sie noch eine Portion Eiswürfel aus dem Spender am Kühlschrank ihrer Eltern in die Wanne geschüttet. In den Frotteeschlappen schlurft sie ein paarmal vor und zurück, um Zeit zu gewinnen, atmet tief ein und schnell wieder aus, wie Günter Wolf persönlich es ihr beigebracht hat, bis ihr schwindelig wird. Sie reißt den Bademantel runter, wirft ihn auf den Stuhl, taucht einen Fuß in die Wanne, steigt hinein, taucht bis zu den Schultern unter.
Das Wasser ist so kalt, dass ihr der Atem stockt: Sie spürt, wie das Blut aus den Randbereichen des Körpers zurückweicht und durch die Halsschlagader in den Kopf steigt, das Herz pumpt wie wild; nur mit Mühe unterdrückt sie den Fluchtimpuls, eigentlich würde sie am liebsten aufspringen, schnell in die Dusche und das heiße Wasser aufdrehen. Aber es ist eine Frage des Prinzips, und von persönlichem Stolz: Mit klappernden Zähnen bleibt sie unter Wasser, ja, taucht sogar noch tiefer ein, bis zum Hals. Dafür musste man sich unglaublich zusammenreißen, klar, aber genau darum ging es doch, äußerste Willensanstrengung. Immerhin gab es eine Menge Leute, die auf das tägliche Tauchbad nach der Wolf-Methode schworen: Hollywood-Schauspielerinnen, berühmte Sänger, Fußballspieler der Serie A und ganz normale Leute, die konnten ja schlecht alle spinnen. Der eine behauptete, er sei durch die Kaltbäder so abgehärtet, dass er keinen Schnupfen mehr bekomme, der nächste, er habe damit seinen Cholesterinspiegel gesenkt, manche wollen dadurch sogar ihre Kurzsichtigkeit oder ihre Cellulitis losgeworden sein, etliche Kilo abgenommen haben, sich besser konzentrieren können: Die Liste war endlos. Es gab natürlich auch Leute, die das alles für Humbug hielten, man ruiniere sich damit, abgesehen von Sportprofis mit chronischen Schmerzen, bloß die Herzkranzgefäße und könne sogar leicht zunehmen. Wie sollte man sich da noch auskennen, je mehr man recherchierte, desto widersprüchlicher die Informationen, am Ende war man nur noch verwirrter als am Anfang.
Auch die Meinungen über Günter Wolf waren ausgesprochen kontrovers: Manche verehrten ihn wie einen Heiligen, andere hielten ihn für einen Scharlatan, der nur das Bedürfnis der Menschen nach einem Allheilmittel ausbeutete. Als sie einmal in München war, um ihn zu interviewen, machte er auf sie den Eindruck, als besäße er durchaus eine gewisse Intuition, aber hundert Prozent sicher war sie da nicht. Er hatte diesen eindringlichen Blick, diese sonore Stimme. Ein bisschen berechnend und aufdringlich vielleicht, aber auch ein bisschen behäbig. Als sie nach elf Minuten aus der Wanne mit den Eiswürfeln stieg und sich, am ganzen Körper zitternd, in den Bademantel hüllte, hatte er sie auf die Stirn geküsst. »Fantastic girl! So so brave!«