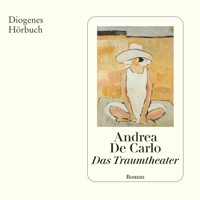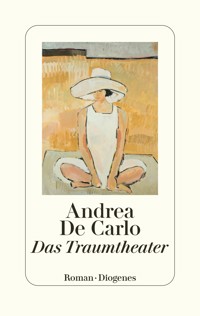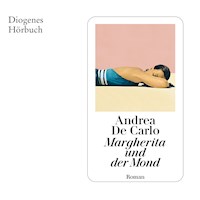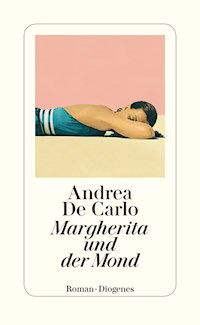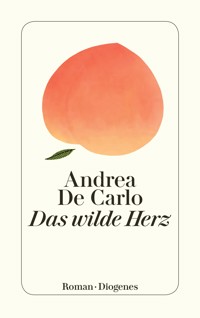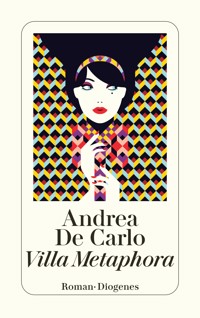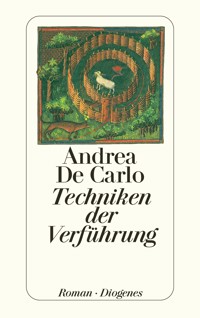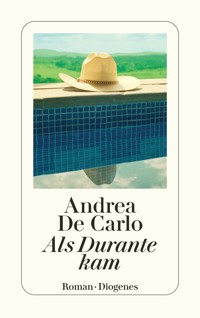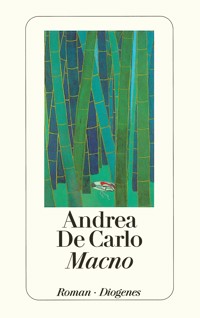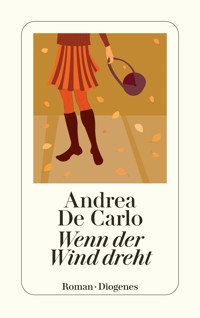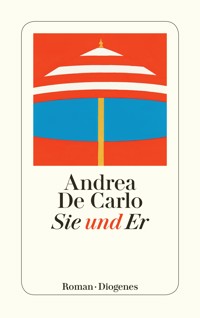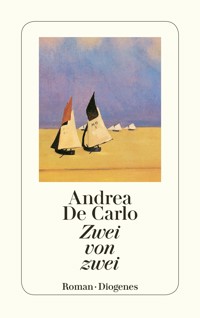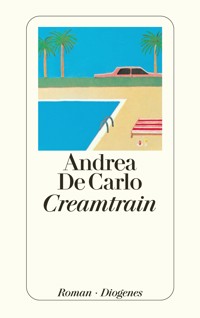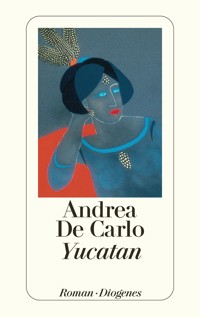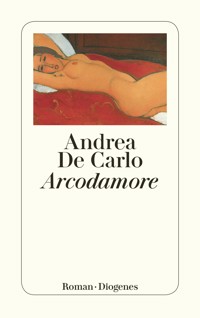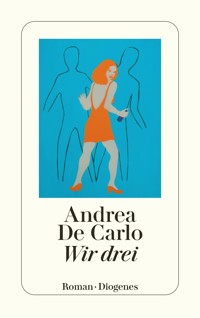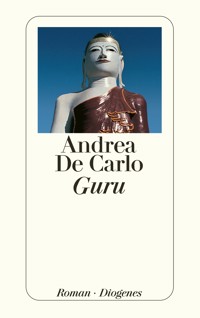
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peaceville in Connecticut: Paradies des Friedens und der Nächstenliebe. So wollen es zumindest die Anhänger des Gurus, die sich dort niedergelassen haben. Um den Frieden ist es allerdings geschehen, als der junge Italiener Uto auftaucht. Mit seiner Punkfrisur, der Ledermontur und der Sonnenbrille tritt er gegen das unermüdliche Lächeln der Sinnsucher an – und weckt durch sein mitreißendes Klavierspiel geheime Sehnsüchte…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andrea De Carlo
Guru
Roman
Aus dem Italienischen von
Renate Heimbucher
Titel der 1995
bei Bompiani, Mailand,
erschienenen Originalausgabe: ›Uto‹
Copyright © 1995 R.C.S. Libri & Grandi Opere
Die deutsche Erstausgabe erschien 1996
unter dem Titel ›Uto‹ im Diogenes Verlag
Umschlagfoto: Copyright © Jean-Leo Dugast/
Panos Pictures, London
Für Malina
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23011 6 (2.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60229 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sich die eigenen Schwächen auszutreiben, aber ich weiß, daß man Abscheu vor den eigenen Fähigkeiten empfinden kann, wenn man sie bei den anderen wiederfindet.
JULES RENARD, Tagebuch
[7] Inhalt
Liebste Marianne[9]
Liebste Lidia[14]
Die Ankunft [17]
Die Geisel am Neujahrstag [54]
Die Geisel wird aktiv [79]
Im Tempel [92]
Marianne sondiert das Terrain [103]
Vittorio sucht Kontakt [106]
Marianne sucht Kontakt [126]
Kontakte mit den Kindern [137]
Erste Begegnung mit dem Guru [147]
Vittorio einen Schritt näher [158]
Weitere Kontakte mit den Kindern [170]
Ich sammle weitere Informationen [179]
Mit Nina im Wald [194]
Ich beeindrucke (nicht nur) den Guru [211]
Noch eine bedeutsame Tat [239]
Marianne prescht vor [252]
Erfolge bei Jeff-Giuseppe [262]
Erfolge bei Nina [271]
Vittorio zweifelt [277]
Marianne will verstehen [323]
Vorbei mit den Weihnachtslichtern [328]
Vorbei mit dem Muttersöhnchen [331]
[8] Vorbei mit dem Eheglück [334]
Vorbei mit dem guten Geist des Hauses [343]
Vorbei mit dem Arm [357]
Die Geisel wird zum Helden [372]
Durch die Tür [379]
Der Held empfängt die Weihe [386]
Der Held erholt sich [389]
Vittorio am Ende [399]
Jedes Wunder braucht ein Publikum [403]
Alter Guru – neuer Guru [426]
[9] Mailand, 25.November
Liebste Marianne,
ich schreibe Dir, weil ich nicht weiß, wie ich es Dir am Telefon beibringen soll, es ist etwas Schreckliches passiert, ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn ich alles aufschreibe, kann ich vielleicht ein bißchen Abstand gewinnen oder wenigstens zu einer klaren und ruhigen Sicht der Dinge finden. Auf jeden Fall ist folgendes geschehen: Antonio hat sich umgebracht, vor vier Tagen. Er hat im Büro in der Kochnische den Gashahn aufgedreht, am Samstag nachmittag, als keiner seiner Angestellten da war. Das Büro liegt im Erdgeschoß, und das Gas ist von dort in den ganzen unteren Teil des Gebäudes geströmt, und als ein Missionspriester den Knopf am Aufzug drückte, um in den fünften Stock hinaufzufahren, wo er einer Frau Referenzen für ein paar junge Südamerikaner bringen sollte, die eine Wohnung mieten wollten, ist durch den elektrischen Kontakt alles explodiert wie eine fürchterliche Bombe. Die Stichflamme soll durch den Aufzugschacht bis zum Dach hochgeschlagen sein, der Fußboden im ersten Stock ist durchgebrochen und ein Stück der Fassade auf die Straße gestürzt, zwei Wohnungen sind völlig zerstört und vier weitere schwer beschädigt, der Priester ist tot, ebenso ein pensioniertes Lehrerehepaar, das in der ersten Etage über Antonios Büro [10] wohnte, weitere drei Personen sind verletzt. Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können, wenn nicht Samstag nachmittag gewesen wäre und nicht in Mailand ausnahmsweise die Sonne geschienen hätte, so daß die meisten Bewohner nicht zu Hause waren. Bei alledem haben wir nicht nur Antonio verloren, was an sich schon eine schreckliche Tragödie ist, sondern mußten auch noch mit ansehen, wie die Presse und das Fernsehen über ihn herfielen und ihn als eine Art Kriminellen oder Terroristen hinstellten. Dabei ist doch ganz klar, daß er überhaupt nicht daran gedacht hat, durch eine so private Tat, vielleicht die privateste, die man überhaupt begehen kann, ein so schlimmes kollektives Unglück auslösen zu können. Alle, die ihn kannten, wußten, daß er der netteste und ausgeglichenste Mensch der Welt war, und Du weißt es auch, obwohl er in letzter Zeit Anfälle von Depressionen hatte und immer wieder sagte, daß er keinen Sinn mehr im Leben sehen könne; aber er wollte eigentlich nie darüber reden, und so gab es zwischen uns kaum noch eine Kommunikation. Ich habe versucht, das auch der Polizei und den Journalisten und den Leuten vom Fernsehen klarzumachen, aber es sind die hartherzigsten Menschen, die Du Dir vorstellen kannst, sie sind nur daran interessiert, sich in den Bosheiten, Gemeinheiten und Allgemeinplätzen bestätigt zu finden, die sie sagen und denken. Jemand, der Antonio nicht kannte, könnte allerdings wirklich das Schlimmste vermuten, denn beim Anblick des eingestürzten Gebäudes kommt man sich vor wie in Beirut oder im ehemaligen Jugoslawien, es sieht aus wie nach einem Bombenangriff oder einem Raketenbeschuß; wirklich schrecklich, daß so etwas passiert ist. Die Kinder waren [11] natürlich erschüttert, jedes auf seine Weise; sie sind ihrem Wesen nach ja sehr verschieden. Riccardo steckte schon vorher in einer Krise wegen Problemen in der Schule, er reagierte mit blinder Wut auf Uto, er sagt, Uto habe Antonio um seine innere Ruhe gebracht und ihn in eine Krise gestürzt. Das ist natürlich ungerecht, auch wenn es wirklich viele Probleme zwischen den beiden gab und der arme Antonio sehr darunter gelitten hat. Du weißt ja, wie sehr Antonio Uto mochte, er hat Riccardo nie bevorzugt, sondern immer alle beide als seine Söhne betrachtet. Vielleicht ist es genau das, was Riccardo nie richtig verstehen konnte, denn im Grunde hat er immer geglaubt, seinem Vater mehr zu bedeuten, und es nicht ertragen, daß er sich mit Uto messen mußte, der hübscher und brillanter ist und sich in allem, was er in Angriff nimmt, als begabter erweist. Eigentlich sollte ich das gar nicht sagen, aber Du weißt ja, daß ich beide wirklich gleich gern habe und trotzdem imstande bin, objektiv zu bleiben, vor allem in einem Augenblick wie diesem, denn auch wenn es um meine Söhne geht, kann ich die Dinge so sehen, wie sie sind. Allerdings mache ich mir zur Zeit vor allem Sorgen um Uto, weil er auf das, was passiert ist, äußerlich überhaupt nicht reagiert hat; er will nicht einmal darüber sprechen und tut gleichgültig und gelassen, aber ich bin sicher, daß er sich schuldig fühlt und daß es ihm sehr schlechtgeht. Seit ich wieder geheiratet und noch einmal ein Kind bekommen habe, hat er sich in dieser Familie immer als eine Art Eindringling gefühlt, obwohl er ganz genau wußte, wie sehr Antonio ihn mochte, trotz der Feindseligkeit und Ablehnung und Gleichgültigkeit, die Uto ihm immer entgegenbrachte. Ich bin sicher, daß er jetzt daran [12] zurückdenkt, wie oft Antonio das Gespräch mit ihm gesucht hat und was für Gemeinheiten er sich dafür anhören mußte. Jetzt fühlt er sich verantwortlich, man merkt es ihm an, aber wir können nicht einmal darüber reden, weil er über nichts sprechen will und sich den ganzen Tag in seinem Zimmer einschließt und sich nur nachts etwas zu essen holt oder wenn niemand im Haus ist. Ich bin zu Tode erschöpft und völlig durcheinander, wie Du Dir vorstellen kannst; was passiert ist, ist so schrecklich, daß ich es noch gar nicht richtig glauben kann. Manchmal warte ich, daß Antonio nach Hause kommt oder mich gleich anruft, ich stopfe mich mit Beruhigungsmitteln voll, die mir der Arzt verschrieben hat, aber sie helfen nicht viel, und dazu habe ich noch diese Sorgen wegen Uto, am liebsten wäre es mir, wenn er für eine Weile Weggehen könnte oder etwas finden würde, das ihn ganz in Anspruch nimmt; aber er sagt wie immer, daß er zu nichts Lust hat, obwohl er diese große Begabung besitzt und sein Klavierlehrer einmal zu mir gesagt hat, daß jemand wie er nur alle zwei, drei Generationen geboren wird. Alle, die ihn kennen, wissen, daß er überdurchschnittlich intelligent ist, nur war er immer so skeptisch und durch seine zu stark ausgeprägte Kritikfähigkeit blockiert, daß er es bisher leider nie geschafft hat, einfach loszulegen und etwas Konkretes und Positives zu machen, und das bringt mich jetzt zusätzlich zur Verzweiflung.
Entschuldige, daß ich Dir so mein Herz ausgeschüttet habe, aber ich mußte mich einfach jemandem anvertrauen, der mich versteht, und Du bist der einzige Mensch, der weder verurteilt noch Vorwürfe erhebt oder kühle und gleichgültige Ratschläge erteilt. Gut, daß es Dich gibt, sonst [13] wüßte ich wirklich nicht, an wen ich mich wenden könnte, um ein bißchen echtes Verständnis zu finden.
Liebe Marianne, ich umarme Dich und Deine wunderbare Familie; wenn ich in dieser leidvollen und schwierigen Situation an Euch denke, kommt Ihr mir vor wie eine Insel der Ruhe und des Friedens.
[14] Peaceville, 4.Dezember
Liebste Lidia,
auch ich schreibe Dir, weil es mir rücksichtslos vorkommt, Dich gleich anzurufen, und ich die Entfernung zwischen uns lieber so behutsam wie möglich überwinden möchte. Zuallererst möchte ich, daß Du die Schwingungen von Frieden und Ruhe und Liebe aufnimmst, die Vittorio, Jeff, Nina und ich Dir, Uto und Riccardo mit unseren Herzen schicken. Denk daran, daß nichts geschieht, was nicht schon geschrieben steht, das sagt der Swami immer. Wir dürfen uns von dem Unglück, das uns im Leben zustößt, nicht allzu sehr aus der Fassung bringen lassen, auch wenn wir Menschen sind und es nur menschlich ist, daß wir Gefühle haben und Schmerz empfinden. Wir sollten aber immer daran denken, daß alles Teil eines großen Plans ist, alles verläuft in Zyklen und folgt vorbestimmten Wegen. Wenn wir von oben einen Blick auf unser Leben werfen könnten, sähen wir eine Reihe von Spuren, wie kleine Zeichnungen im Sand, verschlungene und gerade Linien, die von einem Punkt zum nächsten führen. Du mußt also stark und ruhig sein, Dich nicht von der Verzweiflung überwältigen lassen. Es war Antonios Karma, daß er sein irdisches Leben so beendete, auch wenn wir dafür keine Erklärung finden und uns alles schrecklich vorkommt. Die Erklärung liegt in [15] seinem Lebensplan, dem zufolge sein Leben, wie wir jetzt wissen, auf diese Weise und genau zu diesem Zeitpunkt enden mußte.
Dann möchte ich Dir sagen, daß wir, nachdem wir Deinen Brief mit großer Anteilnahme gelesen hatten, alle vier lange miteinander geredet haben und am Ende beschlossen haben, Dir einen Vorschlag zu machen, der aus unseren Herzen kommt und den Du deshalb wirklich in Betracht ziehen solltest: Schick Uto für ein paar Monate zu uns, damit er einmal von zu Hause wegkommt und in der wunderbaren Atmosphäre hier aus dem Zustand, in den er verfallen ist, herausfindet und heiter und positiv wird. Wir sind alle vier ganz sicher, daß es ihm guttun würde, und uns wäre es eine große Freude, ihn als unseren Gast aufzunehmen und ihm die Wärme und das geeignete Klima zu bieten, in dem er sich seiner uns allen bekannten Begabung widmen kann. Ich und Vittorio erinnern uns noch, wie er uns damals bei Euch in Mailand Bach vorgespielt hat. Das war vor vier Jahren, er war also erst fünfzehn! Wir sind sicher, daß er Großes vollbringen wird, wenn er nur sein inneres Gleichgewicht findet! Deshalb bitte ich Dich, unser Angebot, das von Herzen kommt, ganz ernsthaft in Erwägung zu ziehen! Auch für Nina und Jeff wäre es herrlich, jemanden im Haus zu haben, der fast im gleichen Alter wie sie ist, ihnen altersmäßig zumindest näher steht als wir, denn wenn sie nicht gerade in der Schule sind, leben sie ziemlich isoliert, und obwohl es in Peaceville noch andere Jugendliche gibt, ist es doch nicht das gleiche, wie wenn man einen Gast im Haus hat.
Bis jetzt hat es noch nicht geschneit, aber den [16] Wettervorhersagen nach ist es bald soweit, und dann wird es bei uns noch viel zauberhafter sein. Hoffen wir, daß der Schnee erst nach Utos Ankunft fällt, sonst könnte es schwierig werden, denn wenn der Schnee so hoch liegt wie letztes Jahr, sind die Flughäfen gesperrt. Aber ich bin sicher, daß es keine Probleme gibt.
Unser Swami ist noch auf dem Wege der Genesung. Du weißt ja, daß er eine schwere Herzoperation hinter sich hat. Er erholt sich gut, aber er ist ja schon sehr alt, und man muß vorsichtig sein. Es wäre jedenfalls schön, wenn er an Neujahr wieder unter uns sein könnte, das ist unser größter Wunsch, und ich bin sicher, daß es für Uto eine wichtige Erfahrung wäre. Nachdem wir seine Gegenwart so lange vermißt haben, wird natürlich alles noch viel eindrücklicher und magischer als sonst sein.
Also, überleg es Dir, sprich mit Uto darüber, und laßt uns bald wissen, wie Ihr Euch entschieden habt. Bis dahin umarmen wir Euch mit all unserer Herzlichkeit und Seelenruhe, die Dich und Deine Familie sicherlich auch über den Ozean hinweg erreichen und Euch Trost bringen werden.
Om Shanti Om Kaliani
[17] Die Ankunft
Uto Drodemberg auf seinem Platz im engen Rumpf der Boston Foxville, die hoch am Silvesterhimmel vibriert. Er blickt hinab auf die schneebedeckte Landschaft, die kleinen, zugefrorenen Seen, die winzigen Hausdächer. In der Maschine sitzen nur sechs, sieben Passagiere, Amerika wie im Film, und sie sehen wirklich aus wie Statisten, die nur da sind, um den Protagonisten besser zur Geltung zu bringen, ihn gleich in der ersten Szene ins rechte Licht zu setzen, ihm eine interessante Aura zu geben. Ab und zu blickt einer von ihnen verstohlen zu ihm hinüber, denn sein Aussehen und die Art, wie er gekleidet ist und sich bewegt, ist natürlich viel aufregender als die ihre. Er könnte gut ein Rockstar sein, der gerade zu seinem nächsten Konzert unterwegs ist: Er hat genau die lässige, gelangweilte Art, sich schräg auf den Sitz zu fläzen, sich zur Seite zu neigen, um ohne großes Interesse hinauszuschauen. Ein Rockstar auf seiner letzten Reise, einen Augenblick bevor das Flugzeug abstürzt und tausend Meter tiefer auf dem Boden im Schnee zerschellt. Wenn eine Fernsehkamera oder wenigstens ein Fotoapparat an Bord wäre, könnte man aufnehmen, wie er sogar noch beim Absturz Stil bewahrt, nicht die Fassung verliert, nicht schreit, sich nicht aufregt, sich nirgends festklammert, locker und entspannt bleibt, durch und durch dekadent.
Uto Drodemberg. Uto Drodemberg tot. Uto [18] Drodemberg tot im Schnee, hinauskatapultiert aus dem zertrümmerten Flugzeug. Er liegt auf dem Rücken, ein dünner Blutfaden rinnt ihm aus dem Mundwinkel, aber er ist nicht entstellt: Stoff für einen Kitschroman des neunzehnten Jahrhunderts. Blutleer und melancholisch, auf eine ganz eigene Art klassisch, zeitlos, an keinen Stil gebunden, Spätromantik, Spätrock, wenn man unbedingt nach einer Definition suchen will. Die Fans würden aus allen Teilen der Welt zu seinem Grab pilgern, wo immer es sein würde, mit Blumen und Botschaften, ihm Tränen darbringen, hingeflüsterte Worte, sentimentale Erinnerungen, die an Bildfetzen, Ausschnitte von Filmen und Fotos anknüpfen, wenn es denn Filme und Fotos von Uto Drodemberg gäbe, aber es gibt noch keine, und da es noch keine gibt, wäre es sinnlose Verschwendung, wenn er gerade jetzt sterben müßte, auch wenn letztlich vielleicht alles bedeutungslos ist, aber es wäre eine Verschwendung, und vermutlich würde es auch weh tun, vielleicht ist es besser, das Flugzeug bleibt in der Luft und schafft es, noch einige Kilometer weiter durch den opalenen, schneeträchtigen Himmel zu fliegen, schafft es auch, problemlos und ohne allzu viele Erschütterungen und sekundäre Vibrationen zur Landung auf der Piste anzusetzen, vielleicht wäre das für den Augenblick das Beste, was geschehen könnte.
Jedenfalls ist jetzt der Flug zu Ende und mit ihm dieses Dröhnen um mich her, meine Handflächen sind wieder trocken, und ich verspüre einen Bewegungsdrang; wenn ich das Kinn an die Brust drücke, um in meine Lederjacke hineinzuschnuppern, rieche ich Schweiß und Rauch und [19] feinsten Fernreisestaub, den ich zwar bisher noch nie gerochen habe, der aber genau zu meinen Vorstellungen paßt und mich überhaupt nicht überrascht.
Draußen ist die Luft eisig und klar wie auf einem anderen Stern; das bißchen Licht, das noch da ist, verschwindet in den dreißig Sekunden, die ich brauche, um die asphaltierte Piste zu überqueren und zu den Glastüren zu gelangen. Als ich von drinnen hinausschaue, ist der Himmel bereits so schwarz, als wären Stunden vergangen, es jagt mir einen Schauer durch den Bauch. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen, versuche so geschmeidig und lässig zu gehen, wie ich kann, auch wenn es mich wirklich Nerven kostet; ohne meinen Blick irgendwo verweilen zu lassen, gehe ich mit meiner Reisetasche über der Schulter langsam durch die kleine Ankunftshalle, die nur von wenigen Leuten und ein paar Koffern belebt ist. Ich versuche nicht verloren zu wirken, nicht ängstlich, nicht fremd, obwohl kaum ein Publikum da ist, das das Ergebnis würdigen könnte.
Ich habe die Reise schon längst bereut; ratlos und zweifelnd ist gar kein Ausdruck für meinen Zustand. Ich habe nicht die geringste Lust, irgend jemandem aus der Familie Foletti zu begegnen und mich ihm als Geisel auszuliefern: Es kam mir idiotisch vor, so hier anzukommen, wie ein Postpaket, das über die schräge Ebene der Vereinbarungen gleitet, die meine Mutter mit ihrer lieben Freundin Marianne getroffen hat. Da ich nun schon mal in Amerika war, hätte ich irgendwo andershin fahren können, wenn ich nur früher auf die Idee gekommen wäre und mich schnell entschlossen hätte; ich hätte das Flughafengelände verlassen und einen Zug nach New Orleans oder New York nehmen [20] können, um das Land und womöglich einen neuen Lebensabschnitt auf eigene Faust zu entdecken, anstatt einem von jemand anderem bestimmten Programm zu folgen. Aber so war ich eben: Ich hatte diese immer wieder auftretenden Phasen der Passivität, in denen ich meinte, keine unmittelbare Verantwortung für mein Leben zu haben, so wie ein Beifahrer im Auto, der leicht zerstreut aus dem Fenster schaut, während jemand anderes am Steuer sitzt; dieselbe Gleichgültigkeit dem einzuschlagenden Weg und den nötigen Lenkmanövern gegenüber, nicht aus Vertrauen zum Fahrer, sondern nur, weil man ja bloß der Beifahrer ist. Dann wieder war ich völlig am Boden, die Last der Welt auf meinen Schultern, und hatte das Gefühl, bisher unglaublich dumm und feige gewesen zu sein. Jetzt hätte ich gern irgend etwas getan, um wieder herauszukommen, aber zu spät. Ich darf gar nicht daran denken: Es löst immer noch einen Anfall von Ärger auf mich selbst in mir aus, läßt mich fast ausrasten.
Aber mir blieb nicht viel Zeit, zu überlegen oder mir auszumalen, wie schön es gewesen wäre, wenn die Folettis mich vergessen hätten oder wenn ihnen unterwegs etwas dazwischengekommen wäre, denn ich hatte sie schon erblickt, Vater und Sohn, sie warteten am Durchgang, neben den automatischen Glastüren, durch die ich auf jeden Fall gehen mußte, wenn ich hinaus wollte. Sie standen unbeweglich da, wie zwei gutmütige Kopfjäger, mit den gleichen Gesichtern wie auf den Fotos meiner Mutter, nur daß sie jetzt nicht lächelten, sondern gespannt das versprengte Häuflein der Passagiere aus meinem Flugzeug musterten. Unter den gegebenen Bedingungen war ich eine nur allzu [21] deutliche Zielscheibe, zwecklos, sich zu tarnen oder zu verstecken; wie ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank lief ich ihnen entgegen, mit einer undefinierbaren Mischung aus innerer Auflehnung und Gleichgültigkeit und Resignation und dem Wunsch, es zu Ende zu bringen.
Die beiden Folettis stehen immer noch mit suchendem Blick da: der Vater um die Fünfzig, vielleicht auch etwas jünger, stämmig und robust, das Haar nur leicht angegraut, in einer dick gefütterten grünen Jacke, der Sohn dreizehn, vierzehn Jahre alt, unsicher in seinem hellblauen Daunenanorak, während er versucht, die Haltung des Vaters nachzuahmen. Sie sehen in meine Richtung, während ich auf sie zugehe, immer noch eine Spur unsicher, ob ich es wirklich bin, schließlich ist es mehr als fünf Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, und ich hoffe, daß ich mich seither dramatisch verändert habe. Die Unsicherheit im Blick des Vaters verringert sich jedoch mit jedem Meter, während er auf meine sehr dunkle Sonnenbrille und meine gelben, steil in die Höhe stehenden Haare starrt, auf meinen Ohrring, auf die Jacke und die Hosen aus schwarzem Leder und die hohen schwarzen Motorradstiefel; er gewöhnt sich allmählich an den Gedanken und spannt die Lippenmuskeln zu einem angedeuteten Lächeln. Ich könnte immer noch einen Satz auf eine der Glastüren zu machen und hinauslaufen, bevor sie merken, was passiert ist; aber ich müßte sehr schnell sein und fest entschlossen, und das bin ich nicht, weil mir diese Ankunft das Gefühl gibt, mich im Leeren zu verlieren, mir den Magen gefrieren läßt, mir die Luft aus der Lunge drückt und die roten Blutkörperchen aus dem Blut zieht.
[22] Als ich nur noch zwei Schritte von ihnen entfernt bin, hebt der Vater die Hand und tritt ein wenig auf seinen dicken, kräftigen Beinen hin und her, sagt: »Du bist Uto, stimmt’s?«
Ich bleibe vor ihm stehen, jetzt wirklich wie ein Strafgefangener, aber wenigstens mit der Würde eines Strafgefangenen. »Du bist Vittorio, stimmt’s?« sage ich zu ihm, ohne meine Sonnenbrille abzunehmen oder zu lächeln oder sonst etwas, ohne mir irgend etwas zu vergeben.
Er lächelt trotzdem, plötzlich auf beinah aggressive Art gütig, sagt: »Herzlich willkommen.« Fester Händedruck einer harten, schwieligen, dickfingrigen Hand mit breitem Gelenk, ostentative Männlichkeit, freundschaftlich, offen, direkt, energisch, ohne jeden Zwischenton, ein Händedruck, der mir für eine Woche das Empfindungsvermögen in den Fingern zu ruinieren droht.
Auch der Kleine drückt mir die Hand und zeigt das gleiche Lächeln, aber zehnmal schwächer und zögernder. Sein Vater deutet auf ihn, sagt »Giuseppe«; der sagt fast gleichzeitig »Jeff«. Er nimmt mir die Reisetasche ab, mit halb geschlossenen Augen wie ein braver kleiner Lastesel; der Vater sagt zu mir: »Laß ihn nur!«, obwohl ich gar keinen Widerstand leiste. Jeff-Giuseppe hat sich die Tasche bereits umgehängt, unter dem Gewicht knicken ihm fast die Beine ein.
So wurde ich auf der gnadenlosen Woge von Wohlwollen und Herzlichkeit des männlichen Teils der Familie Foletti in die eisige, uferlose Dunkelheit der amerikanischen Nacht hinausgespült, und ich hatte Angst, obwohl ich meinen Besuch hier möglichst unbekümmert und gelassen zu sehen [23] versuchte. Die Leuchtreklamen längs der Straßen kamen mir vertraut vor, ebenso der gemächliche Strom der Autos und die Mützen hinter den Windschutzscheiben und die Geräusche und Bewegungen ringsum, aber es war eine indirekte und in keiner Weise tröstliche Vertrautheit, die Materialisation der Kulissen aus Tausenden von Filmen, von Videoclips, Plattencovers und Werbespots, die ich seit meiner Kindheit gesehen hatte. Dreidimensional und in natürlicher Größe kamen sie mir beunruhigend wie wahr gewordene böse Träume vor; als wäre man irgendwo in der Zukunft aufgewacht oder auf dem Mond gestrandet. Ich blickte durch die Fenster des Range Rovers hinaus und las die Namen und Markenzeichen in Neonschrift; ich erschauerte im warmen Luftstrom der Klimaanlage, während Vittorio Foletti auf irgend etwas in der Landschaft deutete und dabei von der Seite meine Reaktionen beobachtete und auch Jeff-Giuseppe zum Reden zu bringen versuchte, der mit der krankhaften Schüchternheit des vom Vater unterdrückten Halbwüchsigen hinter mir saß und leise atmend auf meinen Nacken starrte.
Der Vater steuerte den Wagen mit einer Hand durch den spärlichen und langsamen Verkehr; der Achtzylindermotor lief auf niedrigsten Touren. »Wie steht es in Italien?« fragte er mich.
»Wie immer«, antwortete ich, nach draußen blickend.
»Aber jetzt muß sich doch mal irgendwas ändern«, redete er weiter. »Oder ist es immer noch der alte Sumpf?«
»Der alte Sumpf, glaube ich«, erwiderte ich ihm, ohne dem Mitteilungsdruck in seiner Stimme nachzugeben.
Vittorio Foletti sagte: »Du machst dir keine Vorstellung, [24] wie froh wir sind, daß wir aus Italien weg sind und dieses Trauerspiel nicht mehr mit ansehen müssen. Die Schlagzeilen, die Gesichter, die Namen. Hier ist Italien überhaupt kein Thema, es ist ein Land, das gar nicht existiert.«
Er sagt es ohne Emphase und ohne jeden Groll, wie eine Art Zen-Laienpriester, der aus einem angenehmen, behüteten Leben Heiterkeit und Gelassenheit und Sicherheit schöpft; er macht mich wütend.
Das Summen der Klimaanlage, das Summen des Motors. Das sanfte Rucken der Automatikschaltung. Geschmierte Kardangelenke, Öl, Gummidichtungen. Feucht gewordener, wieder getrockneter Autoteppich. Geruch nach sorgfältig gebadetem Hund. Wortleere. Gedankenleere.
An der letzten Ampel vor der Ausfahrt aus der Stadt deutete Vittorio Foletti auf meine Motorradjacke: »Ist das bequem, mit all den Reißverschlüssen?« Schwer einzuordnender Akzent, Mittelitalien möglicherweise, aber verfälscht und fast verlorengegangen auf den Reisen durch die Welt; übernachsichtiges, urteilendes-nicht-urteilendes Lächeln.
»Nein«, sagte ich. Ich hatte den Eindruck, daß ich mich in dem Auto, das wie eine Raumkapsel mit kontrolliertem Luftdruck durch die vertraute und doch fremdartige Landschaft glitt, Vittorios sondierenden Blicken und Fragen recht gut entziehen konnte.
Wir waren schon außerhalb der Stadt und fuhren auf einer leicht ansteigenden Straße durch die finstere und leere Nacht. Da und dort Einfamilienhäuser auf einer Wiese, die Giebel noch mit weihnachtlichen Lichterketten geschmückt, so daß sie wie mit Leuchtstift hingezeichnet aussahen. Ansonsten war der Raum leer und unergründlich; [25] der Blick fand keinen Anhaltspunkt, er stürzte waagrecht davon und wurde ins Unendliche fortgerissen, bis er aus der entgegengesetzten Richtung zurückkehrte.
Vittorio Foletti fährt gleichmäßig mit neunzig, ohne eine Spur von Anspannung, in perfekter Sitzhaltung, weder steif noch zu lässig, mit einer Ausgewogenheit, auf die er vermutlich ganz bewußt achtet. »Du bist in der besten Zeit des Jahres gekommen«, sagt er zur mir. »Es gibt herrliche Feste, und der Guru ist dabei, sich zu erholen. Bald wird es schneien. Und gestern haben wir nicht weit von unserem Haus wunderschöne Hirsche gesehen.«
»Fünf Hirsche«, sagt von hinten Jeff-Giuseppe, der im Halbdunkel nur aus Augen und einen Augenblick später im Scheinwerferlicht eines überholenden Autos nur aus großen, knorpeligen Ohren zu bestehen scheint.
»Wie schön«, sage ich mit null Wärme in der Stimme, mit null Begeisterung und Interesse. Ich möchte nur schlafen, nach den vielen durchwachten Stunden; ich würde mich dazu sogar hinten in den Kofferraum legen, wenn man mich ließe.
Aber die beiden waren wer weiß wie viele Kilometer gefahren, um die Geisel, die man ihnen aus Europa geschickt hatte, in Empfang zu nehmen, sie bombardierten mich weiter mit ihren Freundlichkeiten. »Du hast dich ziemlich verändert, in den letzten fünf Jahren«, sagte Vittorio. »Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du so alt wie jetzt Giuseppe. Wir waren zum Abendessen bei euch eingeladen, und bevor wir uns zu Tisch setzten, sagte deine Mutter: ›Jetzt spielt Uto euch etwas vor.‹ Du weißt schon, eine von den Situationen, in denen man sich sagt: ›Ach du lieber [26] Himmel, auch das noch.‹ Aber dann hast du dich ans Klavier gesetzt – du sahst jünger als vierzehn aus und warst viel magerer und kleiner als Giuseppe –, und dann hast du angefangen zu spielen, Chopin oder was, und Marianne und ich waren völlig von den Socken. Es hat uns die Sprache verschlagen.«
Er machte mit der Rechten eine Geste, die totale Verwunderung ausdrücken sollte, wandte sich lachend zu mir, sah mich forschend an, auf der Suche nach Aufmerksamkeit, Antworten, Publikum.
Ich drehte den Kopf zum Fenster und spähte hinaus; aber außer der schwarzen Nacht gab es nichts zu sehen, auch ohne Sonnenbrille wäre nichts zu erkennen gewesen.
»Ich weiß nicht, ob du dich an mich und Marianne erinnerst«, fuhr Vittorio fort. Schon wieder dieses übertrieben milde Lächeln, das er eigentlich nie ablegt; dazu die konstante Wärme in seiner Stimme, gleichmäßig verteilt auf mich und den Rest der Welt. Innere Mechanismen, die genauso reibungslos und ohne Störgeräusche funktionieren wie die seines Autos.
»Nein«, sagte ich und schaute wieder zum Fenster hinaus.
Jeff-Giuseppe sagte: »Zu Hause haben wir ein Klavier. Ein neues, seit einem Monat, das alte haben wir verkauft. Ein Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie. Es klingt phantastisch.«
Er dagegen hört sich eher jämmerlich an; er ist gerade im Stimmbruch, und der amerikanische Akzent läßt seine Stimme noch unsicherer klingen. Mit seinen viel beschränkteren Mitteln versucht er so zu sein wie sein Vater, im [27] gleichen warmen Ton zu sprechen, positive Absichten mitzuteilen, völlig offen zu sein.
Vittorio sagt: »Weißt du, wer alles zur Familie Foletti gehört? Hat deine Mutter es dir schon erklärt?«
»Nein«, sage ich, obwohl sie es mir mehrmals erklärt hat, aber ich habe nie aufgepaßt, und es interessiert mich auch jetzt nicht.
»Also«, beginnt Vittorio, als sei es eine wahre Freude für ihn, mich über seine privaten Verhältnisse ins Bild zu setzen. »Da ist Giuseppe, der Sohn von Marianne, dann natürlich Marianne selbst und dann meine Tochter Nina. Und Gino, der Hund. Geschrieben Geeno. Damit hast du die ganze Familie Foletti.«
Er redet wie der offizielle Sprecher der Familie, so als sei deren Eintracht so vollkommen und leicht und leuchtend, daß sie sich ohne die kleinsten Schattenseiten dem erstbesten Fremden offenbaren kann.
Ich höre schon gar nicht mehr zu, versuche mich ganz der Nacht und den Vibrationen des Motors zu überlassen, dem Summen, das ich vor Müdigkeit in mir spüre; ich schalte ab, ich bin nicht mehr zu erreichen.
Dann waren wir schon da: Der Range Rover ist im Dunkeln in eine kleinere Straße abgebogen, die durch einen dunklen Wald bergauf führte, unter den breiten Reifen knirschten Erdbrocken und kleine Steinchen; die Straße mündete auf einen kleinen Platz.
Unter einem großen, weihnachtlichen Lichterbogen, der wie ein Zirkuszelt über den Platz gespannt war, hielt Vittorio an. »Wir sind da, lieber Uto«, sagte er und schob mich [28] hinaus, sprang selbst aus dem Auto und ging nach hinten, um die Einkaufstüten auszuladen; Jeff-Giuseppe nahm meine Reisetasche. Die Luft war noch klarer und leerer und eisiger als am Flughafen; das Leder meiner Jacke und meiner Hose war im Nu gefroren, wurde hart und brüchig wie die Haut eines Fisches, der im Fischgeschäft auf Eis liegt.
Das Haus gleicht einem großen Kasten aus hellem Holz und Glas, gelbes Licht beleuchtet Deckenbalken und helle Holzmöbel und einen Weihnachtsbaum und breitet sich nach draußen aus, flutet über den Platz bis zum Rand des dichten schwarzen Waldes, der ihn umschließt. Vittorio Foletti geht mit seinen Einkaufstüten voraus, Jeff-Giuseppe, gebeugt unter dem Gewicht meiner Reisetasche, hinter ihm her, ich folge als letzter und würde statt einem Schritt vorwärts am liebsten jedesmal einen Schritt zurück machen.
Jemand öffnet die Schiebetür aus Glas, ein großer heller Hund kommt herausgestürmt und begrüßt freudig Vittorio und Jeff-Giuseppe, steckt mir keuchend die Schnauze zwischen die Beine. Ich versetze ihm einen kräftigen Stoß mit dem Knie, so schnell, daß seine Besitzer es nicht sehen; der Hund stößt ein dumpfes Jaulen aus und rennt zu Vittorio zurück, der schon bei der Glastür angelangt ist.
Die zweite Hälfte der Familie Foletti erwartet mich gleich hinter der Tür, Vittorios Frau Marianne und Nina, Vittorios Tochter aus seiner ersten Ehe, wie mir meine Mutter erklärt hat, beide in fast gleichen, hellen Kleidern, aber vom Typ und von der Hautfarbe her ganz verschieden. Sie winken und lächeln, als ihre Männer mit mir im Schlepptau hereinkommen. Sobald wir alle drin sind, wird die Tür [29] wieder zugeschoben; wir stehen in einem verglasten Windfang, einer Art Schleuse zwischen draußen und drinnen, mit Schränken und Bänken und Schuhregalen und einer zweiten Schiebetür, die ins Wohnzimmer führt. Die beiden Frauen rufen: »Hallo, da seid ihr ja endlich«, mit sich überlagernden, freundlichen Stimmen, herzlichem Lächeln, Willkommensgesten.
Uto Drodemberg streckt die Hand aus, er versucht gar nicht erst zu lächeln. Aber er hat Stil, er hat Stil, in solchen Dingen braucht er nur seinem Instinkt zu folgen. Obwohl er müde ist und noch benommen von der Reise und vom Jetlag, geht von seiner mageren, elastischen Gestalt eine Anziehungskraft aus, die ihr Ziel erreicht und erwidert wird: Man spürt es an den Reaktionen, an jedem Blick und jeder kleinsten Geste in dem Hin und Her von Blicken und Bewegungen, an den Worten, die ausgerufen oder beiläufig fallengelassen werden. Er ist zu allem fähig, wenn er nur ein Publikum hat, und sei es noch so klein; nur darf man ihn nicht mit einem Familienoberhaupt voller kaum verhohlener Urteile-Nichturteile und einem untertänigen, vom Vater hoffnungslos unterdrückten Sohn in einem Auto einsperren.
Das Familienoberhaupt zog sich die Schuhe aus, öffnete die zweite Schiebetür und betrat das Wohnzimmer, drängte im Vorbeigehen seine Frau Marianne noch näher zu mir hin. Seine Tochter, brünett und mager, mit großen Augen und Gesichtszügen, die denen des Vaters ähneln, hat sich nach der ersten Begrüßung in den Hintergrund zurückgezogen. [30] Vittorio konnte es nicht lassen, uns vorzustellen, obwohl es wirklich nicht mehr nötig war; er übertönte die Stimmen der anderen, machte ausladende Gesten mit seiner großen Hand.
VITTORIO Uto, Kaliani, Nina. Marianne heißt jetzt Kaliani.
MARIANNE Aber du kannst mich nennen, wie du willst, Uto. Wie es dir leichter fällt. Willkommen!
NINA Willkommen!
(Sondierende Blicke von Marianne auf meine Frisur, meine Jacke und Hose aus Leder und auf die Stiefel, die Stiefel!)
MARIANNE Würde es dir was ausmachen, sie auszuziehen? Wir ziehen immer die Schuhe aus, hier drinnen.
(Sie lächelt dabei, genau das gleiche Lächeln wie ihr Mann, und ihre Stimme ist erfüllt von Milde und Gelassenheit, doch ihre Forderung klingt deshalb keineswegs weniger streng.)
Uto gibt keine Antwort, er nickt nur leicht, als spräche er eine andere Sprache und verstünde die genaue Bedeutung der Worte nicht, und es ist ja wirklich beinahe so, er ist an einem fremden Spieltisch und kennt die Regeln des Hauses nicht. Mariannes Ton ist so freundlich und liebenswürdig, daß ihre Frage wie eine richtige Frage klingt, auf die er antworten könnte: »Ach ja? Ich lasse meine aber lieber an, tut mir leid«, doch ihr Blick, so strahlend er ist, hat viel mehr Schärfe als ihre Worte; er ist ein regelrechter Prinzipienwächter, dem schwer zu entrinnen ist.
Also schnallt Uto seine Motorradstiefel auf, mit vor Müdigkeit und Wut und dem Gefühl der Demütigung [31] ungeschickten Fingern, zieht sie aus und stellt sie in das Schuhregal, als koste es ihn nicht die geringste Mühe.
Dann geht er mit dem festesten Blick, den er zustande bringt, ins Wohnzimmer, obwohl seine Aufmerksamkeit von seinen so unbedeckten und verletzlichen Füßen abgelenkt wird. Ihm scheint, daß durch den Verlust der Stiefel seine ganze Gestalt unproportioniert wirkt, daß ohne das Gewicht der Schuhe und ohne ihren Halt das Gesamtbild einen kläglichen Ansehensverlust erleidet. Noch dazu hat er Löcher in den Socken, dem einzigen Paar, das er mitgebracht hat, deutlich sichtbare Löcher an den Spitzen, und die ledernen Hosen sind ohne die dicken Stiefelsohlen zu lang, er muß sich bücken und sie Umschlägen, damit sie nicht am Boden schleifen. Zum Ausgleich nimmt er den Ausdruck eines christlichen Märtyrers an, einen erhabenen, gleichmütigen Ausdruck, der es ihm verwehrt, das geringste Interesse für das Wohnzimmer und die Möbel und das Klavier und die anderen Gegenstände im Raum zu zeigen. Der Teppichboden ist so weich, wie er noch keinen unter den Füßen gespürt hat, da muß eine Schaumgummischicht darunter sein, die jeden Schritt dämpft, aber das gibt ihm erst recht das Gefühl, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein.
Vittorio machte sich zwischen Kühlschrank und Küchenschränken zu schaffen, und Jeff-Giuseppe half ihm, Nina hielt sich mit hängenden Armen in ein paar Metern Entfernung, der Hund Geeno lief von einem Familienmitglied zum anderen, mir blieb er zum Glück fern. Marianne lächelte mich unentwegt an, produzierte freundliche Sätze [32] und Willkommensgesten, klopfte Kissen auf den Sofas zurecht, fixierte mich mit ihrem unverhüllten, himmelblauen Blick mit unbewegten Wimpern.
MARIANNE Und wie geht es deiner Mutter?
(Teilnahmsvoller Ton, Rührung und Trauer im Blick.)
UTO Bestens.
Nina sieht zu uns herüber, sie hat sanftere Züge und ist keineswegs häßlich, obwohl sie ihre Körperformen unter einem mindestens vier Nummern zu großen Pullover versteckt. Die beiden Männer sind immer noch am Kühlschrank beschäftigt, Vittorio gibt Jeff-Giuseppe Anweisungen im Ton perfekten Wohlwollens. Wieder Mariannes sondierender Blick. Mitleid-Verständnis-Rührung, edle Gefühle vereinen sich zu einem einzigen Strom. Sie kommt auf mich zu, streicht mir mit der Hand über die Schläfe, umarmt mich mit einem schrecklich sanften und tiefen Seufzer.
MARIANNE Furchtbar muß das für euch gewesen sein. Aber so war es vorbestimmt, wir müssen es akzeptieren. Du wirst sehen, hier geht es dir bald besser, dieser Ort ist so voller spiritueller Energie. Wir mögen dich, wir alle.
Glücklicherweise zieht sie sich wieder zurück, wenn auch nur ein kleines Stück. Ihren deutschen Akzent hat sie genauso unter Kontrolle wie ihr Mienenspiel, er klingt so abgeschwächt und mild, daß ihm kaum noch etwas von seiner Natur als Angriffswaffe bleibt. Offener Blick, offene Gesten, offene Bewegungen, die alle ineinanderzufließen scheinen.
Blicke von Vittorio vom Kühlschrank her. Verstohlene Blicke der Kinder. Lächeln von allen Seiten; ich bin dem hoffnungslos ausgeliefert; auf so etwas war ich nicht [33] vorbereitet, obwohl ich mich doch auf das Schlimmste gefaßt gemacht hatte.
UTO Mir geht es bestens, danke.
MARIANNE Natürlich. Aber wir möchten, daß es dir noch besser geht.
Ich nehme meine Sonnenbrille ab, um ihr zu zeigen, wie gut es mir geht: Das warme Licht dringt mir zusammen mit ihren lächelnden Blicken in die Augen, läßt mich fast taumeln. Ich muß meinen Blick auf irgendeinen Gegenstand heften, mich an irgend etwas festhalten.
Neben dem Kamin steht ein Weihnachtsbaum, bunte Glaskugeln und Schleifchen und Sternchen an jedem Zweig, darunter eine Krippe, noch dazu selbstgebastelt, aus Sperrholz ausgesägt, daneben ein paar Päckchen und Pakete; bei ihrem Anblick erfaßt ihn plötzlich ein so heftiges Gefühl der Nichtzugehörigkeit, daß er sich am liebsten Stiefel und Jacke anziehen und hinaus in die Nacht laufen und rennen, rennen, rennen möchte, ohne stehenzubleiben.
MARIANNE Du wohnst in Jeffs Zimmer. Da oben.
(Sie deutet auf die helle Holztreppe, die auf einer Seite des Wohnzimmers nach oben führt.)
UTO Ach nein, ich kann doch auf dem Sofa schlafen, oder im Keller.
NINA Im Keller?
(Sie lacht: die Wölbung ihrer Stirn, eigenwillig und auch sinnlich, wie bei einem jungen, nur scheinbar unschuldigen Wal.)
MARIANNE Es ist schon so abgemacht, das Bett ist bereits bezogen. Jeff schläft unten im Gästezimmer. Er freut sich, wenn er ein kleines Opfer für seinen Nächsten [34] bringen kann. Es ist für uns alle ein wunderbares Geschenk, daß du gekommen bist.
Ein sicheres Mittel, mir seinen Haß zuzuziehen, noch bevor ich ihn richtig kenne, dachte ich. Ich zuckte nur leicht mit den Schultern, um Nichtanteilnahme zu bekunden, Nichtschätzung einer Geste, die ich nicht verlangt hatte.
MARIANNE Willst du dir die Hände waschen, dich ein bißchen frisch machen? Da drüben, Uto. Oben hast du natürlich dein eigenes Bad, aber hier unten kannst du das von den Kindern benutzen.
Sie legt mir eine unendlich leichte und zielsichere Hand auf die Schulter, um mich in die richtige Richtung zu schieben und mir Wärme und Anteilnahme zu vermitteln.
Ich schloß die Badezimmertür hinter mir und drehte zweimal den Schlüssel um, ließ das Wasser laufen, betrachtete mich im Spiegel; ich war nicht einmal sicher, ob ich mich wiedererkennen würde. Ich spürte immer noch die Vibrationen des Flugzeugs in mir: immer noch dieses Dröhnen in den Ohren, das Gefühl, auf schwankendem Boden zu stehen, unter mir nichts als Leere. Wenn ich mich so im Spiegel sah, hätte ich jeder x-beliebige andere sein können; kein Detail meines Gesichts gab mir die absolute Gewißheit, daß es zu mir gehörte. Ich machte meine Haare naß, richtete sie mit ein paar raschen Handbewegungen wieder auf, blickte mir fest in die Augen, aber das änderte nicht viel.
Dann lümmelte ich mich auf das Sofa, in diesem makellosen Haus fremder Leute, und verfolgte beiläufig das Hin und Her der Familie Foletti zwischen der Küche und den Zimmern und dem Kamin und dem Weihnachtsbaum, [35] umgeben von dem Harzgeruch, der aus den Balken, den Paneelen und Möbeln drang. Nina war in ihrem Zimmer irgendwo im Haus, auch Vittorio und Marianne hatten sich zurückgezogen, Jeff-Giuseppe saß mit gekreuzten Beinen auf dem Boden vor dem Fernseher, in dem eine Quizsendung lief, unscharf und flimmernd, fast nichts war zu erkennen.
»Kommt nichts Besseres?« frage ich ihn, so wenig freundschaftlich wie ich kann, mit dem Blick zum Fernseher, nicht zu ihm.
Er dreht mit verzweifelter Miene die Handflächen nach oben, sagt: »Das ist das einzige Programm, das wir empfangen können. Meine Mutter wollte keine Parabolantenne. Sonst sitzen wir den ganzen Tag vor dem Fernseher, sagt
sie.«
»Und was sagst du?« frage ich ihn.
Er sieht mich an, als ob er den Sinn meiner Frage nicht verstünde, und bewegt nur die Lippen wie ein hilfloser Fisch.
Inzwischen ist seine Mutter hereingekommen, anders gekleidet als vorher, aber immer noch in Weiß und hellen Aprikosentönen; sie sagt: »Schalte das Ding aus und mach dich fertig, wir wollen gleich gehen.« Jeff-Giuseppe gehorcht und läuft schnell hinaus; seine Mutter macht eine halbe Umdrehung zu mir hin. »Bist du zu müde, oder hättest du Lust, mit uns zur Kundalini Hall zu kommen?«
Auch dies nur eine Scheinfrage, sie zog gar nicht in Betracht, daß ich wirklich antworten könnte, ich sei zu müde und wolle lieber dableiben. Ihr Lächeln, ihre blauen Augen, ihre nervöse Gestalt unter den weichen wollenen Kleidern [36] drückten unbeugsame Erwartung aus: bedingungslosen Einsatz für ein Programm, ohne Spielraum für Kompromisse oder Änderungen. Vittorio und Nina erschienen im Wohnzimmer, und einen Augenblick später folgte Jeff-Giuseppe, auch sie in anderen, aber ebenfalls hellen Kleidern; mit langen Blicken und immer neuem Lächeln gingen sie an mir vorbei in den Windfang hinaus.
Ich stand auf und zog mir Stiefel und Jacke an, folgte Familie Foletti in die kristallklare Nachtkälte hinaus und dachte mit Bedauern an das Sofa in dem geschützten und gut isolierten Raum. Ich fragte mich, ob es Feigheit oder Trägheit oder so etwas wie eine passive, formlose und ziellose Neugier war, die mich trieb, in Situationen, in die ich geraten war, bis zur äußersten Grenze zu gehen, mich immer weiter und immer tiefer hineinziehen zu lassen. Auch wenn ich innerlich vor Unduldsamkeit und Ärger kochte, dauerte es eine ganze Weile, bis ich mich entschloß, ein Ende zu machen. Ich mußte mein Terrain und die anderen Figuren auf dem Terrain erst genau kennen; ich war langsam, wenn es darum ging, Signale zu entschlüsseln, Situationen zu verändern.
Erneut im Range Rover, diesmal auf dem Rücksitz zwischen Jeff-Giuseppe und Nina, immerhin ermutigt durch die Motorradstiefel, die wieder fest an meinen Füßen sitzen, und meine Lederjacke, die wie ein millimeterdicker Schutzpanzer für meine Wesensart war. Die Folettis duften nach Neutralseife und Mandelmilch, nur ich rieche nach Schmutz und nach Moschus, aber es mißfällt mir nicht.
Während wir die ungeteerte Straße entlangfahren, gibt [37] Marianne vorne neben Vittorio Erläuterungen, die für mich bestimmt sind: Sie deutet ins weiße Scheinwerferlicht hinaus, nach rechts und nach links, sagt: »Der ganze Wald gehört der Gemeinschaft, fünfhundert Hektar. Hat Vittorio dir eigentlich schon etwas über Peaceville erzählt?«
Vittorio verneint mit einer ruhigen und gelassenen Kopfbewegung: der perfekte Ehemann in einer Atmosphäre ungetrübter Zuverlässigkeit und Eintracht und Harmonie.
»Da ist einmal der Tempel, in dem gebetet und meditiert wird«, erklärt Marianne. »Dann die Kundalini Hall, wo gegessen wird und Ansprachen und Konzerte und Feste veranstaltet werden. Dann das Ashram, dort leben diejenigen, die schon auf einer höheren Stufe sind, oder Alleinstehende oder Leute, die nur für kurze Zeit hierbleiben. Alle anderen wohnen in ihren eigenen Häusern.«
»Das ist das Besondere hier«, fügt Vittorio an. »Jede Familie hat ihr eigenes Leben und ihren eigenen Bereich und alles, jeder kommt zum spirituellen Zentrum, wann er will. Das ist das Geniale an der Idee des Gurus. Peaceville ist keine spirituelle Kolonie, wie so viele andere Gemeinschaften. Auch nicht so was wie ein Feriendorf oder eine spirituelle Wohngemeinschaft, sondern eine spirituelle Siedlung mit einem Zentrum. Du sitzt nicht ständig den anderen auf der Pelle. Dazu besteht gar keine Notwendigkeit.«
»Aber du weißt, daß die anderen da sind«, sagt Marianne mit beseelter Stimme. »Und du weißt, daß der Swami da ist, immer. Auch jetzt, während er sich erholen muß und nicht in der Öffentlichkeit erscheinen kann. Er ist der Mittelpunkt von Peaceville, alles dreht sich um ihn. Er braucht sich gar nicht zu zeigen. Er braucht nichts zu sagen. Seit er [38] die letzte öffentliche Ansprache gehalten hat, sind fast zwei Jahre vergangen, und trotzdem erfahren wir von ihm alles, was wir brauchen.«
Sie dreht sich um und sieht mich an, um sich zu vergewissern, daß ihre Informationen mich auch erreichen; dann zeigt sie wieder hinaus. »Dort wohnt ein Freund von Jeff, und da unten ist das Haus von Saraswati.«
Auf der holprigen Straße stößt mein rechtes Knie dann und wann an das linke Knie von Nina; sie zieht es jedesmal schnell weg, aber ich spüre trotzdem einen kleinen elektrischen Schlag vom Bein über die Leistenbeuge die Wirbelsäule hinauf. Sie riecht nach grünem Apfel, herb und fruchtig. Wenn sie sich bewegt, geht eine laue Wärme von ihr aus. Ich vermeide es, sie anzusehen, ich blicke geradeaus auf die zwei Lichtkegel der Scheinwerfer, auf die Straße, die durch den Wald zur Staatsstraße hinabführt.
Gerade als ich mich ans Halbdunkel und an die halben Berührungen und tiefen Atemzüge und an das Vermeiden direkter Kontakte gewöhnt habe, sind wir schon da: Die Räder hören auf zu rollen, Bremsen werden gezogen, Türen geöffnet: eisige Luft, Bodenberührung, weite Nacht, grenzenloser Raum; die Beine in Bewegung setzen, Haltung und Gesichtsausdruck wieder unter Kontrolle bringen. Wenn ich könnte, würde ich am liebsten immer nur in Zwischenstadien leben, ohne Ausgangs- und Zielpunkte und ohne Zwecke, die erfüllt werden müssen, in ungewisses Taumeln versunken, vor der Welt beschützt, mit vage kreisenden Gedanken, ohne auf etwas Bestimmtes zu warten (oder auf alles wartend: auf plötzliche Veränderungen und Wandlungen und von einer Sekunde zur anderen sich eröffnende, [39] überraschende Horizonte, auf einen Brief im Briefkasten oder irgendeinen Gegenstand auf dem Boden vor mir, auf eine unverhoffte Begegnung, die Kettenreaktionen nach sich zieht).
Wir gingen einen gepflasterten Weg hinunter und kamen zu einer Art großer Scheune, die mit bunten Lichtern geschmückt war; Marianne und Vittorio und Jeff-Giuseppe und Nina blieben stehen, drehten die Köpfe in alle Richtungen, lächelten, faßten einander an den Armen, strömten über vor Begeisterung und Festtagsstimmung.
Marianne klopfte mir auf die Schulter: »Willkommen in Peaceville, Uto!« – »Ja, willkommen!«, sagte Vittorio. – »Willkommen, willkommen«, wiederholten Jeff-Giuseppe und Nina etwas schüchterner. Leute gingen an uns vorbei auf den großen geschmückten Bau aus Holz zu, alle lächelten und teilten unterschiedslos liebevolle Gesten aus.
Vor der Tür würde ich am liebsten kehrtmachen, mich wieder ins Auto setzen und schlafen; sollen die Folettis doch Silvester feiern, soviel sie wollen; vielleicht würde ich erfrieren, ohne daß es jemand merkt, und ihnen nachträglich das Fest verderben, wenn sie mich auf dem Rücksitz finden, steif wie ein Denkmal der Nichtzugehörigkeit; sie würden sich bestürzt ansehen und zu den anderen Teilnehmern der Feier eilen, um Hilfe zu holen – zu spät.
Statt dessen folge ich ihnen durch den mit kleinen flimmernden Lämpchen geschmückten Eingang in einen großen Raum, der erfüllt ist von gelbem Licht und Wärme und dem Geruch nach indischen Räucherstäbchen und Gewürzen, Curry und Ingwer und Zimt und Nelken. Frauen und Männer in hellen Kleidern in ländlichem oder indischem Stil [40] ziehen sich die Schuhe aus und stellen sie auf lange Schuhbänke und hängen ihre Mäntel an die Garderobe, sehen sich in Strümpfen um und lächeln sich an und berühren sich an den Armen und sprechen flüsternd miteinander wie in einer großen Höhle oder Kirche oder Bibliothek oder in einem Refektorium, während sie mit leisen, gedämpften Schritten auf die nächste Tür zugehen.
Uto Drodemberg, der sich durch die Halle voll flüsternder und lächelnder Leute bewegt, ähnlich einer Fliege, die in der Milch schwimmt. In Lederkleidung unter all diesen weichen Wollstoffen, mit Sonnenbrille inmitten all dieser ungefilterten Blicke, schwarz in einem Meer von blaßrosa und pfirsich- und aprikosen- und creme- und elfenbeinfarbenen und weißen Tönen, seine gebleichten, steil in die Höhe stehenden Haare mitten unter den kurzgeschorenen oder kahlen grauen Köpfen, den Bärten und Pferdeschwänzen und Zäpfchen und Mönchskappen. Keiner dreht sich nach ihm um, aber er spürt genau den Strom der Aufmerksamkeit, die heimliche Neugier und Verwunderung. Da ist dieser krasse Gegensatz zwischen ihm und den anderen: wie ein Gewalttäter in einem Porzellangeschäft, wie ein vom Overdrive verzerrter E-Gitarrenton in einem Streichorchester. Nicht schlecht, bis auf die tonnenschwere Langeweile: Der Kontrast löst einen Adrenalinstoß in ihm aus, der seine Muskeln am Bauch und an den Beinen und am Rücken strafft und seinen Gang noch federnder und eleganter, seinen Gesichtsausdruck noch faszinierender als sonst macht.
[41] Marianne zog sich wie in einer eigens für mich bestimmten Pantomime die gefütterte Jacke und die Schuhe aus und zeigte mir die Schuhbank und die lange Reihe Kleiderhaken, wo ich meine Sachen lassen sollte. Ich gehorchte so gleichgültig, wie ich konnte, ohne auf die anderen Mitglieder der Familie Foletti zu achten, die ihre Jacken und Schuhe ablegten und dabei nach allen Seiten unablässig Grußgesten und Lächeln und leise Glückwünsche austeilten.
Hinter der zweiten Tür war ein noch größerer und höherer Saal, er glich einer mystischen Scheune mit einer hellen Balkendecke und Teppichen auf dem Fußboden. In langen Reihen waren schmale, niedrige Tische aufgestellt, vorn gab es eine kleine Bühne, darauf einen von einer Lampe angestrahlten Sessel und die lebensgroße Pappfigur eines alten, weißbärtigen Inders, bekränzt mit Girlanden aus echten weißen und gelben und roten Blumen. Intensiver Duft von indischen Gewürzen, vermischt mit dem Geruch von Suppe und Kokosmehl; ein monoton murmelnder Chor, begleitet von einem an- und abschwellenden Singsang. Ich stellte mich mit Marianne und Vittorio und den beiden Kindern in die Warteschlange vor der Theke, an der Teller mit rohem Gemüse und Linsen und Nudeln und Sesampaste und anderen fleischlosen Gerichten gefüllt wurden. Ich hatte nicht die geringste Lust mich anzustellen, ich wollte auch nichts essen; von der Reise und der Zeitverschiebung hatte ich einen metallischen Geschmack im Mund, und das Summen in meinen Ohren ließ nicht nach; ich drückte meine Sonnenbrille fester auf die Nase, versuchte wenigstens eine gute Haltung zu bewahren.
Vorn im Saal ist eine ältere Frau in pfirsichfarbenen [42] Kleidern, die wie eine Nonne aussieht, auf die kleine Bühne gestiegen und beginnt eine eintönige Melodie ins Mikrophon zu summen, die über die Lautsprecher an den Wänden in den Saal übertragen wird. Sie legt die Hände aneinander und neigt immer wieder den Kopf, murmelt irgend etwas über das Jahresende und das neue Jahr vor sich hin, so leise, daß es fast nicht zu verstehen ist, wie eine Großmutter, die ihr Enkelkind in den Schlaf lullen will. Ein merkwürdiger Widerhall läßt die Töne noch gedehnter klingen, macht die begleitenden Gebärden der Frau noch langsamer. Die Leute im Saal sehen aus, als würden sie gleich einschlafen, so versunken und entspannt und still sitzen sie alle mit gekreuzten Beinen auf den Teppichen und beugen sich mit rhythmisch wiegenden Bewegungen über die langen, niedrigen Bänke, um ihre Teller voller Gemüse und Getreidekost zu erreichen.
Eine schwammige Dame häufte mir die gleichen Speisen auf den Teller wie den anderen und fragte mich lächelnd: »Wie geht es dir?«, so als hätte sie einen besonderen Grund für ihr Wohlwollen. Ich gab keine Antwort, ich horchte auf das kollektive Summen, mit dem die Leute im Saal ab und zu auf den Singsang der nonnenähnlichen Alten am Mikrophon antworteten. Marianne wich nicht von meiner Seite, als meine eifrige Betreuerin zeigte und erklärte sie mir alles und versuchte mich aufzumuntern. Zu der schwammigen Dame sagte sie: »Unser Freund Uto ist heute aus Italien gekommen.« – »Wie schön«, antwortete diese mit einem breiten Lächeln, so als sei die Nachricht von höchster Wichtigkeit und doch völlig unbedeutend.
Ich wünschte mir nur, sie würden mich in Ruhe lassen, [43] ich war zermürbt vor Müdigkeit, die Augen taten mir weh, mein ganzes Gesicht schmerzte bei der bloßen Vorstellung, wieviel Muskelanspannung das dauernde Lächeln erfordern mußte, das ich ringsherum sah.
Dann sitze ich mit gekreuzten Beinen zwischen Marianne und Vittorio auf dem Teppich vor einem der niedrigen schmalen Tische; wenigstens sieht man so die Löcher in meinen Strümpfen nicht. Ich bin nicht hungrig, und auf meinem Teller sehe ich auch nichts, was einen richtigen Hunger stillen könnte: nur Körner und Grünzeug und schlappe, fade, kalte Nudeln. Ich beobachte die anderen beim Essen.
Links von mir ißt Marianne mit gezielten kleinen Gabelbewegungen, sie macht den Mund kaum auf und kaut ausgiebig, ab und zu löst sie ihren Blick von der Nonne auf der Bühne, um ihrem Mann und den Kindern und mir zuzulächeln. Vittorio rechts neben mir schaufelt mit gesenktem Kopf und gefräßiger Energie alles auf seinem Teller in sich hinein, der doppelt so voll ist wie die anderen. Er wirkt unter all den sanftmütigen und blutleeren Leuten leicht deplaziert, ein bißchen zu erdnah und impulsiv, mit einem Hang zu kräftigeren Speisen und Tonlagen als dem friedlichen und wohlwollenden Gemurmel um ihn herum. Doch dann wendet er sich seiner Frau zu und streift lächelnd ihren Arm, und man merkt, wie hart er an sich gearbeitet hat, um seine wahre Natur unter Kontrolle zu bringen, einzudämmen und umzulenken. Er ist überzeugt, sich gründlich gebessert zu haben, und ist sicher stolz darauf; manche seiner Gesten sehen aus, als mache er sie nur, um seine Fortschritte zu überprüfen, sich ihrer zu vergewissern.
[44] Jeff-Giuseppe ist beim Essen genauso linkisch wie bei allem, was er tut: Mit dem Gesicht fast im Teller stopft er sich den Mund so voll, wie es nur geht, schlingt alles fast unzerkaut hinunter; nur wenn seine Mutter mit wohlwollend-prüfendem Blick zu ihm hinübersieht, reißt er sich zusammen, kaut die nächsten fünf Minuten auf einer kalten Maultasche herum. Nina dagegen ißt gar nichts: Sie stochert nur mit der Gabel auf dem Teller herum, schiebt das Essen zu einem Häufchen zusammen, legt die Papierserviette darauf, um es zu verstecken. Marianne sieht es genau, aber sie sagt nichts, schüttelt nicht einmal den Kopf, sie atmet nur tief durch.
Viel gesprochen wird nicht; jeder scheint sich an die Regel »Viel lächeln und wenig reden« zu halten, alle folgen versunken dem Geschehen auf der kleinen Bühne, wo die alte Nonne gerade von einer jüngeren abgelöst worden ist, die wie eine Japanerin aussieht. Marianne beugt sich zu mir und flüstert mir ins Ohr: »Die Hauptassistentin des Swamis.« Ausdrucksvolles »S«. Warmer Atemhauch. Leichte Berührung. Geruch nach Mandelmilch. Oberflächliche Hautreaktion.
Die Assistentin spricht über den Swami, berichtet, daß es ihm bessergehe und er, so Gott wolle, bald wieder unter uns weile, dann erzählt sie, was er an früheren Silvesterabenden gesagt hat, daß jedes Fest seine Wichtigkeit habe, weil es ein Anlaß ist, sich mit anderen zu treffen und zu freuen, und ein großes Ereignis für die Kinder. Ich höre zu und schaue hin und wieder zu ihr hinauf, knabbere an den salzlosen Speisen; der Kopf dreht sich mir, und in meinen Ohren rauscht es; ein paarmal steigt eine Welle von [45] Übelkeit in mir auf, ich fühle mich der Ohnmacht nahe. Marianne bemerkt es schließlich, sie fragt: »Fühlst du dich nicht wohl, Uto? Du bist blaß.«
»Mir geht es ausgezeichnet«, antworte ich, und sofort verschwindet die Besorgtheit wieder, die auf ihren Zügen erschienen war, sie lächelt, lauscht erneut hingerissen den Worten der Guruassistentin. Im Saal herrscht soviel edle Gesinnung und gegenseitige Achtung und höfliche Zurückhaltung, daß einer stundenlang halbtot auf dem Boden liegen könnte, bevor sich jemand entschließen würde einzugreifen. Ich bin müde, erschöpft und benommen wie ein deportierter Kriegsgefangener, ich würde viel lieber im Bett liegen, statt hier auf dem Boden zu sitzen und nicht einmal meinen Rücken anlehnen zu können. Soviel ich mich auch umsehe in diesem mystischen Schuppen, ich kann niemanden in meinem Alter erblicken, alle sind dreißig, vierzig, fünfzig oder wirklich steinalt, dazu ein paar Kinder. Nur ein Junge in Ninas Alter ist darunter, und natürlich tauschen sie ab und zu Blicke aus der Ferne; einige der Kinder sind in Jeff-Giuseppes Alter. Ich kann mir vorstellen, was für ein Alptraum es für sie sein muß, hier zu leben, als Gefangene ihrer Eltern in dieser Atmosphäre einer von der Welt abgeschnittenen Insel; ich glaube, an ihrer Stelle würde ich alles tun, um von hier wegzukommen.
Abgezehrt, bleich, frei von allen Zweifeln saß die Guru-Assistentin im Lotussitz auf einem Kissen und erzählte ganz alltägliche Episoden aus dem Leben des Gurus, als handle es sich um die erstaunlichsten Geschichten. In einem milden und süßlichen Ton, der vielleicht bei kleinen Kindern oder Halbidioten angebracht gewesen wäre, hauchte [46] sie ins Mikrophon, das sie sich so dicht vor den Mund hielt, daß den Leuten im Saal jede kleinste Zungenbewegung und jedes Atemholen vielfach verstärkt in den Ohren hallte, und begleitete ihre Worte mit kleinen Grimassen. »Und nun sehen wir einen kurzen Film mit unserem lieben Swami, der hoffentlich sehr bald wieder persönlich zu uns sprechen kann«, schloß sie.
Am Bühnenrand standen ein großer Fernseher und ein Videorekorder, die Guruassistentin gab zwei Swamijüngern Anweisungen; sie schoben den Apparat nach vorn und schalteten ihn an. Auf dem Bildschirm erschien der Guru, der alte Inder, dessen Abbild auf der Bühne stand. Er saß auf dem beleuchteten Sessel, der neben dem Fernseher leer geblieben war.
»Der Swami«, flüsterte mir Marianne überflüssigerweise ins Ohr; jedesmal, wenn sie mir ins Gesicht atmete oder mich auch nur ansah, raubte mir ihr leidenschaftlicher Eifer die Kraft wie ein Aderlaß. Ich fragte mich, wie jemand wie Vittorio mit ihr leben konnte; die Vorstellung, was für eine Widerstandsfähigkeit er haben mußte, machte mich wütend.
Der Guru auf dem Bildschirm sprach mit indischem Akzent mit hoher, aber ziemlich melodischer Stimme und häufigen Pausen, in denen er nur lächelte und Gebärden allumfassenden Wohlwollens machte. »Erst vor ein paar Tagen war Weihnachten, und da haben wir uns alle bemüht, besser zu sein, nicht wahr? Wir haben Geschenke gemacht und Geschenke erhalten, nicht wahr? Wir haben an unsere Freunde und Verwandten gedacht, nicht wahr? Auch an die entferntesten, nicht wahr? Und wir waren wirklich besser. [47] Wir waren durchdrungen von edlen Gefühlen. Sie lagen in der Luft. Aber jetzt, wo Weihnachten vorbei ist? Heute, am einunddreißigsten Dezember, am letzten Tag des Jahres? Da sind wir schon in einer ganz anderen Stimmung, nicht wahr? Wir sind voller guter Vorsätze, aber die haben alle mit uns selbst zu tun, nicht wahr?«
Ich blickte umher, und es kam mir unglaublich vor, daß Hunderte von Leuten in tiefem Schweigen auf dem Boden sitzen und mit dieser fokussierten Aufmerksamkeit solche nichtssagenden Banalitäten in sich aufsogen. Ihr kollektives, synchrones Atmen, als säßen sie in einem wunder wie außergewöhnlichen Konzert, machte mich wütend; wütend machte mich auch Marianne, die mit ihrem langen Hals, ihrem Profil mit der gnadenlos geraden Nase konzentriert vornübergebeugt dasaß; wütend machte mich Jeff-Giuseppe, der sich wie ein braver Schüler kein Wort entgehen lassen wollte, und Nina, die den gleichen, allerdings etwas scheinheiligen Schülerblick hatte und vielleicht an etwas ganz anderes dachte, sich das jedoch nie anmerken lassen würde.
Der einzige, der sich nicht ganz perfekt in dieses Meer von Anteilnahme einfügte, war wiederum Vittorio: Er saß zwar ganz still da, den Blick genau auf den Fernseher gerichtet, aber irgend etwas an ihm wirkte leicht verfehlt, genau wie vorhin beim Essen. Vielleicht war es die Art, wie er seinen Unterkiefer anspannte und die Augen zusammenkniff, um schärfer zu sehen, wie er den Kopf schrägstellte und ein Ohr vorstreckte. Der Teller vor ihm war leer bis auf den letzten Krümel, er hatte nicht das kleinste welke Salatblättchen liegenlassen und saß jetzt mit gerunzelten Brauen [48] vornübergebeugt da. Plötzlich wandte er sich zu mir und fragte leise: »Verstehst du alles?«
»Ja«, sagte ich; der einzige Vorteil, den ich davon hatte, ohne nationale Identität in drei verschiedenen Ländern aufgewachsen zu sein, war, daß ich fast gleich gut Deutsch, Spanisch, Englisch und Italienisch sprach.
Er nickte und sah wieder zur Bühne, wo der Bildschirm stand. Dann drehte er sich erneut zu mir und sagte zwischen zusammengepreßten Lippen: »Ich verstehe manchmal kein Wort. Vor allem, wenn es Kassetten sind. Oder abends, wenn ich müde bin.«
Seine Frau drehte sich um und warf ihm einen strengen Blick zu; sofort setzte er sich wieder gerade hin wie ein gemaßregelter Schüler. Eine Sekunde später streckte sie hinter meinem Rücken den Arm aus und strich ihm über die Schulter, um die leichte Spannung sofort wieder aufzulösen und sich einen Kuß auf die Hand geben zu lassen. Ich beugte mich vor, um ihnen nicht im Weg zu sein; eine Welle purer Unduldsamkeit schoß in mir hoch, trotz Müdigkeit, Jetlag und dem Summen in meinen Ohren.
Der Guru auf der Videokassette sagte: »Und was heißt schon, das Jahr geht zu Ende? Meint ihr etwa, der morgige Tag wird ganz anders sein als der heutige? Wirklich ein ganz neuer Tag? So wie ein neues Automodell, mit einem nagelneuen Motor und einer nagelneuen Karosserie? Man kann es kaum erwarten einzusteigen, nicht wahr?«
An dieser Stelle lachte Vittorio mit, und Marianne sah ihn immer wieder an, um Sinn und Inhalt der Ansprache zu bekräftigen, aber er war immer noch angespannt, hielt den Kopf gesenkt und die Augen halb geschlossen.
[49] »Dabei ist jeder Tag ganz anders als der andere«, fuhr der Guru auf dem Video fort. »In Wirklichkeit ist nämlich jeden Tag Silvester, jede Stunde ist Silvester. Wir aber betrachten den einunddreißigsten Dezember als eine wichtige Grenze, als eine Art Deich, der zwei große Wassermassen voneinander trennt. An Silvester können wir in das frische Wasser springen und das alte, das schon ganz verschmutzt ist, hinter uns lassen.«