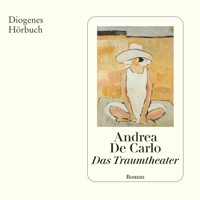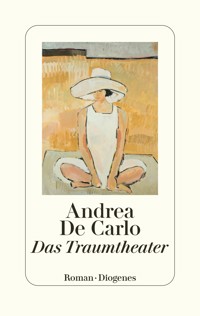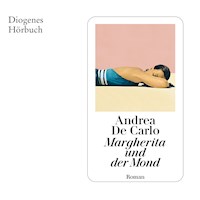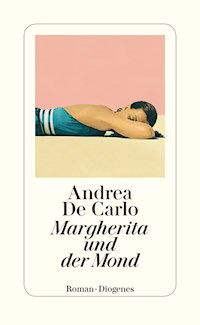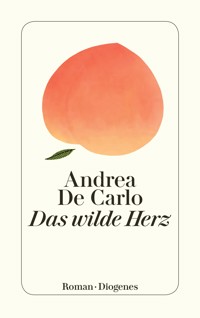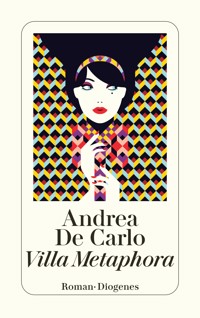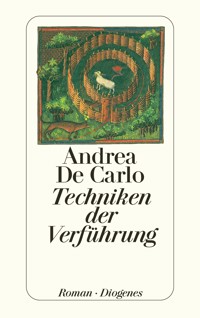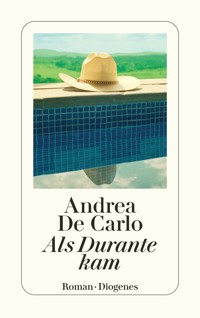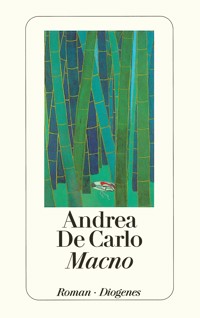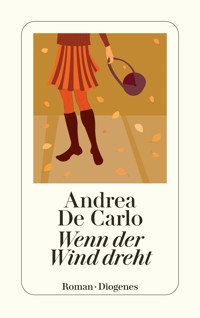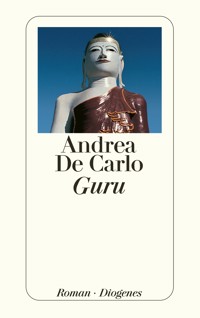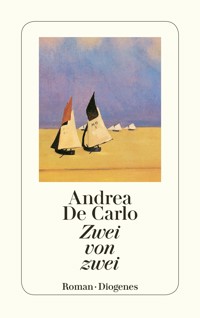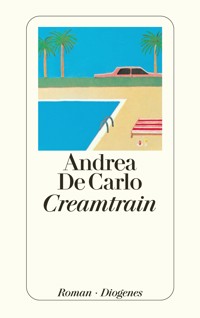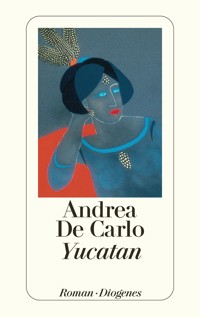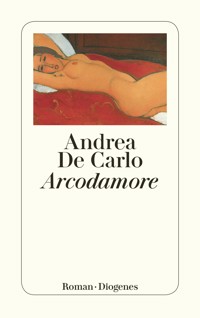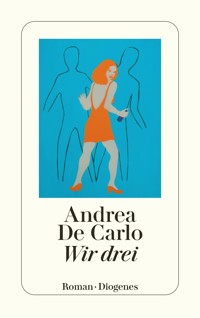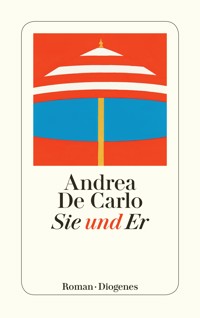
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wahre Liebe gibt es nicht. Nur Beziehungen, die ein wenig Sicherheit geben – so sieht es Clare. Oder Affären – so Daniel. Bei einem Autounfall begegnen sich die beiden zum ersten Mal. Denkbar unromantisch. Doch derart nüchtern beginnen nur die ganz großen Liebesgeschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andrea De Carlo
Sie und Er
Roman
Aus dem Italienischen von
Titel der 2010 bei Bompiani, Mailand,
erschienenen Originalausgabe: ›Leielui‹
Copyright © 2010 by RCS Libri S.p.A.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Illustration von Matt Olson
Copyright © Matt Olson/Photodisc/Getty Images
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24243 0 (2. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60137 9
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Der Autor versichert ausdrücklich, dass die Namen der Gestalten dieses Romans nicht mit denen von realen Personen oder Werken übereinstimmen, die diese auch nur teilweise inspiriert haben. Da es jedoch möglich – und in einigen Fällen sogar wahrscheinlich – ist, dass es reale Personen und Werke mit den gleichen Namen und einigen Eigenschaften der Figuren dieses Romans gibt, versichert der Autor, dass es sich um reinen Zufall handelt: Nicht von ihnen wird hier erzählt.
[7] Das Lustigste am Fliegen ohne Flügel ist, wie unglaublich leicht es geht
Das Lustigste am Fliegen ohne Flügel ist, wie unglaublich leicht es geht: Es genügt, Arme und Beine zu bewegen wie beim Schwimmen, bloß tut man es in der Luft. Es ist einfach, verlangt weder körperliche noch geistige Anstrengung, nur eine gewisse Zielstrebigkeit. Man muss bloß überzeugt sein, dass es klappt, dann klappt es.
Jetzt zum Beispiel fliegt sie flach über die dichtbewachsenen Hügel, über die tiefgrünen Reihen von Kaffeesträuchern, über die Bananenstauden mit ihren beinahe gelben Blättern, über die schmale Straße, die sich kurvig jeder Steigung und Senkung anschmiegt. Große Höhe interessiert sie nicht: Der Genuss liegt darin, im Tiefflug über die Landschaft zu gleiten, um sie in allen Einzelheiten zu genießen, die leuchtenden Farben aufzunehmen, die starken Gerüche einzuatmen, die Veränderungen der Feuchtigkeit an den Stellen wahrzunehmen, an denen die Hügelkuppen steil zum üppigen sonnenlichtgesprenkelten Dschungel hin abfallen. In diesem Zustand vollkommener Leichtigkeit fragt sie sich, wie sie sich je damit begnügen konnte zu gehen, von der Schwerkraft niedergedrückt, Meter für Meter die Reibung ihres Körpergewichts mit der harten Erdoberfläche aushandelnd. Sie beschließt, nie mehr den Boden zu berühren – von jetzt an wird sie sich nur noch fliegend [8] fortbewegen. Falls sie dann einem Mann begegnet, der wirklich mit ihr auf der gleichen Wellenlänge ist, wird sie ihm das einfache Geheimnis des In-der-Luft-Lebens verraten. Es wäre schon schön, diese Empfindungen mit jemandem teilen zu können, jemanden zu haben, mit dem man die Möglichkeiten erforschen könnte, zu trudeln und sich zu überschlagen, sich aufwärts und abwärts zu verfolgen, indem man durch die Wolken auf den Himmel zusteuert und gleich darauf zwischen den Baumkronen an den Stämmen entlang hinuntersaust und erst knapp über den Sträuchern und Grashalmen abbremst, bevor man wieder aufsteigt. Es wäre schön, zu zweit den Fluss entlangzufliegen, der jetzt am Ende eines Tals auftaucht und leuchtend blau zwischen den Ufern dahineilt. Sie lässt sich sinken, um das kühle Wasser zu streifen, und vernimmt dabei ein stotterndes Piepsen, das ihr durch Mark und Bein geht und immer stärker wird.
Dann ist sie auf einmal nicht mehr in der Luft, die ganze lustige Leichtigkeit ist dahin, und die Schwerkraft, von der sie sich für immer befreit zu haben glaubte, übt wieder ihren ganzen Druck aus. Das Piepsen geht weiter, hört aber auf, als sie die Hand ausstreckt und auf den Knopf des Weckers auf dem Nachttisch zu ihrer Rechten drückt. Da ist kein kühler Fluss mehr, nur die zerwühlten Laken ihres schmalen Bettes in ihrem kleinen Zimmer in dem hässlichen kleinen Appartement im ersten Stock am südwestlichen Stadtrand von Mailand.
Mit einem Ruck springt sie auf, um die Zwischenphasen des Erwachens abzukürzen und die Sehnsucht nach dem Traum zurückzudrängen. Geduckt öffnet sie die mit schwarzem, klebrigem Feinstaub verkrusteten [9] Fensterläden, damit man sie nicht nackt sehen kann von der total monochromen Straße aus: Asphalt, Fassaden, Himmel, alles ist grau, selbst die Autos – egal, welche Farbe sie hatten, als sie aus der Fabrik kamen.
[10] Er betritt gerade ein Haus, das er soeben gemietet hat
Er betritt gerade ein Haus, das er soeben gemietet hat, in Südfrankreich, Département Var. Der Besitzer wirkt jugendlich, trotz seiner grauen Haare und Augenbrauen, und zeigt ihm einen Garten, der von einer hohen Backsteinmauer umschlossen ist. Er weist ihn auf eine Stelle am Dach hin, wo eine Art Türmchen eingelassen ist, das die Asche einer Großtante enthält, und behauptet, er stehe mit ihr im ständigen Dialog, so als ob sie noch lebte. Jetzt zum Beispiel wendet er sich an sie und sagt so etwas wie »Beschütze diesen neuen Mieter und stehe ihm bei, solange er hier wohnt«, doch er spricht zu leise, als dass man es hören könnte. Dann treten sie ins Haus, gerade noch rechtzeitig, bevor einige Brüder und Schwestern des Besitzers eintreffen. Es ist ein Familienfest, vielleicht ein Geburtstag, das ist nicht klar. Die Männer ähneln sich alle auf beeindruckende Weise, ihre Gesichter sind feinste Variationen desselben Themas. Die Frauen dagegen sehen anders aus als die Brüder und sind auch untereinander verschieden: Wüsste man nicht, dass sie Schwestern sind, könnte man meinen, dass sie gar nicht zur selben Familie gehören. Er begrüßt alle, schüttelt Hände, lächelt, und die Sache kostet ihn zermürbende Mühe, weil er in zu viele Gesichter schauen, sich zu viele Namen merken, zu vielen Stimmen zuhören muss. [11] So schlüpft er hinaus, sobald er sich unbeobachtet glaubt, durchquert ein Wohnzimmer, wo einige Kinder herumlümmeln und Karten spielen, und geht in den Garten hinter dem Haus. Da ist ein kleiner künstlicher See, grünlich und trübe, auf dem ein altes Buch mit blauem Leineneinband und aufgequollenen gelben Seiten treibt. Er nähert sich und sieht, dass zwei Eichhörnchen mit erstaunlicher Gewandtheit im stehenden Wasser mal dahin, mal dorthin schwimmen und dabei das Buch vor sich herschieben. Auch ein paar Frösche und Molche und andere Sumpftiere huschen auf und unter der Oberfläche herum und stupsen dabei abwechselnd mit den Eichhörnchen das Buch an, man weiß nicht, ob zum Spiel oder um es dann fressen oder zerstören zu können. Jedenfalls ist es eine bedrückende Szene; der kleine Garten und das Haus verstärken seine Beklemmung noch. Er fragt sich, warum er denn je hierherwollte und wie lange er wohl bleiben muss und wozu. In seiner wachsenden Verzweiflung möchte er schreien und treten und die Luft mit Fäusten bearbeiten.
Dann spürt er einen heftigen Schmerz an der Hand, doch der fühlt sich ganz anders an als die Empfindungen von zuvor, er durchschneidet seine Gedanken. Mit einem hastigen Ruck dreht er sich um, öffnet die Augen und findet sich in seiner Zelle des Benediktinerklosters wieder, die in das Zimmer eines Hôtel de Charme umgewandelt wurde und ganz schlicht sein sollte, aber eher grauenhaft ist. Erschrocken setzt er sich auf, betrachtet seine rechte Hand: Die Fingerknöchel sind aufgeschürft und gerötet und blutverklebt. Die Heizung ist aus, seine leichte Baumwollkleidung ist für das Klima unpassend und zudem ganz [12] zerknittert, weil er darin geschlafen hat, jeder Gedanke ist zu drei Viertel verstümmelt, alles ohne Zusammenhang. Die Landschaft, die er sieht, als er aufsteht und die Stirn an die Fensterscheibe legt, ist vollgesogen mit dem Regen, der seit Tagen andauert. Der Sommer hatte gerade erst begonnen, als er sich vor zwei Wochen scheinbar endgültig zurückzog und eine Art tropische Kälte hinterließ, Hügel und Berge voller tropfnassem Grün, zwischen denen man ganz hinten in der Ferne, wenn man die Augen anstrengt, gerade noch ein Stückchen graublaues Meer erkennen kann. Auf dem Fußboden liegen überall abgerissene, zerknüllte Blätter und zwei umgedrehte kleine Lautsprecher mit USB
[13] Sie ist schon so oft an dieser endlosen Mauer entlanggejoggt
Sie ist schon so oft an dieser endlosen Mauer entlanggejoggt und weiß immer noch nicht, was sich auf der anderen Seite verbirgt, verfallende Industriehallen oder Schlafkasernen oder Labors für Tierversuche oder sonst irgendeine Bausünde, wie sie überall am südwestlichen Stadtrand zu finden sind. Sie will es gar nicht wissen, und außerdem stehen ihr, so trostlos die Szenerie auch ist, nicht viele Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, wenn sie nicht wie ein Hamster im Käfig durch die Straßen rund um ihren Block laufen oder den äußeren Umfahrungsring nehmen will, auf dem unablässig ein brutaler Verkehr tobt. Der Regen heute Morgen hat wenigstens den Effekt, dass die Landschaft großenteils verschwimmt, auch wenn es nicht direkt angenehm ist, in Pfützen zu treten und zu fühlen, wie das schmutzige Wasser über den Rand der Joggingschuhe schwappt und die Frotteesocken durchnässt. Doch ihr Bewegungsdrang ist groß, nie würde sie auf das Laufen verzichten, niemals: Sonst müsste sie jetzt in ihrem Zimmerchen sitzen und warten, bis Stefano sie abholt, um zum Mittagessen zu seinen Freunden Tommaso und Lauretta zu fahren, in die Hügel des Oltrepò Pavese.
Als Kind war Laufen ihre liebste Fortbewegungsart, auf dem Weg zur Schule oder nach Hause, um Onkel und Tante [14] oder eine Freundin zu besuchen, um einzukaufen, wenn ihre Mutter fand, dass sie an der Reihe war, um die Gegend zu erkunden, sobald sie keine dringenden Pflichten hatte. Laufen erlaubte ihr, die Abstände zu verkürzen und ihre Unruhe loszuwerden, sich aus starren Situationen und einengenden Beziehungen zu befreien, Wiederholung und Langeweile von sich fernzuhalten. Es hat sie nie Mühe gekostet, wahrscheinlich dank der Übereinstimmung gewisser körperlicher und geistiger Eigenschaften. »Wer lange Beine hat, denkt weiter«, sagte Onkel Harold. Ihre Schwester Paula gab ihr irgendwann den Spitznamen Clarie-Pony, weil sie überallhin rannte, und nach einer Weile wurde sie zu Hause von allen so genannt. Auch heute taucht dieser Name immer mal wieder auf, in einer E-Mail oder bei einem der seltenen Treffen derer, die noch übrig sind von der weitverstreuten Familie Moletto. Ihr missfällt das nicht, ihr scheint, dass er recht gut ihr unruhiges und träumerisches Wesen ausdrückt. So hat sie nun drei Namen: ihren Taufnamen, den Kosenamen der Schwester und den Namen, den Stefano ihr vom ersten Tag an gegeben hat, seit sie zusammen sind. Besser als einen einzigen, in dem dann zwangsläufig alle ihre verschiedenen Seiten Platz finden müssten, einschließlich der Widersprüche.
Dass sie schon als Kind rannte und jetzt joggt, rührt vielleicht daher, dass sie nicht gerne wartet und aller Starrheit instinktiv entkommen möchte. Die schnelle Bewegung vermittelt das Gefühl eines gewissen Abstands von der Wirklichkeit. Es ist zwar nicht wie Fliegen, aber doch eine zeitweise Befreiung von der versklavenden Langsamkeit der Schritt für Schritt, Ecke für Ecke, Gedanke für Gedanke [15] zurückgelegten Wege. Während sie durch diesen traurigen Stadtteil rennt, empfindet sie die gleiche Erleichterung wie damals, als sie mit sechs oder sieben Jahren über den kleinen Rasen vor dem Haus auf die Straße trat und allmählich beschleunigte, bis der bedrückende Teil ihres Lebens weit weg war und sie nicht mehr einholen konnte.
Nicht dass Joggen eine Methode wäre, um sich dauerhaft von allen beschwerlichen Gedanken zu befreien: Einige klammern sich auf dem ersten Stück noch an sie, und sie muss sie mit einem energischen Ruck abschütteln, andere lauern ihr auf, wenn ihre Runde endet und sie wieder normal geht. Wieder andere folgen ihr unbemerkt und blitzen plötzlich zwischen ihren raschen Bewegungen und ihren Atemzügen auf: zum Beispiel das heutige Mittagessen bei Tommaso und Lauretta, so absolut vorhersehbar, Gesichtsausdrücke und Gesprächsthemen eingeschlossen. Oder Stefanos Hang, über ihr Joggen zu lästern, die Absurdität der Energieverschwendung zu betonen, die Wahrscheinlichkeit von Schäden an Gelenken und Bändern, früher oder später. Er ist kein unsportlicher Mensch, er hat eine gute Kondition, wenn er sie zum Beispiel auf eine Bergtour oder einen Fahrradausflug mitschleppt und sie Kilometer um Kilometer zurücklegen, auf Routen, die er vorher eingehend auf der Karte studiert und festgelegt hat. Vielleicht sieht er Rennen als eine Form von Flucht, und die unbestimmte Getriebenheit, die sich dahinter verbirgt, sowie die potentiell unkontrollierbare Leichtigkeit beunruhigen ihn. Sein Sarkasmus ist vielleicht eine Schutzhaltung gegen eine Seite ihres Wesens, die er nicht ganz begreift und die ihm Angst macht. Hierzu fallen ihr noch mehr bezeichnende [16] Episoden ein, zum Beispiel der Besuch ihrer Schwester Julia, als sie noch bei Stefano wohnte. Gemeinsam hatten die Moletto-Schwestern ein schönes Abendessen vorbereitet und nach ein paar Gläsern Wein in der Küche angefangen zu tanzen und lauthals Wild Thing zu singen, und plötzlich war Stefano aus dem Wohnzimmer erschienen, um sie zurechtzuweisen mit der Behauptung, sie störten die Nachbarn. Natürlich war er es, der sich gestört fühlte, weil sein Gleichgewicht an erworbenen Gewissheiten und bewährten Verhaltensweisen ins Wanken geraten konnte durch einen unvorhergesehenen Rock-Abend. Manchmal nervt es sie, dass er so engstirnig ist und so übertrieben reagiert, manchmal findet sie es beruhigend, manchmal auch rührend, weil es eine uneingestandene Zerbrechlichkeit enthüllt. Jedenfalls sagt sie es ihm nicht mehr, wenn sie joggen geht, höchstens ganz allgemein: »Ich drehe eine Runde«, was dem Joggen letztlich noch einen feinen, kindlichen Hauch von etwas Verbotenem verleiht.
[17] Die Autobahn verpestet seine Gedanken nur noch mehr
Die Autobahn verpestet seine Gedanken nur noch mehr. Das ständige Beschleunigen und Bremsen und Spurwechseln, die rasche Verlagerung der Aufmerksamkeit nach vorn und seitlich und nach hinten im Rückspiegel, die Vorwegnahme idiotischen oder offen kriminellen Verhaltens seitens der anderen Autofahrer – alles zerrt an seinen Nerven. Das Verdeck seines grünen, vierzehn Jahre alten Jaguars XJS Cabrio knattert im Gegenwind, als würde es gleich aufgehen, abreißen und ihn ungeschützt dem anhaltenden Regen aussetzen. Es ist ein Jaguar aus der schlechtesten Periode, mit einer kantigen Linienführung, die nichts zu tun hat mit den schönen fließenden Formen der sechziger Jahre und auch nichts mit dem rationaleren und lineareren Design der jüngeren Modelle. Wahrscheinlich hat er ihn deshalb gekauft: weil er ihm irgendwie verkehrt vorkam. Jetzt fährt er allerdings zu schnell für das nicht sonderlich stabile Chassis, das Gaspedal zu drei Viertel durchgedrückt, die Tachonadel zittert unentschieden zwischen 140 und 150, die Reifen verlieren gelegentlich die Bodenhaftung wegen der riesigen Pfützen und des schlechten Zustands der Aufhängung. Ab und zu nimmt er einen Schluck Wodka aus der Flasche auf dem Beifahrersitz: Er schraubt den Verschluss mit einer Hand auf und wieder zu und wirft sie zurück [18] auf ihren Platz. Ständig drückt er auf die Repeat-Taste des CD-Players, um noch einmal I Cover The Waterfront von John Lee Hooker in einer Studioaufnahme zusammen mit Van Morrison abzuspielen, aber auch auf höchster Lautstärke kommt die Musik kaum an gegen das Trommeln des Regens und das Schlagen des Verdecks und das Dröhnen des Motors und das Rollen der Reifen und das vielfältige Zischen und Sausen der Zugluft, die durch alle Ritzen des alten Jaguars dringt. Dasselbe Stück hundertmal hintereinander anzuhören, bis es zum Ohrwurm wird und er jede einzelne Passage auswendig kann, ist eine Manie von ihm. Nur so gelingt es ihm, der harmonischen Struktur auf den Grund zu gehen und zu dem durchzudringen, was hinter den Tönen steht: das Studio und die Blicke zwischen den Musikern, ihre Bewegungen und ihre Ticks, die Kombination von Fähigkeiten und Grenzen, die den besonderen Stil eines jeden hervorbringt, die plötzlichen Intuitionen, die einer Phrase ihren Sinn geben, die Höhenflüge, die Wiederholungen, die Rückkehr zum Thema, so als käme man nach Hause, beruhigend und leicht von Wehmut durchzogen beim Gedanken an das, was noch hätte geschehen können, wenn man noch länger fortgeblieben wäre.
Letztendlich heitert ihn Musik nie sonderlich auf; im Gegenteil, fast immer vertieft sie seine Traurigkeit oder erhöht seine Anspannung, so wie jetzt auf dieser Autobahn voller Pkws und Lastwagen im strömenden Regen. Obwohl er schneller fährt als erlaubt, kommen hinter ihm ständig Limousinen und Coupés und Geländewagen angerast, die ihn mit dem bläulich weißen Licht ihrer Xenonscheinwerfer anblinken und bis auf wenige Zentimeter [19] auffahren, um ihn, Stoßdämpfer an Stoßdämpfer, zum Ausweichen zu zwingen, bis er plötzlich auf die Bremse tritt und sie zwingt, ebenfalls zu bremsen und sich in die erste Lücke rechts einzufädeln und dort im wütenden Zickzack zwischen den Spuren wieder zu beschleunigen. Entweder haben sie Navigationsgeräte, die ihnen die Standorte der elektronischen Geschwindigkeitskontrollen anzeigen, oder die richtigen Kontakte, um sich die Bußgelder tilgen zu lassen, oder es ist ihnen einfach egal, und sie zählen auf die Langsamkeit der Bürokratie in der italienischen Verwaltung und ihre periodischen Amnestien. Jedenfalls fahren sie durchgehend 180 bis 200 Stundenkilometer, wenn ihnen nicht gerade ein alter Jaguar im Weg ist. Auch hier schwankt er zwischen zwei gegensätzlichen Positionen, wie bei fast allem. Er weiß genau, dass er tollkühner fahren könnte als sie alle zusammen, wenn er wollte. Es ist kein abstraktes Wissen: Er hat es im Hirn und in den Beinen, in den Füßen, in den Händen, in dem Adrenalin, das beim bloßen Gedanken in seinem Blutkreislauf zirkuliert. Es ist alles da, am Grund seiner schlimmsten Gedanken, bereit, ans Licht zu kommen. Doch kriminelles Fahren gehört zu den Verhaltensweisen, die er hasst an diesem ungezogenen, gleichgültigen, vulgären, feigen Land voller Gesetze und ohne Regeln. Die Vorstellung, dass es potentiell auch Teil seines eigenen Wesens ist, erfüllt ihn mit dumpfem Groll und treibt ihn dazu, mit 140 Stundenkilometern die Überholspur zu blockieren.
Irgendwann schaltet er den CD-Player ab, weil er nichts hören kann, zieht den MP3-Player aus dem Handschuhfach, versucht, die Kabel zu entwirren, ohne die Kontrolle [20] über das Lenkrad zu verlieren, nimmt die Ohrhörer und schiebt sie so tief ins Ohr, wie es geht. Er lässt mit dem Menü die Playlists durchlaufen bis zur Abteilung »Sprachen«, klickt wahllos auf eine aus einer sehr langen Liste von Deutschlektionen. Der Lehrer ist ein polnischer Jude mit französischem Namen, nach Frankreich ausgewandert, um der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen; später ging er in den Widerstand, wurde drei- oder viermal von den Deutschen verhaftet, entwischte aber jedes Mal, indem er vorgab, er sei ein anderer, bis er am Ende des Krieges nach Los Angeles auswanderte, um eine Sprachenschule zu eröffnen. Dass er diese Geschichte kennt, verleiht dieser Stimme eines gutmütigen alten Onkels mit oft hörbar klapperndem Gebiss einen anderen Klang; zudem ist der Typ vor ein paar Jahren gestorben, so dass bei seinen Sätzen immer auch ein leises Verlustgefühl mitschwingt.
Jedenfalls hat es etwas Hypnotisierendes, hier im ständigen Krach und Vibrieren dieses scheinbar endlose Asphaltband entlangzurasen, es erlaubt ihm, alles viel besser aufzunehmen, als wenn er es in einem Zimmer sitzend lernte. Nach vier oder fünf Lektionen, die er sich auf diversen Autofahrten angehört hat, kann er schon einige einfache Sätze bilden, wenn er auch aufgrund des Lärms keine Ahnung hat, wie seine Aussprache ist. Er hatte schon immer ein Gespür für Sprachen und Akzente, wahrscheinlich weil er sich nirgendwo recht verwurzelt fühlt und ein aus einem festen Zusammenhang herausgelöstes Individuum dazu neigt, Techniken zu entwickeln, die ihm gestatten, unter unterschiedlichen Bedingungen zu überleben. Aber natürlich geht es auch darum, immer wieder eine neue [21] Herausforderung zu suchen, um sich zu beweisen, dass man geistig noch nicht am Ende ist. Es kommt manchmal vor, dass ein Leser oder eine Leserin von vielleicht fünfundzwanzig Jahren ihn um ein Autogramm in einem Buch bittet und ihm dann erzählt, im Unterschied zu ihm leider nie aus dem Land herausgekommen zu sein und keine Fremdsprache zu sprechen. »Und was zum Teufel hindert dich daran?«, antwortet er dann jeweils und würde sie am liebsten an den Schultern packen und heftig schütteln. Ihm scheint, dass es mit Italien auch deshalb bergab geht, weil gewisse Beschränkungen einfach hingenommen werden, als ob es natürliche Barrieren wären, die unüberwindlich sind.
Er versucht, sich auf einige Verbformen zu konzentrieren, aber jedes neue Blinken und Drängen von Autos hinter ihm vergiftet sein Blut noch etwas mehr. Er würde gern einen Zustand größerer Gelassenheit erreichen und sich nicht mehr darum scheren, aber es gelingt ihm einfach nicht. Die Überholer gestikulieren wild, wenn sie schließlich rechts an ihm vorbeifahren: Sie zeigen ihm die Hörner, den Mittelfinger, schreien unhörbare, aber leicht vorstellbare Beleidigungen. Er dreht sich um, fixiert sie, fährt sich mit zwei Fingern über den Hals, um ihnen mimisch die Kehle durchzuschneiden. Die Geste dauert nur eine Sekunde, aber die Überholenden verlieren in dem Moment sichtlich die Fassung. In manchen Fällen bleiben sie etwas zurück, in anderen gestikulieren sie noch wütender und bremsen unvermittelt, sobald sie wieder vor ihm fahren, versuchen, ihn ins Schleudern zu bringen. Er reagiert genauso wüst wie sie oder noch wüster: Er würde auf sie schießen, wenn er eine Pistole oder ein Gewehr mit [22] abgesägtem Lauf hätte oder noch lieber ein auf die Motorhaube montiertes Maschinengewehr oder eine Bazooka, die man per Knopfdruck am Steuer bedienen könnte. Ganz realistisch malt er sich den Knall aus, das Geräusch der splitternden Scheiben, das Quietschen der Räder, während das andere Auto sich querstellt und wegrutscht und gegen die Flanke eines Lastwagens oder eines anderen Autos oder gegen die Leitplanke prallt und eine katastrophale Kettenreaktion auslöst, in die er selbst verwickelt ist, falls es ihm nicht gelingt, sich mit erstaunlicher Promptheit im Zickzack zwischen den Wracks hindurchzuschlängeln. Er zweifelt nicht daran, dass seine Impulse den gleichen Ursprung haben wie die der Überholenden, aber dieses Wissen mindert keineswegs die Heftigkeit seiner Visionen, sondern verleiht ihnen letztlich eine noch destruktivere Note. Ebenso lebhaft stellt er sich vor, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen wegen des umfassenden Ekels, der ihn bis in die Knochen durchdringt. Er kann sich ausmalen, wie die Menschen, die er kennt, dann reagieren: seine Kinder, die vier oder fünf Frauen, mit denen er zu tun hat, seine zwei oder drei guten Freunde, seine Agentin, sein Verleger, ein paar Journalisten, die Besitzerin des ehemaligen Klosters auf den Bergen Liguriens, von wo er soeben geflüchtet ist, das slawische Zimmermädchen, das heute Morgen im Flur einen Strauß verwelkter Schwertlilien aus einer hässlichen Kristallvase genommen hat. Er fährt weiterhin stur zehn Kilometer über der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Überholspur, ohne zu weichen, egal, wie viel Druck die Autos hinter ihm ausüben, starrt weiterhin die Fahrer an, während sie ihn rechts überholen, und mimt die Geste [23] des Kehledurchschneidens, spricht weiterhin die deutschen Sätze des alten, inzwischen verstorbenen Mannes nach, die ihm in den Ohrhörern vorgesagt werden.
Plötzlich ist die endlos wirkende Fahrt fast zu Ende: Er passiert die Mautstelle Mailand Südwest, lenkt das Auto über die Abzweigung zwischen den grauenhaften neuen Bürohochhäusern und den grauenhaften alten Motels und Industriehallen und Tankstellen. Während er zur Überführung hinauffährt, kommt ungeachtet aller Schilder hinter ihm wie eine Rakete ein schwarzer Mercedes mit blinkenden Scheinwerfern angeschossen, und da er nicht Platz macht, wechselt der Mercedes die Spur, um ihn mit dem üblichen wilden Manöver zu überholen. Er beschleunigt seinerseits und lenkt nach rechts, um dem anderen den Weg abzuschneiden; der schwarze Mercedes bremst, schleudert, verliert einen Augenblick die Kontrolle, fährt erneut auf die Überholspur und rast mit ohrenbetäubendem Hupen an ihm vorbei. Er tritt das Gaspedal durch, setzt auf der abfallenden Rampe der Überführung zur Verfolgung an. Er macht eine falsche Bewegung, oder vielleicht verlieren die Reifen in einer Pfütze die Bodenhaftung; der Jaguar wird nach links geschleudert, stößt an die Leitplanke, prallt ab nach rechts, verfehlt knapp einen weißen Fiat, stößt an die andere Leitplanke, schrappt seitlich daran entlang, stratastrock-straack-strackt-taatack, Eisen gegen Eisen, die Reibung von Blech an Blech zwischen einem Metallpfosten und dem nächsten. Er registriert die Richtungsänderungen und Bewegungen und Geräusche, vermischt mit den Spuren der Gedanken, die bis dahin seinen Kopf ausgefüllt haben, und mit dem Lärm des Autos und dem Prasseln des [24] Regens und der Stimme des Herrn aus Polen mit dem falschen französischen Namen, der die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hat und ihm in gelassenem Ton direkt ins Ohr sagt: »Wollen Sie heute Abend mit mir essen gehen?«
[25] Halb in Trance, wie es zu einem verregneten Sonntagnachmittag passt
Halb in Trance, wie es zu einem verregneten Sonntagnachmittag passt, hängt sie ihren räumlich gedehnten Empfindungen und Gedanken nach, ohne Höhen und Tiefen, die man genau benennen könnte. Es gießt in Strömen, Milliarden von dicken Tropfen trommeln pausenlos aufs Autodach und auf die Windschutzscheibe, fließen in Bächen die Fensterscheiben herab. Stefano zu ihrer Linken hält sachverständig das Steuer, während er Betrachtungen über den halben Tag anstellt, den sie im Wochenendhaus seiner besten Freunde in Oltrepò Pavese verbracht haben. Die Weiterentwicklung oder vielleicht Rückentwicklung von Toms Charakter in den letzten Jahren im Vergleich zu dem von Lauretta, ihrer beider Nachgiebigkeit gegenüber der ungebremsten Aufdringlichkeit der zwei Kinder, ihre fragwürdigen Investitionen wie zum Beispiel in den Swimmingpool, den sie bestimmt nicht mehr als ein paar Monate im Jahr nutzen können. Seine Art, die Dinge zu analysieren, ist fast ebenso beruhigend wie entnervend, genau wie sein Profil mit der geraden Nase, sein Muttermal an der rechten Schläfe, seine hellblauen Augen hinter der Brille mit der schmalen Schildpattfassung, sein leicht herablassender Drang, andere zu belehren. Die Gründe, warum es ihnen miteinander gut- oder schlechtgeht, sind alle nahezu [26] greifbar; der Regen löscht die Landschaft rundum aus, so dass es scheint, als seien sie in einem Laborkäfig isoliert, wodurch jede winzige Zuckung, jede Verschiebung des Blicks, jede kleine Veränderung in der Stimmlage eine messbare Bedeutung erhält. Die Wörter hinter den Wörtern, das Echo und der Nachhall, was man sich erträumt und was man braucht, was man sucht und was man findet. Sie betrachtet die Überschwemmung vor dem Fenster, und ihr ist, als sehe sie in sich hinein, zwischen Schläfrigkeit und milchiger Langeweile, Wiederholung bekannter Elemente, Vorwegnahme plötzlicher Erschütterungen.
Dann fährt Stefano an der Kreuzung zu der großen grauen Straße, die ins Zentrum führt, gerade wieder an, und skatapam, schüttelt ein heftiger Stoß das Auto, es macht einen Satz nach vorn, sie werden gegen das Armaturenbrett geschleudert und prallen zurück an die Rückenlehnen und Kopfstützen.
»Scheissssee!«, brüllt Stefano; mit mehreren Sekunden Verspätung streckt er schützend den Arm vor ihr aus.
Sofort sehen sie sich an und dann um: erschrocken, benommen, unsicher.
»Hast du dir weh getan?«, keucht Stefano.
»Ich weiß nicht, ich glaube nicht«, erwidert sie. »Und du?« Ihr Herz rast, sie schnappt nach Luft. Sie tastet verschiedene Teile ihres Körpers ab, um festzustellen, ob sie verletzt ist, findet aber anscheinend nichts. Hinter ihnen wird gebremst und gehupt, Autos und Lastwagen überholen und fahren vorbei.
»Herrgott noch mal!«, schreit Stefano. Er hebt die Hände und schlägt auf das Lenkrad, rückt sich die Brille auf der [27] Nase zurecht, versucht, die Kontrolle wiederzuerlangen, die er so plötzlich verloren hat.
»Was ist passiert?« Sie dreht sich um, kann aber durch den Wasserfall, der die Heckscheibe herunterläuft, nichts erkennen.
»Dieser Verbrecher war das!« Stefano deutet auf ein grünes Gebilde hinter ihnen. Er öffnet die Autotür, merkt aber in der Aufregung nicht, dass er noch angeschnallt ist; wütend löst er den Gurt, bleibt mit der Schulter darin hängen, windet sich wie wild, um sich zu befreien, steigt aus.
»Pass auf!«, sagt sie. Sie bewegt den Kopf von einer Seite zur anderen, um die Halswirbel zu prüfen: Sie scheinen in Ordnung zu sein. Sie öffnet die Tür und steigt ebenfalls im strömenden Regen aus.
Draußen begutachtet Stefano gerade die eingedellte Heckklappe des Audi, das verbogene Nummernschild, die verbeulte Stoßstange. Hinter ihnen steht ein alter grüner Jaguar, niedrig und flach, mit zerquetschter Motorhaube, der Kühlergrill ist aus der Halterung gerissen, der rechte Scheinwerfer hängt nur noch an Drähten, das linke Fenster ist zersprungen. Stefano geht hin und schreit: »Wo zum Teufel hast du hingeschaut, dass du so auf mich draufgefahren bist?!«
»Beruhige dich, Ste!«, ruft sie, denn das Letzte, was es jetzt noch braucht, denkt sie, ist eine Schlägerei unter Männern. Sie denkt auch, dass Stefano, wenn er schreit oder eine kriegerische Haltung einnimmt, auf kuriose Weise seiner Mutter ähnelt: Vielleicht hängt es mit dem leicht schrillen Ton zusammen, den seine Stimme dann bekommt, oder mit der Art, wie er mit Armen und Händen herumfuchtelt.
[28] Doch ihre Aufmerksamkeit ist ganz auf die Sprünge gerichtet, die wie ein Spinnennetz die Scheibe des grünen Jaguar überziehen. Es macht einen seltsamen Eindruck auf sie, selbst im Mittelpunkt eines Unfalls zu stehen, anstatt am Telefon davon zu hören. Sie ist befremdet von der Bruchstückhaftigkeit dessen, was soeben passiert ist; dass sie zu einer Entzerrung gezwungen ist, um aus der Überlagerung von Ereignissen eine Abfolge herzustellen. Die Szenerie rundherum ist trostlos: strömender Regen und Grau und Lärm und Blech und Asphalt und Zement und hässliche Gebäude, kein einziges Element, das dem Blick oder den Gedanken etwas Halt böte.
Stefano dreht sich zu ihr um, schon völlig durchnässt; er sagt nichts mehr und keucht nur noch. Der Jaguarfahrer scheint zu keiner Reaktion fähig zu sein, soweit man erkennen kann: Er liegt schlaff im Fahrersitz, sicherlich verletzt, wenn nicht gar tot.
»Wie geht es ihm?«, schreit sie, während der Regen ihr auf den Kopf prasselt.
»Was?«, schreit Stefano zurück. Das Wasser hat ihm die Haare angeklatscht, es rinnt über seine Brille, er sieht aus wie ein Fremder.
»Lebt er noch?«, schreit sie mit einer unbestimmten Handbewegung zum Inneren des Jaguar.
»Natürlich lebt er noch!«, brüllt Stefano. »Ein Wunder, dass er uns nicht umgebracht hat, dieser Verbrecher! Ruf einen verdammten Krankenwagen!«
»Stell das Warndreieck auf, sonst fahren sie auf uns drauf!« Sie bemüht sich, ihre Reaktionsfähigkeit wiederzuerlangen.
[29] Unwillig gehorcht Stefano, geht zu dem Audi zurück, holt die orangerote Warnweste mit den Leuchtstreifen heraus und schlüpft hinein, nimmt das Warndreieck und stellt es einige Meter hinter dem Jaguar auf den Asphalt. Er gestikuliert wie ein dilettantischer Verkehrspolizist, um die Autos auf die andere Spur zu lenken, die jedes Mal wieder vorpreschen, wenn die Ampel auf Grün schaltet.
Sie berührt mit den Fingern den Türgriff des Jaguar, von einem Verantwortungsgefühl erfasst, dem sie fürchtet nicht entsprechen zu können. Ihre Kleider und Haare sind mittlerweile durchweicht vom Regen; bei jedem vorbeifahrenden Auto spritzen Fluten von Wasser auf, die ihren Rücken und ihre Beine noch nasser machen. Sie ärgert sich, dass sie, Stefano zuliebe und um sich seinen Freunden anzupassen, dieses feine dünne Kleidchen angezogen hat anstatt Jeans und T-Shirt, was ihr viel mehr behagt hätte. Sie holt tief Luft, öffnet die Autotür, schaut hinein.
Im Wageninneren riecht es nach Leder, Alkohol und Orangenschalen, auf dem Boden liegen CDs mit und ohne Hülle herum, ein MP3-Player, italienische und fremdsprachige Bücher und eine fast leere Wodkaflasche. Der Fahrer sitzt zurückgelehnt da und rührt sich nicht; ein Blutfaden läuft ihm über die Stirn und am linken Jochbein herunter und rötet den Kragen seines am Hals geöffneten weißen Hemdes.
»Entschuldigung?«, sagte sie und tippt ihm auf die Schulter. »Hören Sie mich?«
Der Typ antwortet nicht, schnellt aber plötzlich ruckartig nach vorn.
»Hey!«, sagt sie, weicht vor Schreck zurück und stößt [30] gegen den Türrahmen. Sie fasst sich mit der Hand an den Kopf, hin- und hergerissen zwischen Panik und Selbstbeherrschung, auf der Suche nach der angemessenen Reaktion.
Der Verletzte schließt halb die Augen, er scheint sie nicht scharf zu sehen. Seine Haare sind zerrauft, hier und da von grauen Fäden durchzogen, er hat ein Gesicht, das ihr irgendwie bekannt vorkommt, und dunkle, stechende Augen.
»Haben Sie getrunken?« Sie deutet auf die fast leere Wodkaflasche.
»Ja, und?«, brummt der Verletzte, lässt sich im Sitz zurückfallen und schnellt gleich wieder nach vorn.
»Ganz ruhig«, sagt sie in einem Ton, der sie selbst nicht sehr überzeugt, »bewegen Sie sich nicht.« Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse müssten recht gut sein in Anbetracht ihrer Arbeit und der zahllosen Übungen, zu denen ihr Vater sie und ihre Schwestern von klein auf jahrelang gezwungen hat; dennoch fällt ihr in diesem Augenblick bloß ein, dass ein Unfallopfer stillhalten muss.
»Was wollen Sie?«, murmelt der Typ. »Sind Sie von der Polizei?« Er hat sich vielleicht zwei Tage nicht rasiert, aber seine Hände sind gepflegt, die Nägel kurz geschnitten; innen am rechten Handgelenk hat er einen Skorpion eintätowiert.
»Ich war in dem anderen Auto.« Durch den Regenvorhang weist sie auf den Audi ein paar Meter weiter vorne. »Sie sind auf uns draufgefahren.«
»Idioten«, murmelt der verletzte Typ. »Steht da wie angenagelt, statt loszufahren.«
Sie fragt sich, ob diese Worte als Hinweis auf intakte [31] Hirntätigkeit oder eher als besorgniserregend zu werten sind. Ihre Füße haben immer weniger Halt in den durchnässten Schuhen, und jedes Mal, wenn die Autos weiterfahren, wird sie vom Fahrtwind und dem aufspritzenden Wasser erfasst. Der Dauerregen trommelt auf das Stoffverdeck. Halb im Wageninneren, halb draußen fühlt sie sich in einer surrealen Lage. Stefano in seiner orangefarbenen Weste gestikuliert immer noch, um den Verkehr umzuleiten; der ganze Raum ist ausgefüllt, jede Einzelheit gewinnt übertriebene Bedeutung.
Der Typ in dem Jaguar fasst sich an die Stirn, betrachtet seine blutige Hand, hustet; das Blut rinnt weiter herab.
Sie kann sich nicht entschließen, die Verletzung genau anzuschauen, aus Angst, eine zu tiefe Wunde zu sehen, aber sie weiß, dass sie es tun müsste. »Tut es weh?«, fragt sie.
»Aaah, ja«, sagt der Typ. Unerwartet lächelt er: Und es wäre gar kein hässliches Lächeln, wenn es nicht so absolut unangebracht wäre.
Sie fragt sich, ob es sich um einen unwillkürlichen Reflex handelt oder um ein Anzeichen für eine rapide Verschlimmerung seines Befindens. »Zeigen Sie mir, wo?«, sagt sie. Endlich beugt sie sich vor, um seinen Kopf in Augenschein zu nehmen: Da ist ein dunkler, feuchter Fleck, drei oder vier Zentimeter, wo die Haare verklebt sind und das Blut herausläuft.
»Nicht da«, murmelt der Typ.
Sie sieht ihn an und fühlt sich seltsam verunsichert. »Wo dann?«, fragt sie.
Der Typ legt sich eine Hand aufs Herz: »Hier ungefähr. Und wo tut’s Ihnen weh?«
[32] Sie weiß nicht, was sie antworten soll. »Ich rufe jetzt einen Krankenwagen.« Mit der Rechten tastet sie nach ihrer Tasche, aber sie hat sie im Auto gelassen.
»Ist Ihnen klar, wie viele Farben Ihre Augen haben?«, sagt der Typ. Oder jedenfalls kommt es ihr so vor, bei dem Krach ist es schwierig, ganz sicher zu sein.
Sie kann nicht umhin, ihm erneut in die Augen zu schauen: Wärme verbirgt sich hinter der scheinbaren Härte wie ein Feuersee. »Ich gehe mein Handy holen«, sagt sie und deutet hinter sich. »Es ist in meiner Handtasche im Auto.«
»Ach, hören Sie doch auf«, sagt der Typ, wie plötzlich überwältigt von einer unerträglichen Gereiztheit. »Verschwinden Sie.«
»Ich versuche ja nur zu helfen.« Ihr ist klar, dass sie unsicher und unüberlegt reagiert, doch zweifelt sie nicht daran, dass sie Hilfe leisten, etwas unternehmen, ihn retten muss.
»Helfen Sie jemand anderem«, knurrt der Typ. »Oder sich selbst, noch besser. Was ist das eigentlich für ein Akzent?«
Wieder ist sie irritiert, dass der Typ trotz seiner Lage noch fähig ist, solche Einzelheiten zu erfassen. »Ich bin Amerikanerin«, antwortet sie.
»Oh yeah?«, sagt er, legt den Kopf zurück. »My first wife was English. From East Sussex. Totally incompatible. Totally.«
»Bewegen Sie sich nicht, okay?«, sagt sie. »Bleiben Sie still da sitzen. Ich komme gleich wieder.« Sie zögert, ob sie ihn allein lassen soll oder nicht, schaut sich um. Ihre innere Chemie gerät in Aufruhr: Sie richtet sich auf, hüpft durch [33] das Wasser, das in Bächen über den Asphalt strömt, auf den Audi zu.
Ein paar Meter weiter hinten im dichten grauen Regen redet Stefano mit einem Fernfahrer, dreht sich um und schaut sie fragend an.
Sie macht ihm ein vielleicht nicht verständliches Zeichen, kriecht ins Auto und sucht hastig in ihrer Tasche nach dem Handy, kann es nicht finden, reißt sich zusammen, um die Gedanken zu koordinieren, die jetzt zu schnell durch ihren Kopf rasen.
Stefano öffnet die Auditür, lässt sich hinters Steuer fallen, klitschnass und keuchend. Er nimmt sein Mobiltelefon und klappt es mit zitternden Fingern auf.
»Rufst du den Krankenwagen?«, fragt sie.
»Ich rufe die Polizei und den Abschleppdienst«, sagt er. »Den Krankenwagen solltest du doch rufen.«
»Ich finde mein Handy nicht, aber dem Kerl geht es schlecht!«, schreit sie, verwundert über seinen Mangel an Mitgefühl. »Er hat eine Kopfwunde und ist voller Blut!«
»Wir rufen die Polizei und den Abschleppdienst und den Krankenwagen, ja?«, sagt Stefano, als hätte er es mit einer sehr irrationalen Frau zu tun und als wäre dies jetzt eine gute Gelegenheit, ihr etwas beizubringen.
»Ich glaube, es ist ernst!«, schreit sie. »Er bewegt sich so ruckartig und redet wirres Zeug!«
Der Regen verwandelt sich auf einmal in Hagel: Weiße, harte Körner kommen mit doppelter Wucht herunter, dröhnen auf dem Blech des Audi und der anderen Autos rundherum, zerplatzen auf dem Asphalt, so dass das Grau der Straße in wenigen Sekunden weiß wird.
[34] »Ruf den verdammten Krankenwagen!«, schreit Stefano und wählt eine Nummer. »Ich rufe die Polizei und den Abschleppdienst, bevor uns noch weitere Autos drauffahren! Hallo, hallo, hallo, ja, hören Sie mich? Was? Hier ist Rechtsanwalt Panbianco, mir ist einer hintendrauf gefahren! Ja, von hinten, besoffen oder unter Drogen, das weiß ich nicht, er hat mir mein Auto ruiniert –«
Sie wühlt noch hektischer in ihrer Handtasche zwischen den Schlüsseln und den Papiertaschentüchern und der Minitaschenlampe und dem Schweizer Taschenmesser und dem Kosmetiktäschchen und dem Portemonnaie und den Tampons und der Lippenpomade und dem Lippenstift und den Augentropfen und den Kopfschmerztabletten und dem Taschenkalender und dem Notizbuch mit Gummiband und den Sesamschnitten mit Honig und dem Kaugummi und den zahllosen anderen Dingen, die sie normalerweise mitnimmt, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Zuletzt findet sie das Handy, wählt die Notrufnummer. Aber im selben Moment sieht sie, dass der Typ aus dem Jaguar ausgestiegen ist und sich im Hagel umschaut. »He da!«, schreit sie, schon draußen auf dem weißen Asphalt. »Setzen Sie sich wieder ins Auto!«
Der Typ ignoriert sie oder hört sie einfach nicht in dem Lärm, der immer lauter wird. Er dreht sich um, lehnt sich an den Jaguar, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Sie geht auf ihn zu, das Handy ans Ohr gepresst in dem nutzlosen Versuch, das Hämmern des Hagels und das Dröhnen der Motoren und das Knirschen der Reifen auf den zerplatzten Eiskörnern zu überhören. Als sie endlich die Stimme am anderen Ende der Leitung vernimmt, schreit [35] sie: »Wir brauchen einen Krankenwagen nach der Ausfahrt vom Autobahnring an der Mailand–Genua, es gibt einen Verletzten!« Doch sie versteht weder die Antwort, noch kann sie einen Straßennamen oder eine Hausnummer erkennen, um genauer anzugeben, wo sie sich befinden.
Der Mann am Notruftelefon fragt sie gerade etwas von wegen Fahrtrichtung, da beugt der Typ aus dem Jaguar sich hinunter, um die Motorhaube zu betrachten, fällt beinahe um und geht in die Knie.
Sie stopft das Handy in die Handtasche, rennt hin, um ihn am Arm zu stützen, schreit: »Das können Sie nicht machen!«
Der Typ schaut sie mit einer absonderlichen Mischung aus Neugierde und Verwunderung an. Autos und Lastwagen und wieder Autos fahren im wütenden Hagel vorbei, eine Flut erschreckender mechanischer Gebilde, die nur gelegentlich von der Ampel aufgehalten wird.
»Kommen Sie mit!« Trotz seines anfänglichen Widerstands und seines beträchtlichen Gewichts gelingt es ihr, ihn mit vorsichtigen Schritten durch das ohrenbetäubende, blendende Verkehrschaos zu führen, während ihre Finger versuchen, an dem durchnässten Hemdstoff Halt zu finden, und nicht umhinkönnen, die Beschaffenheit der Muskeln darunter wahrzunehmen.
Plötzlich hört der Hagel auf, Stefano fährt im verbliebenen Nieselregen durch die Straßen der überschwemmten Stadt. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren, durch die halboffene Heckklappe dringen Reifenlärm und Feuchtigkeit und Kälte herein. Sie sind alle drei so pitschnass, dass die [36] Ausdünstungen den Innenraum erfüllen, die Scheiben und Stefanos Brille beschlagen, er nimmt sie ab und versucht sie mit dem Hemdsärmel zu trocknen, wischt mit dem Handrücken über die Windschutzscheibe, um draußen etwas zu erkennen.
Der Verletzte sitzt auf dem Beifahrersitz und schiebt ihre Hand weg, als sie versucht, seine Rückenlehne noch tiefer zu stellen.
»Sie müssen aber möglichst flach liegen«, sagt sie. Sie zieht das Päckchen Papiertaschentücher heraus, versucht ihm eines auf den Kopf zu drücken, um das Blut zu stillen. Er weicht aus, dreht sich auf die andere Seite, tritt um sich.
»Wir hätten ihn von einem Krankenwagen abholen lassen sollen, Chiara«, sagt Stefano, starr vor Ärger. »Statt ihn selber hinzufahren.«
»Ich konnte am Telefon nichts verstehen«, antwortet sie. »Und wer weiß, wie lange sie gebraucht hätten, bis sie gekommen wären.«
»Wir hätten warten müssen«, sagt Stefano, »auch auf die Polizei. Man kann doch nicht einfach so vom Unfallort wegfahren. Bloß aus Ungeduld!«
»Wir konnten nicht warten!«, sagt sie. »Siehst du nicht, wie es ihm geht?«
Stefano beißt mehrmals die Kiefer zusammen, um zu betonen, wie viel es ihn kostet, sie in einem so absurden Vorhaben zu unterstützen.
Ihr fällt ein, dass eine weitere Erste-Hilfe-Grundregel lautet, man solle mit dem Verletzten sprechen und versuchen, ihn zum Sprechen zu bringen und ihn wach zu [37] halten, wenn es so aussieht, als gleite er in die Bewusstlosigkeit ab. »Wie heißen Sie?«, fragt sie. »Wie heis-sen Sie?«
»Daniel Deserti«, murmelt er kaum hörbar in dem Lärm der Scheibenwischer und dem Brausen der Lüftung.
»Deserti?«, wiederholt sie.
»Hm«, macht der Typ, offenbar verärgert, dass er es bestätigen muss.
Sie versucht, eine undeutliche Erinnerung einzuordnen, die zwischen vielen anderen Gedanken auftaucht, aber ohne Erfolg; sie versucht auch, sich zu erinnern, was Stimmungsschwankungen bei einem Traumageschädigten bedeuten.
»Und Sie?«, fragt der Typ, der sich Deserti nennt.
»Ich?«, erwidert sie und tippt sich mit dem Finger auf die Brust.
»Wie heißen Sie?«, nuschelt Deserti.
»Clare«, sagt sie. »Aber er nennt mich Chiara.«
Stefano wirft ihr einen irritierten Blick zu, es ist ja wirklich nicht nötig, solche persönlichen Informationen an einen Fremden weiterzugeben, der sie mit seiner kriminellen Fahrweise vor wenigen Minuten durchaus hätte umbringen können.
»Und warum?«, fragt Deserti.
»Na ja, wahrscheinlich ist es einfacher«, sagt sie. »Schließlich sind wir in Italien. Oder, Stefano?«
Stefano dreht sich um und schaut sie noch böser an als zuvor, als würde sie einen Loyalitätspakt zwischen ihnen beiden verletzen.
»Und du lässt dir einfach so deinen Namen verändern?«, sagt Deserti etwas verständlicher. »Von so einem Blödmann?«
[38] »Hey!« Stefano richtet sich auf. »Und wer wäre dieser Blödmann?«
»Du«, sagt Deserti.
»Ste, es geht ihm schlecht«, mischt sie sich ein und zieht ein weiteres Papiertaschentuch heraus. Sie würde lieber Stefano zu ihm sagen, aber er besteht darauf, dass sie ihn Ste nennt wie seine Mutter und seine alten Freunde, auch weil er sich automatisch in ein Arbeitsklima versetzt fühlt, wenn er seinen vollen Namen hört. Zu Beginn ihrer Beziehung jedoch kam es ihr wie eine Identitätsenteignung vor, als er anfing, sie Chiara zu nennen anstatt Clare: die komplizierte Politik der Namen.
»Mir geht’s nicht schlecht«, sagt Deserti. »Lasst mich aussteigen.«
»Ich habe gesagt, Sie sollen sich nicht bewegen«, antwortet sie und versucht erneut, ihn auf den Sitz zu drücken. »In Ihrem Zustand können Sie nirgendwohin gehen.«
»Mach, dass er stillhält, verfluchte Scheiße!«, brüllt Stefano. Er zittert vor unterdrückter Wut: Er schaut den blutverschmierten Deserti an, den grauledernen Sitz, der schon einige Flecken abbekommen hat, die verbeulte, schlecht schließende Heckklappe.
»Setzt mich bei einem Taxi ab«, sagt Deserti. »Oder bei einer Straßenbahn, egal wo.«
»Gleich sind wir da«, sagt sie, so ruhig sie kann. »Noch ein paar Minuten Geduld.« Sie versucht sich krampfhaft an die Strecke zur Notaufnahme der Poliklinik zu erinnern, sie hat sie doch erst vor einer Woche einem Kunden aus Leeds beschrieben, dessen Frau Symptome einer Lebensmittelvergiftung hatte.
[39] »Da, wo?«, sagt Deserti. Er unternimmt einen Versuch, die beschlagene Scheibe zu putzen, um hinauszuschauen, kann aber offensichtlich die Bewegungen seiner Hand nicht richtig koordinieren.
»Beim Krankenhaus«, sagt sie. »Da machen sie alle nötigen Kontrolluntersuchungen und behandeln Ihre Wunde.«
»Ich habe aber nicht die Absicht, mich kontrollieren zu lassen!«, schreit Deserti, seine Stimme überschlägt sich, er versucht den Türgriff zu packen. »Ich will nichts zu tun haben mit Krankenhäusern oder Ärzten, in keiner Form! Lasst mich sofort raus!«
»Bleiben Sie gefälligst ruhig sitzen!«, schreit Stefano ebenso heftig, wenn auch in etwas weniger männlichem Ton; er drückt auf die Zentralverriegelung. »Sie lassen sich jetzt ins Krankenhaus fahren, Schluss, aus! Sie haben schon genug Schaden angerichtet, klar?!«
»Wo hast du den her?«, fragt Deserti, wieder ziemlich undeutlich.
»Er heißt Stefano«, sagt sie, jedes Wort betonend.
Erneut schaut Stefano sie böse an, wütend, dass nun auch noch sein Name von ihrem Helfersyndrom vereinnahmt wird.
»Er hat auch so ein widerliches schwarzes Auto«, nuschelt Deserti. »Es ist erwiesen, dass schwarze Autos von extrem frustrierten und aggressiven Leuten gekauft werden.«
»Pass auf, du! Schließlich bist du auf mich draufgefahren!«, brüllt Stefano. »Und mein Auto ist überhaupt nicht schwarz, sondern Farbe Gewehrlauf, nur damit du es weißt!«
»Siehst du?«, sagt Deserti. »Man müsste allen [40] Scheißbesitzern schwarzer Autos pro Monat einen Bußgeldbescheid schicken, ganz egal, was sie gemacht haben.«
»Also bitte!«, schreit Stefano. »Mister Sicherheit am Steuer hat gesprochen! Einem wie dir müssten sie lebenslänglich geben.«
»Immer mit der Ruhe, Ste«, sagt sie.
»Ruhe, ja klar!«, antwortet Stefano; er schlägt mit den Händen aufs Lenkrad, versetzt der Armlehne einen Stoß mit dem Ellbogen. »Warum zum Teufel hast du nicht den verdammten Krankenwagen gerufen? Nein, sie muss Samariterin spielen, dem erstbesten unglücklichen Kerl zu Diensten, selbst wenn er uns nur durch ein Wunder nicht gerade umgebracht hat.«
»Ihr seid ein fürchterliches Paar«, brummt Deserti. »Fürchterlich.«
»Und noch dazu stockbesoffen!«, sagt Stefano. »Oder mit wer weiß welchen Drogen zugedröhnt!«
»Ein Lakai bist du«, sagt Deserti. »Ein Sklave.«
»Hörst du ihn?«, brüllt Stefano. »Hörst du ihn?«
»Was arbeiten Sie?«, fragt sie, um Deserti abzulenken und zum Sprechen zu bringen.
»Ich schreibe«, sagt Deserti, ein klein wenig deutlicher; vergeblich rüttelt er am Türgriff. »Mach die Türen auf, du Halunke!«
»Für Zeitungen?«, fragt sie. Unwillkürlich benutzt sie den Ton, den sie bei der Arbeit den Kunden gegenüber anschlägt: die Mischung aus Anteilnahme und Distanz, die sie zwangsläufig in dem kurzen Schulungskurs gelernt hat, ohne dass es ihr je wirklich gelungen wäre, die Anteilnahme zu reduzieren und die Distanz glaubhaft zu machen.
[41] »Ach was, Zeitungen«, sagt Deserti, als hätte sie ihn beschuldigt, einen unwürdigen Beruf auszuüben.
»Sind Sie der Schriftsteller Daniel Deserti?«, fragt sie, weil ihr plötzlich ein paar Sommerabende vor vier oder fünf Jahren in den Sinn kommen, die sie lesend in einem Haus von Freunden auf der Insel Elba verbracht hat: eine Liebesgeschichte, die sie begeistert und aufgewühlt hatte, mit einem Foto auf der Rückseite, das sie im Lauf der Lektüre noch öfter betrachtet hatte.
Er nickt widerwillig.
»Das Auge des Hasen«, sagt Stefano und bekundet damit unerwartet eine gewisse literarische Bildung.
»Der Blick, du Blödmann«, nuschelt Daniel Deserti.
»Was?«, sagt Stefano.
»Der Blick des Hasen«, sagt sie, da es ihr jetzt wieder einfällt, gleichzeitig mit einer erotischen Szene an einem Seeufer, die kein bisschen vulgär oder banal erzählt war und seltsame nachhaltige Empfindungen in ihr geweckt hatte.
»Du hast das Gedächtnis eines Blödmanns«, sagt Daniel Deserti zu Stefano. »Namen und Daten reihen sich auf der grauen Tafel deines Hirns leblos aneinander.«
»He du! Hörst du jetzt auf mit deinen Beleidigungen?!«, brüllt Stefano, er bremst, schaut ihn an und droht mit der Faust. »Nur weil du in diesem Zustand bist, sonst –!«
»Ste«, sagt sie. »Er ist verletzt.«
»Ja, verletzt, aber hör dir das an!«, schreit Stefano außer sich. Er putzt seine Brille, die wieder beschlagen ist, fährt ruckartig. »Jedenfalls hab ich es sowieso nicht gelesen, dein Buch! Ich hatte Wichtigeres zu lesen! Ich hab mich bloß an den dämlichen Titel erinnert!«
[42] »Umso besser«, raunt Daniel Deserti. »Jetzt mach die Tür hier auf.« Er rüttelt nochmals schwach an dem Griff, dann beginnt er plötzlich zu husten, krümmt sich zur Seite und kotzt in den Zwischenraum zwischen Sitz und Autotür.
»Iiiihhhh!«, schreit Stefano, bremst scharf. »Verfluchte Scheiße, Chiara, er kotzt mir das Auto voll! Tu was! Er kotzt!! Chiaraaaa?!«
»Was soll ich denn tun?«, fragt sie, während sie in ihrer Handtasche nach weiteren Papiertaschentüchern kramt. »Fahr einfach weiter.« Ihr Ekel hält sich in Grenzen, was sie besorgt, ist das Symptom. Ihr Vater hatte Übelkeit immer als möglichen Hinweis auf Gehirnerschütterung beschrieben, dasselbe sagen auch die Handbücher der Agentur.
»Das hat uns gerade noch gefehlt!«, schreit Stefano. »Zum Teufel mit ihm, ausgerechnet in mein Auto mussten wir ihn reinsetzen! Anstatt den Krankenwagen zu rufen und zu warten wie alle anderen! Ich fasse es nicht!«
»Komm, fahr weiter.« Sie hält Daniel Deserti ein Papiertaschentuch hin. Wie schon so oft fragt sie sich, wie Stefano wohl in einer Situation echter Gefahr reagieren würde. Das einzige Beispiel, das ihr einfällt, stammt vom vorigen Jahr, als sie ein Wochenende im Piemont bei Weinproben in einigen Kellereien verbracht hatten und eine Wespe ins Innere des Audi geraten war. Er hielt am Straßenrand, stieg hastig aus, fuchtelte wie wild mit den Armen herum und überließ sie ihrem Schicksal. Später lachten sie noch zwei- oder dreimal darüber, aber die Episode ging ihr nicht mehr aus dem Kopf, wie eine unbeantwortete Frage im Hinterland ihrer Gedanken.
Daniel Deserti hustet noch, spuckt aus, wischt sich mit [43] dem Handrücken über den Mund. »Widerliches schwarzes Auto«, murmelt er.
»Hörst du jetzt auf?!«, schreit Stefano. »Hörst du endlich auf?!«
»Fahr weiter!«, wiederholt sie. Erneut hält sie Daniel Deserti ein Papiertaschentuch hin. »Es ist alles in Ordnung, alles in Ordnung.«
»O ja, wahrhaftig, alles in Ordnung!«, sagt Stefano; er beschleunigt und bremst abrupt, ein paarmal streift er beinahe ein anderes Auto. »Sag mir wenigstens, ob ich hier lang richtig fahre! Chiaraaa?!«
»Ich glaube schon«, sagt sie.
»Was soll das heißen, du glaubst??!«, schreit Stefano. »Glaubst du es oder weißt du es?!«
»Fahr geradeaus«, sagt sie und versucht, jede Spur von Zweifel aus ihrer Stimme zu tilgen. »Und gleich vor der Ampel biegst du rechts ab.«
Endlich sind sie tatsächlich vor der Notaufnahme des Krankenhauses. Stefano hält unter dem Vordach, direkt vor dem Eingang.
Ein kleiner, untersetzter Pfleger kommt heraus und macht ihm Zeichen, dass er da nicht halten dürfe.
»Ist das der Eingang zur Notaufnahme, ja oder nein?!«, schreit Stefano. »Was sollte ich denn machen Ihrer Meinung nach?!«
Sie steigt hinten aus, öffnet die Tür zum Beifahrersitz. »Wir haben einen Verletzten«, sagt sie. »Es ist ein Notfall.«
Der Pfleger reckt den Hals, um nachzusehen, und nickt.
»Lasst mich in Ruhe«, faucht Daniel Deserti, setzt einen Fuß auf den Boden. »Ihr könnt mich alle mal.«
[44] »Rufen Sie jemanden!«, sagt sie zu dem Pfleger. »Lassen Sie eine Trage bringen oder irgendwas!«
Daniel Deserti versucht, allein aus dem Auto auszusteigen, aber es gelingt ihm nicht. Er ist durchnässt vom Regen, blass, das Blut läuft ihm über die Stirn den Hals hinunter bis zu dem rotverfleckten Hemd: Es sieht allerdings nicht so aus, als ob er weit kommen könnte.
»Nur die Ruhe, es ist alles in Ordnung«, sagt sie, langsam scheint sie wieder Kontrolle über sich zu gewinnen. Ihr Herzschlag ist wieder fast normal, der Atem ebenfalls; die Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen, sind wieder klar.
Zwei Krankenträger kommen mit einer Rollbahre, und obwohl Daniel Deserti Widerstand leistet, hieven sie ihn mühelos darauf.
»Hey!«, ruft Stefano über das Auto hinweg, das Hemd klebt an seinem schmalen Brustkorb, die Augen hinter den beschlagenen Brillengläsern sind verschleiert, die nassen Haare schüttere Strähnen. »Wir haben nicht einmal das Formular für die gütliche Einigung ausgefüllt!«
»Das ist doch jetzt nicht der richtige Moment, Ste!« Sie deutet auf die Rollbahre, die auf die Automatiktüre zugeschoben wird.
»Wann dann?«, antwortet Stefano kopfschüttelnd. »Er hat mir nicht einmal seine Versicherungsnummer gegeben oder eine Telefonnummer, was weiß ich!«
»Glaubst du, er wäre dazu in der Lage gewesen?«, sagt sie, enttäuscht über diesen neuerlichen Beweis von Gefühllosigkeit.
»Also hör mal!«, schreit Stefano. »Mein Auto ist hin! Der Schaden beträgt Tausende von Euro!«
[45] »Ich lasse mir seine Daten geben, okay?«, sagt sie. »Oder ich suche sie morgen bei der Arbeit raus. Fahr ruhig schon nach Hause, wir telefonieren dann.« Sie winkt kurz und folgt den Pflegern, die im Eingang verschwunden sind. Sie fühlt sich absolut im Recht, auf der richtigen Seite.
»Wie?«, sagt Stefano. »Chiara? Wo gehst du hin?«
Der Pfleger von vorher fängt wieder an, ihm Zeichen zu geben, dass er mit dem Auto nicht da stehen bleiben kann.
[46] Nur einen Augenblick zuvor war er noch mitten in einem gar nicht üblen Traum
Nur einen Augenblick zuvor war er noch mitten in einem gar nicht üblen Traum; darin lief er mit überraschend großen Sätzen durch eine Landschaft von Olivenbäumen, Steineichen und Weinreben einen Weg bergab und begegnete einer eleganten älteren englischen Reisenden, die zu ihm sagte: »Wenn Sie noch mal mit mir auf den Hügel steigen, erkläre ich Ihnen, wie man echte Sprünge macht.« »Was meinen Sie mit echt?«, fragte er. »Dutzende von Metern weit«, antwortete die elegante Dame. Dann begann der Klingelton des Handys ihn aus dem Traum herauszuholen, zog ihn an die Oberfläche wie eine Angelschnur einen Fisch, dem sich der Haken in die Backe gebohrt hat, der unerwartete Übergang schmerzt und verstört ihn. Er strampelt wütend, fuchtelt mit den Armen, schüttelt das Laken ab; schließlich findet er auf dem Nachttisch das klingelnde, vibrierende Handy, fegt es mit einer Handbewegung auf den Boden und lässt sich zurückfallen.
Doch jetzt ist er wach, jede Faser noch durchdrungen von der nun unerfüllbaren Vorfreude auf die meterweiten Sprünge. Sein Kopf schmerzt, und wenn er ihn berührt, fühlt er das große Pflaster auf den Stichen, mit denen sie ihm vor fünf Tagen die Kopfhaut wieder zusammengeflickt haben. Gedanken tauchen auf wie Geröll, zusammen mit [47] dem Bewusstsein: unaufgefordert, ungewollt. Das Handy beginnt schon wieder zu klingeln, mit unerträglicher Beharrlichkeit. Er wälzt sich noch wütender als zuvor über das Bett, fährt mit der Hand über den Fußboden, bis er an das kleine vibrierende Plastikgehäuse stößt. Er drückt eine Taste, schreit ungehalten: »Wer ist da?«
»Dottor Zattola für Sie«, sagt eine weibliche Stimme, ganz kühle Dringlichkeit.
»Daniel?«, sagt gleich darauf eine männliche Stimme, weich und schwer wie nasser Stoff.
»Hallo«, sagt er.
»Ar-man-do«, sagt die Männerstimme. »Zat-to-la.«
»Aha«, sagt er, während das Bild seines Gesprächspartners allmählich an Schärfe gewinnt: das breite Gesicht, die rötlichen Haare, die kleinen blauen Augen, gereizt von wahrscheinlich schlechtsitzenden Kontaktlinsen, das von einem kurzen Bart bedeckte Doppelkinn, der immer in irgendwelche Hintergedanken versunkene Ausdruck.
»Waren wir nicht um elf verabredet, wir zwei?«, sagt Armando Zattola.
Er streckt eine Hand nach der Uhr auf dem Nachttisch aus: Die Zeiger stehen anklagend auf elf Uhr dreißig. »Ja?«, sagt er.
»Ja«, sagt Zattola. »Ich habe es hier im Kalender stehen, und es wurde mir von mehreren Seiten bestätigt.«
»Tut mir leid«, sagt er.
»Mir auch, sehr«, sagt Zattola. »Vor allem, weil ich zwei andere wichtige Termine extra verschoben habe.«
»Oje!«, stöhnt er. »Ich war bis fünf Uhr auf, deshalb.«
»Das ausschweifende Leben des Schriftstellers«, sagt [48] Zattola in dem vergeblichen Versuch, den Sarkasmus nachzuahmen, den schon sein Vater eher schlecht als recht dem Naturtalent seines Großvaters abgeschaut hatte.
»Ich bin bei einer Sendung für Teleshopping von Kunst hängengeblieben«, sagt er. »Was für ein schauderhaftes Land. Hoffnungslos.«
»Alles Stoff für deine Bücher«, sagt Zattola. »Na gut, mir reicht es zu wissen, dass du noch lebst, wir sehen uns ein andermal.«
»Ich gehe in fünf Minuten los«, sagt er. »In einer halben Stunde bin ich da.«
»Nein, jetzt ist es zu spät«, sagt Zattola. »Ich habe den ganzen Tag einen Termin nach dem anderen.«
»Ich komme«, sagt er.
»Nächste Woche geht es wieder«, sagt Zattola. »Montag oder Dienstag. Sprich mit Caterina, macht einen Termin aus.«
Er setzt sich auf den Bettrand; Übelkeit dringt durch seine Kopfschmerzen, vergeht, kommt zurück. Selbst wenn er seinen Traum hätte weiterträumen können, denkt er, hätte die alte englische Lady ihm wahrscheinlich doch nicht wirklich beigebracht, wie man Dutzende von Metern weite Sprünge den Hügel hinunter macht, sondern wäre auf einmal nicht mehr da gewesen, wie es gewöhnlich in Träumen geschieht. Dennoch gelingt es ihm nicht, das Gefühl freudiger, dann aber unerfüllter Erwartung loszuwerden. Er gibt sich einen Ruck, geht in die Küche, öffnet den Kühlschrank, trinkt einen großen Schluck Weißwein direkt aus der Flasche. Es ist ein bitterer Chablis ohne jede freundliche Nuance. Andererseits war sein Verhältnis zum Alkohol seit je rein [49] funktionell: Er trinkt nur in gewissen Phasen, maßlos und ohne Begeisterung, um Spannungen zu lösen oder Inspirationen zu beflügeln oder Gefühle zu betäuben. Bisher, scheint ihm, hat er an keiner dieser Fronten größere Erfolge erzielt. Er macht sich einen löslichen Kaffee und kippt ihn viel zu heiß hinunter.
Dann geht er ins Bad, dreht den Hahn auf, schüttet sich Hände voll kaltes Wasser ins Gesicht. Als er sich im Spiegel ansieht, hat er den Ausdruck eines von Autoscheinwerfern geblendeten Tieres.
Auf der Fahrt mit der U-Bahn betrachtet er durch die dunklen Gläser seiner Sonnenbrille die stehenden und sitzenden Leute rundherum. Er fährt nicht häufig U-Bahn, denn er hasst die Vorstellung, Dutzende von Metern unter der Erde zu sein, ebenso wie das Gedränge, das kalte Licht, die verbrauchte Luft. Dennoch muss er zugeben, dass sie ein phantastischer Beobachtungsposten ist: Er hatte immer schon vorgehabt, einmal einen ganzen Tag darin zu verbringen, von einer Endhaltestelle zur anderen und wieder zurück zu fahren, um die Leute zu studieren und sich im Kopf Notizen zu machen.
Die anderen beobachten, darin ist er ein Meister: die Einzelheiten erkennen, auf die es ankommt, sie aus dem Fluss des Allgemeinen und Unbedeutenden herausfischen. Er hat nie wirklich versucht, diese Fähigkeit in ihre Bestandteile zu zerlegen, doch wenn er es müsste, würde er sagen, sie besteht aus einer Mischung von Neugier, Ärger, Anteilnahme, Abstand, Verständnis, Unduldsamkeit, Sympathie, Abneigung, alles gebündelt in einem Blick. Das ist es, was [50] ihn blitzschnell unter die Oberfläche eines Ausdrucks oder einer Bewegung vordringen lässt, direkt hinein zu den inneren Beweggründen. Von hier aus ist er zum Schreiben gekommen und nicht umgekehrt: Was er im Lauf der Jahre lernen musste, war, seine Beobachtungen und Intuitionen in Wörter zu übersetzen, sie neu zusammenzufügen und in Form von Figuren und Geschichten darzustellen. Gleichwohl ist ihm jedes Mal, wenn er schreibt, deutlich bewusst, dass er eine Übersetzung vornimmt, mit einer entsprechenden unvermeidlichen Einbuße an Komplexität. Immer hat er den Eindruck, als bliebe der interessanteste, subtilste, widersprüchlichste Teil bei seinen Beschreibungen und Dialogen auf der Strecke, ginge verloren wie jetzt die Gedanken der Passagiere, die an jeder Haltestelle aus dem Waggon aussteigen und davoneilen. Er weiß genau, dass er, um diese Aspekte zu erhalten, beschließen müsste, seine Lebensenergie radikal umzuverteilen, sie viel mehr in seine Arbeit als in seine physische Existenz zu stecken, anstatt zu versuchen, sie halb und halb zu nutzen. Er weiß nicht mehr, wer als Erster den Spruch geprägt hat: »Entweder du lebst, oder du schreibst«, aber vor dieser Vorstellung hat ihm immer gegraut, sie kommt ihm vor wie der gemeinste, unannehmbarste Tauschhandel.
Zudem speist sich seine Beobachtungsgabe aus einem angeborenen Talent, das in Wirklichkeit ein eher besorgniserregender Makel ist: sich mit jedem zu identifizieren, der lange genug in sein Blickfeld tritt. Ihm genügt eine Geste, ein Wort, ein unbedeutendes Detail, und schon versetzt sich sein gesamtes Wahrnehmungssystem in die andere Person. Diese Haltung ist weder moralisch noch sozial und noch [51] viel weniger politisch motiviert; es ist ein Mechanismus, der sich von allein in Bewegung setzt, er kann nichts dagegen tun. Es ist ihm schon immer so gegangen, von klein auf, bei allen Berufen, die er ausgeübt hat, bevor er zu schreiben anfing, auf Reisen, bei Konflikten, in seinen Liebesbeziehungen. Im einen Moment ist er vollkommen bei sich, in direktem Kontakt mit seiner Wesensart, und im nächsten wird er von der Wesensart des oder der anderen überrannt. Deshalb muss er immer auf der Hut sein, sich abschirmen, sich fernhalten, darf sich nicht einfangen lassen. Schon lange hat er entdeckt, dass Grobheit eine äußerst wirksame Verteidigung darstellt und außerdem viel weniger Energie kostet als Freundlichkeit.
Dann gibt es noch das Phänomen der möglichen Leben, die sich ihm in fast jedem U-Bahn-Waggon anbieten, in Form von jeweils sehr unterschiedlichen Frauen. Warum es viel häufiger in der U-Bahn als in Zügen oder Flugzeugen auftritt, wo man doch mehr Zeit und Gelegenheit hätte, um ein Gespräch anzuknüpfen und sich entwickeln zu lassen, ist schwer nachvollziehbar. Egal, unter welcher Stadt er gerade unterwegs ist, fast unweigerlich befindet sich in seinem Waggon eine Frau, der er, so scheint ihm, monate- oder sogar jahrelang seine besten Eigenschaften und Fähigkeiten widmen könnte. Er hat schon mehrere Hypothesen zur Erklärung dieses Phänomens aufgestellt, ist aber bisher zu keinem endgültigen Schluss gekommen. Vielleicht hängt es von der unberechenbaren Dauer der Anwesenheit der Personen ab, vom ständigen Ein- und Aussteigen, von der extremen Überlagerung, die seine Aufmerksamkeit noch zuspitzt. Wenn er daran denkt, wie viele Waggons zu einem [52] einzigen Zug gehören, jeder mit einer Frau, die den Lauf seiner Existenz verändern könnte, und dann an die Anzahl von Zügen, multipliziert mit allen Linien einer Stadt und mit allen Städten der Welt, die eine U-Bahn haben, wird ihm ganz schwindlig bei der Vorstellung.
Eine andere Überlegung, die ihn beschäftigt, ist die, wie unterschiedlich die Frauen sind, die ihn faszinieren, was Aussehen, Alter und möglichen Charakter angeht, und wie sie ebenso vielen unterschiedlichen Seiten seines Wesens entsprechen. Natürlich fühlt er sich nicht wahllos angezogen; was ihn interessiert, ist die Authentizität, unabhängig vom Stil, und er weiß genau, wie selten sie ist und wie man sich täuschen kann. Dennoch passiert es, dass er eine Frau beobachtet, die ein paar Meter von ihm entfernt sitzt oder steht, dass er ihren Blick und ihre Proportionen und die Farbe, die Beschaffenheit und den Schnitt ihrer Haare registriert, ihre Art, dazusitzen und vor sich hin zu starren oder ein Buch zu lesen oder über Kopfhörer Musik zu hören, und anhand dieser Elemente ist er nahezu sicher, dass sie eine überraschende Wendung in seinem Leben herbeiführen könnte. Dann steht sie rasch auf und steigt aus; noch bevor es ihm gelungen ist, sich eine Reihe von Gesten und Wörtern auszudenken, verschwindet sie in der Menge und hinterlässt das schmerzliche Gefühl verpasster Gelegenheiten. Und noch an derselben Haltestelle oder gleich an der nächsten steigt schon wieder eine Frau mit ganz anderen Merkmalen ein, die aber ebenso seine Phantasie beflügelt. Immer wieder passiert ihm das, unabhängig von der Anzahl Frauen, mit denen er im Lauf der Jahre tatsächlich Beziehungen eingegangen ist und die er weit über ihre [53] anfängliche Erscheinung hinaus kennengelernt hat, bis zur völligen Auflösung aller Gründe für Anziehung oder Interesse. Mag sein, dass der spannendste Aspekt einer Begegnung in deren hypothetischer Dimension liegt: in den nicht ausgeloteten Möglichkeiten.