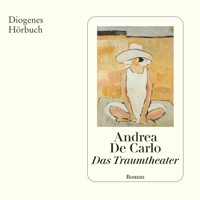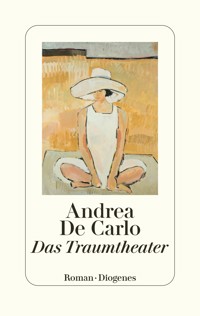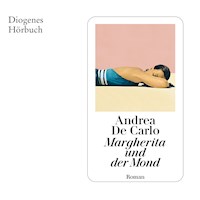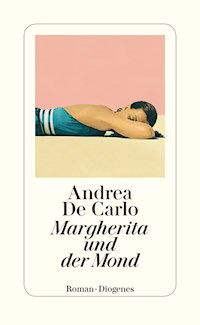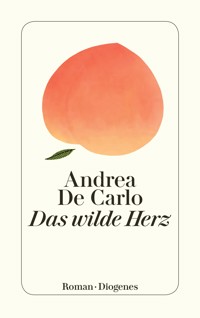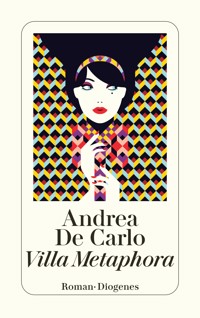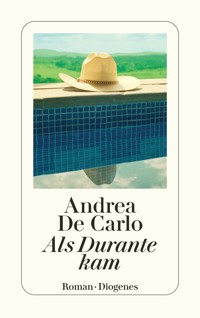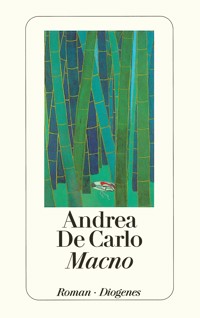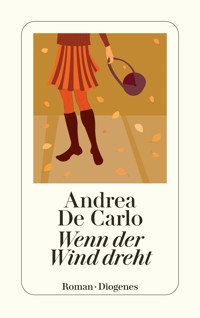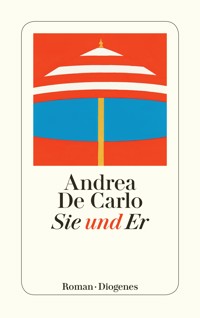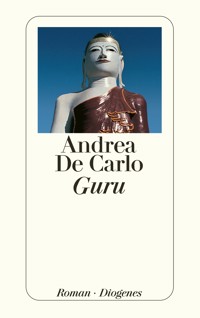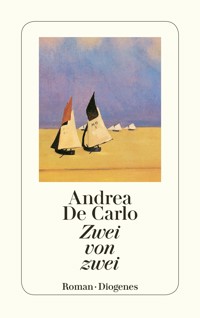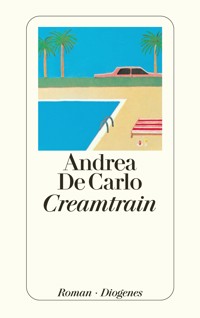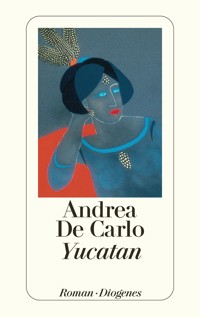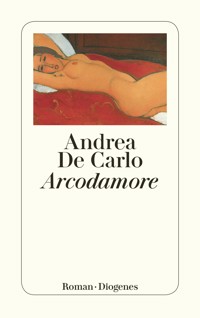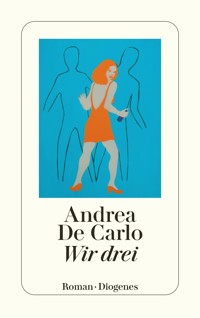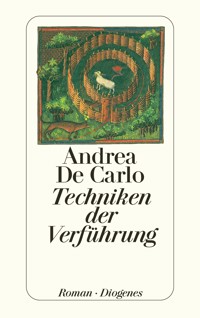
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Autor zwischen der Frau, die er liebt, und dem Literaten, den er bewundert und der ihn fördert: In diesem modernen Künstlerroman wird das Schriftstellerdasein zum Abenteuer. Unter De Carlos Feder entsteht ein spannendes und scharfes Bild des heutigen – korrupten – Italien: Der Leser blickt hinter die Kulissen und erfährt Aufschlussreiches über das Innenleben von Redaktionsstuben und Literaturbetrieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andrea De Carlo
Technikender Verführung
Roman
Aus dem Italienischen vonRenate Heimbucher
Titel der 1991 bei Bompiani, Mailand,
erschienenen Originalausgabe:
›Tecniche di seduzione‹
Copyright © 1991 Gruppo Editoriale Fabbri,
Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A.
Die deutsche Erstausgabe
erschien 1993 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Livre de Chasse
des Grafen Gaston Phoebus,
›Les Chasses à Chantilly‹, 15.Jahrhundert
Copyright © Bibliothèque nationale, Paris
Jede Ähnlichkeit
mit lebenden Personen und
tatsächlichen Begebenheiten
ist rein zufällig
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
www.diogenes.ch
Diogenes Verlag AG Zürich
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22783 3 (4.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60363 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
I Techniken der Annäherung [7]
II Techniken der Eroberung [151]
III Techniken der Besitzergreifung [289]
IV Techniken des Verlassens [405]
[7] I
Techniken der Annäherung
[9] Eins
Im November 90 arbeitete ich in der Redaktion von Prospettiva, mit einem Praktikantenvertrag, weil ich noch nicht die Journalistenprüfung gemacht hatte. Die Büros waren im zweiten Stock eines riesigen Gebäudes aus Glas und Beton, das auf einer öden Grasfläche an der östlichen Peripherie Mailands lag, umgeben von Trabantensiedlungen und Industriehallen und LKW-Depots und Autobahnauffahrten und Schnellstraßen voll dichtem Verkehr aus der Stadt und in die Stadt. Die Etage war als Großraumbüro konzipiert, so daß zu jeder Minute des Tages jeder jeden im Blick hatte: Köpfe und Oberkörper und Arme in ständiger Bewegung zwischen Barrikaden aus Metallschränken und Preßspan-Raumteilern. Die Luft wurde in einem geschlossenen Kreislauf klimatisiert, gefiltert und recycelt, die Fenster waren versiegelt. Der Fußboden war mit einem Synthetikspannteppich ausgelegt, der sich bei jedem Schritt elektrisch auflud, so daß man einen kleinen Schlag bekam, sobald man mit der Hand irgend etwas berührte. Das Neonlicht war gnadenlos weiß, und in den seltenen Augenblicken der Stille, in der Mittagspause oder abends, wenn fast alle gegangen waren, hörte man an der niedrigen Decke Tausende von Leuchtstoffröhren knistern, die unter Metallgittern notdürftig verborgen waren. In der übrigen Zeit herrschte eine Geräuschkulisse wie in einem elektronischen Bienenstock, Keybordgeklapper und Computersummen und gedämpfte Telefontriller und sich kreuzende und überlagernde Stimmen, die halblaut persönliche [10] Bemerkungen murmelten, flüsternd Informationen austauschten und herrische Anordnungen skandierten.
Am späteren Vormittag kam Tevigati, der Chefredakteur, an meinem Schreibtisch vorbei und sagte in seiner gewohnten beiläufigen Art: »Roberto Bata, kannst du mal einen Augenblick zu mir kommen?«
Ich arbeitete gerade an einer Textcollage aus Telefoninterviews zu der These, daß große Busen out sind; ich antwortete ihm: »In fünf Minuten.« Erst vor wenigen Monaten hatte er mich einen ganz ähnlichen Bericht zusammenstellen lassen, in dem es hieß, daß üppige Formen allenthalben das Bild beherrschten, ebenfalls belegt mit Meinungsäußerungen von »Persönlichkeiten der Kulturszene« und einer ganz ähnlichen Auswahl berühmter Italienerinnen und Amerikanerinnen, die als Beispiele angeführt wurden. Wenn man hier drinnen saß, mußte man den Eindruck bekommen, daß die ganze Welt aus unglaublich rasch aufeinanderfolgenden Zyklen bestand, in denen Verhaltensweisen und Vorstellungen und Motivationen und Triebe und Werte und Werke untergingen und wiederkehrten, um ohne ersichtlichen Grund erneut unterzugehen. Nahezu jede Woche glaubte man irgendein neues schwaches Anzeichen zu erspähen, das groß herausgestrichen und verallgemeinert werden mußte, bis es wie ein alles mitreißender Trend erschien; unsere Archive waren voll mit Fotos und Namen und Telefonnummern, die sich zur Bestätigung auch der unhaltbarsten Folgerungen heranziehen ließen. Drei Viertel meiner Zeit verbrachte ich damit, Kontakte zu Soziologen und Schauspielern und mehr oder weniger bedeutenden Politikern zu knüpfen, um ihnen ein Statement über Aids oder Jungmanager oder den Minirock oder über Sex im Auto oder den Hunger in der Dritten Welt zu entlocken. Eine Tätigkeit, die so stereotyp und [11] standardisiert und automatisch war, daß ein Computer sie genauso gut gemacht hätte, ohne daß ein kompliziertes Programm erforderlich gewesen wäre.
Es waren noch keine drei Minuten vergangen, da klopfte eine Redakteurin namens Germietti mit den Fingerknöcheln auf meinen Schreibtisch, deutete zu Tevigatis Platz hinüber und sagte: »Du, der will dich jetzt gleich.«
Also ließ ich meinen Monitor und ging im Zickzack zwischen Schränkchen und Raumteilern und Schreibtischen durch zu ihm. Einem außenstehenden Beobachter kam die Redaktion vielleicht wie eine emsig werkelnde Gruppe von Freunden vor, die zusammen eine Zeitung machten, aber abgesehen von der Tatsache, daß wir alle ziemlich jung waren und uns duzten und uns im gleichen Stil kleideten, gab es genauso wie in anderen Büros, in denen es viel förmlicher zuging, eine feste Rangordnung mit einem Verhaltenskodex und einer Hackordnung, von Stufe zu Stufe wachsenden Rechten und Gratifikationen.
Der Schreibtisch des Chefredakteurs Tevigati zum Beispiel stand an der Glasfront und erhielt natürliches Licht und war von hinten durch eine Schiebewand abgeschirmt, an die Fotos und Ansichtskarten und persönliche Notizen gepinnt waren. Viel war das nicht, wir einfachen Redakteure aber hatten nicht einmal das, um uns gegen die Reizüberflutung zu schützen.
Tevigati musterte mich von unten bis oben, forderte mich mit einer Handbewegung auf, Platz zu nehmen. Er telefonierte gerade und machte sich auf einem kleinen Block Notizen, behielt dabei den Bildschirm im Auge und schaute aus dem Fenster, zurückgelehnt in seinem Schreibtischsessel mit federnder Rückenlehne. Hier drinnen konnte schwerlich jemand einen Gedanken zu Ende denken, ohne unterbrochen zu werden und auf zwei, drei, oder vier [12] andere Schienen abgelenkt zu werden, denen man allen gleichzeitig folgen sollte. Deshalb wurde die Fähigkeit, sich auf nichts eindeutig zu konzentrieren, in der Redaktion auch so hoch bewertet, ja auf den oberen Machtstufen sogar als regelrechte Tugend vorgeführt.
Ich bemühte mich, Tevigati nicht allzu auffällig zu beobachten; ich sah zu den Flugzeugen hinüber, die im nahen Flughafen starteten und hinter den Pappelreihen in den schmutzig-weißen Himmel aufstiegen. Dies hier war wirklich nicht die Arbeit, die mir vorgeschwebt hatte, als ich zu schreiben anfing, andererseits gab es zwischen meinen Vorstellungen und der Realität ohnehin nicht viele Berührungspunkte. Immerhin hatte ich ein regelmäßiges Einkommen und konnte die Wohnungsmiete bezahlen, statt meinen Eltern auf der Tasche zu liegen wie damals, als ich noch davon träumte, Enthüllungsjournalismus zu betreiben oder Romanschriftsteller zu werden, ohne mir die Verben vorschreiben und die Adjektive kontingentieren lassen zu müssen.
Tevigati legte den Hörer auf, spannte die Lippen zu einer Art geistesabwesendem Lächeln. »Da bin ich«, sagte ich; aber sein Blick war noch nicht auf mich eingestellt. Hier drinnen mußte jede Botschaft warten, sich genügend verdichten, durch die sich ab und zu öffnenden Kanäle schlüpfen, um dann genau im richtigen Moment, nicht zu früh und nicht zu spät, einzutreffen.
Ich schwieg, sah zu, wie er an seinem Daumen nagte, rasch auf die Telefontasten hämmerte und sich von einer Sekretärin eine Nummer geben ließ. Seine Aufmerksamkeit war von Natur sprunghaft und schaltete alle paar Sekunden um, was ihm sehr dabei geholfen haben mußte, seinen Posten zu erobern und ihn trotz häufig wechselnder Besitzer und Verlagsleiter die ganzen letzten Jahre [13] hindurch zu behalten. Ohne den Hörer vom Ohr zu nehmen, zog er eine Einladungskarte aus einer Schublade, kickte sie mit den Fingern, an denen die Nägel völlig abgekaut waren, zu mir herüber.
Ich beugte mich vor und las: Unter dem Signum eines der bedeutendsten Mailänder Theater und dem Symbol der Stadtverwaltung stand Der Traumaktivator – Konzertantes Schauspiel in zwei Akten, und weiter unten nach einem Text von Marco Polidori. Ich sah Tevigati fragend an, denn das Theater war der Exklusivbereich von Angelo Zarfi, einem fettleibigen Kritiker mit schriller Stimme, der seine Besprechungen in Form von verschlüsselten Botschaften an einen kleinen Kreis von Eingeweihten verfaßte. Bei Prospettiva waren die Kompetenzbereiche fest voneinander abgeschottet: meiner lag zwischen Kultur und Folklore, in Wirklichkeit weit mehr bei Folklore als Kultur, ohne jede Chance, in absehbarer Zeit herauszukommen. »Zarfi schreibt über das Stück, du sollst die da interviewen«, sagte Tevigati. Mit seinem Kugelschreiber unterstrich er in der Liste der auf der Einladung abgedruckten Schauspieler den Namen Maria Blini, der ganz klein unter dem Regisseur Remo Dulcignoni, der Bühnenbildnerin Aida Celbatti, dem Komponisten Silvio Dramelli und dem Hauptdarsteller Riccardo Sirgo stand.
Währenddessen setzte er seine telefonische Fahndung fort: »Nein, nein, den aus Paris. Paris, verdammte Scheiße.« Er gefiel sich in einer vulgären Ausdrucksweise, vor allem gegenüber den Frauen in der Redaktion, zugleich aber sollte mir sein Tonfall auch die Rangverhältnisse klarmachen, mir vor Augen führen, daß ich gegen ihn gänzlich unbedeutend war.
»Wieviele Zeilen?« fragte ich, bloß um ein paar Sekunden schneller zu sein als er. Ich versuchte mir oft einzureden, [14] daß die Arbeit hier in diesem Laden eine Quelle der Inspiration für mich war; dann wieder war ich sicher, daß meine Fähigkeit, frei zu schreiben, dabei für immer draufgehen würde.
»Dreißig Zeilen«, sagte Tevigati, als spräche er überhaupt nicht mit mir. Er kaute an seinem Daumen, schnaubte in den Hörer, würdigte mich keines Blicks.
»Bis wann?« fragte ich.
Er deutete ungeduldig auf die Einladung, auf der das Datum des heutigen Tages stand. »Morgen früh«, sagte er. »Es kommt in diese Nummer. Bring ein bißchen Pep rein, mach was aus ihr.«
Ich sagte: »Ich weiß nicht, ob ich’s schaffe, heute abend. Ich hatte schon was vor.«
Er brüllte in den Hörer: »Den aus dem Büro, wen denn sonst, Himmelherrgott! Ich warte seit einer Stunde!«
Konzertante Schauspiele anzusehen und debütierende Schauspielerinnen zu interviewen und mit der Dringlichkeit eines Kriegsberichts dreißig Zeilen Schwachsinn zu schreiben war das letzte, was ich an diesem Abend gern gemacht hätte. Ich hatte meiner Frau Caterina versprochen, mit ihr essen zu gehen; es war Donnerstag, und ich hatte es satt, mir schlichte, kurze, reißerische Sätze einfallen zu lassen, um die wechselhafte Neugier der Prospettiva-Leser zu kitzeln.
Aber Tevigati war so gereizt, daß er nicht mehr ansprechbar war: er knallte den Hörer auf die Gabel und drückte mir die Karte in die Hand, sagte: »Das Leben besteht auch aus kleinen Extra-Anstrengungen, lieber Roberto Bata.« Die Art, wie er mich immer mit Vornamen und Familiennamen ansprach, machte mich wütend: der studentische oder kommißhafte Ton, den er dabei jedesmal anschlug.
Dann blinkte das Kontrollämpchen an seinem Telefon [15] auf, die Nadeln seines Druckers begannen über das Papier zu kratzen, eine Redakteurin kam mit einem Ordner in der Hand; Tevigati verabschiedete mich mit einer unbestimmten Handbewegung, und sein Interesse an mir erlosch.
[16] Zwei
Zu Hause sagte ich zu Caterina, daß wir nicht essen gehen konnten, weil ich ins Theater müsse, um diese junge Schauspielerin zu interviewen. Sie schien nur leicht enttäuscht, trübselig und vom Winter angeödet wie sie war, aber zwei Minuten später lehnte sie mit Tränen in den Augen am Fenster. Ich fragte sie, was sie habe, legte ihr den Arm um die Schulter; sie riß sich los, sagte: »Zum Teufel mit dir, laß mich in Ruhe.« Ich wollte ihr erklären, daß es nicht meine Schuld war und ich nichts machen konnte, aber sie schrie mich an, sie sei es leid, jeden Abend zu Hause zu sitzen und vor Langeweile umzukommen, bloß weil ich es nicht fertigbringe, mich auch nur ein einziges Mal gegen Tevigati durchzusetzen.
Der Frust, der in mir steckte, ließ meine Schuldgefühle in Wut umschlagen, und ich schrie im gleichen Ton zurück, daß ich ja nicht zum Spaß bei Prospettiva arbeite, daß ich schon längst gekündigt hätte, wenn ich allein wäre und kein geregeltes Leben führen und sie unterstützen müßte, damit sie ihren Vertretungsdienst als junge Augenärztin machen konnte. Unsere Stimmen und die Worte, die wir wählten, wurden immer böser, bis es so ähnlich klang wie zwei Hunde, die aufeinander losgingen; ich schnappte mir meinen Mantel, knallte die Wohnungstür zu und rannte die Treppen hinunter, wie von Sinnen vor Wut und Müdigkeit und Hunger und schlechtem Gewissen. Drunten auf der Straße sprang das Auto nicht an, ich hatte die Scheinwerfer angelassen, und die Batterie war leer.
[17] Ich mußte zu Fuß zur Bushaltestelle gehen und in dem eiskalten und giftigen Nebel fast zwanzig Minuten warten; als ich im Zentrum ankam, blieb mir noch eine ganze Stunde bis zum Beginn der Vorstellung. Ich sah mir die Bars mit den beleuchteten Vitrinen voll belegter Brötchen an, aber ich hatte nicht die geringste Lust, hineinzugehen und allein zu essen; zum Zeitvertreib lief ich fünfzigmal um die gleichen Häuserblocks. Dann war es plötzlich fünf vor neun, und ich ging schneller, rannte das letzte Stück fast.
Das Theaterfoyer war so heiß wie eine Sauna, voller übertrieben herausgeputzter Leute, die sich um den Kassenschalter drängten oder ihre Mäntel und Pelze an der Garderobe abgaben oder von ständigem Lächeln und Seitenblicken und Grußgesten und Blicken auf die Uhr durchsetzte Gespräche führten. Es war ein Premierenpublikum, viel aufgeregter als das etwas tranige Mittelschichtpublikum, das derartige Aufführungen in Mailand sonst besucht: Werbeleute waren da und Architekten und Jungmanager und Familiensöhnchen, langbeinige amerikanische Models und Managerinnen und Psychologinnen und Verlobte, die wie verrückt rauchten, reife Damen mit mahagonifarben oder rot getöntem Haar, Greisinnen mit silberblauen, auftoupierten Köpfen, die sich nur mit Hilfe von Korsetten und elastischen Binden auf den Beinen halten konnten, in quadratischen Schuhen mit Absätzen so klobig wie Zebrahufe.
Die feinsten Gäste trafen erst im letzten Moment ein, gespielt gleichgültig inmitten der allgemeinen Aufmerksamkeit: der Bürgermeister mit Frau und Tochter, die in Haute-Couture-Kleider gehüllt und mit goldenen Armreifen behängt waren, der neue Intendant der Scala, ein paar Fernsehstars, eine Modeschöpferin, eine Tänzerin, eine Sängerin mit so oft geliftetem Gesicht, daß sie schon gar [18] nicht mehr versuchte, ihren Ausdruck zu verändern. Einige von ihnen hatte ich telefonisch für Prospettiva zu den verschiedensten Themen interviewen müssen; es beeindruckte mich, sie an mir Vorbeigehen zu sehen wie Verkörperungen ihrer Telefonstimmen, ohne einen Schimmer davon, daß sie je mit soviel falscher Freundlichkeit mit mir gesprochen hatten.
Dann gingen die Lichter aus und wieder an und wieder aus, die Menge drängte zu den Saaltüren; ich ließ mich im Strom mittreiben.
Das Stück war kostenaufwendig inszeniert, anderthalb Milliarden Lire Subventionen aus öffentlichen Mitteln für die Realisierung der frigiden Phantasien des Regisseurs Dulcignoni und seiner Bühnenbildnerin Celbatti. Hauptdarsteller war Riccardo Sirgo mit seinem Doppelkinn und seinem gefärbten, quer über die Glatze gekämmten Haar, der sämtliche Untugenden und Klischees des institutionalisierten experimentellen Theaters in Italien in sich vereinte und mit einer fast unerträglich selbstgefälligen Riesenfrosch-Stimme sprach. Fünf jüngere Schauspieler, kahlgeschorene Muskelprotze, bewegten sich zwischen Treppen und Rutschbahnen und Monitoren um ihn herum, kletterten große, auf Schienen montierte Kuben hinauf und wieder hinunter. Dulcignoni und Sirgo mußten mit vereinten Kräften daran gearbeitet haben, jedem Satz einen unnatürlichen Rhythmus zu geben und den Wörtern ihren Sinn zu nehmen, sie wie ein Glucksen oder Röcheln oder Brummen klingen zu lassen, begleitet vom Zirpen und Stottern des auf einer beweglichen Plattform hinter der Bühne auf- und niederschwebenden Orchesters.
Außerdem wirkten zwei Schauspielerinnen mit, in grauen Baumwollumhängen, die absichtlich so geschnitten waren, daß bei jeder Bewegung nackte Haut blitzte und [19] dem Publikum auf diese Weise wenigstens ein interessanter Einblick geboten wurde. Die eine war häßlich, erinnerte mit ihrem rabenschwarzen Haar eher an eine Opernstatistin und war grobknochig wie ein Marathonläufer, die andere aber hatte eine schlanke und wohlgeformte Figur und ein schönes, von kurzem, weizenblondem Haar eingerahmtes Gesicht mit einer vorwitzigen Nase; sie hatte eine sinnliche Art, sich zu bewegen, eine leicht rauhe und verglichen mit den anderen Schauspielern wenig geschulte Stimme. Auch wenn ihre Rolle marginal, sozusagen rein dekorativ war, auf wenige Sätze und abstrakte Tanzbewegungen beschränkt, wirkte sie in diesem Panorama wandelnder Leichen wie der einzige Funke Leben. Es zog mich an, daß sie kaum etwas von der gekünstelten Professionalität an sich hatte, die ihre Kollegen so unerträglich machte, so wie mich ihre aus dem Rahmen fallende Natürlichkeit und ihr geschmeidiger und zugleich schüchterner Gang anzogen, ihre Beine mit den vollen Waden und den schmalen Fesseln, ihre runde Stirn. Ich sah nur noch sie, und jedesmal, wenn sie von der Bühne verschwand, überfiel mich trostlose Langeweile; die ganze Zeit hoffte ich nur, daß sie diese Maria Blini war, die ich interviewen sollte.
In der Pause ging ich in das von Rauch und Geplauder erfüllte Foyer. Jedesmal, wenn einer den Platz wechselte, entstanden kleine Wellen von Blicken und wohlüberlegten Bewegungen, Annäherungen, die zufällig wirken sollten. Jeder Gruß löste eine Kettenreaktion aus, Bemerkungen und Händeschütteln, Gelächter und leere Gesten, wie Zauberworte ausgesprochene Namen. Ich schlenderte lustlos umher, versuchte gar nicht erst, irgendeinen Ausdruck aufzusetzen, müde und gelangweilt und schwitzend in meinen dicksohligen Schuhen, in meiner Tweedjacke, die mir schon den ganzen Tag zu warm gewesen war. Ich winkte [20] einer ehemaligen Schulkameradin zu; sie ging vorbei, ohne mich auch nur zu erkennen. Ich grüßte Angelo Zarfi, den Kritiker von Prospettiva; er schenkte mir ein kaum wahrnehmbares Lächeln und drehte den Kopf sofort wieder weg, auf der Suche nach wer weiß was für anderen Kontakten.
Der zweite Teil des Stücks war noch schlimmer als der erste: noch steriler und wahnhafter, unausgewogen und ohne Rhythmus, ohne den kleinsten Anhaltspunkt, bis auf die blonde Schauspielerin. Die Wörter donnerten über die Bühne wie Panzer bei einer Militärparade, unverständlich, aber bedrohlich, überschnitten sich in häßlichen Geometrien; hätte ich nicht das Mädchen, von dem ich hoffte, daß es Maria Blini war, zum Anschauen gehabt, ich wäre auf die Straße geflüchtet und hätte das Ende des Stücks draußen abgewartet. So aber konzentrierte ich mich auf sie und grenzte alles andere aus, auch wenn sie gerade weit weg oder von dem monumentalen Bühnenbild halb verdeckt war. Ich verfolgte interessiert ihre Bewegungen: wie sie hüpfte und die Arme hochwarf und sich gegen die anderen Schauspieler lehnte und die Beine unter der hauchdünnen Tunika vorstreckte, immer mit einer Spur Verlegenheit oder Unsicherheit und daher manchmal langsamer oder schneller als der Rhythmus der Gesamtchoreographie. Diese Ungenauigkeiten ließen sie aber nicht linkisch wirken, sondern hoben sie aus der düsteren Szenerie des Stücks heraus. Meine ganze Aufmerksamkeit richtete sich auf ihre Art, auf den Zehenspitzen zu balancieren oder die kurzen Haare zu schütteln, wenn sie eine Drehung machte: ein hübsches junges Mädchen, das brav eine Übung einstudiert hatte, deren Sinn und Zweck es nicht in Frage stellte.
Als das Stück zu Ende war, wartete ich stehend, mitten im überwiegend höflichen und befreit klingenden Applaus, [21] der sich unter den vereinzelt ertönenden enthusiastischen Beifall mischte, der nicht minder hartnäckig war und durch Rufe nach dem Regisseur, nach der Bühnenbildnerin, dem Komponisten und dem Hauptdarsteller verstärkt wurde. Die blonde Schauspielerin verschwand mit ihren Kollegen in den Kulissen, kam aber gleich wieder herausgerannt, lächelte, verbeugte sich Hand in Hand mit den anderen. Ich sah sie heftig atmen nach zwei Stunden ständiger Bewegung, einbezogen in die allgemeine Begeisterung für Dulcignoni und die Celbatti und Sirgo und Dramelli, die wie vier Königinnen im Zentrum der Bühne herumstolzierten.
Zuletzt begannen die Leute aus dem Saal zu strömen; ich folgte einer kleinen Prozession von Zuschauern, die ganz darauf versessen waren, die für das Unterfangen Verantwortlichen aus der Nähe zu sehen und gesehen zu werden. In dem engen Korridor drängten Männer und Frauen an mir vorbei zu den Künstlergarderoben, um Dulcignoni und Aida Celbatti und Sirgo und Dramelli mit Umarmungen und Küssen und maßlosen Komplimenten zu überhäufen. »Hervorragend«, sagte der Bürgermeister immer wieder mit seiner farblosen Stimme; und die anderen Ehrengäste plapperten dieses Adjektiv mit unterschiedlichem Timbre und unterschiedlicher Emphase nach, was die vier Stars des Abends zu halben Verbeugungen und selbstgefälligem Lächeln veranlaßte. Die Tochter des Bürgermeisters versuchte sich vor Sirgo aufzuspielen: sie wiegte sich in den Hüften und fuchtelte mit den Händen, die goldenen Armreifen klirrten an ihren mageren Armen. Sirgo entblößte seine falschen Zähne, mimte den Interessierten und Belustigten, als stünde er immer noch auf der Bühne, paßte dabei aber auf, daß er nicht in die Ecke abgedrängt und von den anderen Quellen des Lobs abgeschnitten wurde.
Die Jungschauspieler standen weiter hinten, auf dem [22] Korridor oder an der Tür zu ihren Garderoben, blaß und naßgeschwitzt, von kaum weniger angesehenen Verehrern und Verehrerinnen belagert als die Hauptdarsteller. Ich fragte einen von ihnen, wer Maria Blini sei; ohne mich anzusehen, deutete er auf die junge Blondine, die von drei, vier Schwachköpfen bedrängt wurde, aus denen die Adjektive nur so hervorsprudelten. Sie hörte sie lächelnd an, schüchtern und geschmeichelt, elektrisiert durch die Premierenatmosphäre. Auch aus der Nähe betrachtet besaß sie echte, natürliche Anmut; das Neonlicht nahm ihr nicht wie ihren Kollegen die dreidimensionale Ausstrahlungskraft, die sie auf der Bühne gehabt hatte.
Sowie ich eine Bresche in dem Halbkreis der sie Belagernden bemerkte, schlüpfte ich hindurch, sagte zu ihr: »Ich bin Roberto Bata von Prospettiva, ich soll ein Interview mit Ihnen machen, wenn Sie fünf Minuten Zeit haben.« Mir war heiß, und ich spürte den Atem und die Blicke zu vieler Menschen um mich herum; ich war nicht daran gewöhnt, diesen Satz, den ich am Telefon schon so oft gesagt hatte, jemandem von Angesicht zu Angesicht zu sagen.
»Ah ja«, sagte sie, schien aber überrascht und unsicher, blickte sich haltsuchend um. In Wirklichkeit war sie aus der Nähe noch hübscher als vorhin auf der Bühne, noch aparter. Die Augenschminke war ihr die Wangen hinabgelaufen, aber der Blick ihrer haselnußbraunen Augen war ebenso klar wie ihre Züge, die kurze, ein bißchen breite Nase, die hohen Wangenknochen, die vollen, rosigen Lippen, das warm schimmernde blonde Haar. Sie war von der Anstrengung und dem Hin-und-her-Laufen am Schluß immer noch außer Atem, nackt unter dem feuchten Baumwollstoff, hin und her gerissen zwischen ihrem Interesse für mich und dem für die anderen, die ringsum warteten.
[23] Aus wenigen Zentimetern Entfernung sah ich gebannt auf ihre fast unmerklich bebenden Lippen; sie fragte: »Könnten Sie ein paar Minuten warten?«
»Aber sicher«, sagte ich, fast zu hastig, und wich an die Wand zurück; die anderen drängten an mir vorbei, begierig, sich mit weiteren vorgefertigten Phrasen wichtig zu machen.
Etwa eine Viertelstunde stand ich in einer Ecke und verfolgte das Kommen und Gehen der Gratulanten, hörte mir mit immer geringerer Neugier an, was sie von sich gaben. Es war elf Uhr vorbei, und ich war müde und halb verhungert, bekümmert wegen des Streits mit Caterina, verwirrt von den Empfindungen, die ich bei meinem kurzen Gespräch mit Maria Blini gehabt hatte. Ich dachte an die Fragen, die ich ihr stellen konnte, ohne allzu platt oder aufdringlich zu wirken; an die dreißig Zeilen, die ich am nächsten Morgen abliefern sollte; ich suchte nach einem Anfang, aber mir fiel keiner ein.
Irgendwann gingen auch die hartnäckigsten Bewunderer, zusammen mit Dulcignoni und der Celbatti und Dramelli; die jungen Schauspieler tauschten kurze Bemerkungen über das Stück aus, Vorwürfe und technische Rechtfertigungen, knufften sich zum Spaß. Ich versuchte mich an Maria Blini heranzumachen, aber Sirgo kam mir zuvor und umarmte sie, verschwitzt und aus der Form geraten wie er war, küßte sie aufs Haar und sagte mit seiner gezierten Froschstimme: »Entzückend, ganz entzückend.« Auch die jungen Männer der Truppe sagten ihr und dem anderen jungen Mädchen Artigkeiten, bevor sie unter die Dusche gingen, obwohl ihr Interesse an Frauen sichtlich gering war. Es herrschte ein kameradschaftliches Klima zwischen ihnen, eine körperliche Vertrautheit, angesichts derer ich mich noch müder und ausgeschlossener fühlte.
[24] Dann bemerkte mich Maria Blini; sie sagte: »Ach, entschuldigen Sie. Wenn Sie noch fünf Minuten auf mich warten können, ich dusche schnell und ziehe mich an.« Sie mußte schon ganz erschöpft sein, aber man merkte ihr nichts an; sie schien immer noch voller Lust, sich zu bewegen und sich zu zeigen.
So setzte ich mich auf eine Metallbank im Korridor, halb besorgt wegen der späten Stunde, halb erfreut, daß die Situation fortdauerte. Eine Garderobiere kam und sammelte die Kostüme auf, die die Schauspieler auf den Boden geworfen hatten; auf der Bühne hinter uns hantierten die Arbeiter und räumten die Requisiten auf. Ich hörte Hammerschläge und das Quietschen von Seilwinden, Wasserrauschen in den Duschräumen; ein Schauspieler pfiff, ein anderer gurgelte.
Endlich kam Maria Blini mit noch feuchtem Haar, bekleidet mit einer kurzen schwarzen Jacke und schwarzen Samthosen. Ich fragte sie, wo wir das Interview machen konnten, sie sagte: »Irgendwo, Hauptsache, es gibt was zu essen.« Sie lächelte, faßte sich an den Magen.
»Klar«, sagte ich, auch wenn ich vorgehabt hatte, ihr meine Fragen hier im Theater zu stellen und dann nach Hause zu gehen, und überhaupt nicht wußte, wohin ich zu so später Stunde mit ihr gehen sollte. Aber ich war selber ausgehungert, und der Gedanke, mit einem so hübschen Mädchen essen zu gehen, ließ mein Herz höher schlagen.
Sie holte einen kurzen schwarzen Mantel aus ihrer Garderobe, verabschiedete sich von den anderen Schauspielern, die sich fertig anzogen oder kämmten, und ging mir zum Bühnenausgang voraus. Es beeindruckte mich, wie sich ihre etwas steife Höflichkeit mit einem viel instinktiveren Verhalten, ihre Schüchternheit mit einer körperlichen Ungezwungenheit vermischte, die nur Leute haben, die mit [25] ihrem Körper arbeiten und Spaß daran haben. Ich beobachtete ihren Gang und war hingerissen von ihren Bewegungen; von der Art, wie sie sich ein paarmal umdrehte und mich anlächelte.
Draußen auf dem Gehsteig jedoch stand ein Grüppchen Leute, die fröstelnd auf sie warteten. Ein Typ mit glatt zurückgekämmten Haaren rief »Na endlich!«, kam auf sie zu und nahm sie in die Arme; hinter ihm stand ein großgewachsenes Mädchen, das wie eine Giraffe um sich blickte, und ein sehr steifes Paar, das ich schon in der Künstlergarderobe gesehen hatte, und ein Typ in schwarzer Lederkluft mit kahlgeschorenem Kopf. Alle zusammen machten Maria erneut Komplimente, wie einem kleinen Mädchen, das gerade aus der Schule gekommen ist; sie schwatzten auf sie ein und schauten sie an und drehten sich dann zu zwei großen, an der Gehsteigkante geparkten Autos um, konnten es nicht erwarten, endlich aufzubrechen, und schenkten mir keinerlei Beachtung.
Maria warf mir einen unsicheren Blick zu; mit einer Handbewegung zu den anderen hin sagte sie: »Das ist Roberto Bata von Prospettiva.«
Sie sagten »hallo«, mit sehr geringer Begeisterung; nur der mit dem glattfrisierten Haar gab mir die Hand, sagte »Luciano Merzi«, auch er nicht gerade herzlich.
Dann kam Sirgo mit Schal und Hut und hochgeschlagenem Mantelkragen aus der Tür wie die Karikatur eines Schauspielers, gefolgt von der zweiten, weniger hübschen Schauspielerin. Er sah kaum jemand an, sagte nur: »Wo ist das Auto, ich hol mir noch eine Lungenentzündung.«
Der Mann mit dem steifen Benehmen öffnete unverzüglich die Tür eines der Autos; ich und Maria und das Giraffenmädchen und der Kahlköpfige stiegen in das Auto von Luciano Merzi.
[26] Wir fuhren in der in Nebel getauchten Innenstadt herum, Maria saß vor mir auf dem Beifahrersitz wie eine wertvolle Geisel, ich auf dem Rücksitz zwischen dem Giraffenmädchen, das kein Wort sprach, und dem Kahlköpfigen, der sich immer noch in Betrachtungen über das außergewöhnliche Bühnenbild erging. Merzi fuhr äußerst langsam; ließ seine behandschuhten Finger über das Lenkrad gleiten, erklärte Maria, wie grundlegend ihre Gegenwart für das Gleichgewicht des Stücks gewesen sei. Sie zierte sich, sagte: »Wo ich doch die Hälfte der Einsätze verpatzt habe.« Aber natürlich freute sie sich über die Komplimente: man hörte es ihrer Stimme an.
Luciano Merzi wußte den Weg nicht genau oder wollte uns so lange es ging im Auto behalten; als er nach einigen Runden endlich anhielt, waren wir etwa dreihundert Meter vom Theater entfernt, zu Fuß hätten wir dazu nur ein paar Minuten gebraucht. Vor einem Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert mit gelb gestrichener Fassade stiegen wir aus, Merzi deutete nach oben auf eine Reihe beleuchteter Fenster. Wir waren mitten in der Innenstadt von Mailand, in dem kleinen Bezirk, wo die berühmten Modeschöpfer und Juweliere ihre Ateliers haben und die Wohnungen teurer sind als irgendwo sonst in Italien. Vereinzelte Verkehrsgeräusche kamen von weither, die Gehsteige waren verwaist und makellos sauber. Ich hatte keine Lust, so spät abends zu einem Empfang in eines dieser Häuser zu gehen; aber Merzi schob uns hinein, es war zu spät, etwas zu sagen.
Der Aufzug fuhr in eine große, überheizte und zu hell beleuchtete Diele hinauf, die mit all dem Stuck und Edelholz und Samt und Glas an eine Bonbonniere erinnerte und in einen dicht bevölkerten Saal mündete. Die Hausherrin war klein und blond, falten- und scheinbar alterslos; sie faßte [27] zur Begrüßung im Vorraum Sirgos beide Hände, und als sie Maria erspähte, zog sie ihn hinter sich her, um auch noch ihrer habhaft zu werden. Als ich ihre Stimme hörte, fiel mir ein, daß sie Paola Zobetto di Susta hieß, ich hatte einmal mit ihr telefoniert, als ich eine Meinungsumfrage über das Comeback von Pelzmänteln machte. Sie hakte sich bei Maria und Sirgo ein, jeden an einer Seite, und trat mit ihnen in den Saal wie eine pummelige und zu klein geratene Königin.
Ich und Merzi und der Kahlköpfige und das Giraffenmädchen gingen hinterher, mitten unter die Ehrengäste von vorhin, die Grüppchen um den Bürgermeister mit Frau und Tochter und um Dulcignoni, um die Celbatti und Dramelli bildeten. Alle tranken Champagner, fischten sich Erdnüsse und Salzgebäck aus Schalen, die auf jeder geeigneten Fläche rumstanden, redeten und redeten. Auch ich nahm mir ein Glas, fühlte mich dabei mit meinen Alltagsklamotten und meinen Arbeitsabsichten unter den Abendkleidern und blasierten Gesichtern, die ich mir schon allzu lang hatte ansehen müssen, noch unbehaglicher als im Theater.
Dann lenkte die Hausherrin die Aufmerksamkeit auf eine lange Tafel, hinter der einige Kellner darauf warteten, Essen auszugeben, und die Gäste setzten sich in Bewegung, ohne ihre Gespräche und Posen aufzugeben. Aber alle hatten schrecklichen Hunger, und bald herrschte am Büffet ein fast gewalttätiges Gedränge: man schubste und drückte, um sich den Teller füllen zu lassen, lehnte sich an irgendein Möbelstück oder an die Wand, setzte sich auf Stühle oder Sessel oder Sofas, während die Blicke unentwegt zwischen den Gesichtern und dem Teller hin und her gingen.
Mir wurde klar, daß ich unter diesen Umständen nicht die geringste Chance hatte, zu meinem Interview zu kommen; ich stellte mir schon vor, was Tevigati für ein Gesicht machen würde. Dann sah ich an einem Fenster Maria Blini [28] mit ihrem Teller, eingeklemmt zwischen einem Werbefilmregisseur auf der einen und Luciano Merzi auf der anderen Seite, und ging zu ihr, fragte sie, ob sie mir fünf Minuten widmen könne, irgendwo in einer stilleren Ecke der Wohnung.
»Natürlich, entschuldigen Sie«, sagte sie sofort; wandte sich aber zu Luciano Merzi wie jemand, der mit einer solchen Situation nicht allein fertig wird.
Merzi ging widerstrebend zur Hausherrin; von weitem sah ich, wie sie fragte, für welche Zeitung ich arbeite, sah sie nicken, als er Prospettiva sagte. Sie kam und führte uns durch eine Flügeltür in einen kleineren Raum. »Halten Sie sie nicht stundenlang fest«, sagte sie zu mir mit einem kalten Lächeln, bei dem sich die gestraffte Haut an den Mundwinkeln kräuselte.
Dann waren Maria Blini und ich allein, setzten uns an die beiden Enden eines dick gepolsterten kleinen Sofas. Sie stellte ihren Teller mit Makkaroni in Béchamelsoße auf einen niedrigen intarsienverzierten Tisch; ich holte meinen kleinen batteriebetriebenen Rekorder aus der Tasche und postierte ihn neben ihren Teller. Ich stellte ihr die erste abgedroschene Frage, die mir ohne Nachdenken einfiel, sagte: »Wie sind Sie dazu gekommen, Schauspielerin zu werden?«
Es war ganz sicher nicht die ideale Interview-Situation, müde und abgelenkt und hungrig wie wir alle beide waren, mit den Stimmen und Geräuschen, die durch die Tür drangen, und trotzdem schaffte sie es, ohne die Wichtigtuerei und Heuchelei zu antworten, in die die meisten Interviewpartner verfallen, auch wenn sie noch so spontan wirken. Sie redete wie mit einem Freund und Vertrauten, verschanzte sich nicht hinter diplomatischen Ausflüchten oder künstlicher Begeisterung. Als ich sie fragte, was sie von dem Stück hielt, antwortete sie, es sei eine interessante [29] Erfahrung gewesen, aber überhaupt nicht ihr Geschmack, Dulcignonis Wesen und die Art, wie er Regie führte, hätten sie oft in Rage gebracht.
Ich blickte auf ihre Lippen, wenn sie sprach, betrachtete ihre Hände und Handgelenke, die glatten weißen Unterarme, die aus den Ärmeln schauten. Ich nickte zustimmend, ohne ihre Worte im einzelnen aufzunehmen; ich war überrascht von der Art, wie sie sich gab, von der naiven und beinahe gewagten Vertraulichkeit, mit der sie mir ihre Gedanken offenbarte.
Ich blickte auch immer wieder auf ihren Teller Makkaroni, der auf dem Tisch stand, denn ich starb fast vor Hunger: zwei-, dreimal dachte ich daran, sie zu fragen, ob ich eine Gabelvoll haben könne, aber ich getraute mich nicht. Nur mit Mühe konnte ich mich noch auf meine Fragen konzentrieren, ich strengte mich ungeheuer an, seriöser und nüchterner und gewissenhafter zu erscheinen, als ich war.
Ich fragte sie, was für Pläne sie nach dem Traumaktivator habe; sie sagte, das wisse sie noch nicht, außer daß sie im Frühjahr vielleicht eine Rolle in einem Film bekommen werde, der in Sizilien spielt. Ohne mich von meinen Interviewer-Stereotypen lösen zu können, fragte ich sie, was sie mehr interessiere, Film oder Theater; sie sagte: »Weiß ich nicht. Ein Film ist als Idee aufregender, so umfassend und glanzvoll, vielseitig und simultan. Aber wenn du nicht wirklich ein Star bist, sitzt du stundenlang rum und wartest, bis die Beleuchtung und die Kamerawagen und all der Kram aufgebaut ist, und wenn du dann endlich dran bist, dauert es nur ein paar Minuten, und du hast nur eine vage Vorstellung vom Ganzen. Erst wenn du den Film gesehen hast, weißt du, was du gemacht hast.« Sie wirkte auf einmal unkonzentriert und nervös, sie schien Mühe zu haben [30] weiterzusprechen. Sie deutete auf den Teller vor ihr, fragte: »Stört es dich, wenn ich esse? Mir ist schon ganz flau vor Hunger.«
»Iß ruhig«, sagte ich; sie stürzte sich voller Gier auf die Makkaroni in Béchamelsoße. Ich staunte, wieviel vitale Energie in ihren Bewegungen war, jetzt, wo sie sich nicht mehr zurückhielt; wie das Essen ihr unendlich viel interessanter und erfreulicher schien als all das leere Geschwätz und die künstlichen Intelligenzübungen, die den Abend gefüllt hatten. Sie fragte mich, ob ich auch etwas wolle, aus irgendeinem blödsinnigen Grund aber lehnte ich ab; ich sah sie weiter an, jedesmal, wenn wieder eine Gabelvoll Makkaroni zwischen ihren schönen Lippen verschwand, spürte ich einen Stich im Herz und im Magen.
Ich hätte ihr noch ein paar Standardfragen über ihr Privatleben stellen sollen, ob sie allein lebte oder mit jemand zusammen war und was für Hobbys sie hatte, aber meine Rolle kam mir ohnehin schon reichlich dämlich vor. Ich fragte sie, ob ihr Mailand gefalle; sie sagte nein, ohne hinzuzufügen, daß sie die Mailänder aber sehr möge, wie das sonst so üblich ist. Ich fragte sie, was sie las; sie sagte »Alles mögliche«, das letzte Buch, das sie vor den Proben gelesen hatte, war Ein Held unserer Zeit von Lermontow. Sie versuchte nicht im geringsten, gebildet oder intelligent zu erscheinen: sie antwortete impulsiv, verhaspelte sich ab und zu, lachte, langte mit der Gabel in Richtung Teller, sah mich an.
So erzählte ich ihr aus einem Impuls heraus, daß ich nur bei Prospettiva arbeite, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, in Wirklichkeit aber Schriftsteller werden wolle. Ich sagte ihr, daß ich an einem Roman schreibe, der in meiner Redaktion spielt, daß ich damit fast fertig sei. Außer mit Caterina hatte ich über dieses Thema nie mit jemand [31] gesprochen, aber ich wollte vor Maria nicht als bloßer Klatsch- und Tratschsammler dastehen; ich versuchte verzweifelt, ihr ein interessantes Bild von mir zu zeigen.
»Wirklich?« fragte sie, mit einem neugierigen Aufblitzen der Augen, genau wie ich es mir erhofft hatte.
Aber just in diesem Augenblick wurde die Flügeltür aufgestoßen, die Hausherrin streckte den Kopf herein und sagte: »Haben Sie uns die Ärmste jetzt lange genug entführt? Sie haben sie ja nicht mal essen lassen!« Hinter ihrer gespielten Entrüstung war unschwer echter Ärger zu erkennen. »Wir sind ja schon fertig«, sagte ich und stand auf.
Ich bereute es fast sofort, aber zu spät, denn die Tür war bereits weit offen und das Zimmer voller Leute und Stimmen und Rauch, und Maria Blini im Sog des Aufmerksamkeit heischenden und Aufmerksamkeit anbietenden allgemeinen Lächelns und der überschwenglichen Gesten schon zwei Meter von mir abgedriftet.
Ich beugte mich gerade zu meinem Rekorder hinunter, da bemerkte ich, wie durch die Menge um mich herum ein fast unmerkliches Vibrieren ging; einen Augenblick später sah ich, daß Marco Polidori gekommen war.
Er war nicht so groß, wie er auf Fotos oder im Fernsehen wirkte, aber stattlich gebaut und elegant in seinem schwarzen Anzug, dessen Schnitt gegenüber den steifen, ausgepolsterten Anzügen der anderen Gäste sehr salopp wirkte. Sein berühmtes, seitlich und im Nacken kurz geschnittenes volles Haar fiel ihm in die Stirn, seine berühmten dunklen Augen blickten genauso durchdringend wie auf den Umschlägen seiner Bücher. Bereitwillig ließ er die Zudringlichkeit der Hausherrin über sich ergehen, die ihm nicht von der Seite wich, tauschte Grüße und kurze Sätze mit den Gästen, zu denen er hingelotst wurde. So wie er lächelte, die Hände in den Taschen vergraben, amüsierte er sich offenbar nicht [32] sonderlich; aber er wußte, daß er im Blickpunkt stand, nahm es mit routinierter Lässigkeit hin. Im Vergleich zu Riccardo Sirgo war er ein Schauspieler viel modernerer Schule, verhalten und präzise, dem es nicht auf Effekthascherei, sondern auf die Feinheiten ankam.
Ich beobachtete, wie er sich von den Blicken der weiblichen Gäste verfolgt bewegte, und dachte, daß er vielleicht gerade dank dieser Fähigkeit, die richtige Balance zu finden, mit fünfzig Jahren der hierzulande und weltweit bekannteste italienische Schriftsteller war, dessen Romane hunderttausendfach verkauft, verfilmt und in viele Sprachen übersetzt wurden und dessen Titel von Semiologen und Werbeleuten und Politikern aufgegriffen und wiederverwertet wurden. Marco Polidori gehörte zu einer ganz anderen Kategorie als die Berühmtheiten, die ich mir für Prospettiva an die Strippe holte: einmal, als ich vorschlug, zu irgend etwas seine Meinung einzuholen, sagte Tevigati: »Der läßt sich doch nicht herab, mit den Zeitungen zu reden.« Das stimmte nicht, aber natürlich achtete er darauf, sich aus dem niederen Getümmel herauszuhalten, sich nicht allzusehr zu exponieren, sich nicht unter seinem Niveau zu verkaufen. Interviews gab er selten und nur wenn sie entsprechend groß herausgebracht wurden; im Fernsehen zeigte er sich nur in seriösen Sendungen und wenn er sicher war, der Ehrengast zu sein. Auf diese Weise war es ihm gelungen, sein Image zu pflegen und zu verbreiten, ohne es zu entwerten, gelungen, bei allen bekannt zu sein, ohne daß sein Ansehen, an das kaum einer seiner Kollegen herankam, darunter gelitten hätte.
Die Hausherrin führte ihn von Gast zu Gast und schließlich auch zu Maria Blini, stellte sie einander vor. Mit einer eleganten Geste gab er ihr die Hand, sagte: »Meinen Glückwunsch. Wie es aussieht, sind alle hell begeistert.« Er hatte [33] einen ganz leichten Triestiner Tonfall bei sonst neutralem Akzent; er sprach mit einem Minimum an Stimmaufwand.
»Ja, sieht so aus«, antwortete Maria, in ganz anderem Ton, als sie ihn vorher mir gegenüber gehabt hatte. Ihre weichen Züge spannten sich zu einem wachsameren, erwachseneren Ausdruck, ihre schönen Lippen verzogen sich zu einem zaghaften Lächeln. Mit einer Handbewegung zu mir sagte sie: »Das ist Roberto Banta von Prospettiva.«
»Bata«, stellte ich klar und streckte die Hand aus. Polidori drückte sie und sah mich nur einen kurzen Augenblick an, aber ich hatte ein schwer zu definierendes Gefühl dabei. Es hatte nichts damit zu tun, daß ich einer berühmten Persönlichkeit gegenüberstand; es lag an seinem Blick, aus dem sehr dezidierte Überzeugungen und eine scharfe Urteilskraft sprachen, an dem dunklen, spöttischen Glanz seiner Augen. Seine Bücher kannte ich kaum, bis auf ein paar Kapitel aus Flußsteine, das wir auf dem Gymnasium durchgenommen hatten, und die Hälfte der Mimetischen Umarmung, in dem ich während eines Spanienurlaubs über Caterinas Schultern hinweg ein bißchen herumgelesen hatte. Als einen meiner Lieblingsschriftsteller hätte ich ihn nicht genannt, wenn ich gefragt worden wäre; trotzdem war ich, als er mir jetzt gegenüberstand, so aufgeregt, wie es mir selten passiert war.
Polidoris Blick kehrte fast sofort wieder zu Maria Blini zurück. Sie zeigte erneut auf mich und sagte: »Er ist nicht nur Journalist. Er schreibt auch Romane.«
Darauf war ich so wenig gefaßt, daß ich vor Verlegenheit rot anlief. Ich blickte in die gleichgültigen oder unwilligen Gesichter der anderen Gäste ringsum und wußte nicht, wie ich mich aus der Affäre ziehen sollte.
Polidori schien ungehalten, sich noch länger mit mir [34] abgeben zu müssen; unvermittelt fragte er mich: »Sind Sie von dem Stück auch so begeistert?«
Es war wirklich eine sonderbare Situation, mit Maria Blini vor mir und meiner Müdigkeit und meinem Unbehagen und den Gästen ringsum; seine Frage klang, als wolle er mich auf die Probe stellen. Ich sagte: »Nicht besonders. Eigentlich überhaupt nicht.«
Sofort wurde es um uns unnatürlich still; die Hausherrin starrte mich an, als hätte ich auf ihr blank gebohnertes Parkett gespuckt.
Auch Polidori schaute mich an, aber jetzt war sein Blick wachsamer, lebendiger; ob aus Neugier oder weil er sich gekränkt fühlte, war mir nicht klar. »Und warum nicht?« fragte er.
Und aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, plötzlich an einem entscheidenden Punkt meines Lebens zu stehen, ohne Zeit zum Nachdenken zu haben und ohne den geringsten Abstand, um angemessen reagieren zu können. Das feindselige Desinteresse der Gäste und der Hausherrin verdichtete sich immer mehr, bis es einen regelrechten Sog erzeugte, der meine Empfindungen aus mir herausschwemmte, ohne daß ich sie artikulieren konnte, wie ich gewollt hätte. »Es war eine Art stilisierter Tanzübung für Leichen, wenn man von Maria absieht, die das einzige Lebendige war. Und Ihr Text dient nur als Alibi, man versteht sowieso kein Wort. Eine kalte und sterile und schwerfällige Angelegenheit, zum Sterben langweilig.«
Meine Boshaftigkeit brach ungefiltert aus mir heraus; am liebsten hätte ich die Hausherrin und die Gäste, die zufällig in meiner Nähe standen, mit Fußtritten traktiert, ebenso Tevigati, der mich hergeschickt hatte, und Luciano Merzi, der sich jetzt bei Maria Blini einhakte und ihr etwas ins Ohr flüsterte. Ich wartete nur auf irgendeine frostige [35] Entgegnung von Polidori, um ihn zu attackieren: ihm laut ins Gesicht zu sagen, wie ich seine Bücher und das Bild, das er in der Öffentlichkeit abgab, verabscheute, die kulturelle Erpressung, die auch er mit allem ausübte, was er schrieb. Statt dessen sagte Polidori: »Aber Langeweile ist doch gerade eine der Waffen der institutionalisierten Avantgarde, oder? Die vielfache Verschlüsselung, die kryptischen Anspielungen und Zitate, mit denen man den Kritikern schöntun und die Minderwertigkeitskomplexe und das Sühnebedürfnis des Publikums ausnützen will.« Er lächelte, und ich war verdutzt über seinen Ton, über seinen Standpunkt, der dem meinen anscheinend so nahe war.
Die Hausherrin stieß eine Art kehliges Lachen aus, die anderen Gäste taten es ihr nach, schielten dabei zu Sirgo und Dulcignoni hinüber, die weiter hinten im Saal immer noch Komplimente und Kommentare aus zweiter und dritter Hand entgegennahmen. Dann wurde Polidori erneut bedrängt: mit Blicken und Gesten, die ihn zu anderen Punkten des Hauses locken sollten.
Er aber schien näher an mir interessiert; er fragte: »Was für eine Art Romane schreibst du?«
»Keine bestimmte Art, glaube ich«, antwortete ich. »Und bis jetzt ist es auch erst einer.« Daß er mich duzte, brachte mich noch weiter aus dem Lot, bewog mich, viel mehr von mir preiszugeben, als ich wollte: »Ich hatte immer nur Kurzgeschichten geschrieben und wollte es mal mit einer richtigen, längeren Geschichte probieren. Sie ist wohl ziemlich autobiographisch und hat mit Prospettiva und mit Mailand und all dem zu tun.« Gleich darauf bereute ich diese Sätze: die Objektivität und die Besonnenheit, die sie vortäuschten, so als wolle ich mein eigener kleiner Kritiker sein.
Polidori veränderte seinen Blick nicht, obwohl die [36] Hausherrin und die anderen Gäste ihm immer mehr auf die Pelle rückten und mich mit wachsendem Unwillen anstarrten. Er fragte: »Und du hast noch nie etwas veröffentlicht?«
»Nein«, sagte ich und zwang mich, den Blick nicht zu senken, ganz unbefangen zu wirken. Teils tat ich das seinetwegen, teils wegen Maria Blini, auch wenn Merzi sich sehr bemühte, sie von mir abzulenken.
»Auch nie etwas an einen Verlag geschickt?« fragte Polidori weiter. Sein Interesse schien echt zu sein, aber ich fragte mich jetzt, ob es nicht rein soziologischer Natur war oder gar dem Wunsch entsprach, langweiligeren Gesprächen zu entgehen.
»Nein«, antwortete ich wieder. »Was die Erzählungen betrifft, habe ich ein paarmal dran gedacht, aber dann hatte ich doch keine Lust mehr dazu. Und der Roman ist noch nicht fertig, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn je fertigkriege. Mir liegt sowieso nicht viel daran, veröffentlicht zu werden.« Das stimmte nicht, jedenfalls nicht ganz; ich merkte, wie künstlich es klang.
Die anderen Gäste ließen Polidori keine Ruhe mehr; ein junges Mädchen in einem von oben bis unten plissierten Kleid beugte sich vor und sagte aus nächster Nähe etwas zu ihm, die Gastgeberin zerrte an seinem Arm. Er sagte zu mir: »Hättest du nicht Lust, mich etwas lesen zu lassen?«
Ich konnte nur stammeln: »Ich weiß nicht recht. Doch. Wenn du Zeit hast, meine ich.« Ich versuchte mich ihm gegenüber wie von gleich zu gleich zu verhalten, allein schon der Versuch kostete mich schrecklich viel Mühe.
Polidori sagte: »Ich bin noch ein paar Tage in Mailand. Wenn du eine Kopie hast, kannst du sie in meinem Hotel abgeben.« Er nannte mir den Namen des Hotels und drückte mir die Hand; es war klar, daß die Zeit, die er mir [37] unter den gegebenen Umständen widmen konnte, zu Ende war.
Ich hätte ihm gern erklärt, daß ich meinen Roman eigentlich lieber erst weitergeschrieben hätte, bis er mich ganz überzeugte, aber er wandte sich zu den ungeduldig wartenden Damen und Mädchen und zu Dulcignoni, der auf ihn zukam; schon trennten uns Dutzende von Gästen. Merzi zog Maria Blini weg, geradewegs in die Arme eines zigarrerauchenden Fettsacks, der sie mit abstoßender Vertraulichkeit umarmte und abküßte.
Ich ging zum Ausgang, drehte mich noch einmal halb zu ihr um, während sie mit der Anmut eines seltenen Tiers auf seine Ergüsse antwortete, und jähe Eifersucht durchzuckte mich, die jedoch von meiner Müdigkeit und Verwirrung in dem plüschigen, überheizten Vorraum erstickt wurde.
Draußen auf der Straße saß die Begleitmannschaft des Bürgermeisters in den dunkelblauen Limousinen, bei laufenden Motoren, um sich in der feuchten Kälte zu wärmen; ihre Blicke folgten mir, als ich rasch den Bürgersteig entlangging, in der Hoffnung, noch einen Bus zu erwischen.
Als ich zu Hause ankam, war es drei Uhr vorbei: alle Lichter waren ausgeschaltet, im Schlafzimmer schlief Caterina tief und fest. Durch meinen Kopf schwirrten Sätze und Bilder des Abends, ein flaues Gefühl stieg mir vom Magen bis ins Gehirn. Ich ging in die Küche und durchstöberte den Kühlschrank, holte mir ein Kotelett und kalten Blumenkohl heraus und verschlang alles in zwei Minuten, dann nahm ich einen Brocken Parmesan und vertilgte ihn Stückchen um Stückchen, zuletzt nagte ich mit den Zähnen die Innenseite der Rinde ab. Ich dachte an Maria Blinis [38] Makkaroni mit Béchamelsoße, an die vitale und gierige Art, wie sie sie gegessen hatte; an ihre sonderbare Anmut einer zivilisierten Wilden.
Ich konnte nicht mehr vor Müdigkeit, trotzdem fühlte ich mich noch nicht schläfrig. Ich setzte mich ins Wohnzimmer, schloß die Kopfhörer an meinen kleinen Rekorder an und hörte mir das Interview mit Maria Blini an. Ihre Stimme klang auf dem schmalen Tonband etwas weniger voll, aber sie strahlte genau die Lebendigkeit aus, die ich in Erinnerung hatte. Ich horchte auf die leichten Schwankungen in der Lautstärke, wenn sie sich bewegte, auf das Klirren ihrer Gabel auf dem Teller: ich sah sie wieder vor mir, so als hätte der Kassettenrekorder zusammen mit ihren Worten auch ihre Blicke und jede noch so kleine Bewegung aufgenommen.
Ich zog mich aus, schlüpfte ins Bett. Caterina schlief auf dem Bauch, die Arme um das Kopfkissen geschlungen, ein Knie angezogen, als klettere sie eine steile Wand hinauf. Ich löschte das Licht, blieb bewegungslos neben ihr liegen; dann schob ich eine Hand hinüber und streichelte behutsam, um sie nicht aufzuwecken, ihren Rücken und das Gesäß. Ich rutschte dichter zu ihr; fuhr mit den Fingern ihre feuchten Schenkel hinauf, unter das Baumwoll-T-Shirt, das sie als Nachthemd benutzte. Ich versuchte mit den Fingerkuppen möglichst wenig Druck auszuüben, ganz auf die Oberfläche konzentriert, über die sie glitten; aber sie drehte sich auf die Seite, sagte in vorwurfsvollem Ton: »Ich schlafe, Roberto.«
Also ließ ich mich wieder auf den Rücken fallen, atmete mit hinter dem Kopf verschränkten Händen. Ich war zu aufgewühlt, um zu schlafen; einen Augenblick später rüttelte ich sie an der Schulter, sagte: »Das Stück war unerträglich. Die Regie und die Musik und die Schauspieler waren [39] zum Davonlaufen. Danach mußte ich noch zu einem Fest, da hab ich Marco Polidori kennengelernt.«
»Den alten Lustmolch«, murmelte Caterina im Schlaf und drehte sich auf die andere Seite.
[40] Drei
Montag morgen war die Luft in Mailand so kalt und giftig, daß ich fast erleichtert war, mich in dem Redaktionsgebäude mit seinem künstlichen, für jeden Wetter- und Jahreszeitenwechsel undurchlässigen Mikroklima verkriechen zu können. Meine Kolleginnen und Kollegen machten ihre üblichen belämmerten Montagsmienen; das Hintergrundgeräusch in dem großen elektronischen Bienenstock hatte noch nicht seine höchste Frequenz erreicht. Ich schaltete den Monitor auf meinem Schreibtisch an, um beschäftigt zu wirken, und holte mir von einem der Nebentische die neueste Nummer von Prospettiva, blätterte sie durch. Normalerweise las ich meine Artikel nicht mehr, wenn sie gedruckt waren, aber ich wollte das Interview mit Maria Blini noch mal sehen: sie sehen, vor allem.
Ich suchte zwischen Werbeanzeigen für Zehn-Millionen-Lire-Uhren und zwanzig Jahre alten Single-Malt-Whisky, für Platinfüllfederhalter und elegante Druckbleistifte; zwischen den pseudosoziologischen, mit nackten Fotomodellen illustrierten Meinungsumfragen, eilig aus Newsweek oder dem Economist oder Scientific American abgekupferten Artikeln zur internationalen Politik, von halben Informationen strotzenden Berichten über die Geheimdienste auf Abwegen und über nie aufgeklärte Bombenanschläge und über die Korruption auf Staats- und Parteienebene, den um die Sprüche der Politiker und ihre widerrufenen Absichtserklärungen und ihre verschlüsselten Warnungen herum konstruierten Analysen.
[41] Endlich fand ich sie: lächelnd an einem Steinmäuerchen lehnend, nur mit einem bis zum Busen aufgeknöpften Herrenhemd bekleidet, das so kurz war, daß es kaum die Schenkel bedeckte. Ein Sommerfoto, auf dem ihre blonden Haare länger waren und noch von der Sonne gebleicht, ihre Haut dunkler als vor drei Tagen, als ich sie aus der Nähe sah. Mein ohnehin schon kurzes Interview hatte man um gut ein Drittel gekürzt, damit es in einen in den Artikel von Angelo Zarfi eingerückten Kasten paßte; hatte meine Betrachtungen über sie auf ein paar etikettierende Adjektive zurückgestutzt, den eigenwilligen Ton ihrer Antworten mit Gewalt standardisiert. Ich war an diese Art technische oder stilistische Zensur gewöhnt, aber der Gedanke, daß Maria mich dafür verantwortlich machen könnte, beschämte mich und machte mich wütend. Ich betrachtete das fünf mal acht Zentimeter große Foto von ihr unter der blödsinnigen Überschrift »Hier kommt Maria« und hätte gern eine andere Rolle im Leben gehabt.
Hinter meinem Monitor tauchte Tevigati auf und fragte: »Betrachtest du dein Meisterwerk?«
Ich suchte nach einem Blick, der ihm als Antwort dienen konnte und der mein Verlangen, ihm an die Gurgel zu springen, wenigstens ein bißchen durchschimmern ließ.
»Wenn du gleich ausflippst, sobald ich dich mal an eine hübsche Tussi ranlasse, dann war das dein letztes persönliches Interview, Roberto Bata. Dann hängst du weiter am Telefon. Weißt du, was es in dem Laden hier kostet, eine halbe Stunde zu vergeuden, um deine beknackten poetischen Ergüsse wieder rauszustreichen?«
Ich ließ mich nicht provozieren, sah schweigend zu, wie er mit einem gönnerhaften Lächeln, das die Wirkung seiner Worte teilweise abschwächen sollte, um mich herumlief.
»Wir sind keine Literaturzeitschrift, falls du das [42] vergessen haben solltest, Roberto Bata. Wir sind ein Informationsblatt.« Er skandierte alles so laut wie durch ein elektrisch verstärktes Megaphon, um von möglichst vielen Mitarbeitern gehört zu werden und öffentlich auf bestimmte Grundsätze hinzuweisen; nicht einmal in so einem Fall brachte er es fertig, sich auf einen einzigen Gesprächspartner zu konzentrieren.
Einige Kollegen lächelten wie er, andere blickten weg; die Regeln in der Redaktion waren klar und von allen akzeptiert, Solidarität blieb den Tarifverhandlungen Vorbehalten.
Dann erläuterte mir Tevigati seine neueste Idee: eine Reportage über das Comeback der Ehe. Er diktierte mir eine Liste mit den Personen, die ich anrufen und nach ihrer Meinung fragen sollte. »Du mußt natürlich auch herausfinden, in welcher Situation sie selbst gerade leben«, sagte er.
»Okay«, sagte ich; und da er sich nicht vom Fleck rührte und mich weiter anstarrte, nickte ich zwei-, dreimal mit dem Kopf. Voller Groll schlug ich mein Telefonverzeichnis auf.
Jedesmal, wenn ich eine dieser Umfragen machte, mußte ich mich auf ein kleines Wortgefecht einlassen, denn meine Interviewpartner behaupteten meistens, sie seien gerade zu beschäftigt oder hätten nichts Besonderes zu sagen, oder weigerten sich, Auskunft über ihr Privatleben zu geben. Doch es genügte, die Namen ihrer Kollegen aufzuzählen, die ich bereits kontaktiert hatte, und durchblicken zu lassen, daß ich ihre neueste Platte oder Fernsehsendung, ihr neues Buch oder ihren neuen Film erwähnen würde, und schon waren sie nicht mehr zu halten, gingen rückhaltlos aus sich heraus, enthüllten bereitwillig die intimsten Details ihres Tagesablaufs, nur darauf erpicht, brillant und vorurteilslos und faszinierend zu erscheinen.
Branzi, der Philosoph, erklärte mir, daß das Leben in der [43] Großstadt heutzutage die Menschen zum Alleinleben ermutige und daß er und seine Frau sich schon als eine vom Aussterben bedrohte Spezies betrachteten; die Fernsehansagerin Suriani bestätigte, daß sie Ende des Monats in Frascati heiraten werde, mit einer ganz schlichten und bescheidenen Hochzeitsfeier, genau wie ihre Eltern. Ich nahm die Antworten auf Tonband auf, ohne richtig zuzuhören, aber ich sah die Leute vor mir: ganz auf den Klang ihrer Stimme konzentriert, erregt beim Gedanken, Indikatoren für einen neuen Trend zu sein oder gegen einen alten zu verstoßen.
Um eins hatte ich zwischen Rom und Mailand bereits eine ganze Anzahl geistreicher und anregender, nüchterner, überraschender und vernünftiger Aussagen gesammelt, die ich auf jeweils ein, zwei zusammenhängende Sätze reduzieren mußte, in denen der Name des Interviewten fett gedruckt erschien. In den zwei Jahren, die ich bei Prospettiva arbeitete, war mir der unpersönliche und reißerische Stil, den Tevigati so angestrengt kultivierte, zur zweiten Natur geworden; Ausrutscher wie der beim Interview mit Maria Blini passierten mir wirklich nicht oft. Manchmal fragte ich mich, was der Durchschnittsleser wohl denken würde, wenn er wüßte, wieviel Groll hinter jedem dieser griffigen Sätzchen, hinter jedem der gefälligen Adjektive steckte, über das seine Augen glitten.
In der Pause aß ich wie immer unten in der betriebseigenen Kantine, mit den Redakteuren und Redakteurinnen meiner Zeitschrift und der vielen anderen Blätter derselben Verlagsgruppe, die auf ihre Tabletts blickten und Insiderbemerkungen machten und sich über berufliche Qualifikation und Gewerkschaftsrechte und persönliche Ansprüche unterhielten. Ich stocherte mit der Gabel in meinem Teller Nudeln mit Schinken und dachte an Tevigati, der in dem separaten kleinen Speisesaal für die höheren Chargen aß, [44] an meine laue und gewohnheitsmäßige Beziehung zu Caterina, an meinen alten VW, der am Morgen nur gestartet war, nachdem ich ihn angeschoben hatte, an die Lippen von Maria Blini Donnerstag nacht, an den Blick von Marco Polidori; an die Fotokopien meines unvollendeten Romanversuchs, die ich am Freitag nachmittag in einem großen gelben Umschlag in seinem Hotel abgegeben hatte. Die Redakteurin, die rechts von mir saß, hieß Pesco; sie erzählte mir, daß sie wegen der Klimaanlage an chronischer Sinusitis leide und daß ein Anwalt, mit dem sie befreundet war, sicher sei, daß sie in einem Schadensersatzprozeß gegen die Verlagsgruppe gewinnen würde.
Als ich wieder oben war, telefonierte ich eine weitere Runde. Um zwei Uhr traf man die Leute am ehesten zu Hause an, und unter den Nachwirkungen des Mittagessens wurden oft die schönsten oder jedenfalls die geschwätzigsten, narzißtischsten und schamlosesten, für unsere Artikel am besten geeigneten Aussagen gemacht. Ich wählte die Nummer und hörte mir Anrufbeantworter an, manche mit witzigen Ansagen und einigen Takten Musik vor dem Pfeifton, sprach meine Nachricht auf Band und wartete, bis mich die Prominenten aus dem Kulturbetrieb fünf Minuten später zurückriefen. Schläfrig wie ich war, mußte ich freudige Überraschung heucheln, wenn sie sich meldeten, meine Routinefragen Vorbringen, als hätte ich sie mir eigens für sie ausgedacht. Ich kam mir mies vor, der Klang ihrer Stimmen an meinem Ohr war mir zuwider, der sentenziöse Schwachsinn, den ich aufnehmen mußte, ekelte mich an.
Dann klingelte das Telefon, und in meinem falschen, professionellen Ton sagte ich »Ja, bitte?«, aber statt einer meiner Interviewpartner war eine Sekretärin am Apparat. »Einen Augenblick«, sagte sie, »Dr.Polidori möchte Sie sprechen.«
[45] Ich schaltete das Tonbandgerät ab, spähte umher, ob sich nicht vielleicht irgendeine blöde Redakteurin an einem der Schreibtische einen Scherz mit mir erlaubte; aber alle saßen in ihre Arbeit vertieft wie hypnotisiert vor ihren bläulichen Bildschirmen. Und da hörte ich auch schon Polidoris Stimme: »Wie geht’s, Roberto?« fragte er, höflich, aber ein wenig ungeduldig, als hätte nicht er mich, sondern ich ihn angerufen.
Ich antwortete: »Danke, gut.« Ich behielt die anderen Schreibtische weiter im Blick, auch wenn ich keinen Zweifel mehr hatte, daß er es wirklich war.
»Um wieviel Uhr machst du Feierabend?« fragte er. Man hörte andere Stimmen hinter der seinen, jemand sprach hastig auf englisch.
»Um halb sechs«, antwortete ich, vorsichtig und angespannt wie ein Hund vor dem Fangeisen.
Polidori unterbrach sich und sprach mit jemand anders, dann sagte er: »Wie wär’s, wenn wir zusammen etwas trinken gingen, um sieben?« Es war gar keine richtige Frage: er ließ mir kaum Zeit zu fragen wo und legte auf.
Um halb sechs trat ich auf den großen Parkplatz vor dem Redaktionsgebäude hinaus, fand zwei Redakteure einer anderen Zeitschrift, die mir das Auto anschoben. Zum Glück sprang es fast sofort an, fuhr ruckend und spuckend los, und ich ordnete mich in den Verkehr ein, der am Ende des Tages in die Stadt zurückströmte. Ich hatte noch Zeit; ich war froh, nicht allzu rasch in die Stadt zu gelangen.
Ich fragte mich, ob Marco Polidori schon den ganzen Packen Fotokopien gelesen hatte, den ich für ihn abgegeben hatte, oder ob er nur ein paar Seiten überflogen hatte. Auf jeden Fall bezweifelte ich sehr, daß er zwischen seiner und meiner Art zu schreiben irgendwelche Affinitäten [46] gefunden haben könnte. Man brauchte nicht alle seine Bücher gelesen zu haben, um zu wissen, wie intelligent und komplex und kenntnisreich die literarischen Vorhaben waren, denen er sich widmete. Der Ton der Besprechungen, die jede Neuerscheinung von ihm begleiteten, sagte schon alles: die ehrfürchtige Einhelligkeit, die immer wiederkehrenden Superlative, die Interpretationsmuster, die man den Lesern vorsetzte, damit sie besser darüber plaudern konnten. Marco Polidori war eher so etwas wie eine nationale Institution als ein Schriftsteller, so anti-institutionell er dem Anschein nach auch sein mochte; sein Name war einer der wenigen, die unser Land voll Stolz exportieren konnte. Zur Zeit der Flußsteine hatte er verglichen mit seinen Kollegen vielleicht sogar einen innovativen Stil geschrieben, eindringlich und mit Spaß an der Sache, und er hatte gegen die geltenden Regeln verstoßen. Aber das war in den sechziger Jahren gewesen, als die Kritiker noch nicht so automatisch begeistert waren, was immer er schrieb, und er es noch nicht zu naiv oder simpel fand, sich einer Geschichte und ihren Figuren ohne distanzierende Filter und raffiniert ausgeklügelte geometrische Gliederungen zu überlassen.
Deshalb war ich immer angespannter, je mehr sich die Autoschlange, in der ich steckte, dem Zentrum näherte. Der Gedanke, vor einem lebenden fünfzigjährigen Denkmal den einzigen im Mahlwerk des Lebens noch nicht zerriebenen Teil von mir bloßzulegen, mich wie ein Schüler seinem Urteil zu unterwerfen, behagte mir überhaupt nicht. Der Romanversuch, den ich ihm zu lesen gegeben hatte, war zu sehr mit meinen eigenen Gedanken und Angelegenheiten durchsetzt, ich hatte ihn verbissen und voller Wut abends und an meinen freien Tagen niedergeschrieben, als Entschädigung für das, was mir fehlte, und um mich für die Wirklichkeit zu rächen. Ich hatte darin nie eine [47] literarische Übung oder einen kulturhistorischen Essay oder einen handwerklich gekonnten Text gesehen; ich hatte meine Empfindungen zu Papier gebracht, so wie sie mir durch den Kopf oder durch den Bauch gingen, ohne viel drüber nachzudenken oder das Geschriebene zu überarbeiten oder mich an irgendeine von Tevigatis Regeln zu halten. Es ging darin auch um Caterina und mich; es war keine Geschichte, die ich sezierenden Blicken aussetzen wollte.
Im Stop-and-go-Tempo, mit beschlagenen Fenstern, die ich hinunter- und wieder hinaufkurbelte, brauchte ich eine geschlagene Stunde bis in die Innenstadt; und dort weitere zwanzig Minuten, bis ich einen Parkplatz fand. Schließlich ließ ich das Auto irgendwo quer auf dem Gehsteig stehen, mit der Schnauze nach außen, damit ich nachher leichter anschieben konnte, und schon blieb mir fast keine Zeit mehr.
Polidoris Hotel war in einer Sackgasse gleich hinter dem Domplatz. Immer wenn ich zufällig daran vorbeigekommen war, parkte eine Luxuslimousine vor dem Eingang, ein Rolls-Royce oder ein überlanger Mercedes, der vielleicht hohen Gästen zur Verfügung gestellt wurde oder auch bloß dastand, um das Image des Hauses zu heben. Der Dom war in nächster Nähe, gleich hinter den Arkaden, wo zwei Afrikaner am Rand des unaufhörlich vorbeiziehenden Menschenstroms falsche Lacoste-Hemden verkauften.