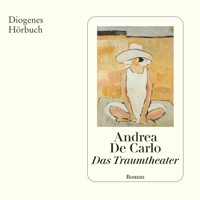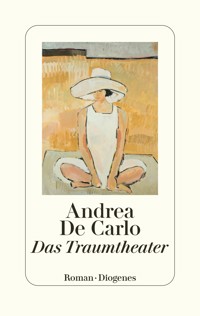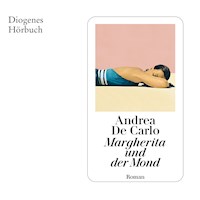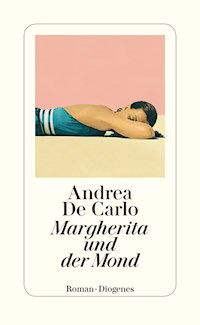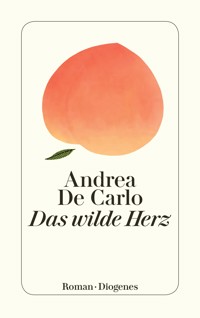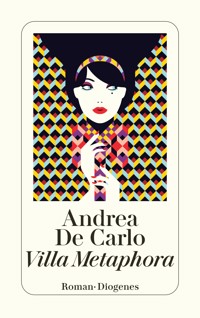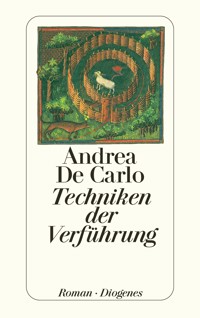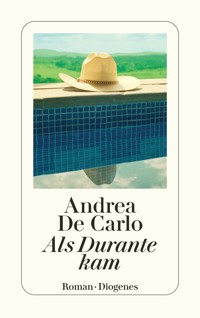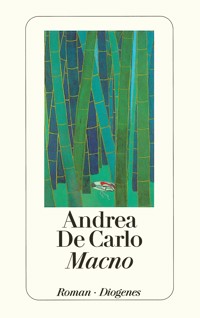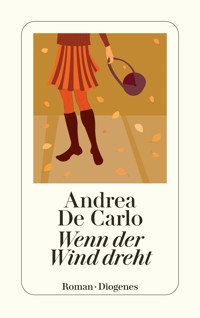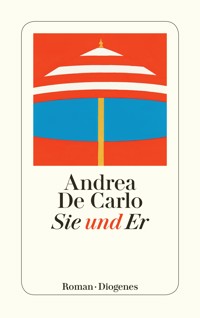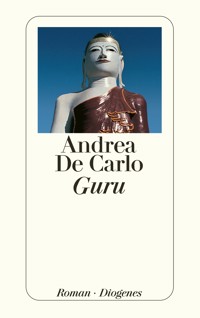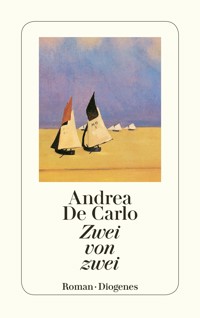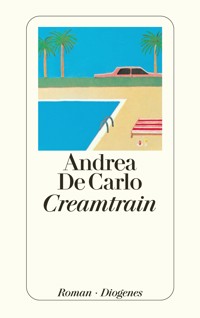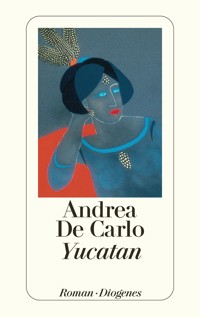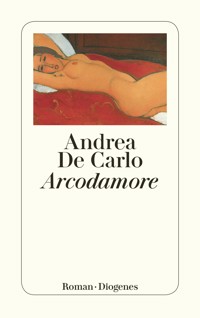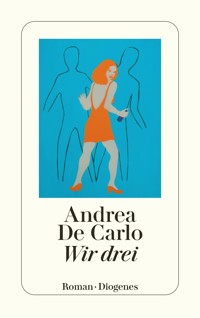9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fjodor Barna, ein junger Amerikaner in Mailand, fühlt sich fremd in einer Gesellschaft, die nur aus vorgestanzten Figuren besteht. Doch anstatt zu protestieren, beobachtet er nur und wundert sich. Dann trifft er auf eine, die fliegen kann: Malaidina, ein Wesen aus einer anderen Welt, der er nachzujagen beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andrea De Carlo
Vögel in Käfigenund Volieren
Roman
Aus dem Italienischen von
Burkhart Kroeber
Titel der 1982 bei
Einaudi, Turin, erschienenen Originalausgabe:
›Uccelli da gabbia e da voliera‹
Copyright © 1982 by
Giulio Einaudi Editore S.p.A., Torino
Die deutsche Erstausgabe erschien
1984 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration von Andrea De Carlo
Copyright © Andrea De Carlo
Für Alessandra G. R.
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 21386 7 (7.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60232 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Eins
Um drei Uhr nachmittags bin ich in meinem weißen MG auf der Goldfinch Avenue, Richtung Hills, mit einer Stones-Cassette im voll aufgedrehten Stereoapparat, und überfahre ein Stopplicht, ohne es zu bemerken. Von rechts kommt ein hellgrüner Chevrolet, gleitet heran wie ein kleiner Wal unter Wasser. Ich mache keinen Versuch zu bremsen oder das Steuer herumzureißen oder so. Ich sehe das Hellgrün auf mich zukommen, ohne den Fuß vom Gas zu nehmen.
Es macht ein volles, sattes Geräusch: eine Art hochkonzentriertes ptrac, bei dem die verschiedenen Laute sich in- und übereinanderschieben, statt sich in alle Richtungen auszubreiten, wie es normal wäre. Einen Klang, der viele Klänge in sich enthält, sie vereinfacht und zugleich mit Nuancen anreichert.
Der MG hat keine Knautschzonen, keinen Platz für die Beine; er wirbelt blitzschnell herum. Ich sehe die Kreuzung aus mehreren Blickwinkeln gleichzeitig; aus dem Stand in umgekehrter Perspektive zur Fahrtrichtung.
Diese Bilder sind nicht klar voneinander getrennt, nicht aneinandergereiht zu einer Sequenz; sie komprimieren sich im Zeitraum eines Sekundenbruchteils. Infolge der Kompression, oder um sie möglich zu machen, verliert jedes Einzelbild seine Schärfe, fließt mit den vorausgegangenen und nachfolgenden zusammen.
Der MG steht, fest und endgültig: komprimiert wie die Bilder der Sequenz, wie die Töne des Aufpralls.
[6] Ich ziehe langsam die Beine raus. Stehe auf dem Asphalt und betrachte das verbogene Lenkrad, die zerknautschte Motorhaube.
Aber komisch, ich habe irgendwie gar kein unangenehmes Gefühl. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber es ist so. Ich habe nur dieses Gequirl von mechanischen Vorgängen im Kopf: den Aufprall und die Drehung und den plötzlichen Halt, der mich gegen die Scheibe wirft und in den Sitz zurückschleudert. Keine unangenehmen Gefühle; ich habe nichts gebrochen.
Ich drehe mich um und sehe den Chevrolet mitten auf der Kreuzung stehen: ein bißchen zur Seite geneigt, abgesunken auf zwei platten Reifen. Ich setze mich in Bewegung, gehe mit schleppenden Schritten zur Fahrerseite. Am Steuer sitzt eine dicke Frau: sitzt einfach da und macht nicht mal einen Versuch herauszukommen. Ihr Kopf ist nach hinten gekippt. Ich denke »O Scheiße!«
Ich ziehe am Türgriff; er geht nicht auf, aber ich habe wohl auch nicht allzuviel Kraft in den Armen. Ich spähe durchs Fenster: kein Blut zu sehen, auch sonst keine Schweinerei. Die dicke Frau kippt den Kopf nach vorn, dann wieder nach hinten. Ich sehe mich um; ein paar Leute betrachten die Szene, reglos auf Gehsteigen in der Ferne. Alles ist ruhig, keine anderen Autos fahren vorbei, die Luft steht still. Ich probiere nochmal den Türgriff: nichts.
Ein älterer Typ kommt näher, die Hände in die Hüften gestützt. Er sagt: »Ich hab alles mitangesehen, vom Garten vor meinem Haus.« Er zeigt auf den Garten vor seinem Haus, an einer Ecke der Kreuzung. »Ihr seid alle Verbrecher, ihr mit euren verdammten Sportwagen.«
Jetzt beunruhigt mich sein Ton; irgendwie ist die Situation auf einmal viel schlechter als noch vor zwei Sekunden. Ich schaue erneut in den Chevrolet. Die Frau [7] scheint nicht ernsthaft verletzt zu sein; sie scheint überhaupt nicht verletzt zu sein. Ich klopfe ein paarmal ans Fenster, aber sie rührt sich nicht.
Ich sage zu dem älteren Typ: »Tut mir leid, ich hab das Stopplicht übersehen.«
Er sagt: »Ihr gehört alle ins Gefängnis.« Sein Ton ist so dumpf, so fugenlos dicht: Alle meine Erklärungen würden an ihm abgleiten, ohne irgendwas zu verändern.
Ich sage: »Was haben denn Sie für ’ne Ahnung? Was glauben denn Sie für ’ne Meinung zu haben?«
Er macht einen Schritt zurück und sagt: »Wenn Sie so mit mir reden, zeig ich Sie an.« Er hat ein häßliches graues Hemd an: so eins mit langen Kragenspitzen, die an den Enden geknöpft sind. Er hat eine häßliche Art zu reden: mit kaum geöffneten Lippen und plinkernden Augenlidern. Er ist sehr viel unangenehmer als der Zusammenstoß.
Ein Polizeiauto kommt und gleich hinterher eine Ambulanz. Ein Polizist und zwei Sanitäter treten ins helle Licht des frühen Nachmittags, gehen zum Chevrolet, machen sich an der Tür zu schaffen. Der andere Polizist kommt zu mir und fragt, ob das mein MG ist. Ich sage ja. Der ältere Typ mit dem grauen Hemd bleibt in der Nähe, sieht mißtrauisch zu. Der Polizist verlangt meine Papiere. Sagt: »Warten Sie hier.« Geht zum Streifenwagen, um meine Personalien per Funk zu überprüfen.
Ich betrachte die Palmen und Eukalyptusbäume hinter meinem einstigen weißen MG. Ein Knie tut mir weh, nicht sehr. Meine Hose hat einen kleinen Riß, die Haut darunter ist leicht aufgeschürft. Ich schüttle das rechte Bein.
Die beiden Sanitäter und der Polizist reden mit der Frau durch die Scheibe; sagen zu ihr: »Bleiben Sie ganz ruhig.« Einer der Sanitäter geht um den Wagen, öffnet die Tür auf [8] der Beifahrerseite und zwängt sich in das deformierte Innere. Der andere Sanitäter und der Polizist gehen ebenfalls rüber und helfen, die Frau herauszuziehen. Sie zerren die Frau aus dem Wagen, fassen sie unter die Achseln und um die Hüften. Sie läßt sich tragen, schleift die Füße nach. Die drei Männer bringen sie vorsichtig an den Straßenrand, sie gleitet aus ihren Armen und sinkt auf den Bordstein. Sie hat ein rosa Hosenkostüm aus satiniertem Acrylstoff an und weiße Schuhe mit Schmetterlingsschnallen. Sie biegt noch immer den Kopf nach hinten mit Bewegungen wie ein Pelikan. Nach einer Weile sagt sie zu einem der Sanitäter: »Mir blutet die Nase.« Er betrachtet sie mit gebeugtem Hals, die Hände in die Hüften gestützt, und sagt: »Nein, ich sehe nichts.« Sie richtet den Kopf auf, legt sich die Hände auf die Knie und starrt geradeaus ins Leere.
Der eine Sanitäter meint zu dem anderen: »Vielleicht hat sie einen Schädelbruch oder sowas?« Der andere schüttelt zweifelnd den Kopf. Der Polizist hockt sich vor die Frau, um den Sachverhalt aus der Nähe zu untersuchen.
Ich gehe zu der Frau und sage: »Es tut mir sehr leid.«
Sie dreht ruckartig den Kopf zu mir und schreit: »Sie Verbrecher, nicht mal gebremst haben Sie!«
Der andere Polizist, der meine Personalien per Funk überprüft, ruft aus dem Streifenwagen herüber: »Ich hab doch gesagt, Sie sollten da warten, wo Sie waren!«
Ich sage »Okay, okay« und gehe wieder dahin zurück, wo ich war.
Die beiden Sanitäter helfen der Frau auf die Beine, verfrachten sie in die Ambulanz. Der freie Polizist geht zu dem Polizisten im Streifenwagen, läßt sich von ihm meine Personalien diktieren, schreibt sie auf ein schmales [9] längliches Blatt und übergibt es einem der Sanitäter. Er stellt sich mitten auf die Kreuzung, schaut in alle vier Richtungen, macht Bewegungen wie ein Schutzmann. Die Ambulanz fährt davon, mit eingeschaltetem Blaulicht, ohne Sirene. Fünf oder sechs Kinder mit Fahrrädern stehen neugierig am Straßenrand, dazwischen Hausfrauen und ältere Typen, die aus den nahen Gärten gekommen sind.
Der Polizist mit meinen Papieren steigt aus dem Streifenwagen, kommt langsam zu mir und fragt: »Haben Sie denn gar keine Versicherung?«
»Nein«, sage ich. Mir scheint, sein metallener Armschutz drückt ihn ein bißchen am Handgelenk.
Er sagt: »Sie sitzen dick in der Tinte.« Schaut nachlässig auf die Papiere in seiner Hand. »Das kostet Sie mindestens fünfzigtausend Dollar Schadenersatz.« Er läßt mich ein paar Blätter unterschreiben und sagt, ich könnte jetzt erstmal gehen.
Vor dem Haus liegt Maggie in einem weißrot gestreiften Liegestuhl, um sich zu sonnen, mit einem Buch von Harold Robbins in der Hand. Sie hat einen braunen Bauch, braune Arme, blonde, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare und Sonnencreme auf Nase und Stirn. Kaum sieht sie mich, sagt sie: »Fjodor, da ist ein Telegramm für dich, auf dem Tisch im Wohnzimmer.« Sie hebt kaum eben den Kopf, um mir das zu sagen, ohne den Hals oder Rücken auch nur einen Zentimeter zu krümmen. Sie hat einen engen blauen Bikini an, der ihre Beine verlängert und Teile der Hinterbacken freiläßt.
Ich gehe ins Haus, nehme das Telegramm vom Tisch und trete damit ans Fenster. Es kommt aus San José in Costa Rica. Ich mache es auf. Es lautet: »Möchte dich sehen. Dein Vater.« Ich zerknülle es in der Hand, rolle es [10] zwischen den Fingern, bis es ein leichtes Papierbällchen ist, schnipse es in eine Zimmerecke und gehe wieder hinaus.
Ich erzähle Maggie den Unfall. Sie hört mir zu und sagt: »Ach du Scheiße!« Legt das Buch ins Gras, dreht sich unendlich langsam zur Seite, um mich anzusehen, stützt sich auf einen Ellenbogen und erklärt mir, ich sei ein verantwortungsloser Idiot; bei dem, was ich mit der Musik verdiente, bräuchte ich fünfzig Jahre, um den Schaden abzubezahlen, wahrscheinlich würde ich im Gefängnis landen, sie habe jedenfalls keine Lust und keine Absicht und sowieso keine Möglichkeit, mir zu helfen. Sie faucht: »Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst nicht so irre fahren!« Sie schließt die Augen zu einem Schlitz, um das Sonnenlicht abzuschirmen und ihre Worte schneidend zu machen.
Ich bleibe fünf Minuten lang auf dem Rasen und höre ihr zu: so verblüfft über ihren Ton, daß mir keine passende Antwort einfällt, nicht mal ein passender Gesichtsausdruck.
Dann gehe ich ins Haus, und plötzlich kommt mir die Wut, und ich gehe gleich wieder raus und schreie zu Maggie, sie soll sich zum Teufel scheren, und ich knalle die Tür zu und mache sie wieder auf und knalle sie nochmal zu, noch lauter als beim erstenmal. Ich gehe ins Wohnzimmer, schnipse mit den Fingern an ein Browallia-Pflänzchen in einem kleinen blauen Keramiktopf auf dem Fensterbrett.
Ich muß sagen, normalerweise passe ich ganz gut auf, wie die fließenden Elemente einer Situation sich verschieben und allmählich verdichten, bis sie schließlich das Ganze aus dem Gleichgewicht bringen oder zum Kippen oder zum Kentern oder zum Wegrutschen, um sich eigene [11] Wege zu suchen. Nicht daß ich dasitze und dauernd warte, bis was passiert, um es dann zu beobachten, wenn es passiert; ich passe nur auf. Und wenn ich sehe, daß eine Situation zu sehr ins Kippen gerät, springe ich lieber rasch ab, statt mich daran zu machen, sie wieder mühsam auszubalancieren.
Ich schaue durchs Fenster auf Maggie, die wieder ausgestreckt daliegt mit ihrem Harold Robbins vor Augen, und mir scheint, diesmal bin ich ziemlich zerstreut und langsam gewesen.
So trete ich rasch wieder raus und sage zu Maggie, daß ich gehe. Ich sage ihr, daß sie den Fernseher und die Möbel und die Bücher und Magazine behalten kann. Auch meine Stratocaster und den Verstärker und die Noten und die Platten und den Plattenspieler und das Tonbandgerät und die Landkarten und die Handbücher zur Vogelzucht.
Sie betrachtet mich durch die Wimpern, mit leicht verdrehtem Hals, flach und reglos auf dem gestreiften Liegestuhl. Sagt nichts.
Ich renne wieder ins Haus, die Treppe rauf in den Oberstock, schnappe mir einen Plastiksack für den Müll, stopfe die Kleider rein, die mich nicht mehr interessieren, schmeiße ihn in eine Ecke. Packe die Kleider, die mich interessieren, in einen alten, seit einem Augustgewitter ruinierten Schweinslederkoffer, schleppe ihn über die Stufen runter und bestelle mir ein Taxi zum Flughafen.
Maggie muß in der Küche sein oder sonstwo im Haus, denn als ich rausgehe, ist der Liegestuhl auf dem Rasen leer.
Ich fliege von Santa Barbara nach Los Angeles.
Ich fliege von Los Angeles nach San José in Costa Rica.
[12] Zwei
Aus San José schicke ich meinem Vater ein Telegramm, neutral und vage, wie die Telegramme sind, die wir uns schicken. Ich nehme das erste Flugzeug nach Cañas, in Cañas das erste nach Tualsín. Wir folgen einem halbkreisförmigen Kurs in einer alten, vermutlich bei irgendeiner Geschäftsauflösung ersteigerten Fokker. Ich schaue hinunter auf die Waldgebiete, die hellen und rötlichen Flecken der Kahlschläge, die Kakaopflanzungen auf den Hochebenen, die Bananenplantagen. Die Tür zum Cockpit schlägt bei jeder Schwankung; der Pilot ist, scheint mir, jung und zerstreut.
Schließlich landen wir in Tualsin, auf einer Piste, die aussieht wie ein stillgelegtes und eingezäuntes Stück Straße. Ein gewisser Mario Sotas erwartet mich in einem gelben Jeep, von meinem Vater geschickt. Er redet kaum, fährt zügig. Nach einer Stunde auf ungepflasterter Straße durch halbhohen Buschwald erreichen wir den Besitz meines Vaters. Mario Sotas hält, steigt aus, nimmt meinen Koffer, stellt ihn gleich hinter die Eingangstür. Ich folge ihm, laufe quer durch das Haus auf die Rückseite, trete hinaus in den großen Garten, wo die Volieren sind.
Ich gehe im Schatten einer doppelten Reihe von Jacarandas, deren Blätter sich oben zu einem zartgrünen Filter verflechten. Hier werden fünfzehn verschiedene Kolibri-Arten gehalten, jede mit ihren bevorzugten Pflanzen und Blumen in einer eigenen kleinen Voliere. Ich betrachte die zuckenden Blitze von Smaragd und Rubin und Topas [13] durch den feinen Maschendraht: Tupfer von reiner Farbe, die fast zu schnell für das Auge vorbeihuschen und hinter Laubvorhängen verschwinden. Weiter hinten kommen die Paradiesvögel in großen Kuppelvolieren, so dicht voller Vegetation, daß sie dem Blick fast undurchdringlich erscheinen. Ich gehe langsam, verfolge mit den Augen die Bahn der Sonnenstrahlen, die schräg durch das Laubdach einfallen, von Blatt zu Blatt hin- und herspringen und plötzlich die goldgrünen Zierpunkte auf den Schwanzfedern einer Königsparadisea enthüllen. Ich trete vor, und bei der geringsten Verschiebung des Blickwinkels läßt ein Lichtstrahl das Purpurschwarz, das Malachitgrün, das Hyazinthrot und das Smaragdgold einer Paradieselster aufleuchten, läßt die Farbtöne in extremen Frequenzen vibrieren. Weiter hinten kommen aschgraue Papageien und Aras und Kakadus in robusten, weniger kostbaren Stahldrahtvolieren.
Auf halbem Weg steht mein Vater vor einem verzinkten, stellenweise funkelnden Drahtgeflecht. Er dreht sich kurz zu mir um, sieht mich an und macht mir ein Zeichen, daß ich leise sein soll.
Ich gehe zu ihm und sage »Hallo«.
Er bringt mich mit einer raschen Geste zum Schweigen und deutet durch das Volierengitter. Die Papageien hinter mir kreischen so laut, daß ich nicht begreife, welchen Schaden meine Stimme anrichten könnte.
Ich schaue ebenfalls durch die Maschen: dichtes Blattwerk, ein Ipecacuanha-Strauch voll blaßorangener Beeren; ein Vogelpaar, groß wie Junghühner, sitzt in den Zweigen und schaut uns an mit zur Seite geneigten Köpfen. Ich sage zu meinem Vater: »Sind das zwei Takahes?« Ich betrachte seinen Hut aus weißem Segeltuch mit der einseitig aufgeschlagenen und durch einen Knopf [14] gesicherten Krempe, betrachte den Schatten unter seinen blauen Augen.
Er nickt wortlos, ohne sich umzudrehen.
Ich frage ihn: »Und wo hast du sie her?« Nicht daß ich es wirklich wissen möchte, es ist nur so eine Art automatische Frage.
Er zuckt die Achseln, dreht mir den Rücken zu und macht ein paar Schritte zu einer anderen Voliere, in der zwei Quetzals scharlachrote und grünbraune Kleckse ablassen.
»Die Takahes sind doch praktisch ausgestorben, es gibt kaum noch welche«, sage ich.
Er betrachtet die Quetzals ein paar Minuten, folgt mit den Augen ihrem Gekletter von Zweig zu Zweig und sagt dann: »Mindestens zwei gibt es noch, wie du siehst.« Er redet zwischen den Zähnen, um die Vögel nicht aufzuregen.
Ich folge ihm zwischen den Volieren und denke die ganze Zeit, daß ich am liebsten gleich wieder zum Flugplatz möchte. Ich folge ihm ins Haus.
Das Wohnzimmer ist weit und niedrig; Jalousien aus rohen Palisanderleisten schirmen das Tageslicht ab. Ein Steinway-Flügel steht an einem der Fenster; überall an den Wänden sind .Bücherregale; auf dem Fußboden helle Matten.
Mein Vater macht einen als Möbel verkleideten Eisschrank auf, nimmt zwei Bierdosen raus, behält eine für sich und reicht mir die andere. Zeigt mir, wo die Gläser sind, setzt sich in einen alten Thonet-Schaukelstuhl, stemmt sich mit den Füßen zurück. Ich setze mich vor ihn, gieße das Bier ins Glas; es schäumt sehr.
Mein Vater trinkt ein paar Schlucke, betrachtet sein Glas im Gegenlicht und sagt: »Also interessiert dich jetzt auch die Musik nicht mehr.«
[15] Ich suche nach einer passenden Antwort, und während ich suche, sage ich »Nein«.
»Tatsache ist«, sagt er, »daß ich mich allmählich frage, was dich eigentlich interessiert.« Sein Englisch ist unpersönlich und knapp, er könnte ein Theaterkritiker sein, der von einer Aufführung spricht, die er so belanglos findet, daß sie nicht mal mehr einen Verriß verdient. »Scheint mir immerhin sonderbar, daß du mit einundzwanzig Jahren…«
»Ich versuch’s ja dauernd herauszufinden«, sage ich. In Wirklichkeit betrachte ich gerade sein Hemd: die Art, wie die Ärmel hochgekrempelt sind, über den Ellenbogen mit einem dünnen Gummi befestigt zu einer kleinen akkuraten Rüsche.
Er trinkt einen Schluck Bier und stellt die Füße auf den Boden, um das Schaukeln zu stoppen. Sein Haar ist ziemlich lang und dicht, weiß mit bläulichem Schimmer. Er sieht mich starr an, seine Augen glänzen. Er sagt auf Italienisch: »Fjodor, ich glaube nicht, daß du auf diese Weise viel herausfinden wirst.« Komisch, wie ihm sofort wieder dieses kehlige R des gutsituierten Mailänders auf die Zunge kommt; wenn er eine andere Sprache spricht, bleibt ihm davon keine Spur. Er schaut aus dem Fenster.
Von draußen hört man das Kreischen und Flöten der Turakos, Milvulos, Tokos, Parasolvögel, Kolkraben: ein gemischtes Konzert in verschieden hohen Frequenzen. Es ist schwül, aber zum Glück nicht allzu heiß.
Ich sage zu meinem Vater: »Morgen früh fahre ich.«
Er wartet eine Minute oder zwei, schaut weiter aus dem Fenster. Fragt dann: »Und wohin willst du?«
»Weiß ich noch nicht.«
Er sieht mich an. »Wenn du nicht bis morgen früh deinen Bruder in New York anrufst und ihn aufforderst, [16] dir eine Arbeit anzubieten, dann tu mir den allerletzten Gefallen und laß dich hier nie wieder blicken.«
Ich bleibe ein paar Sekunden lang still, um über den Ton seiner Worte nachzudenken, über ihre lautliche Konsistenz im Verhältnis zu dem Gekreisch der Tukane und der Schizoros und der Trichoglossas, das durch die Ritzen der Jalousien hereindringt. Dann stehe ich auf und sage: »Da brauchen wir gar nicht bis morgen zu warten, für Leo arbeiten werde ich nicht.«
Mein Vater steht ebenfalls auf, stellt sein Glas auf den Eisschrank und sagt: »Die Entscheidung ist unwiderruflich. Ich hoffe, das ist dir klar.«
»Okay, alles klar.« Ich mache Anstalten, ihm die Hand zu geben, aber er dreht sich schroff um und geht aus dem Zimmer.
Ich hole meinen Koffer.
Mario Sotas erwartet mich vor dem Haus, sitzt schon am Steuer des gelben Jeep mit einem Anflug von Lächeln auf den Lippen. Wir fahren schnell auf der ungepflasterten Straße davon.
[17] Drei
In New York passiere ich den Zoll, gehe in einen der Wartesäle und setze mich. An einer Säule sind zwei Telefone, überdacht mit blauen Plexiglashauben; ich betrachte sie ungefähr eine halbe Stunde lang, die Hände in den Taschen, die Füße auf dem Schweinslederkoffer. Ein paarmal stehe ich auf, öffne mein Notizbuch beim Buchstaben L und setze mich wieder. Ich versuche mir einen Satz auszudenken, mit dem ich meinen Bruder ansprechen kann, aber mir fällt keiner ein; ich glaube nicht, daß ich ihm nichts zu sagen habe.
Endlich springe ich auf, gehe zu einem der Telefone, nehme den Hörer ab, drücke rasch nacheinander die Tasten in der Hoffnung, daß niemand antwortet. Es antwortet eine Sekretärin. Ich sage ihr, daß ich mit Leo sprechen möchte. Sie fragt, wer ich bin; es klingt, als hätte ich kaum viel Chancen, an ihn heranzukommen. Ich sage ihr, wer ich bin. Sie sagt: »Er ist in einer Besprechung, aber ich will versuchen, ihm gleich Bescheid zu sagen.« Ich schaue auf meinen sechs Meter entfernten Koffer.
Leo kommt ans Telefon und sagt »Ja?« Er redet mit einer Sekretärin oder sonstwem in seiner Nähe. »Fjodor, entschuldige, aber ich bin im Augenblick sehr beschäftigt.« Er redet weiter mit irgendwem, hält die Hand über die Muschel. »Entschuldige nochmals. Also, wie geht’s? Papa hat mir schon gesagt, daß du kommen würdest.«
»Woher hat der denn gewußt, daß ich kommen würde?« frage ich.
[18] »Was?« Im Hintergrund ist lautes Stimmengewirr zu hören; vermutlich steht er halb umgedreht zu irgendeinem aufgeregten Mitarbeiter, ohne groß auf den Hörer in seiner Hand zu achten. »Entschuldige, ich hab dich nicht verstanden.«
»Macht nichts.«
»Na bestens. Also hör zu. Wenn du ein Taxi nimmst und herkommst, gehn wir zusammen was essen.« Die Stimmen im Hintergrund schwellen an, übertönen seine letzten Worte.
»Aber ich würd gern erstmal duschen, wenigstens. Bin eben grad angekommen.«
»Gut, gut. Kannst du hier machen, während ich noch was erledige. Bis gleich.« Er legt auf.
Ich setze mich wieder und denke einen Moment lang darüber nach, wie sich sein Oxford-Englisch nach sechs Jahren New York verflüssigt hat, abgestumpft auf dem T und gedehnt auf dem R, ohne dabei im geringsten an Arroganz zu verlieren.
Ich gehe hinaus und nehme ein Taxi.
An der Ecke Fifth Avenue und 42. Straße steige ich aus, trete auf den Gehsteig und schaue am Gebäude der MultiCo Enterprises hoch. Die Gebäude auf der anderen Straßenseite spiegeln sich in den Scheiben. Ein eisiger Wind bläst mir durch die Baumwollkleider.
Ich betrete die Halle und sage zum Pförtner hinter dem breiten Empfangstresen, daß ich eine Verabredung mit Leo Barna habe. Er mustert mich von unten bis oben, schließt die Augen zu einem Schlitz und sagt: »Würde es Ihnen was ausmachen, mir Ihren Namen zu nennen?«
»Ich heiße Fjodor Barna.« Ich habe nicht die geringste Lust, in diesem Augenblick hier zu sein; ich habe nicht [19] die geringste Lust, mich irgendwie zu verrenken, um Leo zu sehen.
Der Pförtner legt den Kopf schräg, ohne seinen Gesichtsausdruck zu verändern. Ich glaube, er mustert meinen Zweitagebart, meine windzerzausten Haare, mein Baumwollhemd und die Jeans. Er drückt eine Taste am Haustelefon und sagt in zweifelndem Ton: »Da ist ein Herr Fjodor Barna.« Die Sekretärin am anderen Ende gibt die Meldung weiter. Der Pförtner schaut mit einem befriedigten Grinsen vor sich hin. Ich beuge mich über den Tresen, um einen Blick auf die Monitore der Überwachungsanlage zu werfen, und er erstarrt. Mir scheint, seine Hand tastet nach einer Schublade mit einer Pistole oder nach einem Alarmknopf. Die Stimme der Sekretärin am anderen Ende sagt »Geht in Ordnung«. Der Pförtner entspannt sich, zeigt mit der Hand auf die Fahrstühle und sagt: »Entschuldigen Sie, aber wir müssen immer erst kontrollieren.« Viel Aufhebens macht er jedenfalls nicht. Ich gehe mir einen Fahrstuhl holen.
Auf dem einundzwanzigsten Stock erwartet mich eine junge Sekretärin. Sagt »Guten Tag, Herr Barna«, führt mich einen Gang hinunter, öffnet eine Tür, hinter der eine Art Hotelzimmer ist, mit einem großen Bett und einem Sofa, deutet kurz in das Zimmer und sagt: »Herr Barna läßt Ihnen ausrichten, Sie können sich ruhig Zeit lassen. Er kommt Sie in einer halben Stunde abholen.« Sie verabschiedet sich und schließt die Tür.
Ich drehe den Schlüssel um. Auf dem Bett liegt ein Anzug aus grauem Kaschmir, ein Kamelhaarmantel, ein Schal im gleichen Grau wie der Anzug. Auf einem Kärtchen steht in langgezogener Handschrift: »Falls du vergessen hast, daß du in N.Y. bist.«
Ich dusche eine Viertelstunde lang, rasiere mich, ziehe [20] den grauen Anzug an. Gehe zum Fenster, schiebe den weißen Vorhang beiseite und schaue hinunter: auf das Gewimmel der Leute, das Gewimmel der Taxis, Busse und schwarzen Limousinen. Der eisige Wind bleibt draußen vor den geschlossenen Doppelscheiben, man hört nur das leise Summen der Aircondition. Mir dröhnen ein bißchen die Ohren; ich habe mich beim Rasieren am Kinr geschnitten; ich habe Hunger. Ich gehe zurück, um das Handtuch zu holen, rubble mir die Haare und schaue hinab auf die Straße.
Es klopft an der Tür. Ich gehe aufmachen, und da steht Leo in einem nachtblauen Anzug.
Er reicht mir die Hand, gibt mir mit der Linken einen Klaps auf die Schulter. Seine Zähne sind weißer, als ich sie in Erinnerung hatte; er hat eine neue Art, die Lippen auseinanderzuziehen, um sie zu zeigen, ohne daß es wie ein richtiges Lächeln wirkt. Er tritt ins Zimmer, betrachtet mich erst von der einen Seite, dann von der anderen und sagt: »Paßt dir ja bestens, mein Anzug.«
»Vielen Dank.« Es stimmt nicht, daß mir sein Anzug besonders gut paßt; er ist an den Schultern zu eng, er ist an den Ärmeln und Beinen zu lang.
Leo umkreist mich auf der Suche nach neuen Blickwinkeln. »Papa hat mir schon gesagt, daß es dir gut geht, aber ich dachte nicht, daß es dir so gut geht.« Er dreht sich und schaut kurz im Zimmer umher. »Dagegen dein armer Bruder, sieh ihn dir an, wie er vom Streß ruiniert ist.«
Ich sehe ihn an, aber ich finde ihn gar nicht sehr ruiniert; ich finde, er wirkt elastisch, voller Spannkraft und mechanischer Energie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Er gibt mir einen Klaps auf den Arm und sagt: »Warum gehn wir nicht was essen, statt hier herumzustehn wie zwei Stiesel?« Ich folge ihm aus dem Zimmer, [21] den Gang hinunter zum Fahrstuhl. Auf halbem Weg kommt die junge Sekretärin aus einer Tür, geht neben Leo her, stellt ihm rasch nacheinander eine Reihe von Fragen und notiert sich die Antworten auf einem Stenoblock. Wir betreten zu dritt den Fahrstuhl.
Leo und ich stehen nebeneinander vor dem Spiegel. Er betrachtet sich flüchtig, wendet den Blick zur Anzeigetafel. Er ist nicht der Typ, der sich lange im Spiegel betrachten muß, um ein Bild von sich zu haben.
Ich versuche herauszufinden, ob wir uns ähnlich sehen. Nicht sehr, scheint mir. Vielleicht ein bißchen im Schnitt der Augenbrauen, im Ansatz der Backenknochen, kann sein. Aber Leo ist blond und blauäugig, er ist sieben Jahre älter als ich, er hat eine andere Art zu stehen und den Kopf zu bewegen. Ich glaube nicht, daß man uns für Brüder halten würde, wenn man uns nebeneinander sieht, nicht einmal jetzt, wo wir gleich gekleidet sind. Ich komme mir lächerlich vor in diesem Kamelhaarmantel, gehemmt in den Bewegungen. Ich frage die Sekretärin: »Finden Sie, daß wir uns ähnlich sehen?« Ich deute auf Leo und mich im Spiegel.
Sie kichert verlegen, schaut kurz zu Leo hinüber, ohne im geringsten sein Äußeres mit meinem vergleichen zu wollen. Streicht sich mit einer kurzen nervösen Bewegung ein Haar aus der Stirn und sagt: »Ich denke schon.« Die Fahrstuhltür öffnet sich.
Wir sind unten in der Privatgarage. Leo öffnet die Tür eines bronzefarbenen Corniche Cabrio, das Ding ist zweieinhalbmal so lang wie mein verflossener MG. Ich gebe der Sekretärin durch einen Wink zu verstehen, daß sie ruhig vorn sitzen kann, aber sie rutscht sofort auf den Rücksitz, ohne mir viele Alternativen zu lassen. Leo startet den Wagen. Ich frage ihn: »Seit wann hast du den?« [22] Er sagt: »Schon länger.« Er hatte schon immer diese Art, meine Fragen nicht zu beantworten, wegzusehen und mich mit zwei oder drei Worten abzuspeisen.
Wir fahren eine Rampe hinauf, erreichen die 42. Straße. Im Wagen herrscht die gleiche Temperatur wie im Gebäude der MultiCo, was den Kamelhaarmantel und den grauen Kaschmirschal ziemlich überflüssig macht. Auch hier ist nur das leise Summen der Aircondition zu hören, aber noch leiser.
Leo fährt konzentriert, beobachtet den Verkehr. Wir gleiten zwischen den Autos dahin wie in einem Stummfilm. Nach einer Weile sagt er zu mir: »Ich hab dir immer gesagt, du wirst nie ein großer Rockgitarrist.« Er wirft mir zwei oder drei Blicke zu, in Abständen von Sekundenbruchteilen, um zu sehen, wie ich reagiere.
Ich sage nichts. Ich drehe mich um zu der Sekretärin; sie beobachtet den Verkehr mit neutralen Augen.
Leo lacht. »Mein Gott, ich dachte, du hättest wenigstens noch ein bißchen Sinn für Humor.«
Ich sehe aus dem Fenster.
Im Oberstock bei Tedro’s ist ein Tisch für uns reserviert; wir werden in fünf Minuten bedient. Leo und ich essen jeder ein großes Grillsteak und eine Schüssel Salat; die Sekretärin knabbert an einem Schnitzel, garniert mit kleinen weißlichen Pilzen und Ananasscheiben. Die Kellner sind sehr aufmerksam und zuvorkommend.
Nach einer Weile sieht Leo mich an und fragt: »Also. Was hast du vor?«
»Nichts«, sage ich.
Er schneidet sich ein großes Stück Fleisch ab, schiebt es sich auf der Gabelspitze in den Mund und kaut es sorgfältig. »Wenn du nach New York gekommen bist, [23] mußt du doch irgendwas vorhaben.« Er wischt sich mit der Serviette über den Mund, fixiert mich.
»Ich weiß nicht recht, warum ich gekommen bin«, sage ich.
Er wendet sich an die Sekretärin: »Heut nachmittag wird Tillson Ihnen zwei oder drei Vorschläge unterbreiten. Ich habe ihm gestern gesagt, er soll mal ein bißchen überlegen, wo ein guter Einstieg sein könnte. Prüfen Sie’s nach, der Tillson ist ein Holzkopf.« Die Sekretärin notiert sich diese Informationen, nickt mit dem Kopf. Leo hebt zwei Finger und bestellt den Kaffee.
Kaum daß wir ihn getrunken haben, stehen wir auf. Ein Kellner läuft, unsere Mäntel zu holen. Der Oberkellner verbeugt sich noch auf der Treppe, während wir schon fast in der Garage sind.
Wir gleiten wieder durch den Verkehr. Leo sagt: »Entschuldige, aber ich muß mich beeilen. Es ist schon sehr spät.« Er schaut auf eine sehr flache Armbanduhr. »Du gehst am besten in meine Wohnung und schläfst dich erstmal gut aus, wir können dann morgen reden.« Er hält am Bordstein in der Park Avenue, läßt mich aussteigen, fährt davon.
Ich nehme den Fahrstuhl zum obersten Stock und klingle an der Tür. Ein Hausmädchen macht mir auf, ein philippinisches, glaube ich; nimmt mir den Mantel ab, führt mich ins Wohnzimmer und zieht sich zurück.
Es ist ein sehr helles Wohnzimmer mit einer breiten Glastür, die auf eine Terrasse führt. Es enthält Sessel und Möbel im Italian Design, ein paar Warhols und Lichtensteins an den Wänden, die Bestseller der letzten vier Jahre in der Reihenfolge ihres Erscheinens auf einem langen Bücherregal, fünf oder sechs Fotobände mit Landschaftsbildern auf einem flachen Kristalltisch. Alles blitzsauber [24] und reglos und unbenutzt. Ein leichter Geruch von Polsterschaum liegt in der Luft.
Ich öffne die Glastür, trete auf die Terrasse, schaue hinunter auf die Straße, bis ich vor Kälte ganz blau bin. Es scheint mir lächerlich, nach New York gekommen zu sein, hier auf Leos Terrasse zu stehen und hinunterzuschauen.
Ich gehe wieder ins Zimmer und mache einen Rundgang durch den Rest der Wohnung. Gleich neben dem Wohnzimmer ist ein Gymnastikraum mit Trimmgeräten: Tretrad, Rudersitz, Hanteln, Schaumgummimatratzen und all dem Zeug. Sogar ein elektrisches Rollband ist da, auf dem man Jogging machen kann, ohne das Haus zu verlassen. Ich ziehe mir die Jacke aus, drücke auf ein paar Knöpfe und laufe gegen das Band. Ich habe nicht die geringste Idee, was ich hier soll, jetzt, wo ich in New York bin. Ich erhöhe die Bandgeschwindigkeit, laufe so schnell ich kann.
Ich verlasse den Gymnastikraum mit klopfendem Herzen und fliegendem Puls. Ich gehe in die Küche und meine, vor Hitze gleich zu ersticken. Ich versuche,, das Fenster aufzumachen, aber es geht nicht. Das Hausmädchen schaut durch die Tür und fragt, ob ich irgendwas möchte. Ich sage ja, einen Milkshake mit Schokolade. Sie holt sofort Milch, holländisches Kakaopulver und Zucker und tut alles in den Mixer.
Ich frage sie: »Wohnt Leo hier allein, oder hat er eine Freundin?«
Sie lächelt verlegen, schaut zur Wand, schaut auf den Milchkarton in ihrer Hand und sagt leise: »Weiß ich nicht.« Sie schraubt den Deckel fest und setzt den Mixer in Gang.
Ich kann jetzt vor Müdigkeit kaum noch sehen; mir [25] dröhnen die Ohren. Ich setze mich auf einen Hocker, trinke den Milkshake, lasse mir zeigen, wo mein Zimmer
ist.
Ich nehme ein Buch von einem Regal, es heißt Großansichten von Arizona. Ich streife die Schuhe ab, setze mich auf das Bett und blättere langsam die großen Farbseiten durch. Nicht daß ich die Fotos wirklich ansehe, ich gleite nur mit den Augen über das Hochglanzpapier. Ich lege mich auf die Seite, ziehe das auf geschlagene Buch mitten auf das Bett. Ich drehe mich auf den Rücken und schlafe ein.
Um sieben Uhr morgens stehe ich auf und ziehe mich an. Ich gehe in die Küche, um mir eine Tasse Milch heiß zu machen, gehe ins Wohnzimmer, um sie zu trinken. Durch die Wand ist das Rattern des Rollbands zu hören, laut wie das Schleudern einer Waschmaschine. Kaum hat es aufgehört, stelle ich die Tasse hin und gehe in den Gymnastikraum.
Leo macht gerade Kniebeugen; er sieht kurz auf und macht gleich weiter. Er hat eine kurze Hose aus weißem Frotteestoff an, dazu ein Band aus weißem Frotteestoff um die Stirn.
»Wie geht’s?« sage ich.
Er beugt weiter die Knie mit gestreckten Armen, ohne den Kopf zu drehen oder seine Bewegungen zu verlangsamen. Er ist ganz schön kräftig geworden durch all diese Übungen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe: straffer, mit festen Muskeln an Armen und Beinen und Brust. Dafür haben sich seine Augen ein wenig verengt, vielleicht entsprechend der Verengung seiner Interessen. Er muß eine Art Teleskopsicht entwickelt haben, wie eine Zwergohreule oder ein Sperberkäuzchen, um wenige Einzelheiten scharf anzuvisieren.
[26] Jetzt hört er auf, nimmt ein Handtuch, rubbelt sich Brust und Rücken ab. Setzt sich auf das Rudergerät, zieht die Ruder zurück und sagt: »Gestern abend. Hast du. Ein gutes französisches. Dinner verpaßt.« Er redet stoßweise, während er den Oberkörper vorbeugt; er schnauft und rudert.
»Tut mir leid. Ich glaub, ich hab sechzehn Stunden durchgeschlafen.«
Er rudert ein paar Minuten lang wortlos, die Augen starr geradeaus gerichtet, die Muskeln gespannt, das Gesicht schweißüberströmt. Sagt dann: »Da war auch. Die Freundin. Einer Freundin von mir. Nettes Mädchen. Fotomodell.«
Ich sage nochmal: »Tut mir leid.« Es stimmt nicht, daß es mir leid tut; ich stelle mir vor, wie wohl die Freundinnen der Freundinnen von Leo sein müssen.
Er steht auf, macht ein paar Lockerungsübungen, schüttelt die Beine aus. Nimmt zwei Fünf-Kilo-Hanteln vom Boden und stemmt sie in schnellem Rhythmus vor und zurück. Sagt dabei: »Hab gestern abend. Mit Tillson gesprochen. Es gibt zwei Möglichkeiten.« Er sieht geradeaus vor sich hin, ganz auf seine Muskeln konzentriert mit geblähten Halsadern. »Schließlich weißt du. Noch gar nichts. Mußt erstmal. Sowas wie ’ne Lehre machen. Wir können dir nicht gleich. Einen Job mit Verantwortung geben.« Ich glaube, er läßt den Bizeps jetzt nur noch schwellen, um mir zu zeigen, wie stark er geworden ist. Er atmet tief durch, stößt die Hanteln vor und zurück, strengt sich mächtig an, um das Tempo zu halten, aber jetzt muß er jeden Augenblick aufhören.
Er hört auf. Läßt die Hanteln auf eine Schaumgummimatte fallen, schüttelt die Arme aus, macht ein paar Schritte im Kreis. Läuft durch den Raum, schlüpft in einen [27] Bademantel aus weißem Frotteestoff mit einem schmalen senkrechten blauen Streifen, dreht sich zu mir und sagt: »Du kannst entweder hier arbeiten, wo ich und Tillson dich anleiten, oder in Mailand, wo Bob Lowell ist.« Er rubbelt sich mit einer rasenden Fingerbewegung die Haare. Macht zwei Schritte zur Tür.
»Dann geh ich nach Mailand.«
Er sieht mich an, sagt mit einem fast unmerklichen Zucken in den Augen: »Okay, wie du willst« und geht rasch hinaus.
[28] Vier
Wer schon mal an einem Wintertag über Mailand geflogen ist, kennt das: Eine Art riesige graue Kuppel wölbt sich über die ganze Fläche der breit hingelagerten Stadt. Eine Kuppel aus demselben Material wie das, was sie umschließt: ein rundum fugenloses Massiv, gebildet aus Schichten und Schichten von Grau, so dicht und dick übereinander, daß sie nichts durchscheinen lassen von dem, was darunter ist.
Wir landen nachmittags um vier. Ich warte zwanzig Minuten lang auf meinen Koffer, die Luft im Wartesaal ist zum Schneiden vom Qualm der anderen Reisenden. Ich passiere den Zoll, passiere die Carabinieri am Ausgang, passiere die Absperrketten. In der Halle zwischen den Wartenden steht ein großer dicker Typ, der eine Visitenkarte mit dem Markenzeichen der MultiCo in der Hand hält. Ich gehe auf ihn zu und sage: »Ich bin Fjodor Barna.« Er sagt »Ah, wunderbar!« und drückt mir die Hand. »Sehr erfreut. Bob Lowell.« Er strahlt mich an.
Wir gehen zum Ausgang. Er will meinen Koffer tragen, ich nehme ihn rasch in die andere Hand, damit er ihn nicht erreichen kann, aber er insistiert, greift hinüber und faßt nach dem Griff. Ich lasse ihm seinen Willen. Ist sowieso kein schwerer Koffer.
Wir treten auf den Vorplatz, und schlagartig kommen mir wieder die alten Gefühle, die ich früher hier hatte, dicht ineinander verquickt wie die grauen Schichten der Kuppel. Eigenartig, daß sie die ganzen Jahre lebendig [29] geblieben sind, irgendwo hinten in meinem Kopf, ohne an Schärfe zu verlieren. Der Geruch der Luft kommt mir wieder; und das Licht, gefiltert durch den Staub und den Dunst der feuchtfauligen Felder und den Rauch der Fabriken. Leo muß ganz schön verwundert gewesen sein, als er hörte, daß ich nach Mailand wollte. Jetzt bin ich selber verwundert.
Ich steige in Lowells Volvo, wir verlassen den Parkplatz. Wir fahren schnell über eine Landstraße. Lowell zeigt auf den Tacho und sagt: »Er macht’s nicht mehr so wie früher.« Er duftet stark nach Rasierwasser, er hat einen sandfarbenen, bis zum Hals zugeknöpften Mantel an. »Seit ich ihn habe panzern lassen, ist er zu schwer. Als ob man dauernd sechs Personen zusätzlich mitschleppt.« Er zeigt mit dem Daumen nach hinten: auf die sechs Personen zusätzlich.
»Und wieso haben Sie ihn panzern lassen?« Ich sehe hinaus auf die dunklen Felder neben der Straße, auf die langgestreckten und flachen Fabrikgebäude.
Er dreht kurz den Kopf zu mir. »Na ja, hier muß man sich vorsehen. Sie wissen doch, wie dieses Land ist.« Er lacht kurz und verlegen.
»Besonders gut weiß ich das nicht«, sage ich. »Das letzte Mal war ich hier vor fünfzehn Jahren, und da war ich ein ziemlich zerstreutes Kind.«
Er lacht nochmal. Er sieht auf den Tacho, den Drehzahlmesser. Er muß um die dreiundvierzig sein, oder vielleicht einundvierzig; er hat ein rosiges, glattes Gesicht, die Haare tief in der Stirn, kurz gehalten im Kochtopfschnitt. Er muß sehr kräftig gewesen sein, als er noch Baseball spielte an der Universität und sich viel bewegte oder auch nur weniger regelmäßig aß, bevor er heiratete und hierherkam, um die Leitung der MultiCo Italiana zu [30] übernehmen. Sein ursprünglicher Körperbau ist noch erkennbar unter den Wülsten am Hals und am Bauch und am Hintern, der kaum in den Sitz des gepanzerten Volvo paßt; aber seine physischen Reflexe sind abgestorben, untergegangen in seiner gewaltigen Körperfülle. Seine geistigen Reflexe müssen dagegen noch ziemlich lebhaft sein, wenn auch extrem spezialisiert und gefiltert durch die wäßrige Mattigkeit seiner Augen.
Während wir über die Autobahn fahren, vorbei an langen Reihen von Lastwagen, sagt er: »Find ich prima, daß du nach Mailand gekommen bist. Sicher wird es dir hier gefallen, ganz sicher.« Ich glaube zwar, daß er an Leo denkt, aber jedenfalls gibt er sich alle Mühe, nett zu sein. Er sagt: »Meine Frau hat gesagt, ich soll dir sagen, sie würde sich freuen, wenn du morgen abend bei uns zum Dinner bist.«
Wir fahren nach Mailand rein, durch breite Alleen voller dichtem, brüllendem Verkehr. Wir quälen uns im Schrittempo voran, halten, fahren ein paar Meter, halten wieder; spurten bei Ampeln los, um noch beim letzten Gelb rüberzukommen. Lowell fragt, ob ich mich an die Straßen erinnere oder an eins der Gebäude. Ich sage nein.
Er hält vor einem Hotel im Zentrum, parkt mit zwei Rädern auf dem Gehsteig. Zieht einen Umschlag aus der Tasche, reicht ihn mir und sagt: »Für die ersten Ausgaben.« Der Umschlag enthält zwei Kreditkarten auf meinen Namen und ein paar blanke, nagelneue Hunderttausendlirescheine. »Wenn du irgendein Problem hast, ruf mich zu Hause an, jederzeit.« Er erklärt mir, wo die MultiCo ist und wie man vom Hotel aus hingelangt. »Also, bis morgen früh.« Er gibt mir die Hand und schaut mir nach, während ich aussteige und die Wagentür zuschlage und ins Hotel gehe.
[31] Kaum bin ich allein, erscheint es mir komisch, in ein Hotel wie dieses zu gehen, gekleidet wie ein Kunde von Hotels wie diesem. Meine Gesten erscheinen mir komisch, wie ich den Paß auf den Tresen lege und den Schlüssel entgegennehme und dem Portier zulächle, der sich lächelnd verbeugt.
Im Zimmer schaue ich in den Spiegel und bin beeindruckt von meiner Kleidung. Seit ich das Internat verlassen habe, war ich nicht mehr so angezogen. Ich mache ein paar Bewegungen vor dem Spiegel, und es ist komisch, wie der Schnitt des Jacketts und der Anzughosen den Charakter meiner Gesten verändert, wie der Geist dieser Stoffe und Nähte an mir hochsteigt bis zum Hals und die Gesichtsmuskeln erreicht und sie zu passenden Ausdrücken animiert.
Ich dusche, ziehe mir Jeans und einen dicken Pullover an. Schalte den Fernseher ein, aber es gibt bloß amerikanische Serials von vor zwei, drei Jahren, einen Dokumentarfilm über die Vatikanischen Museen und ein kaum verständliches Quiz. Ich ziehe die Jacke über und gehe hinaus, um ein paar Schritte zu machen.
Draußen ist es schon dunkel; es ist kalt wie in New York, aber viel feuchter. Die Kälte und Feuchtigkeit und der Smog machen die Luft so dick, daß man sie mit einer gewissen Heftigkeit einsaugen muß, um sie bis in die Lungen zu kriegen. Ich gehe langsam, werde rechts und links angestoßen von Menschenströmen, die mit starrem Blick und hastigen Schritten über die Gehsteige drängen. Ich bleibe vor einem Schaufenster stehen und betrachte die ausgestellten Gegenstände, die Reflexe der Autos, die sich vor den Ampeln zu dröhnenden Schlangen stauen.
Ich gelange zum Domplatz. Das Licht der Straßenlampen wird von den Wasserpartikeln so stark gefiltert und [32] aufgesogen, daß die Luft genauso massiv erscheint wie die Gebäude. Es gibt keinen Freiraum mehr um die Mauern des Doms, um das Denkmal oder um die Gestalten, die den Platz überqueren. Es gibt keine Farben mehr, keine Kontraste. Es gibt nicht mal mehr viele Grautöne, höchstens noch zwei oder drei. Jetzt macht es mir Eindruck, daß mein Vater an einem Ort wie diesem geboren und aufgewachsen ist, daß er hier angefangen hat, die ersten Grundzüge seines Charakters auszubilden.
Ich gehe unter die Bögen der Galerie. Hier sind die Lichter noch gelb und warm. Ich betrachte Schaufenster voller bunter Schachteln mit Biscuit und Karamelbonbons und Schokolade, garniert mit goldenen Bändern und rosa und lila und malvenfarbenen Schleifen. Im großen Achteck, wo sich die beiden Arme der Galerie überkreuzen, stehen Gruppen von älteren Typen in Mänteln und Hüten, die gestikulieren und reden, alle sehr nah beieinander. Einige haben Hunde an der Leine, die an den Rändern der Gespräche sitzen und die Passanten beobachten. Einige schneuzen sich laut die Nase.
Ich trete in ein Café und bestelle mir einen Cappuccino. Zwei oder drei mit großer Sorgfalt gekleidete Paare sitzen an Tischchen vor Aperitifs in hohen dünnen Gläsern. Am Tresen stehen mehrere Typen um die vierzig, alle in eng taillierten und schulterwattierten Mänteln, in Hosen, die ziemlich weit über die Schuhe fallen, und Schuhen mit glänzend polierten Spitzen. Sie trinken irgendwas, stellen dann plötzlich ihr Glas auf den Tresen, laufen mit dem Portemonnaie in der Hand zur Kasse, zahlen, gehen hinaus und verfallen sofort in den gleichen hastigen Schritt wie die Ströme der heimwärts strebenden Menschen.
[33] Ich trinke den Cappuccino und sehe durchs Fenster. Mir scheint, das ist keine Stadt, in der man sich viel im Freien aufhält. Ich will zurück ins Hotel.
Auf dem Platz vor der Scala haben sich Gruppen von Arbeitern in blauen Overalls vor einem großen dunklen Gebäude versammelt. Sie rufen Parolen. Einige schütteln Kuhglocken, andere halten rot beschriftete Spruchbänder hoch. Die Parolen und das Glockengeläut und die Spruchbänder werden sofort verschluckt, aufgesogen vom Dunkel des dichten Abends. Es ist keine fröhliche Szene, obwohl ein paar Arbeiter lachen und sich eingehakt haben. Auch die Umgebung ist alles andere als fröhlich. Ich haste jetzt auch.
[34] Fünf
Am Morgen führt mich Bob Lowell durch die Flure der MultiCo. Alle naselang bleibt er vor einer Türe stehen, klopft, geht rein, zeigt mit der Hand auf mich und sagt: »Doktor Barna.« Er spricht Italienisch mit einem häßlichen, breiten Akzent, aber er kann sich recht gut verständlich machen. Die Typen, die er mir vorstellt, erheben sich, drücken mir die Hand, bleiben stehen und sehen mich an, ohne zu wissen, was sie sagen sollen, bis wir wieder draußen sind. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll; ich lasse mich einfach herumführen, drücke Hände und lächle so gut ich kann.