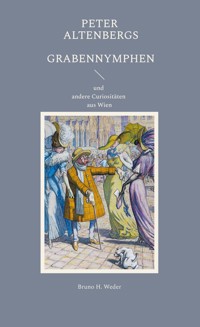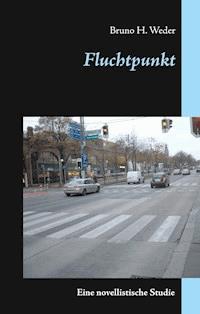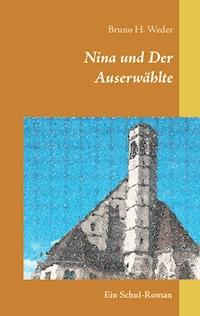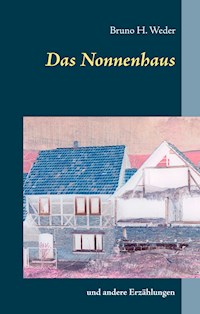
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erstmals werden in diesem Band Erzählungen vereint, die bisher nur verstreut zugänglich waren. Das Nonnenhaus, Der Schrank und Der Drechsler sind skurrile Dorfgeschichten, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Arlecchino und Der Pfauenthron haben eine Künstlerpersönlichkeit als Hintergrund, und Schlaf, mein Schlaf! ist eine Hommage an Jean Paul.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Nonnenhaus
Der Schrank
Der Rabe
Schlaf, mein Schlaf!
Der Drechsler
Puppchen, du bist mein Augenstern!
Arlecchino, Tod und Trakl
Der Pfauenthron oder Schiller in Karlsbad
Textnachweis
Biogramm
Das Nonnenhaus
Es war damals schon unheimlich gewesen in jenem Haus, das allgemein Nonnenhaus genannt wurde. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob ich fünf oder sechs Jahre zählte - auf jeden Fall ging ich noch nicht zur Schule -, als mich mein Vater dorthin zu einem Kondolenzbesuch mitgenommen hatte (auch das ein Beispiel seiner ungeheuer variationsreichen Tyrannenphantasie). Über die Herkunft des Namens gab es verschiedene Theorien. Uneingeweihte tippten natürlich sofort auf eine frauenklösterliche Unterkunft. Das war an sich nicht einmal abwegig; denn bereits die Alemannen hatten dort Land urbar gemacht, indem sie es dem Sumpf, den der nahe Fluß durch alljährliche Überschwemmungen nährte, abtrotzten. So soll sich ein einzelner Alemanne, weiß der Lokalchronist zu berichten, dorthin verirrt haben (wohl im Metsuff?), seinen blanken Speer in die Erde der von Farnen überwucherten Halde gestoßen haben und damit aller Welt (sic!) angezeigt haben, daß dies nun sein Eigentum sei. Vermutlich ist es einer (auch betrunkenen?) Römerin zu verdanken, daß bald statt der Farne Reben wuchsen. Vielleicht sind aber auch spätere Kolonisatoren auf denselben Gedanken gekommen, so daß Nachwuchs garantiert war. Und im Zeichen einer allgemeinen Christianisierung ging der mittlerweile beträchtlich gewachsene Hof durch eine Schenkung an das etwas abgelegene Kloster über. Was wäre demnach näher gelegen, als daß dort zwecks Aufsicht einmal ein Nonnenkloster gegründet wurde (Abt Salomon erwähnt allerdings in seiner Urkunde noch nichts Dergleichen). Möglicherweise hing das auch damit zusammen, daß man den heidnischen Bräuchen einen andern Anstrich geben wollte; hatte immerhin Dagobert (ja, der Merowinger, nicht der Duck) einst in einen nahen Felsen, scheint's, eine Mondsichel einhauen lassen, und zwar nicht, wie irrtümlich sagenhaft überliefert, als Grenzzeichen, sondern als Abschreckung - er war sehr abergläubisch - gegen irgendwelche seiner Feinde.
Doch das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall gab's einmal ein St.Katharinenklösterchen, womit gezeigt wäre, daß die Herleitung nicht ganz abwegig gewesen wäre (vielleicht spukten zeitweise tatsächlich einige Nonnen in Andacht an Katharina oder an sie aufgeschreckt habende bärtige Inzuchtlüstlinge darin). Tatsache aber ist, daß das Haus seinen Namen vom Ornithologischen her erhielt, wobei die Kausalitäten nicht genau auszumachen sind. Da dem reich ausgestatteten Riegelbau auch eine sehr geräumige Vorratskammer und Scheune mit dazugehörendem Tenn angegliedert war, war es selbstverständlich - wenigstens zu jener Zeit noch -, daß im First und in irgendwelchen Schlupflöchern Vögel aller Art nisteten. Und irgendwann ging einmal von einem kundigen Ornithologen der Ruf aus, es handle sich vornehmlich um Nonnen (so heißt eine Art von Weberfinken), die dort ihre Brutplätze einrichteten. Inwiefern sich dieser Schalk einen Witz geleistet haben mag, bleibe dahingestellt; denn irgendein - wohl dahergelaufener - Neunmalkluger will eingeworfen haben, daß das gar nicht Weberfinken gewesen seien; vielleicht hätten es die Spatzen von allen - allerdings andern - Dächern gepfiffen, daß das vielfältige Gepiepse eher anthropologischnönnisch als ornithologisch-nönnisch zu deuten sei. Im Klartext: Zwar habe es sicher Geschöpfe der Gattung Lonchura (im Volksmund Nonnen genannt) gegeben, die sogar Jagd auf Geschöpfe der Gattung Lymantria monacha (im Volksmund ebenfalls Nonnen genannt) gemacht hätten; aber hauptsächlich hätten die Nonnen (im Volksmund Kathrinchen genannt) dort mehr ihr Wesen als ihr Unwesen getrieben, wodurch eben das Fichtengebälk manchmal ins Ächzen und andere ins Stöhnen geraten seien. Schließlich war diese Ablage des St.Katharinenstifts nicht das Original, sondern als Internat für edle und gutsituierte Bürgerstöchter gedacht, die nicht unbedingt dem reinen Geist frönten, zumal die meisten unbesorgten Eltern in der weiter entfernten Stadt Gallach wohnten. Und so gab's halt allenthalben gemischte Interessen, vor allem, wenn die Ordensträgerinnen eben Betzeit hatten, und das war just die Zeit, da die Weberfinken mit viel Gepfeife ins Gebälk zogen. Nun, mit den Jahren ergab sich sowieso das eine oder andere, als die Zeit ins Land ging; denn das Internat wurde aufgelöst, als während der Nachwehen der Reformation sämtliche Güter des Frauenstifts St.Katharina an die Stadt Gallach übergingen, so daß sich die Ordensträgerinnen gezwungen sahen, einen neuen Wohnsitz zu nehmen. Der Besitzübergang mußte sich offenbar reibungslos vollzogen haben; denn Urkunden bezeugen keinen Streit, sondern allgemeine Zufriedenheit, so daß ein Pächter (Baschi Schelling soll er geheißen haben) gar vermerken konnte, als er von den vorhergehenden Besitzern das Nonnenhaus (und weitere Güter) in Besitz nehmen konnte:
„Ich, Baschi Schelling, bekenne, wie oben stat, daß die herren wol zufrieden sind und ich auch.“
Dann aber wechselte die Szenerie gewaltig. Baschi Schelling war eine eigentümliche Figur gewesen, hatte sich immer auf seinen Vorteil verstanden und war manchem im Ort eher ungeheuerlich vorgekommen, weil er jeden mit einem Spruch in aller Öffentlichkeit lächerlich zu machen versuchte, ihn übers Ohr haute oder - schlimmstenfalls, weil er über große Finanzen verfügen mußte - mit ihm prozessierte. Daß er bis ins letzte rücksichtslos war, zeigte sich in der Tatsache, daß er seine Frau, als er ihrer überdrüssig geworden war und sie nicht in eine Scheidung einzuwilligen gedachte, weil sie sah, daß er nur die Tochter des Hofammanns Ritz für sich haben wollte, kurzerhand wegen Hexerei anzeigte. Da man ihm nicht gleich glaubte, wurde er ein paar Mal verzeigt, angeblich, weil er beim Aveläuten den Hut nicht gezogen hatte, während des Wetterläutens „gejuchzet und Maitli an der Hand gefüehrt“ habe, was ihn unglaubwürdig habe erscheinen lassen. Doch mit der Zeit, als er immer neue Argumente lieferte, was seine Frau alles „so mache“, hätten ihm die Gemeindegewaltigen zu glauben begonnen, weil sie der Ansicht waren, das könne ein normal veranlagter Mensch gar nicht erfinden. So habe er sie beispielsweise eines Nachts - eine Viertelstunde nach Mitternacht mochte es gewesen sein - dabei ertappt, wie sie einen Besenstiel mit grüner Salbe bestrichen, dann unter unverständlichem Gemurmel den Stecken liebevoll gestreichelt und ihn anschließend zwischen die Beine genommen habe. Erst dann habe sie das allseits bekannte Sprüchlein vernehmlich deklarieret: „Nun ûf und an in aller Tüfel Namen - stoß nienen an - über all Büchel und Berg ûs!“
Diese Aussage des Baschi Schelling genügte, die Richter zu überzeugen. Sie ließen die Frau verhaften, abführen und steckten sie im Rathaus ins Verlies, wo sie sie solange folterten, bis sie alles „gestand“. Danach wurde mit ihr kurzer Prozeß gemacht: Sie wurde öffentlich als Hexe bezeichnet, an den Pranger gestellt, geköpft, die Leiche auf dem Rathausplatz verbrannt, während ihr Kopf als Mahnmal aufgespießt wurde. Die Asche wurde an einem geheimen Ort begraben, damit weder Mensch noch Kuh schaden zu nehmen hätten. Baschi war's zufrieden, doch zeigte er es nicht in der Öffentlichkeit, sondern feierte zu Hause. Als er eben dabei gewesen sei, so erzählte sich manch einer hinter vorgehaltener Hand, das Glas Farnhalder Spätlese über den auf einer Art Altar liegenden nackten Frauenkörper der Josefa Grüninger zu schütten, um sie, wie er sagte, niederen Weihen bekanntzumachen, in der Absicht, sie nachher zu besteigen; denn er habe schon seine Hose herunterzuwursteln begonnen, doch sei er urplötzlich wie zur Salzsäule erstarrt (der Vergleich mit Lots Frau stimmt an dieser Stelle natürlich nicht, weil Schelling nicht hinter sich geschaut hatte). Da sei die nackte Jungfrau (?) mit einem Schrei aufgeschossen und in eine Ecke gerannt, wo sie sich notdürftig in einen Vorhang gewickelt habe. So hätten sie - beichten immer die, die dabei gewesen - Baschi noch nie gesehen. Bleich sei gar kein Ausdruck, so bleich sei sein Gesicht gewesen. Und doch sei der Anblick irgendwie komisch gewesen, wie er erstarrt dagestanden habe, die Hose an den Knien, mit nunmehr abgeschlaffter Männlichkeit, und jählings habe er sein Glas aus der Hand fahren lassen und sich über Stunden - so sei es ihnen vorgekommen - nicht mehr gerührt. Kaum ein paar Tage seien verstrichen, als Baschi Schelling ausgezogen sei und das Haus zum Verkauf ausgeschrieben habe. Da es aber offenbar so war, daß der Geist von Baschis Hexenfrau nach wie vor in diesem Haus verkehrt habe, hätten die Käufer jeweils nicht lange ausgeharrt und das Objekt habe in kurzer Zeit den Besitzer einige Male gewechselt.
Als die Federers ins Nonnenhaus zogen, war es dem Verfall nahe. Der Riegel erwies sich als derart wurmstichig, daß ein Halten der Fassade kaum mehr gewährleistet war. Zudem neigten sich sämtliche Mauern beträchtlich - würde man es dem Augenmaß nach beurteilen, müßte man den Ausdruck „wacklig“ anführen -, so daß ein Wohnen in diesen Mauern nur unter ständiger Lebensgefahr möglich schien. All dies störte die Familie Federer weiter nicht; denn es war für sie möglich, das Haus zu einem Preis zu erstehen, der jeglicher Beschreibung spottete. Dies hatte allerdings nicht den alleinigen Grund in dem desolaten baulichen Zustand, sondern in der Tatsache, daß es eben spukte und, da dies allseits bekannt war, niemand das Objekt früherer Exzesse als Besitz begehrte. So erzählte man sich, daß gewaltige Windstöße durch die Räume fegten, auch wenn - scheint's - Windstille war, so daß Türen, die an sich gar nicht mehr schlossen, zugeknallt wurden. Andere wiederum berichteten hinter vorgehaltener Hand, im Kamin herrsche zu gewissen Zeiten (man wisse ja, in welchen) ein gewaltiges Sausen und Pfeifen. Handelnder in der Familie war in erster Linie Jakob Federer. Warum dies eine Rolle spielt, zeigt sich in der Tatsache, daß mit seiner direkten Familie, d.h. seiner - zweiten - Frau, übrigens auch eine Federer, die allerdings im Basenverhältnis zu ihm stand, seinen sieben Kindern - vier Söhne und drei Töchter -, vor allem seinem Vater, der in einem - für damalige Verhältnisse - unbestimmten Alter war, d.h. sozusagen zeitlos aussah, sich, seit „Menschengedenken“, nicht mehr veränderte, und seinem Bruder, den er aus dem Armenhaus (das damals noch „Armenasyl“ hieß) übernommen hatte, der seiner geistigen Fähigkeiten wegen - immer in Relation zu der sonst schon nicht gerade als gesegnet zu bezeichnenden Familie - oft verspottet wurde, weil er auch zu aller Debilität einen schiefen Mund hatte, der jeweils arg verzogen wurde, wenn er ins Stammeln geriet (daß er auch einen Kropf gehabt habe, ist eine mutwillige Erfindung), lauter Federers einzogen. Federer - er soll hier sozusagen stellvertretend genannt werden - war also neuer Besitzer des Nonnenhauses geworden; und er hatte seine vorhandene nähere Sippschaft um sich geschart. Wovon er sich und seine Familie eigentlich ernährte, ist nie ganz klar geworden. Sein Vater saß jeden Tag bei Sonne und Regen vor seinem Haus auf dem als Bänklein dienenden Eichenstammstück, das auf der einen Seite aussah, als ob es ein stilisierter Hundekopf sei, und am andern Ende glich es einer Gans. Die beiden Enden wurden durch ein etwa zwei Meter langes, wurstähnliches Stück miteinander verbunden. Vater Federer hatte es einst, als der nahe Fluß über die Ufer getreten war und viel Holz mit sich gebracht hatte, ins Trockene gehievt und nach Hause geschleppt. Als sein Sohn (woher hatte er eigentlich die Mittel?) das Nonnenhaus gekauft hatte, war es eine Selbstverständlichkeit gewesen, den Ganswursthund mitzunehmen. Da der Bruder Jakobs armengenössig war, war er der Gemeinde für irgendwelche Arbeiten eingeteilt. Meistens hatte er die Straßen mit dem Birkenreisigbesen zu säubern. Dabei freute er sich kindlich, wenn ihm Kinder und Jugendliche „Hoi Paul!“ zuriefen; denn das war gleichsam sein Lebenssinn. Und jedes Mal, wenn es ein paar Mal geschehen war, fühlte er sich ungeheuer erregt, so daß er den Drang hatte zu pissen, weshalb er seinen inzwischen zum Stecken gewachsenen Pimmel herauszog und ihn liebevoll allen, die ihn sehen wollten oder mußten, zeigte. Oft, so versteht sich, wurde dies natürlich als öffentliches Ärgernis bezeichnet, was dem armen Kerl jeweils ein Wochenende bei Wasser und Brot im Gemeindegefängnis eintrug. Meistens hatte jedoch Zellweger, der Dorfpolizist, Einsehen und ließ ihm durch seine Haushälterin einiges