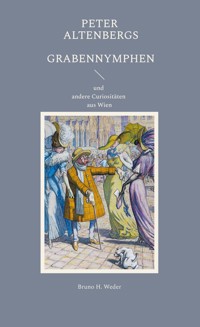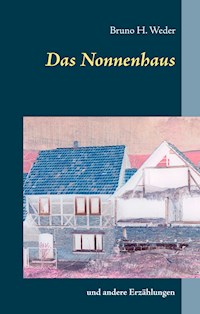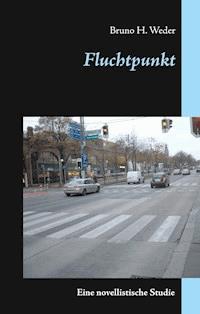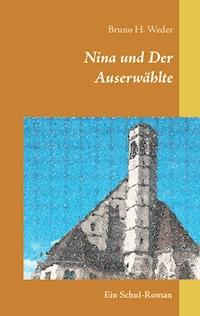
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nina ist eine fiktive Frauenfigur, eine Traumfrau und die Geliebte des Auserwählten. Der Auserwählte ist ein Traummann und die männliche Spitzenfigur in einem kaleidoskopisch-intrigant zusammengefügten Schulroman eines fiktiven Gymnasiums. Kabale und Liebe im 21.Jahrhundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ähnlichkeiten mit irgendwelchen Leuten oder Vorkommnissen sind rein zufällig, aber gewollt. Betroffenheit, die sich beim Lesen einstellt, ist immer ein Eingeständnis des Betroffenen, daß er sich in irgendeiner Weise ertappt fühlt.
Inhaltsverzeichnis
Kyrie: Prolog
Gloria: Das erste Buch: Die Gruft
Credo: Das zweite Buch: Die Zellen
Sanctus: Das dritte Buch: Auditorium maximum
Benedictus: Das vierte Buch: Refectorium
Agnus Dei: Epilog
Anmerkungen
KYRIE
Prolog
Attendite, popule meus, legem meam: inclinate aurem vestram in verba oris mei.
(Mein Volk, achte auf mein Gesetz; neiget euer Ohr zu dem Wort meines Mundes.)
************************
Eine festliche Schar älterer und jüngerer Leute stand vor der Kirche Zur Lieben Frau in Gallach. Es war einer jener unvergleichlichen Maitage, deren strahlend schönes Wetter die Welt in eine seltsam täuschende Friedfertigkeit tauchte. Oben auf dem bewaldeten Hügel war, weithin sichtbar, das Stift Gallach zu sehen, beschützendthronend über der Stadt. Die Glocken läuteten, und die versammelten Kirchgänger bildeten ein Spalier und lachten dabei fröhlich. Kaum hatten sie sich formiert, fuhren zwei schwarze Carossen vor, denen zwei Paare entstiegen, wobei die eine Frau ein weißes Bündel auf den Armen hielt. Unter einem blütenweißen Schleierchen schlummerte friedlich ein kleines Kind, das erst dreieinhalb Monate alt war und an diesem strahlenden Tage zur Taufe geführt wurde. Glückstrahlend gingen Eltern und Paten durch das Spalier, während ein dreijähriges Mädchen, das ein langes weißes Kleidchen trug, einen Blütenkranz im Haar, Rosen auf den Boden streute. Rote Rosen. Die Orgel setzte mit einem festlichen Präludium ein und ließ ihm eine quirlige Fuge folgen. Die übrigen Leute schlossen sich den Paaren an und setzten sich in die vorderen Reihen der Bänke, während die hinteren durch fremde Kirchenbesucher, die ihre Neugierde am kommenden Akt zu befriedigen suchten, gefüllt waren. Der Pfarrer mit seinen Ministranten hielt ebenfalls Einzug, und als die Orgel geendet hatte, begann er den Taufgottesdienst. Nach der Lesung, einem Gebet und einem von der Gemeinde intonierten Choral nahm der Pfarrer die Taufzeremonie vor. „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes: Ich taufe dich auf den Namen Nina Noser. Der Herr sei mit dir.“
************************
GLORIA
Das erste Buch: Die Gruft
DE MORTUIS NIL NISI BENE
( Über die Toten ausschließlich Gutes )
INTROITUS: Iustitia regnorum fundamentum
(Grundlage der Herrscher ist die Gerechtigkeit)
************************
Eine merkwürdige Situation ergab sich für den voreingenommenen Gruftbesucher (unvoreingenommene gab es nicht). Man ging, wenn man durch das schwere Eichenportal geschritten war, durch den langen Gang auf frisch gebohnertem Parkett, geführt vom Custos, der auch die Türe hütete und Outsiders fürs erste in Empfang nahm. Er pflegte dabei lange in seinen majestätischen Bart zu reden: Floskeln, Redensarten, vielleicht auch Ernstgemeintes. Immerhin war er von außerordentlicher Liebenswürdigkeit, ein altgedienter Herr, der seit Jahrzehnten dieselben Dienste versah, nie krank war, nie irgendwelche Querelen verursachte. Er sinnierte, daß er bereits den dritten Abt überlebt hatte. Jacobus, so hieß er bei allen Patres - niemand kannte allerdings seinen richtigen Namen -, saß an einem kleinen Tischchen unmittelbar hinter dem Haupteingang. Das Holztischchen, noch aus dem vorigen Jahrhundert, war mählich auf wackligen Füßen. Er pflegte allen Leuten, ob aufgefordert oder nicht, zu erzählen, daß es noch aus der Frühzeit stamme (Aus der Naissance, nicht Renaissance, meinte er abschließend). Lediglich eine Schublade zeugte von der eigentlichen Funktion: Er bewahrte darin die mickrigen Trinkgelder auf, die er im Verlaufe seines Custos - Lebens angesammelt hatte. Mein Sparbuch für die alten Tage nannte er sie. Sie irgendwie und irgendwo nutzbringend anzulegen, war nie seine Absicht gewesen. Jedem Besucher, der ihm ein kleines Trinkgeld spendete, versicherte er, daß es in dieser Abtei ausschließlich Gutes gebe, er konnte die Verdienste der Insassen, allen voran des Abts, nicht hoch genug veranschlagen.
„Requiescat in pace“, murmelte er eben.
Man glaubte ihm die Trauer. Seine dichten, struppigen Barthaare begannen bis in die tiefsten Spitzen zu zittern, seine Stimme bebte, und er vergrub seine tattrigen Hände in den Taschen seines blauen Übermantels. Dabei schien er dauernd, nervös um sich sehend, nach dem Erscheinungsbild seines Vorgesetzten zu suchen, immer bereit, einen Kratzfuß anzubringen. Einige der Besucher waren tatsächlich nicht ganz sicher, ob Abt Conrad nicht doch noch aufstehen würde, wie um zu zeigen, daß er im Grunde genommen auch den Tod überlisten könnte, wenn er nur wollte.
„Wir bitten um angemessene Ruhe“, flüsterte Jacobus, wenn er einen Besucher die Treppe zur Gruft hinunterführte.
Es war nicht in erster Linie der aufgebahrte Abt, der das Interesse der Besucher weckte, sondern zweifellos der Raum, in dem sich Conrad zum letzten Mal in Szene setzte. An sich war er quadratisch, aber durch die Abschrägungen der Ecken wandelte er sich zu einem Achteck. Dadurch, daß er nicht allzu hoch war, war ihm eine gewisse Heimeligkeit eigen. Auch etwas Bergendes hatte er in sich. In die Schrägwände waren vier Nischen eingelassen, auf denen je eine Allegorie der vier Jahreszeiten stand. Alle vier stellten Christus dar, wobei jeder Kopf Conrad wie aus dem Gesicht geschnitten war. Der Abt hatte die Figuren im Verlaufe seiner Amtszeit durch den Gallacher Bildhauer Bucher schnitzen lassen. Der Winter zeigte sich dem Besucher als die unter dem Kreuz zusammengebrochene Christusfigur, eine farbig gefaßte Holzplastik. Er stützte sich auf die linke Hand, das blaue Gewand in langen Falten stilisiert. Ein leicht gekräuselter Bart lenkte von der etwas beschädigten Nase ab. Der Frühling trug auf dem Sockel die Aufschrift Unser Herr im Elend. Christus saß halb entblößt auf einem prismatischen Block, Unterkörper und Beine mit außen blauem, innen rotem Kleid bedeckt, Hände vorn gefesselt, Haar und Bart stilisiert, Wunden aufgemalt. Diesen beiden gegenüber waren der Sommer und der Herbst. Jener hing an einem schwarzen Holzkreuz, das mit roten Rosetten versehen war. Blattartige Nimbusstrahlen waren am Körper angesetzt. Und dieser zeigte den Gekreuzigten auf einem altarartigen Sockel, wobei das Kreuz durch einen Weinstock symbolisiert wurde, das mit durchbrochen gearbeitetem Rankenwerk mit Weinlaub und Trauben versehen war. Das Ganze war kräftig blau, grün, rot und gelb bemalt, das Rankenwerk vergoldet. Von der Flachkuppel fiel gedämpftes Tageslicht ein. Durch die Ausbrüche zu den übrigen Grufträumen wurde ein kreuzförmiger Grundriß vorgetäuscht. Abt Conrad hatte auch am Baustoff nicht gespart; denn das Stift pflegte diese Baukosten nicht zu übernehmen, weshalb der Abt dies hatte aus privaten Mitteln finanzieren müssen. Es handelte sich um Carraramarmor mit schwarzen Sockeln und violettgrauem Fries, in den Mosaikkreuze eingelassen waren. Raffiniert war, daß sich der Abt nicht hatte in der Mitte des Raums aufbahren lassen, wie es zu erwarten gewesen wäre. Dieser Ort war seinem Sarkophag vorbehalten. Er selbst lag ein wenig abseits und zog damit natürlich die größere Aufmerksamkeit auf sich. Dieser Sarkophag war üppig in barocken Formen gehalten. Die Füße waren Geierkrallen nachempfunden, die sich in den Tonplattenboden einzubohren schienen. Auf der Stirnseite befand sich auf dem unteren Teil über gekreuzten Knochen ein lachender Totenschädel, auf dessen Stirn der Name des Herstellers zu lesen war: B.F.Mollmann. Darüber, auf dem Sargdeckel, glotzte ein Satyrkopf den Beobachter an: Halb Mensch, halb Tier, es war nicht genau auszumachen, welche Züge überwogen. In seinem riesigen Mund war der Sargdeckelring befestigt. Stärke, Kraft und Unwiderruflichkeit sprachen aus diesen Zügen. Je an den Ecken waren Engelsbüsten mit Flügeln. Die unteren schauten nach unten (in die Halle?), die oberen gegen die Flachkuppel. Auf dem Deckel stand ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen, im Schnabel eine Stiftsordnung haltend. Die Seite rechts, wenn man vom Eingangsdurchbruch herkam, war einem feinziselierten Samttuch nachgebildet, auf dessen Mitte über einem Lorbeerkranz ein Langschwert einen Krummsäbel kreuzte. Die Rückseite des Sarkophags sollte einen Felsvorsprung andeuten, auf dem die allegorische Darstellung von Amor und Psyche in Vollplastik zu sehen war. über den beiden hielt ein neckischer Cupido seine rechte Hand segnend ausgestreckt. Ging man auf die andere Längsseite, so bemerkte man eine reliefartige Darstellung einer Schlachtenszene: Drei Patres kümmerten sich um einen verletzten Krieger, der von zwei Kameraden auf einer Bahre davongetragen wurde. Bei zweien der drei Patres konnte eine entfernte Ähnlichkeit mit Stiftsinsassen, Pater Leo und Pater Ferdinand, festgestellt werden. In der Mitte des Deckels war ein reliefartiges Großereignis zu bestaunen: ein prunkvoller Triumphbogen, unter dem hoch zu Roß der Abt in eine größere Stadt einritt. Anhand der Paläste mußte es sich um Florenz handeln. Wie Conrad auf diese Idee gekommen war, mußte rätselhaft bleiben. Auf jeden Fall war rundherum viel jubelndes Volk zu sehen. Dieses ganze Prachtsgebilde war in alter Manier in Zinn gehalten. Je in der Diagonale an den vier Ecken befanden sich zwei Clivien und zwei Narzissenbouquets. Leicht abseits aber, wie geschildert, die Hauptfigur dieser Tage: Abt Conrad I. Er war bereits präpariert für die Bestattung im Sarkophag. Herz und Eingeweide waren entnommen, wobei jenes in der Stiftskirche aufbewahrt wurde, während man noch nicht wußte, wo die Eingeweide hinkommen sollten; dies mußte erst dem Testament entnommen werden. Der einbalsamierte Leichnam war mit einem Purpurmantel bekleidet - der Ordensregel völlig widersprechend. Es würde demnach interessant sein, was der Bischof, der schließlich an der Beisetzung teilnehmen würde, dazu meinte. Ob er ihn wohl noch umkleiden ließ? Oder übersah er es einfach? Ein Entscheid würde ihm vermutlich nicht leicht fallen. Der Abt hielt die Hände schön über dem Unterleib gefaltet (wessen Idee dies wohl gewesen war?). Der Leichenkosmetiker hatte ihm ein gewinnendes Lächeln ins Gesicht gezaubert, das immer noch verbunden war mit des Abts eigenem diabolischen Fratzenlächeln, das das Hämisch-Verschmitzte in seinem Leben so markant unterstrichen hatte. Dadurch kam auch das Hinterhältige, das Hinterfotzige, das ihm Zeit seines Lebens eigen gewesen war, deutlich zum Ausdruck. Das schüttere Haar wirkte allerdings nicht in derselben Art, wie dies zu Lebzeiten der Fall gewesen war; es schien vielmehr wie angeklebt, hatte etwas Unechtes an sich. Doch dieses Moment würde sich ändern, sobald Conrad in den Sarkophag gesteckt würde. Es ging gegen Abend des zweiten Todestages von Abt Conrad. Jacobus kam die Treppe zur Gruft heruntergeschlurft, schnaufend, schniefend und gebetmurmelnd. Ehrfürchtig betrat er die Gruft, leicht schaudernd; in der Hand hielt er zitternd eine übel riechende Petroleumlampe und eine Zündholzschachtel. Nachdem er die Lampe auf den Boden gestellt hatte, klaubte er ein Zündholz hervor und entzündete die Vesperkerzen. Kaum flackerte das Licht, schien der Raum wie verwandelt. Wie schon am Vortag überkam ihn ein leichtes Schütteln, Tränen kollerten ihm über die eingefallenen Wangen, ehe er erneut ansetzte, um auch die Kerzenreihe bei den allegorischen Jahreszeitenfiguren anzuzünden. Als auch die vier Leider am und unterm Kreuz ihre Farbenpracht erstrahlen ließen, murmelte Jacobus ein Paternoster, steckte die Zündholzschachtel in die linke Tasche seines blauen Übermantels und verließ, nach einem ehrerbietigen Kniefall und zwei Kratzfüßen, den Raum, nicht ohne vorher über den Saum des Purpurmantels gestrichen zu haben. Dann schlurfte er zur Treppe, wollte sich noch einmal kurz umkehren und verbeugen, hörte aber, während er sich drehen wollte, die Glocke anschlagen, weshalb er in Trab kam; denn das Zeichen bedeutete wohl, daß ein Gast von außen kam, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Schnell strich er sich die Falten aus dem Übermantel, sammelte sich, als er oben an der Treppe angekommen war, atmete tief ein, dann aus. Und gemessenen Schrittes begab er sich an seinem Tischchen vorbei, faßte den schweren Griff der Eichentür, um zu öffnen. Der Schreck fuhr ihm durch alle Glieder, als er den Gast erkannte. Es war kein Geringerer als Bischof Gregor. Jacobus wollte leicht ins Japsen kommen, doch unterdrückte er diese orale Regung noch rechtzeitig. Wieso kam Gregor unangemeldet? Und dazu noch ohne Begleitung? Jacobus wußte weder ein noch aus. Was sollte er nur tun? Die Patres waren auch nicht einfach zu erreichen; vor allem Pater Leo nicht, der Pater Prior, der Conrad in allen Repräsentationen zu vertreten hatte; denn Leo schaute, daß er nach Möglichkeit allem ausweichen konnte, weil er sich schnell einmal verunsichert fühlte. Und überhaupt: Es war ja Vesperandacht, durchfuhr es Jacobus, also extrem hoffnungslos. Bischof Gregor hatte, da er die Gallacher Stiftsverhältnisse sehr genau kannte, eben aus diesem Grund diese Zeit der Ankunft gewählt. Er kannte auch Jacobus und dessen Gewissensnöte, so daß er ihm gefühlvoll die Hand mit dem Ring zum Kuß hinstreckte. Der Custos ergriff, fast zu sehr zupackend, die Hand, fiel auf die Knie und küßte den Ring. Gregor seinerseits sah väterlich-mild auf seinen Türöffner, umfaßte die ihn haltende Hand mit bestimmtem Druck und zog anschließend den Custos von treuen Gnaden hoch, klopfte ihm auf die Schulter und hieß ihn, einen Wein aus des Kellers Schätzen zu holen. Gerne tat ihm Jacobus den Gefallen und eilte dienstfertig fort. In der Zwischenzeit, so meinte er, könnte er sich überlegen, was er dem Bischof zu sagen gedachte. Als erstes, so nahm er sich vor, würde er ihn seines Treueverhältnisses versichern und ihm - zum wievielten Male wohl? - klar machen, daß er trotz aller Intrigen mit den Handlungen des Abts solidarisch sei, sich niemals mit den intriganten Patres, auch wenn er manchmal in diese Richtung bearbeitet worden sei, habe anfreunden können. Und ab und an wurden solche Strömungen allzu deutlich sichtbar, die entsprechenden Spannungen spürbar. Jacobus wurde sichtlich nervös; denn dies wußte der Gnädige Herr natürlich längst, da gab es nichts mehr zu soffeln.
Er realisierte, daß er zu trödeln begann, und beeilte sich, daß er zurückkam. Er traf den Bischof gedankenversunken, zum Fenster hinausstarrend, an. Fast wäre Jacobus versucht gewesen, an die Türe zu klopfen, um den Gnädigen Herrn nicht aus der Andacht zu reißen. Aber genau in diesem Moment sagte Gregor, fast wie selbstverständlich, doch einen Schalk in den Augen, der Custos solle nicht so patzig tun; er führe sich ja schier so auf wie ein resches Ding. Weil Jacobus nicht sonderlich viel mit diesen Worten anzufangen wußte, der exclusiven Wortwahl seines Dienstherrn nicht folgen konnte, dachte er, es müsse sich schon um etwas Besonderes handeln, fügte sich also mehr als gern.
„Und daß mir niemand etwas von meinem Besuch erfährt“, donnerte der gestrenge Herr. Jacobus war erneut erleichtert. Er brauchte also auch die Patres nicht in ihrer Andacht zu unterbrechen, auch den gefürchteten Pater Leo nicht zu rufen, keine außergewöhnlichen Unternehmungen anzubahnen, nur um den hohen Herrn zufriedenzustellen. Aber, so fragte sich der Custos, warum in aller Welt war dann der Gnädige Herr überhaupt hergekommen, wenn niemand etwas erfahren durfte? Wie er es drehte und wendete, er kam zu keinem Schluß; nichts wollte ihm einleuchten. Sonst hatte der hohe Besuch immer eine ganze Reihe von Begleitpersonen um sich geschart und legte großen Wert auf ein entsprechendes Protokoll. Aber eben kam er in aller Heimlichkeit, ohne nur jemanden bei sich zu haben. Irgendeine spezielle Absicht müßte demnach auszumachen sein. Jacobus hirnte gewaltig, kam aber zu keinem Resultat. Wenn er nur die Absicht durchschauen könnte. Es gelang ihm nicht. Und fragen konnte er den Gnädigen Herrn auch nicht. Möglicherweise, so tröstete sich Jacobus, ergäbe sich eine Lösung, wenn sie gemeinsam zur Gruft hinunterstiegen, um der aufgebahrten Leiche die - in diesem Fall - zweitletzte Ehre zu erweisen. Schließlich war anzunehmen, daß der Bischof deswegen gekommen war. Dennoch nagte es in des Custos Innern: warum kein offizieller Kondolenzbesuch? Wie alle übrigen Besucher? Er suchte hündisch den Augenkontakt. Dabei fing der Bischof von selbst zu reden an.
„Also, mein Sohn, wo liegt unser Patientchen?“
„Bei uns ist niemand krank“, vermeldete der getreue Custos und begriff sogleich, was der Bischof eigentlich gemeint hatte. „Gleich da vorne, wenn es dem Gnädigen Herrn beliebte, mir gütig folgen zu wollen.“
Gemächlichen Schrittes bewegte sich das ungleiche Paar zur Abtesgruft, um das Patientchen zu besichtigen. Jacobus, sichtlich erregt, ging voran, indem er mit der voluminösen Petroleumlampe leuchtete. Der Bischof, die Hände in den Ärmeln seines Ornats vergraben, dahinter, ein vieldeutiges Schmunzeln auf den Lippen. So synkopierten die beiden die Stufen zur Gruft hinunter. Kaum dort angekommen, stieß der Bischof einen sehr unkirchlichen Laut aus:
„Gopferdammich. Was ist denn dem eingefallen?“
Jacobus hüstelte verlegen und gab sich sehr erstaunt, derartige Wortlaute von den vermeintlich geheiligten Lippen zu vernehmen, sagte aber nichts, sondern versuchte, sich ein bißchen im Schatten zu halten, damit der Bischof sein Entsetzen nicht von seinen Zügen lesen könnte.
„Das geht natürlich nicht“, sinnierte der Oberhirte, „dieses Purpurmäntelchen muß runter, und zwar jetzt gleich.“
Und schon begann er, wie wild an der letzten Bekleidung des Verblichenen zu zurren, ohne daran zu denken, daß dies wegen der Leichenstarre kein leichtes Unterfangen war. Er forderte Jacobus auf, ihm zur Hand zu gehen; doch vorerst solle er eine entsprechende schwarze Soutane holen, wie sich dies auch gehöre. Jacobus nickte gehorsam und eilte nach einem ausgiebigen Kratzfuß von dannen.
„Ich wußte es, daß er die Verwegenheit hätte, sich so zu benehmen. Aber wer hat ihn eigentlich eingekleidet?“ fragte der Bischof, als der Custos mit dem verlangten Kleidungsstück wiederkehrte.
„Der Leichenwäscher, mit Verlaub“, antwortete Jacobus.
„Aber der sollte doch die Regeln kennen.“
„Auf ausdrückliches Geheiß des Abts, wie mir schien“, versuchte der Custos eine Rechtfertigung.
„Abah. So ein Bocksmist. Hier, zieh an diesem Ärmel und halt ihn ein wenig am Hals hoch.“
Die beiden werkten, und beinahe hätte Gregor die Petrollampe umgeworfen. Und dann hatten sie den ersten Teil erreicht: Abt Conrad lag nackt da, nur noch in Socken. Der Bischof machte ein merkwürdiges Gesicht, als er sich die Bescherung ansah.
„Und daß du mir keiner Menschenseele etwas davon sagst, verstanden; keinem der Patres, und sonst schon gar niemandem. Das wäre ja gräßlich, wenn dies jemand erführe.“
„Sie können sich selbstredend auf mich verlassen“, meinte der Custos, der erleichtert war, als er diese Worte vernahm; denn es wäre ihm schwer gefallen, die richtigen Worte zu finden. Dabei klopfte ihm der Gnädige Herr wohlwollend auf die Schulter und ließ gar seine Hand den Rücken hinuntergleiten. Den Custos durchfuhr ein wohliges Gefühl, während er sich überlegte, was diejenigen sagen würden, die den Abt bereits im roten Ornat gesehen hatten. Sie würden den Wechsel selbstverständlich sofort bemerken. Sollte er einfach so tun, als wüßte er von nichts? Vielleicht konnte ihm der Gnädige Herr einen Rat geben, wenn die Arbeit beendigt sein sollte.
„Wenn dich jemand fragt, warum der Abt sein Kleid gewechselt hat, sagst du einfach nichts, zuckst mit den Achseln, fertig. Das kann schließlich alles heißen. Klar?“
Jacobus nickte dankbar. Mittlerweile hatten sie das Umkleideverfahren beendet. Abt Conrad I. lag wieder mit gefalteten Händen (am entsprechenden Ort natürlich) da, nicht mehr im gleichen Glanz, aber nicht minder friedlich. Nur der Mund, so schien es Jacobus jedenfalls, schien zu schmollen.
„So, jetzt haben wir unser Glas Wein verdient.“
Der Bischof prüfte die Flasche, die der Custos aus dem Keller geholt hatte und rümpfte die Nase.
„Aber doch nicht vom gewöhnlichen; den kann ich morgen wieder trinken. Hol einen andern. Du weißt schon.“
„Sie kommen morgen wieder?“
„Natürlich. Ich muß unserem Patientchen auch einmal eine offizielle Visite abstatten.“
„Schön.“
„Ja. Wenigstens kann ich morgen beruhigt kommen. Und ich weiß jetzt auch, warum unser Früchtchen die Hände grad da hat falten lassen.“
Der Custos machte, daß er in die Stiftskellerei kam; denn er kannte aus früheren Besuchen die Bedürfnisse des Gnädigen Herrn, ließ also den Meßwein links und den gewöhnlichen rechts liegen, ging geradeaus, kramte einen langen Schlüssel aus der inneren Westentasche und schloß die Gittertür zum separaten Weinkellerabteil auf. Er war der einzige, der Zutritt zu diesem Abteil hatte, durfte es auch nur auf Geheiß des jeweiligen Abts oder eben des Bischofs betreten, wenn eine offensichtliche Ausnahmesituation herrschte, und diese schien Jacobus an diesem Tag offensichtlich gegeben. Während er einen Grand cru aus dem Hause Rothschild, Jahrgang 47, hervorzauberte, überfiel ihn plötzlich eine Art Angst vor den beiden kommenden Tagen. Wenn also der Bischof bereits anderntags seine offizielle Visite abstattete, kamen sicher viele weitere illustre Gäste, Prälaten und sonstige, was jeweils eine rechte Aufregung im Stift zur Folge hatte. Von überall her bekam der Custos Anweisungen. Deshalb war es besonders schwer, abzuschätzen, wer von allen Auftraggebern den jeweiligen Vorrang hatte, und schon oft hatte er sich geirrt, was manchmal zu peinlichen Umständen geführt hatte. Als er das Weinkellerabteil sorgfältig zusperrte, beruhigte er sich langsam und erfreute sich an dem Gedanken, daß er gleich Gelegenheit haben würde, einen edlen Tropfen Weines mit dem Gnädigen Herrn zu trinken. Zu credenzen, wie der Bischof sicher gleich betonen würde. Als er in die Gruft zurückkam, war Gregor eben dabei, in einer Ecke des Sarkophags die Palmetten, Girlanden, Löwenkopfhandhaben und das Knorpelwerk einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Dabei hatte er eine Nickelbrille auf, was ihm ein noch ehrwürdigeres Aussehen verlieh. Der Custos blieb stehen und sah ihn eine Weile bewundernd an. Er erschrak fast, als ihn der Bischof anfragte, ob er den Wein schon geöffnet habe.
„Nein“, versetzte Jacobus, „aber ich werde es sofort tun.“
„Gut so, mein Sohn“, ertönte es väterlich. „Und wo bekomme ich ihn serviert? Doch nicht hier, an diesem ungastlichen Ort?“
„Wenn Euer Gnaden mit meiner bescheidenen Zelle vorlieb nehmen wollen, so ist's mir recht.“
„Also gut, da wird mich auch niemand von den Patres bemerken; die werden eh ihre Andacht beenden. Ganz gut. Gehen wir.“
Der Custos nahm die Petrollampe vom Boden und folgte dem Bischof, sorgsam die Tür, als sie die Treppe hochgestiegen waren, schließend.
„Und du erzählst mir derweil, wie Conrad das Zeitliche gesegnet hat. Und, bitte, nicht die offizielle Version, die kenne ich bereits.“
„Es gibt nicht viel zu erzählen“, setzte der Custos an, sichtlich bemüht, Zeit zu gewinnen. „Er fühlte sich schon lange krank, weil er von den andern Patres bis auf wenige Ausnahmen immer mehr geschnitten und in die Isolation gedrängt wurde. Zunehmendes Mißtrauen war auch festzustellen, und die einzelnen Patres, die ihn nicht so recht mochten, begannen seine Convente zu boykottieren. Und offensichtlich hatten sie ihren Spaß daran.“
„Wie ging dies?“
„Ich war ja nie dabei, kann also nur berichten, was ich vom Hörensagen her weiß. Gnädiger Herr, ich bitte Sie, dies zu berücksichtigen. Offensichtlich müssen sie sich untereinander abgesprochen und etwelche Anträge gestellt haben. Das muß offenbar soweit gegangen sein, daß einmal an einem Convent sämtliche Tractanden mit Nichteintretensanträgen zurückgewiesen worden sind. Es gab in der Folge auch eigentliche Mißtrauensvoten, die er - im nachhinein sei's geklagt - nicht zu verkraften imstande schien. Und während des letzten Convents soll er mittendrin bleich geworden sein, habe sich noch kurz aufgebäumt und sei dann mit einem Krachen auf den Tisch gefallen, zum Entsetzen aller, die es mitansehen mußten. Ja, und dann habe ich sofort den Arzt, Dr. Zweifel, gerufen, aber dieser konnte auch nur noch feststellen: Exitus. Da haben wir auch gleich Sie benachrichtigt.“
„Ich wundere mich nur, warum er mir nie davon erzählt hat. Prost dem Herrn.“
„Sehr zum Wohl, Euer Gnaden. Ich kann es mir schon vorstellen. Man hat allseits gemunkelt, er habe ein schlechtes Gewissen, von wegen Amtsführung und so.“
„Hm.“
„Und ohne letzte Ölung, einfach weg.“
„Naja.“
************************
ORATIO: Genuflectitur ad hoc verbum
(Bei diesem Wort beugt man die Knie)
************************
Der Custos war schlecht aufgestanden; denn der Wein war ihm spürbar in den Kopf gestiegen. Zudem war es bereits nach Mitternacht gewesen, als der Bischof aufgebrochen war, einige Stunden später also, als Jacobus sonst zu Bett zu gehen pflegte. Und an diesem Morgen wurde eine Menge Leute erwartet, weshalb er zeitig bereit sein mußte; denn er konnte es sich keinesfalls leisten, die Türe einfach geschlossen zu halten, wenn der erste Kondolenzbesuch kam. Es war auch nicht klar, wieweit es in den Abend dauern würde. Immerhin nahm er sich vor, dafür an diesem Abend früh ins Bett zu gehen, damit er den folgenden Tag nicht mit derselben Hypothek angehen müsse. Denn die feierliche Beisetzung erlaubte weder Kater noch Kopfweh. Doch spätestens beim Leichenmahl würde er sich wieder sinnvoll betrinken können. Tatsächlich hatte er sich nicht verrechnet: Noch während er sich den blauen Übermantel anzog, schlug die Glocke an. Jacobus zuckte leicht zusammen. Es war politischer Besuch: eine Abgeordnete des Bundesparlaments zusammen mit ihrem Ehemann, einem ewig jammernden Apotheker, der dauernd klagte, daß es ihm finanziell und familiär schlecht gehe. Das Ehepaar war mit Abt Conrad befreundet gewesen, dankbare Leute für ihn, weil sie ihm immer zuhörten - im Gegensatz zu andern Leuten -, wenn er über seine Stiftsinsassen abfällig dahergeredet hatte, was meistens der Fall gewesen war, da er sonst keinen Gesprächsstoff gekannt hatte. Und dieses Thema war für ihn in der Tat unerschöpflich gewesen. Kaum waren die beiden eingetreten, begann der Apotheker zu jammern. Jetzt, da Abt Conrad nicht mehr unter den Lebenden weile, gehe es ihm noch schlechter, schließlich sei man oft zusammen gewesen. Und all diese schönen Stunden gehörten nun der Vergangenheit an. Denn der Convent würde wohl, wenn man die Insassen des Stifts und deren Situation nur ein bißchen kenne, kaum einen Nachfolger wählen, der auf der Linie des Vorgängers wäre. So vereinsame man halt immer mehr. Eine Tatsache, der er sich täglich bewußter werde. Wo dies wohl noch enden würde. Jacobus nickte eifrig, obwohl ihn der Kopf dabei schmerzte, und stimmte ab und an auch verbal zu. Und er, Jacobus, hoffte schließlich auf ein Trinkgeld, obwohl er insgeheim ahnte, daß er auch diesmal leer ausgehen würde, wenn Herr und Frau Kellenberger wieder gingen. Doch der Custos war genügsam, mochte nicht jammern. Wenn's was gab für sein Sparbuch für die alten Tage, war es ihm recht, und wenn's halt nichts gab, war es ihm billig. Er führte die beiden den Gang entlang, schloß die Türe auf. Die Treppe hinunter ging er voran zur Gruft, wo sie Conrad am Vorabend umgezogen hatten. Wie sie unten angekommen waren, wußte er nicht recht, was er sagen sollte. Also schwieg er lieber, sagte einfach immer ja, wo er es für gut befand. Dies, so hatte er im Verlauf der Jahrzehnte gelernt, war oft die beste Diskussion; den andern reden lassen und ihm zustimmen, das gab keinen Ärger, keinen Streit, sondern schuf Freunde.
„Eine schöne Gruft“, seufzte Frau Rat und wischte sich verstohlen eine imaginäre Träne aus dem Augenwinkel.
„Dies wünschte ich mir auch, wenn ich's nur vermöchte“, stöhnte ihr Anhängsel.
„Ach, du mit deinen Pillen könntest dir eine größere Gruft leisten. Und einen noch gewaltigeren Sarkophag dazu. Oder einen doppelten, damit's für mich auch reicht. Aber unsereiner kommt eben niemals in eine solche Gruft, da muß man schon Abt gewesen sein.“
„Er hatte es auch nicht immer leicht.“
„Habe ich das Gegenteil behauptet?“
„Ich meine ja nur; Gruft allein macht auch nicht glücklich.“
Der Custos, dem die ganze Unterhaltung höchst peinlich war, versuchte abzulenken, indem er auf die Insignien, das Kreuz mit Corpus und Maria mit den sieben Schwertern hinwies.
„Und schauen Sie, werte Frau Rat, werter Herr Apotheker, wie das Décorensemble durch die Inschriftkartuschen, Totenköpfe, geflügelten Engelsköpfe und Löwenkopfhandhaben vollendet wird. Und hier, an dieser Ecke, ganz besonders schön die Auferweckung des Lazarus und die Auferstehung Christi, umgeben von den Totenköpfen, aus deren Augenhöhlen Schlangen hervorkriechen. Und auf dieser Seite“ - der Custos war im Element – „beginnen die Totenköpfe, versehen mit Fledermausflügeln, ein besonders hübscher allegorischer Hinweis auf die Ewigkeit übrigens, makabre Zwiesprache mit dem Beschauer.“
Während Frau Rat leicht erschauerte, redete der Custos weiter und schwelgte auch in den bereits beschriebenen Einzelheiten, die sich Abt Conrad hatte anfertigen lassen. Doch lenkte die Frau Rat bald ab, da sie sich auch dem Abt zuwenden wollte.
„Hat er nicht ein friedliches Gesicht?“ fragte sie ihren Mann.
„Mir kommt es ein wenig schmollend vor.“
„Ach was, das redest du dir ein, weil du das Gefühl hast, er sei mit sich und der Welt unglücklich gewesen.“
„Kann sein.“
„Natürlich ist es so.“
Der Apotheker schwieg, dachte aber bei sich: blöde Gurke, Edelziege, verdammte. Dann errötete er leicht, weil er sich, bei einem Toten stehend, ertappt fühlte. Wer weiß, dachte er, vielleicht kann sein Geist, wenn er noch im Raum weilt, meine Gedanken lesen. Und Tote bleiben bekanntlich oft in den Räumen, wo man sie besucht, damit sie die Reaktionen der Lebenden testen können, ob das Bild, das man von jemandem hatte, auch mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Unsicher täppelte er von einem Fuß auf den andern. Sie drängte hinaus, wollte gehen; sie kämen ohnehin am folgenden Tag zur Beisetzung. Ob es auch etwas Rechtes zum Essen gebe. Der Mann stupfte sie.
„Waren Sie je enttäuscht mit dem Essen im Stift, gnädige Frau?“
„Eigentlich nicht, aber es waren auch nicht dieselben Anlässe.“
„Auch der Bischof wird anwesend sein, da können wir uns doch nichts Schäbiges leisten.“
„Ist auch wieder wahr.“
In diesem Moment läutete es wieder, und der Custos war froh, daß er die beiden elegant loswerden konnte. Er ging wieder voraus; denn so konnte er die Türe öffnen. Er hoffte jeweils, durch diese Haltung eher zu einem Trinkgeld zu kommen; denn er hatte die devote Türsteherhaltung einmal bei einem Museumsführer beobachtet und gefunden, daß man ohne schlechtes Gewissen nicht an ihm vorbeikönne, auch wenn er nicht gerade die hohle Hand zu machen pflegte. Aber seine Hoffnung wurde auch diesmal enttäuscht; der Apotheker jammerte noch im Hinausgehen von den schlechten Zeiten. Und Frau Rat hielt Jacobus nur die Hand zum Abschied hin, was ihr umso leichter fiel, als der neue Besuch bereits zur Türe hineindrängte. Am Mittag hängte Jacobus ein Schild vor die Türe, daß er während einer Stunde nicht zu sprechen sei; denn er wollte sich noch ein wenig erholen, bis die hohen bischöflichen Gäste erschienen. So konnte er in aller Ruhe sein bescheidenes Mittagsmahl verzehren und seinen Kopf ein wenig auslüften. Während er sich ins Refectorium begab, stellte er insgeheim mit Erstaunen fest, daß von den Patres noch nicht sehr viele ihre obligaten Kondolenzbesuche abgestattet hatten. Er schaute zum Tisch hin, wo die Patres saßen, um abzuschätzen, wer von ihnen schon gekommen war, aber der Tisch war bereits leer, und ein Schüler räumte eben das gebrauchte Geschirr weg. Mürrisch würgte er die paar Bissen hinunter, kam sich gehetzt vor und wollte sich dennoch Zeit nehmen. Aber er fand keine innere Ruhe, weshalb er den Teller halbvoll wieder auf den Tresen stellte und sich hinter seinen Tisch zurückbegab. Als er das Refectorium verließ, stieß er beinahe mit Pater Hieronymus zusammen, der sich sofort entschuldigte.
„Keine Ursache“, entgegnete Jacobus, „ganz meinerseits.“
Hieronymus versicherte den Custos noch einmal, daß er es keinesfalls absichtlich getan habe, aber Jacobus hörte, wie die Glocke anschlug, was ihn jeder weiteren Diskussion enthob. Wenn jemand trotz seines Anschlags läutete, konnte es nur der offizielle Bischofsbesuch sein, und der Custos eilte dienstbeflissen zur Türe, um sie gemessen aufzureißen. Er hatte sich nicht getäuscht und blickte, wie er die Eichentüre aufschloß und die Treppe hinunterschaute, auf eine lange Colonne von Trauergästen, die sich fast wie in einem Convoi aufgestellt hatten, an der Spitze der Oberadministrator, gefolgt von zwei Prälaten. Dann unter einem kleinen Reisebaldachin, dessen Purpur bereits etwas verschossen war, der Gnädige Herr höchstderoselbst, diesmal in vollem Ornat, pompös, wie es sich gehörte. Im Anschluß daran verlor sich die unüberschaubare Schar der Zugewandten, der Freunde des Hauses, der Magnifizenzen und Mitläufer. Jacobus machte, der Situation entsprechend, gleich drei Kratzfüße hintereinander; denn, so glaubte er, lieber einen zu viel als einen zu wenig. Die Colonne setzte sich langsam und stockend in Bewegung. Plötzlich kam Jacobus in Gewissensnöte, weil er nicht wußte, ob er vorausgehen sollte oder ob er an der Türe verbleiben müßte, um alle einzeln zu begrüßen. Und wiederum, wie schon am Abend zuvor, war der Bischof so liebenswürdig, ihm die Entscheidung gleich abzunehmen. Fast befehlend, rief er unter dem Baldachin hervor, Jacobus möge nur vorausgehen, damit alle den Weg fänden und sich mählich in der Gruft einrichten könnten, sie seien eh recht viel an der Zahl, und so müsse wohl jemand darauf achten, daß die Petrollampe nicht umfiele. Der Custos fand es außerordentlich nett, daß der Bischof sich dieses Details vom Vorabend erinnerte, und machte sich gerne auf den Weg, was ihm auch noch leichter fiel, als Pater Leo, der Pater Prior, damit Conrads Stellvertreter, herbeieilte, um die illustren Gäste im Namen des Hauses zu begrüßen. So ergab sich eins zum andern, und die Meute suchte sich den Weg durch Gang, Treppe und Finsternis. Der Custos war ob des vielfältigen Gemurmels stark beeindruckt, fast zu schnell und zu eifrig in seinem Gang; denn es erwies sich, daß der Reisebaldachin des Bischofs kaum durch die Türe ging, ohne daß beide Flügel geöffnet würden. Allerdings hätte es zwecks Öffnung eines Schlüssels bedurft, doch der Custos konnte nicht mehr zurück, weshalb der Baldachin eingewickelt und in der Gruft neu entfaltet werden mußte, was zu erheblichen Bedrängungen und Verknäuelungen führte, die sich aber offensichtlich entwickeln ließen, so daß am Ende nur einige Chorknaben keinen Einlaß in die Gruft erhielten. Und diese waren es eh nicht leid, konnten sie doch umso ungestörter ihren Pennälerwitzchen nachleben, was ihnen höchstens die hintere Reihe vergällte, sofern sie sich nicht wider Erwarten daran ergötzte. Trotz aller Abgegriffenheit des Rosenkranzes animierten die Kügelchen, wenn man sie durch die Finger gleiten ließ, zu mancherlei Gedanken, wes Gestalt diese auch sein mochten.
Als sich die Leute gebührend umgesehen, ihre Füße in eine bestimmte Ordnung gebracht hatten und aus dem Schnaufen herausgekommen waren, setzte der Bischof an, mit sonorer Stimme das Miserere zu intonieren. Danach hielt er kurze Andacht, in der er die Verdienste des Verblichenen antönte, zugleich aber betonte, es sei am folgenden Tag ausführlicher darauf zurückzukommen. Pater Leo trat bei diesen Worten von einem Fuß auf den andern, griff zweimal in die Soutanentasche, um sich eine Cigarette zu angeln, und erinnerte sich immer noch rechtzeitig daran, daß es weder Zeit noch Ort wäre, sich einen Glimmstengel anzuzünden. Eben führte Gregor aus, daß der Silberbecher mit dem Herzen des Abts bereits an anderer Stelle feierlich deponiert (wie scheußlich sich dieser Ausdruck in diesem Zusammenhang ausmachte) worden sei; der Kupferkessel mit den Eingeweiden hingegen noch an geeigneter Stätte, so hoffe er, Ruhe finden möge. Einige der Zuhörer waren bei diesen Worten hellhörig geworden. So konnte doch ein Kondolenzbesuch offiziellsten Charakters nicht angegangen werden. Aber es wagte natürlich niemand, etwas zu sagen, geschweige denn, in irgendeiner Form zu protestieren. Einige der sensibleren Leute merkten aber, daß offensichtlich nicht alles in bester Ordnung schien, weshalb männiglich gespannt war, wie die Umstände gedeihen würden. Immerhin, so überlegten die Sensationslüsternen, gäbe es keine der gewöhnlichen Beisetzungen mit dem routinierten Zeremoniell. Sogar die Ministranten waren für diesmal ruhig geworden, um wenigstens am Rande etwas mitzubekommen. Es hatte sie schon merkwürdig berührt, daß außer Pater Leo niemand von den Patres an der offiziellen Kondolenz teilnahm. Lag eine bestimmte Absicht dahinter? Oder - viel spannender - hatten sie nicht kommen dürfen? Ein gewitzter Primaner glaubte gar zu wissen, daß es so etwas Ähnliches wie eine Palastrevolution geben könnte. Grausam waren auch die Gerüchte, daß es - bei aller Zurückhaltung in der Gruft - Dinge gäbe, von denen niemand glaubte, daß sie existierten. Und als jemand hinter vorgehaltener Hand raunte, es sei etwas faul im Stift Gallach, waren einzelne Kicherversuche nicht zu überhören. Aber auch der Custos war betreten, er realisierte, daß Dinge im Tun waren, die er in keiner Weise mehr überblickte und die auch mit seinem Brummschädel nicht in Zusammenhang sein konnten. Immerhin, vermerkte er mit Stolz, war der Gnädige Herr in bester Verfassung. Es konnte also nicht der heiße Jahrgang 47 des edlen Traubensafts gewesen sein, der seine Sinne verwirrte.
„Ich bitte jetzt jeden der Anwesenden, dem Verstorbenen im Vorbeigang eine entsprechende Ehre zu erweisen.“
Hier ebenfalls eine solche Anspielung. Oder schien dies überinterpretiert? Der Custos hatte Mühe, dem ganzen Spiel zu folgen, weil er geglaubt hatte, dem Bischof eine Primärinformation geliefert zu haben. Es schien doch, als habe der Gnädige Herr das erste Mal etwas Derartiges vernommen. Hatte ihm Gregor eine Komödie vorgespielt? War er deswegen zuerst allein hergekommen? Jacobus fand, daß dies eine mögliche Erklärung hätte sein können, doch wollte er seinen Kopf nicht weiter über Gebühr belasten. Offensichtlich waren mehr Dinge vorgefallen, als es die Schulweisheit preisgab. Es gab Bewegung in die Gruft, das Gemurmel setzte wieder stärker ein, und der beißende Geruch des Weihrauchs staute sich im engen Raum, drückte von der Flachkuppel herab und zog an den Nasen der Pilger vorbei. Einige niesten. Der Zug schien sich rückwärts zu bewegen, obwohl einige den Sarkophag noch gerne kommentiert hätten. Jetzt fiel es Jacobus ganz penetrant ein, daß etwas sehr Wesentliches einer solchen Zeremonie, eines solchen Rituals fehlte. Nein, das war doch am Rande des Skandals. Merkte denn niemand von den Anwesenden etwas? Es hatte keine Kerzen.
Das gab es nicht. Ein Gruftbesuch zur Kondolenz mit den üblichen protokollarischen Ehrwürdigkeiten. Aber keine Kerzen.
Und die Vesperkerzen hatte er aus zeitlichen Gründen noch nicht anzünden können. Jacobus wurde fast schwindlig, und er hätte sich gerne einem der Patres mitgeteilt, mit denen er ein Vertrauensverhältnis pflegte. Zum Beispiel Pater Christian, dem sympathischen Geographen, der immer aufgelegt war, Sprüche zu machen. Zugegeben, er war dem Abt hörig gewesen, genoß den Ruf, absolute Langeweile im Unterricht zu verbreiten. Aber dennoch: Pater Christian hätte er sich gerne mitgeteilt. Aber es war außer Pater Leo niemand von den Patres da. Und auch keine Kerzen.
Der Zug nach oben stockte, und Jacobus, der naturgemäß am Ende, ganz zuhinterst war, wußte nicht, was er tun sollte, wußte nicht, was los war, weshalb er vor sich hinmurmelte:
„Wenn das nur gut kommt.“
„Was meinst du damit?“ fragte der zweite Prälat, ein dicklicher Herr, der, das fiel dem Custos als erstem auf, sehr breite Finger hatte, deren Nägel er überall angenagt hatte, wo er mit seinem Mund nur hinkam.
„Ich meinte nur. Nichts Besonderes.“
„Aber etwas muß dich doch bewogen haben, diesen Satz zu äußern.“
„Ich weiß nicht“, antwortete Jacobus einsilbig; denn er wollte sich das Vertrauen, das er beim Bischof zu haben glaubte, nicht verscherzen.
„Ist es dein erstes Begräbnis?“
„Wieso? Ich lebe ja noch.“
„Ach so, ja.“
Der Prälat begann, einen Anflug eines schallenden Gelächters zu imitieren, nahm aber auch dieses sofort zurück.
„In Anbetracht der Dinge“, kommentierte er vielsagend.
Dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung, und der Custos wurde abgedrängt, so daß er - er empfand es irgendwie ungerecht und war doch froh darüber - sich nicht mehr weiter über diese heikle Angelegenheit unterhalten mußte. Immerhin ertönte jetzt der befreiende Ruf des Bischofs:
„Auf ins Refectorium. Tempus fressandi.“
Auch diese Worte waren nicht gerade dazu angetan, des Custos’ Stimmung zu verbessern. Immerhin lag in der mittleren Gruft ein Toter, der darauf harrte, die erlösende Beisetzung zu erhalten, damit er, zusammen mit den andern Gruftinsassen, auf Erlösung hoffen konnte. Ein aufatmendes Murmeln ging durch die Reihen. Jacobus drängte sich durch die Leute und schloß die dem Eingang gegenüberliegende große Eichentüre auf, die den Blick in den unteren Kreuzgang freigab. Mit dem Öffnen machte sich ein Schwall von Küchengeruch bemerkbar, der einige Nasen in leichtes Schwingen versetzte. Obwohl sich alle einredeten, daß es erst am folgenden Tag zum lukullischen Mahl käme, glaubten sie sich in der Sicherheit, daß in diesem Stift auch eine leichte Mahlzeit etwas Besonderes bedeutete. Als der letzte des Zugs die Eichentüre passiert hatte, schloß der Custos sorgfältig ab und seufzte, weil er nicht dabei sei konnte, sondern weiterhin die Türe hüten mußte. Es stimmte ihn auch traurig, daß keiner der Herren es für nötig gefunden hatte, ihn mit einem Trinkgeld zu beehren; wenn sie sich aber schon so abfällig benahmen, war wohl auch nichts anderes zu erwarten gewesen. Bald waren die Stimmen verhallt, und er war wieder sich selbst überlassen. Als er es sich hinter seinem Holztischchen bequem gemacht hatte und niemand Einlaß begehrte, ließ er im Geiste die Patresbesuche noch einmal Revue passieren. Wer war dagewesen? Sicher einmal Pater Christian, er war der erste gewesen, er war immer der erste, fast überkorrekt. Dann noch Pater Leo (logo, bei ihm als Pater Prior war Zwang) und... Und? Ja, und Pater Franz. Doch, genau. Dieser widerliche Altphilologe mit den schweinsäugernen Stecknadelknöpfen. Natürlich. Aber war dies auch schon alles? Und warum ausgerechnet Pater Franz? Nein, Pater Meinrad, der Organist und Pianist. Aber das war doch, ja, unglaublich war das; mehr noch, Unanstand, Verletzung der primitivsten Anstands- und Anstaltsregeln. Auch einem, den man nicht mochte, tat man das nicht an. Diese Bestattung konnte nichts Gutes verheißen. Alle Zeichen wiesen darauf hin, daß etwas in der Luft lag. Und was kam erst nachher? Würde es unter dem Nachfolger würdiger zu und her gehen? Jacobus zweifelte daran und seufzte nochmals ganz tief.
************************
LECTIO: Ecce homo te absolvo
(Siehe Mensch, ich erteile dir Absolution)
************************
Abt Conrad hätte, wenn er's noch gekonnt hätte, auf ein reich befrachtetes Leben zurückblicken können. Vor Zweiunddreißig Jahren war er ins Stift Gallach eingetreten, nachdem er in Theologie promoviert hatte. Bereits nach einem Jahr hatte er die niedere Profeß, wiederum ein Jahr später die höhere abgelegt. Und zusammen mit Pater Leo, dem Pater Prior, hatte er die Zukunft geplant. Der damalige Abt, Ferdinand II., war ein ältlicher und auch kränklicher Mann gewesen, so daß es absehbar war, daß er bald einmal das Zeitliche segnen würde. Pater Conrad hatte sich nicht verrechnet: Ganze zwei Jahre machte es Ferdinand noch und röchelte dann aus dieser Welt, bescheiden, wie er gekommen war; denn er war kein bewegender Mensch gewesen, aber als Administrator hatte er offensichtlich seine Meriten. Conrad hatte sich schnell beim alten Herrn eingeschmeichelt und dessen Vertrauen gewonnen, so daß er auch andernorts in Kürze als dessen Nachfolger angesehen wurde. Es galt also nur noch, die Conpatres zu gewinnen. Da die meisten ebenfalls einer älteren Generation angehörten, war es relativ leicht, sich bei ihnen durch Sprüche und Heucheleien beliebt zu machen. Zugleich versprach er Leo das Amt seines Stellvertreters, sofern er ihm für seine Pläne Unterstützung zusichere, was dieser gern versprach, da er wegen fachlichen Ungenügens kaum aus eigenem Antrieb eine entsprechende Stellung erlangt hätte. Und da er glaubte, in dieser Stellung als Pater Prior auch eine gewisse Macht ausüben zu können, meinte er die Zusicherung mit der Unterstützung nicht einmal heuchlerisch. Auf diese Weise kamen die beiden also zu Amt und Würden, und es ging leidlich zu und her im Stift Gallach; doch die ältere Generation starb langsam aus, und es rückten jüngere, initiativere Leute nach, denen nicht alles gleichgültig war, die auch über eine eigenständige Meinung verfügten. Diese Tatsache führte schnell dazu, daß einige mit dem Abt und seinem Adlatus auf Collisionskurs gerieten, die Fronten verhärteten sich. Begonnen hatte der Conflikt mit einer Kleinigkeit: Ein Schüler hatte dem Abt einen Streich gespielt. Er hatte ihm von einer Schulreise, schön säuberlich in eine Tortenschachtel einer bekannten Gallacher Conditorei verpackt, einen Kuhfladen gesandt, enthaltend auch eine Gratulationskarte mit dem Inhalt, daß das Comitee zur Verbesserung des Stiftshumors Abt Conrad beglückwünsche, weil er gedenke, an der kommenden Abiturfeier die Fahnen des Stifts auf Halbmast zu setzen. Da Conrad I. deswegen stark verunsichert wurde, wollte er den Schüler kurzerhand vom Stift weisen. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, daß sich ein Pater für den Schüler einsetzen würde: Pater Rudolf. Dieser war allerdings in der Zwischenzeit aus dem Stift ausgetreten, relaïsiert also, verheiratet und Vater zweier eben erwachsener Töchter, die eine bildhübscher als die andere, mit tiefbraunen Augen. Der Abt hatte deswegen einen außerordentlichen Convent angesetzt, in dem in einem peinlichen Verlauf ein auf ein Kesseltreiben hinauslaufendes Ausschlußverfahren hätte stattfinden sollen. Es kam in der Folge zu heftigen Auseinandersetzungen, weil sich keine Mehrheit der Conventsmitglieder für das Anliegen finden ließ. Im Gegenteil, der Abt war sogar beschuldigt worden, amtswidrig gehandelt zu haben, indem er noch vor der Einberufung des Convents dem Schüler bereits die genannten Sanktionen angedroht hatte. Außerdem, so hatte Pater Rudolf herausbekommen, hatte es noch andere Unstimmigkeiten gegeben. So habe der Abt den Schüler beispielsweise in sein Büro zitiert, um ihm absurde Dinge vorzuhalten: Er habe den Schüler wiederholt außerhalb des Stifts angetroffen, wo er mit verschiedenen Mädchen geschmust habe. Viele Leute hätten deswegen bei ihm, Conrad, vorgesprochen und sich beschwert; ja sogar gesagt, sie würden diese Schweinereien, die da betrieben würden, dem Bischof hinterbringen. Dann habe er auch noch etwas von gerichtlichen Schritten gemurmelt, wegen Ehrverletzung und Verleumdung. Pater Rudolf hatte kein Blatt vor den Mund genommen und dies alles vor den Convent gebracht, doch der Abt stritt alles ab, gab vor, überhaupt nichts davon zu wissen. Darauf war es laut geworden: Rudolf hatte erwidert, genau dies sei der Skandal, daß Conrad immer in denselben Verhaltensmustern verweile: Erst brocke er sich und andern etwas ein, dann kämen Anschuldigungen wildester Art, völlig haltlos natürlich, absolut unbegründet und aus der Luft gegriffen. Anschließend allerdings wolle er von allem nichts mehr wissen, wolle nichts gesagt haben, so daß letztlich Aussage gegen Aussage stehe, da es nichts zu beweisen gebe. Im übrigen sei eine solche Handlung vonseiten der Stiftsleitung nicht nur ein Skandal, sondern eine ausgewachsene und grenzenlose Sauerei mindestens vierter Potenz. Dies waren zweifellos - und nicht nur wegen des immer lauteren Tons von Rudolf - harte Worte an die Adresse von Conrad, der diese Äußerungen naturgemäß als persönlichste Beleidigungen auffaßte und wie immer in derartigen Situationen reagierte: absolut ungeschickt. Er wurde ausfällig, indem er ins riesige Auditorium Maximum, wo seit seiner Amtsübernahme die Convente stattzufinden pflegten, rief, rote Äderchen an der Stirne, solche Ungehörigkeiten wolle er überhört haben. Und: Es sei wohl der Gipfel der Arroganz und zeuge nicht gerade von einem Übermaß an Intelligenz, wenn jemand, der immerhin über einen akademischen Titel verfüge, derartige Worte in einen solch geheiligten Raum fallenlasse. Das war Ausgangspunkt weiterer Querelen. Pater Hieronymus bemerkte bitterzynisch, wer so reagiere wie der Abt vorhin, sollte im Grunde genommen von der Curie ein Stipendium nach Rom erhalten; denn der Jesuitenorden dort wäre vermutlich froh um solche Brandredner, und das Stift Gallach wäre eine wackere Sorge los, könnte neu Bilanz ziehen, neue Wege suchen, die mit einer Mistkarre geführte Schule wieder vom Überdung zu befreien. Pater Christian rief sogleich zur Besonnenheit auf. Es gehe wohl nicht an, in diesen Räumen auf diese gehässige Art persönliche Controversen auszutragen. Die angeschlagenen Töne seien in jeder Beziehung unfair.
„Vielleicht, meine Herren (er sagte ausdrücklich Herren und nicht etwas anderes), wäre es ganz gut, wenn Sie Ihre Immissionen unter vier Augen submissest emittieren wollen.“
„Geschätzte Collegen“, nahm Pater Leo die Gelegenheit wahr, „es ist doch unsere Mission, den Menschen Frieden zu bringen.“
„Bonae voluntatis“, rief Pater Ernst dazwischen.
„Ich sehe nicht ein“, fuhr der Pater Prior unbeirrt fort, „wieso ausgerechnet dieser Convent Sendegefäß ist für diese Dreckwerferei. Es geht doch um etwas anderes. Besinnen wir uns in Gottes Namen. Ein Schüler hat sich gravierender Verfehlungen schuldig gemacht. Und da ist es mir“ - Leos Stimme nahm einen weinerlichen Ton an – „völlig unerklärlich, warum ausgerechnet unser lieber Abt Conrad im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen müsse.“
Als Leo sich dabei eine Cigarette anzünden wollte, rief Pater Anselm beherzt dazwischen:
„Wir haben schon genug Stunk. Nicht noch zusätzlichen Rauch, sondern mehr Sachlichkeit.“
Hechelnd fuhr Leo weiter, indem er verschämt den Stengel auszudrücken versuchte:
„Warum immer Conrad? Er versucht doch andauernd, die schwierige Situation, die sich aus der Constellation Bischof - Collegium und Schülerschaft ergibt, geradezu meisterhaft zu lösen.“
„Was heißt hier meisterhaft?“ ertönte ein böser Zwischenruf.
„Wer hat dies gesagt?“ griente Leo in die Runde.
Das Unwetter hatte unkontrollierbare Formen angenommen. Conrad hatte sich halb aus seinem Sessel erhoben und drückte, die Finger gespreizt auf den Tisch pressend, die Knöchel weiß. Pater Ekkehart, der bis anhin Arbeiten korrigiert hatte, sah von seinen Heften auf, schnob gewaltig und meinte:
„Jetzt ist es Zeit für einen Ordnungsantrag. Bitte, kommen wir auf unsere Geschäftsordnung zurück.“
Der Abt aber, wie immer in seinem seltsamen Demokratieverständnis, hatte nicht die Absicht, darauf einzugehen, sondern concertierte weiter.
„Also“, setzte er in seinem Plädoyer an, „ich habe stets...“
Weiter kam er nicht; denn Pater Franz war aufgestanden und declamierte mit lautstarker Stimme:
„Geschätzte Collegen. Ich dachte, ich hätte es mit Akademikern zu tun. Oder täusche ich mich tatsächlich? Ich würde es außerordentlich schätzen, wenn diese Salbaderei endlich ein Ende hätte. Und zwar sei sie eine von allen Seiten zu beendigende. Dixi.“
Es entstand eine peinliche Pause, in die Pater Ernst vernehmlich rülpste. Dann setzte Abt Conrad erneut an, offenbar gewillt, die Seiltänzerpose aufzugeben. Mit fast sentimental zu nennender Stimme zitterte er von seinem renaissancemaschinengeschnitzten Sessel:
„Ich glaube, es ist im Sinne aller hier Anwesenden, wenn wir zu unserem Besten einen andern Weg einzuschlagen versuchen. Ich erbitte deshalb Anträge, wie der Convent weitergehen soll, bitte constructiv.“
Es entstand langes Schweigen. Die Köpfe rauchten, niemand gestand sich ein, in dieser Atmosphäre emotionslos weiterfahren zu wollen, weil jeder befürchtete, eine einmal innegehabte Position aufgeben zu müssen. Und dennoch erwartete jedermann, daß etwas geschehen müßte; denn brach man zum jetzigen Zeitpunkt ab, war dies einem Eingeständnis gleichzusetzen, mangelnde Solidarität gegenüber dem früheren Pater Rudolf zu haben. Diskutierte man hingegen weiter, bestand die Gefahr, daß man entweder in dieselbe Klemme kam oder aber, daß Abt Conrad mit seinem zeitraubenden Geschwätz, das er zu führen imstande war, den Convent verlängerte, so daß erst recht alle aggressiv würden. Und das Geschwätz stand, ob man es wollte oder nicht, noch bevor; denn auf der Tractandenliste rangierte - neben dem wohl gestorbenen Tractandum - das ominös mit Mitteilungen überschriebene. Und diese Mitteilungen - wenn's nur welche gewesen wären! - konnten sowohl Zeit und Geduld strapazieren. Pater Hans seufzte vernehmlich. Er hatte jetzt schon Kopfweh. Er erinnerte sich, wie Abt Conrad einmal über eine halbe Stunde über die Immissionen, die die Kehrichtabfuhrleute verursachten, referiert hatte. Und er sinnierte wortschlangengedankenverloren weiter, auch als eine lautstarke Unterhaltung unter den Patres eingesetzt hatte. Zu allem Überfluß konnte in solchen Momenten Pater Anselm, der sonst an Conventen nichts verlauten ließ, aus sich herauskommen und ein längeres Votum über die Zusammenhänge der Verhaltensweisen des heutigen Menschen mit der Decadenz der Moral halten. Hatte er ausgeredet, konnte der Abt weiterfahren. Es war anzunehmen, daß Conrad solche Zwischenakttöne nicht einmal ungern hörte, weil sie die Convente noch weiter verzögerten, er also seine Leute länger um sich versammelt hielt. Dabei betonte er, daß es ihm überhaupt nichts ausmache, wenn nötig bis Mitternacht zu sitzen. Dies führte nicht nur zu gewöhnlichen Protestreaktionen vonseiten der Patres, sondern es konnte durchaus sein, daß in der linken hinteren Ecke, wo immer dieselben Patres saßen, Zwischenrufe hörbar wurden, lautstarke Zwischenrufe, oft an der Grenze des Anstands. Wurde es doch etwas zu laut, pflegte Abt Conrad, der vieles geflissentlich überhörte, die rhetorische Frage zu stellen:
„Darf ich noch einen kurzen Moment um Aufmerksamkeit bitten?“
Erfahrungsgemäß nützte dies nicht sehr viel, weshalb er einfach weiterfuhr und die Zeit zerredete. Diesmal ging es um die Vorteile eines Stundenplans mit vielen Zwischenstunden; denn kompakte Stundenpläne sagten dem Abt nicht zu, weil er die Patres allzu wenig um sich versammelt sah. Dabei hatte er nur das Gefühl, allein zu sein, von seinen Kindern - und Kinder waren alle, Schüler und Patres, incl. Pater Leo und incl. Hauspersonal - verlassen worden zu sein. A propos um ihn versammelt sein: Einmal im Jahr ergab sich eine äußerst günstige Situation. Alljährlich im Sommer fand der Sporttag statt; ein Anlaß, an dem alle ausnahmslos mitzumachen hatten. Alle waren auf den Beinen und an den Bällen, im Sägemehl oder auf der Aschenbahn; es gab - sozusagen fast - keinen Unterschied mehr zwischen den Rassen und den Klassen. Pater Hans zum Beispiel war an diesem Tag, sonst eher zurückhaltend in puncto Ausgelassenheit, am Wurststand voll im Saft. Er grillte und brachte saftige Steaks und deftige Sprüche an den Mann. Für die Schüler und die Patres bestand der jeweilige Höhepunkt im Fußballspiel Patres gegen Schülerauswahl. Dabei durften unter diesen Umständen natürlich nur die Schüler gewinnen, sich also einmal den Patres überlegen zeigen. Es war auch das einzige Mal im Jahr, daß die Schüler die Patres nicht in der Soutane zu sehen bekamen. Somit hatten alle Beteiligten ihre Gaudi; der eigentliche Höhepunkt aber für den Abt fand erst am Abend statt: Er durfte die Rangverkündigung vornehmen. Alle Patres und Schüler waren im Refectorium versammelt und umringten ihn, verzehrten ihre Brettljause und tranken Wein oder Tee, derweil der Abt mit großem Pathos die einzelnen herausragenden Leistungen würdigte und die Ränge verkündete. Selbstverständlich wurden die einzelnen Ergebnisse heftig beklatscht. Und dieses Applaudissement bezog der Abt auf sich: Das einzige Mal im Jahr, da ihm alle uneingeschränkt zujubelten, einhellig derselben Ansicht. Und er sonnte sich in diesem Applaus, verlas deshalb nicht nur die ersten, sondern auch die Ränge zwei bis vier. Auf diese Weise konnte dieses Nach-Spiel gut und gern anderthalb Stunden dauern.
„Fast wie eine Operndiva“, maulte Pater Emmanuel, der auf den Abt eifersüchtig war.
„Eher ein russischer Parteifunktionär“, entgegnete Pater Christian flüchtig.
Sonst war der Alltag für den Abt eher trist, im Grunde genommen war er in einer Stellung, die er sich immer anders vorgestellt hatte. Er hatte die Meinung vertreten, das Amt sei mit viel Würde und Ansehen verbunden. Aber darin hatte er sich gewaltig getäuscht; eigentlich war er nur Verwaltungsbeamter mit einigen Repräsentationspflichten. Diese waren aber eher ernster Natur, wenn er an wichtigen Tagen die Messe lesen mußte. Oder aber er wurde vom Bischof zu einer Sitzung zitiert, erhielt entsprechende Ordinationen und durfte - wenn überhaupt - an Congregationen teilnehmen, an denen es meistens noch ein schlechtes Essen gab, weil es sich in der Regel um Massenveranstaltungen handelte. Dies bejammerte der Abt auch oft genug, was ihm nur ein müdes Lächeln der andern - mit Ausnahme von Pater Leo vielleicht - einbrachte, möglicherweise begleitet vom maliziösen Spruch, schließlich habe er dieses Amt gesucht, er brauche also nicht zu jammern. Dies traf ihn ganz besonders, weil es der Wahrheit entsprach, und alles Wahre hörte er nicht gern. Es gab auch Zeiten, in denen er sich dem besonderen Gespött der Conpatres ausgesetzt fühlte. Etwa, wenn er nach einem der berüchtigten Convente, um seine Macht zu demonstrieren, Beschlüsse faßte und sie schriftlich, von Pater Leo mitunterzeichnet, via Anschlagbrett bekanntgab. Und Pater Andreas hielt in solchen Momenten nicht zurück, sondern erzählte lauthals irgendeinen Spruch oder Abtwitz, wofür er besonders bekannt war, so daß es oft hieß:
„Na, Andi, noch einen Abtwitz auf Lager?“
Er konnte schon gut träfe Sprüche machen, kannte aber sehr genau die Grenzen, obwohl er hemmungslos erzählte, auch wenn Conrad zugegen war und im Anschluß daran (nicht während) hochroten Kopfes den Raum verließ, die Türe laut zuknallend, was wiederum zu Gelächter Anlaß bot. Im Gegenteil: Andreas kannte auch hier das Prinzip der Inflation zu gut, auch wenn der schweinsstecknadelkopfäugige Pater Franz ihn foppte. Wenn Abt Conrad derart in Rage gebracht wurde, steuerte er schnurstracks auf sein Büro zu, sperrte die Türe auf und setzte sich, nachdem er sie wieder verriegelt hatte, hinter seinen gewichtigen Schreibtisch, den er sich aus einheimischem Kirschenholz hatte fertigen lassen, und nahm die Schülerkartei zur Hand, lehnte sich genüßlich zurück und besah sich Blatt um Blatt, sich die Photographie und die Personalien dazu einprägend; denn er wollte jeden Schüler bereits beim Eintritt ins Stift dem Namen nach kennen, auch wenn er ihn später nicht unterrichtete. Schließlich verfügte er über ein immenses Gedächtnis, behielt alle tadeligen und untadeligen Taten über Jahre im Kopf, um sie dem Betreffenden bei Gelegenheit vorzuwerfen, wenn auch manchmal etwas abgeändert oder verfälscht. Und solche Gelegenheiten ergaben sich genügend bei den Stiftungsfesten, Hochzeiten oder Beerdigungen. Böse Zungen behaupteten auch, er habe mit Pater Leo auch anders geartete Beziehungen gepflegt als die im Beamtenverhältnis includierten. Ging man Pater Andreas diesbezüglich an - er schien sonst wirklich der bestorientierte Mensch im Stift zu sein-, wich er aus, sinnierte höchstens:
„Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber nicht so.“
Und auf die weiterbohrende Frage:
„Und mit jungen Bürschlein? Mit Käfigfleisch?“
„Vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es aber so.“
Abt Conrad hatte dieses Geheimnis nun mit in die Gruft genommen, und von Pater Leo, dem Pater Prior, war sicher keine Antwort zu bekommen; denn verhielt es sich tatsächlich so, würde er nichts ausplaudern, und wenn es sich nicht so verhalten hatte, konnte er es nicht.
************************
GRADUALE: Pereat tristitia et benedicta omnia opera
(Die Traurigkeit soll untergehn, und gelobt seien alle Werke (des Herrn))
************************
Der Tag der feierlichen Beisetzung war angebrochen. Die Stiftsköche und - bäcker waren zeitig an die Arbeit gegangen; denn man erwartete eine Menge Gäste. Die Schüler waren ebenfalls angehalten worden, mit Hand anzulegen, hatten das Refectorium festlich geschmückt und die Tische gedeckt. Allerdings fanden nur Gäste und Patres darin Platz. Die Schüler erhielten ihr Leichenmahl im Auditorium maximum (weniger festlich geschmückt, dafür gemütlicher). Pater Jon, der Turnlehrer, war vom Bischof bestimmt worden, dort Aufsicht zu halten, worüber er ganz froh war; denn auf diese Weise war er unter seinesgleichen, wie er es nannte, und entging dem ganzen Popanz (ob er die Bedeutung dieses Worts wohl kannte?). Die zehn geschicktesten Schüler waren auserlesen, im Refectorium zu servieren. Um sechs Uhr morgens hielt Pater Otmar die Morgenandacht, die erstaunlich kurz ausfiel, obwohl er sonst dafür bekannt war, sehr lange Predigten zu halten. Bereits am Vortag war die Stiftskirche durch die Schüler hergerichtet worden, wobei Pater Ferdinand, der Zeichnen und Werken unterrichtete, einen neuen Leidensweg Christi entworfen, Limbaholztafeln zurechtgelaubsägelt und Raffaelfarben gemischt hatte. Diese hatte er süß grell auf die Tafeln gepinselt, mit alten schwarzen Rahmen versehen und anstelle der tradierten Bilder in der Kirche aufgehängt. Pater Ferdinand hatte das Flair, im richtigen Zeitpunkt äußerst schnell produzieren und geschäften zu können. Also fertigte er gleich auch Radierungen desselben Sujets an. Die Auflage von achtzig Stück pro Blatt gedachte er noch am selben Tag abzusetzen; denn die Gelegenheit war günstig wie selten; denn wer konnte es sich schon versagen, an einem derartigen Anlaß nein zu sagen. Zudem war der Preis so angesetzt, daß man kaum darauf verzichten konnte, ohne als schäbig angesehen zu werden. Das erste Radierungsexemplar schenkte er dem Gnädigen Herrn, das ölige Original dem Stift (ungern zwar, aber wohl oder übel). Über die Qualität der jeweiligen Produkte konnte man geteilter Meinung sein; hatten doch alle Figuren, die Ferdinand darstellte, dreieckige Köpfe, wobei er dies als symbolische Ausdruckskraft verstanden wissen wollte: Was denn der Begriff Trinität sonst zu bedeuten habe. Pater Hieronymus allerdings nannte es schlichtes Unvermögen. Außer dem Bischofsexemplar gab es keine Freiexemplare, obwohl ihn sogar dieses eine reute. Bemerkenswert war das letzte Bild des Leidenswegs: Christus hing völlig schief am Kreuz, von seinem rechten Auge sah man - vermutlich wegen des Dreieckskopfs auch symbolisch gemeint - nur die Hälfte. Statt der Dornenkrone hatte Pater Ferdinand eine Rondellinschrift Consumatum est