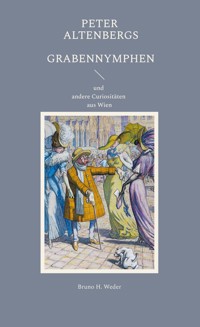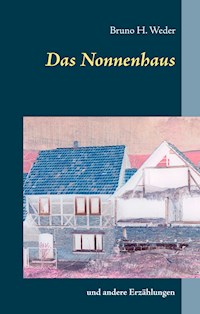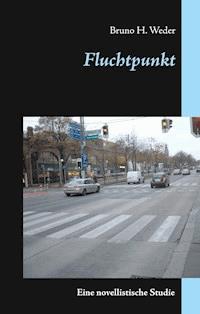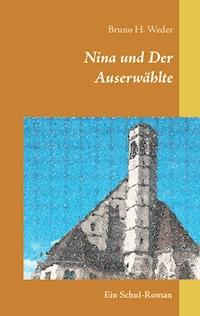Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Essay-Band vereinigt erstmals verschiedene Texte, die bisher nicht oder nur schwer zugänglich waren: vier Texte zu Gerold Späth, je einen zu Beat Brechbühl, Herbert Rosendorfer und Walter Vogt. Zudem unter dem Titel "Scholle und Fernweh" Gedanken zum Inseldasein der deutschschweizerischen Literatur, zum Thema Gewalt und zu Überlegungen zur Sprache nach der Wiedervereinigung in Deutschland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Auf der Suche nach Outopía oder Annäherung an Gerold Späth
Gründlinge, Grundeln, Greßlinge oder Neues vom Karpfenteich
Gerold Späths Sindbadland
Hin und zurück (Zu Gerold Späths Barbarswila)
Beat Brechbühl
Der Pfauenthron oder Schiller in Karlsbad (Herbert Rosendorfer Zum 70. Geburtstag)
Sprachkorsette
Gewalt in Geschichte und Gegenwart
Walter Vogt
Scholle und Fernweh – Gedanken zum Inseldasein der schweizerdeutschen Literatur
Biogramm
Auf der Suche nach Outopía oder Annäherung an Gerold Späth
Eine Skizze in neun Bildern
I.
Ein kalter, diesiger Tag, als wir in Kloten das Flugzeug bestiegen. Wir froren und schlotterten; bedauerten, nicht noch wärmere Kleider angezogen zu haben, waren froh, endlich die DC 9 der Alitalia besteigen zu können. Über Zürich dann, verärgert über einen geschäftstüchtigen Zigarrenraucher auf einem Nichtraucherplatz, genossen wir den letzten Blick über die noch schneebezogene Landschaft. Und ab in die Wolken. In Rom gelandet, staunten wir über den schönsten Frühlingstag; ein Hauch von Wärme empfing uns im Flughafen Fiumicino (welch ein Hohn: Er heißt «Leonardo da Vinci»!). Nachdem wir die lästigen, sich uns aufdrängenden «Taxifahrer» im Innern des Flughafens endlich los geworden waren, fuhren wir mit einem der gelben Fahrzeuge zum Hotel «La Residenza» mitten in die alte Ewigkeit (die heißen Rhythmen aus einer Disco vis-à-vis riefen einen Satz aus dem Brief in Erinnerung: »lch habe dem Portier gesagt, er solle Euch ein ruhiges Zimmer geben, aber römische Ruhe ist so eine Sache.«), ließen das Gepäck stehen und setzten uns, von einem wohligen Lüftlein umweht, unter die riesigen Pinien im Park der Villa Borghese, ließen die Zeit verstreichen bis Mittag, indem wir der balzenden Jugend zuschauten, die imaginären Klänge von Ottorino Respighis «Gli uccelli» und «Pini di Roma» im Ohr. Nach einem genußreichen Apéro in einem der sündhaft teuren Bistros an der Via Veneto (immer Wolfgang Koeppens Roman «Der Tod in Rom» dabei), den unversieglichen Menschenstrom an uns vorbeiziehen lassend, machten wir uns auf zur nahegelegenen Via Ludovisi und warteten vor dem herrlich großen Tor der Nummer 48. Es war ausgemacht, daß wir dort um 13 Uhr abgeholt würden.
Das Istituto Svizzero ist nicht nur wegen der bloßen Existenz ein gewaltiges Phänomen, sondern auch wegen der Lage (die durchaus auch bewegte Geschichte zu bieten hat). Als sich das Tor öffnete und Gerold Späth uns unter dem Torbogen begrüßte, um uns durch den von hohen Mauern umgebenen Park zu führen, war dies mein zweiter Zugang zum ideen- und listenreichen Schriftsteller aus Rapperswil.
II.
Der erste hatte sich eher zufällig ergeben: Ich hatte mich auf einer Fahrt von Bern nach Zürich befunden. Eine Vernissage-Rede, die ich am Vorabend, einem Samstag, im Schloß Gerzensee zur Eröffnung einer Bilderausstellung von Christian Fuhrer gehalten hatte, war der Grund meines Abstechers gewesen. Da sich der Abend reichlich in die frühen Morgenstunden ausgedehnt hatte und der junge Tag schlechtes Wetter brachte, war ich sehr spät aufgestanden, hatte erst nach einem Spaziergang im nahen Wald am Nachmittag die Rückreise angetreten. Um mich bei Konzentration halten zu können, hatte ich Radio DRS eingestellt. Offenbar war gerade Hörspielzeit. Den unmittelbaren Anfang hatte ich offensichtlich verpaßt, war somit mitten im Geschehen:
«. . . sagt der Sportfischer mit dem Schlamm am Schwimmer und sieht von oben herab ins Wasser vor der Ufermauer. Dort schwanken grüne Bierflaschen zwischen den Steinen. Seegras und Algenschlieren wellen, schlingern je nach Stärke und Geschwindigkeit der Motorboote, die den Damm unterfahren; manchmal ein Wasserskifahrer im Schlepp, der seine Künste zeigen will und über die Kielwellen schletzt. Das Bier im Wasser zwischen den Steinen bleibt lau. Die Sonnenwirbel kreisen hoch. Der See ist warm, blinkt silbrig im Licht.»
Ich war angetan von dieser Beschreibung. Erst ein paar Monate wohnte ich in Rüti, war von nördlicheren Gefilden der Schweiz in diese Gegend verschlagen worden, kannte mich noch nicht gut aus, und dennoch fühlte ich mich durch die Radioklänge in heimatlichen Gefilden. Die Entwicklung des Geschehens versetzte mich in einen zunehmenden Spannungszustand, so daß ich sogar meinen leichten Brummschädel vergaß. Dabei hatte ich bis zum Ende nicht die leiseste Idee, daß der Ort des Geschehens in unmittelbarer Nähe meines Wohnorts zu suchen war: Rapperswil. Ich dachte nur: Da hat ein Autor eine ungeheuer liebevolle Schilderung von Raum und Mensch getroffen; eine Schilderung, die einem unvoreingenommenen Hörer ein lebendiges Bild eines beliebigen Kleinstädtchens zu vermitteln wußte, so daß man sich unmittelbar zu Hause fühlen mußte. Ich konnte deshalb nur beistimmen, als es am Ende hieß: «Ein Städtlein, fast aus dem Bilderbuch; irgendwoher müssen sie kommen, die kleinen Städte in den Bilderbüchern.«
Damals hatte ich noch keine Ahnung gehabt von der Existenz des Schriftstellers Gerold Späth, hatte genügend zu tun mit der Plackerei des Brötchenverdienens und mit meinem Studienabschluß an der Universität Zürich, fühlte aber deutlich, daß ich, als die Absage die Identität an den Tag gebracht hatte, mehr von diesem Menschen lesen und auch wissen wollte. Gleich am nächsten Tag kaufte ich mir (ich schwänzte deswegen extra eine Vorlesung) ein dickes Buch, einen sogenannten Erstling, wie man mir in der Buchhandlung versicherte. Und gleich begann ich auch mit Lesen (und schwänzte deswegen noch eine zweite Vorlesung). Tatsächlich erlebte ich etwas, was ich seit der Jugendzeit nicht mehr gekannt hatte: Literatur als Nahrungsmittel: Mit Heißhunger verschlang ich die gut 600 Seiten - und begann gleich nochmals von vorne, weil ich das Gefühl hatte, wegen des Lesetempos einiges verpaßt zu haben.
III.
Ein Jahr später empfand ich das ungemein prickelnde Gefühl von Sensation: Gerold Späth hatte nach langem Hin und Her zugesagt, an der Kantonsschule in Wattwil eine Lesung zu halten. Der Roman «Stimmgänge» war eben erschienen. Er las aus «Unschlecht» und dem neuen Roman, erklärte, kommentierte nur wenig, ging aber bereitwillig auf Fragen ein. Er war gut angekommen, die Lesung bildete noch einige Zeit Gesprächsstoff. Dabei reifte in mir der Gedanke, einmal etwas über diesen Autor publizieren zu können, was es mir ermöglichte, mit ihm in erste Gespräche zu kommen.
Das erste Mal trafen wir uns im Quellenhof, den ich nicht lange zu suchen brauchte; denn die Halsgasse ist schließlich im Roman «Unschlecht» treffend beschrieben: «Rapperswil ist stolz auf seine Handlungen, Werkstätten, Fabriken und Läden. Noch größer aber ist der Stolz auf die Wirtschaften. Wir haben am Hauptplatz den Freihof, die Falkenburg, das Rößli und die Rathausstube. An der Halsgasse, die vom Engelplatz zum Hauptplatz führt und sich unterwegs zur Kluggasse mausert, weil dem kurzen Hals der Schnauf ausgeht, steht die fröhliche Wirtschaft zum Paragraph 11, in die zurückzukommen ist; dann die Wirtshäuser zum Schaf, in dem seit Jahren mehr gemetzget als getrunken wird, die Spanische Weinhalle und grad gegenüber die andere, die Tonhalle. Die Traube macht den Abschluß in der Kluggasse und vieler Saufnächte älterer Knaben. Am Fischmarktplatz und in der Nähe gibt es den Hirschen, das Schiff, den Hecht, den Bären, das Bellevue, den Anker, das National, den Schwanen - scheint's das beste Haus am Platz - das Schwert, den Speer, das Du Lac, den Steinbock. In den Gassen stößt der Durstige auf den versteckten Sternen, den Löwen, den Quellenhof, die Schmidstube, und weiter landeinwärts auf den Rosengarten und den Scheidweg, aufs Kreuz und die Zeughauswirtschaft. Hotels, Gasthöfe, Beizen, Spunten - alles vorhanden.»
IV.
Ich entwickelte Späth meine Ideen, ein groß angelegtes Konzept. Er meinte nur lakonisch: »Schön, schön. Der Germanist bist Du. Dann schaff mal dran.« Wir kamen auf andere Themen, sprachen über seine Beziehung zu Rapperswil. »Weißt Du, jeder braucht seinen privaten Miststock. Der meinige ist hier.« »Und warum ziehst Du nicht weg, wenn Dich alles anödet?«, wagte ich zu fragen. «Im Moment wachsen meine Figuren noch drauf. Auch wenn's stinkt.»
In Rom dann, fast auf gleicher Höhe des Petersdoms (auch das eine herrliche Geschichte, warum's nicht höher ging!) den sagenhaften Rundblick auf der Terrasse des Istituto genießend, auf die Frage nach dem Befinden, auf die Frage nach dem neuen Heimatgefühl (auch nach einem Jahr in Berlin): «Wenn Du Dich hier umschaust, siehst Du nichts als Ewigkeit. Was soll's. Ich habe meine Figuren im Kopf. Dort können sie beliebig herumlaufen, ohne einander zu stören. Vor allem: ohne mich zu stören. Dabei erzählt er schwallweise die Entstehungsgeschichte des Istituto Svizzero. Im Hinabgehen noch ein kurzer Abstecher in die Bibliothek und sein Arbeitszimmer; ein karger Raum, eine Zelle sozusagen. Er erinnert mich spontan an Schillers Turmzimmer zu Jena, nicht wie bei Goethe alles voller Utensilien, Steine, Pflanzen usw. «Die Natur findet bei mir draußen statt.»
Vor dem Essen, das seine Frau und die beiden Kinder liebevoll zubereitet haben, ein knappes Gespräch mit Benno Ammann, dem Komponisten, der irgendwelche kargen Unterstützungsgelder lieber in Notenpapier als in sein Gebiß investiert hat. Das Mittagessen läßt uns langsam unser typisch schweizerisches, hektisches Zeitgefühl verlieren. Wir sind dabei konfrontiert mit einigen Ölbildern: «Donne di Roma». Insbesondere «Allessia» hat es uns angetan (der Verschrieb ist bewußt rot unterstrichen). Wir sind von Gesprächen, Wein und Ewigkeit eingenommen. Dennoch mahnt Späth zum Aufbruch, die Zeit ist knapp, der Besuch dauert nur ein paar Tage und Nächte, und die Stadt bietet eine reichhaltige Geschichte. «Rom macht man zu Fuß.» Wir schauen ihn etwas ungläubig an, realisieren jedoch schnell, daß er nicht die Millionenstadt meint; denn diese gibt sich wie jede andere Großstadt. Tatsächlich ist die Altstadt kompakt. Aber jeder Stein ist ein Stück Geschichte. Der Fremdenführer Späth liefert keine Elegien, wie dies weiland Goethe an Christiane Vulpius adressiert hat, sondern überquillt von Anekdoten, Legenden, Mythen und Geschichten. Wir wissen nicht immer, ob er sie gerade erfindet oder sprachwuchernd nacherzählt. Halbe Romane; man müßte sie sich merken oder aufschreiben können. Dazwischen die Frage, woran er arbeite.
Die Frage war zu diesem Zeitpunkt nicht verfehlt; denn nach dem Berlin-Jahr, das dem Rom-Aufenthalt vorausgegangen war, hatte er als erster den von Günter Grass gestifteten «Alfred-Döblin-Preis» erhalten; für ein phänomenales Buch notabene: «Commedia». Wir konnten uns nämlich nach dem Erscheinen dieses Buchs nicht genau vorstellen, wie die Entwicklung weiterginge. «Ich schreibe hier nur für die Schublade.» Er winkt ab, wie so oft, wenn's um Unveröffentlichtes geht.
Es war abgemacht, bei Gino essen zu gehen. Rom erwacht erst abends. Wie wir über die Piazza Navona schlendern: ausgelassene Stimmung, lockere Fröhlichkeit ohne Betriebsamkeit. Wir diskutieren über die Wirkung von «Commedia»; dabei unterbreite ich ihm den Wunsch, daraus einen Teil dramatisieren zu dürfen, einige der 203 Figuren und Stücke aus dem Museum auf die Bühne bringen zu können. Die Idee eines groß angelegten Totentanzes stößt offenbar auf reges Interesse, so daß er mir für die Realisierung grünes Licht gibt. Dabei erinnere ich mich an eine Lesung in St. Gallen und die anschließende Rückfahrt nach Rapperswil. Kurz nach Erscheinen von »Balzapf oder als ich auftauchte» war es gewesen; bei irgendeinem Enzian zu nachtschlafener Zeit (er hatte ihn aus Rauris, einem österreichischen Bauerndorf, in dem literarische Begegnungen stattfinden, mitgebracht; ich fand ihn abscheulich) hatte er von der Idee erzählt, einmal alle Nebenfiguren aus den «Stimmgängen» in einem Buch vereinigen zu können; dabei auch einen kurligen Museumskurator die kurligsten Geschichten erfinden zu lassen: Irgendwelche Dinge, die es in der Realität gibt, dann plötzlich ein Bruch, der Kurator erzählt weiter, spinnt den Faden auf seine Weise weiter; Züs Bünzlins Schublade durch Späthsche Fantasie angereichert.
V.
Überhaupt: Späth geht selten auf Fragen nach seiner Arbeitsweise ein. «Ich schreibe die Bücher. Das genügt. Interpretieren können andere.» Dennoch hie und da, aber eher selten, ein Hinweis für den geplagten Germanisten, der einen größeren Lexikon-Artikel verfassen sollte. Etwa zum schmalen Roman «Die heile Hölle»: «Du kannst den Vater nicht einfach im Wald herumrennen lassen, sonst würde er noch heute dort herumirren. Nein, das braucht System. Da ist der ganze Spaziergang eine Odyssee. Die Mädchen sind die Sirenen, der alte Einsiedler der Zyklop. Den Rest kannst Du Dir selber heraussuchen.» Überhaupt: Fakten suchen, recherchieren, reisen, Ausstellungen durchkämmen, Kataloge und Materialien sammeln (aus Alaska etwa hat er sich stoßweise Zeitungen nach Hause geschickt um der Authentizität willen). «Das muß alles stimmen. Als ich beim Schreiben von <Unschlecht> nicht mehr weiterkam, bin ich zu Grass gegangen und habe ihn um Rat gefragt. Der hat mich nur gefragt, wie dies mit den Inseln sei. Alles so belassen, wie es ist. So habe ich sie in zwei Teile gesprengt. Voilà.» Apropos «Heile Hölle»: Das Haus, das er in dem Buch beschreibt, ist oft Gegenstand von Werweißern gewesen. Die einen meinten, es sei die Villa X, andere lokalisierten es als Haus Y. In Tat und Wahrheit ist es vor Jahren abgerissen worden!
VI.
Im britischen Museum in London befindet sich auf einer Metope vom Südfries des Parthenons in Athen ein berühmtes Fabelwesen der griechischen Mythologie: der Kentaur, d.h. ein menschlicher Torso sitzt auf einem Pferdeleib, eine Kombination also zweier Realitäten zu einem neuen, einheitlichen Ganzen, in Wirklichkeit nicht Existierendem. Bezug zu Späth: Was um 440 vor Christi Geburt seine Gültigkeit hatte, kann durchaus in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts Anlaß zu kreativem Denken sein. «...es ist eine der ewigen wirklich alten ewigen Geschichten immer wieder, hör zu und bleib still wie jedesmal, sie braucht nur dein Ohr und daß du eine Weile bleibst und ruhig weiteratmest, sie versinkt in sich auf sechzehn Grad nördlicher Breite knapp bei dreiundzwanzig Grad westlicher Länge, eine Phäakanakin, hatte man mir gesagt, ich lasse ihr zwei Flaschen, sie hat sich eingerollt in ihren Kummer, vor dem Morgen mache ich leis und ohne Blick zurück auf mein Schiff.» Die Kombination als Bauprinzip, zugleich Schlüssel zum Verständnis: Odysseus ist auf der Insel der Phäaken gelandet, wo er auf Nausikaa (eine besonders junge Schönheit) trifft. Er sieht in ihr einen Menschen (Kanake heißt übersetzt Mensch), sie ist weiblich, also eine Kanakin (eine Wortneuschöpfung), Kombination beider Teile, im Mittelteil verkürzt, ergibt: Phäakanakin. Desgleichen «Anxuruk» (beides übrigens in «Sindbadland», dem nicht zu überbietenden Fortsetzungsprodukt von «Commedia»): Anxur ist der volskische Name der latinischen Stadt Tarracina, heute Terracina genannt. Es handelt sich um die italienische Hafenstadt am Tyrrhenischen Meer, am Südostende der Pontischen Sümpfe. Mit dem Ausbau der Via Appia wurde die Stadt (406 vor Christi Geburt von den Römern erobert, 329 römische Kolonie) mit ihrer Hafenanlage zur bedeutendsten Küstenstadt neben Ostia. Dazu eine türkisierende Endung. Auf diese Weise werden Teile der Wirklichkeit zu eigentlichen Utopien.
VII.
Da war noch etwas: Aus irgendwelchen Gründen - wir hatten ausführlich und lange über Hörspiel und Theater diskutiert - waren wir plötzlich darauf gekommen. Er habe da noch ein Theaterstück in der Schublade, so einen Monolog. Er wisse auch nicht recht; die Heddy Maria Wettstein habe es entsetzt zurückgewiesen: So etwas führe sie nicht auf. Das wäre doch etwas für uns. Natürlich, sofort her damit, war mein erster Gedanke. Mit ungeheurer Spannung haben wir die siebeneinhalb Maschinenseiten gelesen, waren uns sofort einig: Das wollen wir spielen. In Wien dann haben sich die Pläne entwickelt, doch wir wußten nicht, womit wir «Die Witwe» hätten kombinieren können. Da hat sich ein außerordentlicher Glücksfall ereignet: Gerold Späth wurde mit einem weiteren - übrigens sehr begehrten - Preis ausgezeichnet: unter 1800 Einsendungen - wohlverstanden, alle anonym - machte seine Kurzgeschichte «Familienpapiere» Furore. Als ich in «Westermanns Monatsheften» diese «Beichte» eines Pfarrers gelesen hatte, war mir die Kombination klar vor Augen: «Familienpapiere» ergab einen herrlichen Monolog, dann Pause, damit sich die Zuschauer voll auf den anderen Monolog konzentrieren könnten: «Die_Witwe». Die Kombination erwies sich als glücklich. Zum 10-Jahr-Jubiläum des Kammertheaters Linth wurden am 15. März 1986 die beiden Monologe als Uraufführungen mit dem einmaligen Ambiente im großen Rittersaal im Schloß Rapperswil, wo Späth übrigens zusammen mit seinem Freund Günter Grass Jahre zuvor eine denkwürdige Lesung gehalten hatte, vor einem dankbaren Publikum gespielt.
VIII.
Apropos «Outopía»: der Begriff heißt, aus dem Griechischen übersetzt, «Nicht-Ort«. Späth ernstnehmen heißt, ihn nicht auf gewisse Örtlichkeiten und Personen festlegen wollen. Dazu ist er literarisch eine allzu große Kapazität, als daß er es nötig hätte, Wirklichkeit zu kopieren. Zwölf Jahre mögen es her sein, als ein offenbar angesehener Rapperswiler zu mir die Bemerkung fallengelassen hatte, er wisse nicht, was es eigentlich über Späth zu schreiben gäbe, er sei doch im Grunde genommen kein Schriftsteller, es ginge ihm nur darum, die Leute in Rapperswil und Umgebung schlecht zu machen. Ich habe geantwortet, in ein paar Jahren würde sich schon das Gegenteil erweisen, besagter Herr werde schon noch sehen. Besagter Herr wird sein Urteil nicht mehr revidieren können; denn er ist mittlerweile gestorben.
IX.