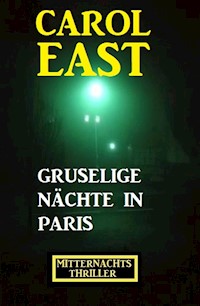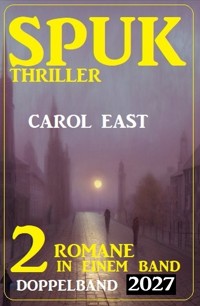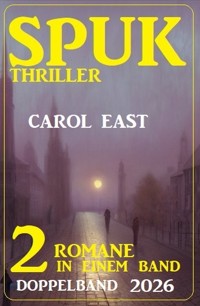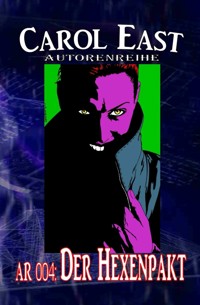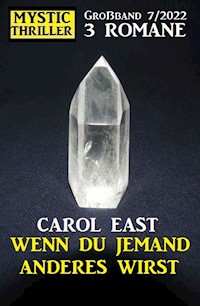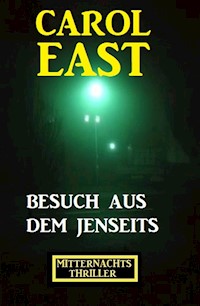Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Haus auf dem Hügel war von fast jeder Stelle innerhalb der kleinen Stadt zu sehen. Zumal kein Haus in dieser Stadt höher war als ein Stockwerk – genauso wie das Haus auf dem Hügel. Als würden sich die Häuser der Stadt vor ihm ducken und sich bemühen, bloß nicht größer und prächtiger zu wirken. Prächtig war das Haus auf dem Hügel durchaus, wie es da so einsam stand, als wäre es um Abstand zur übrigen Stadt bemüht. Kein Baum, kein Strauch behinderte die Sicht zu ihm hinauf. Die Gegend war absolut kahl. Selbst das Gras bildete höchstens ein paar mickerige Büschel, die sich verzweifelt in die wenigen und winzigen Ritze im allgegenwärtigen Felsboden klammerten. Petra Hansen fiel besonders eines auf, was sie als viel merkwürdiger noch empfand im Vergleich zur kahlen Landschaft und dem seltsamen Haus auf dem Hügel: Es gab keinerlei Straßen! Nicht nur nicht innerhalb der Stadt, wo die Häuser standen wie von einem Riesenkind zufällig hingewürfelt, mit unterschiedlichen Abständen voneinander, sondern auch nicht zum Haus auf den Hügel hinauf. Und es gab keine Straße nach außerhalb. Sie zog ihre hübsche Stirn kraus, die sie allerdings selber als alles andere als hübsch empfand, und schüttelte am Ende sogar den Kopf, während sie dieses Bild der Stadt mit ihrem Haus auf dem Hügel betrachtete. Der Hügel war die höchste Erhebung weit und breit. Mit nur knapp hundert Fuß über der Stadt noch weit entfernt von einer Bezeichnung etwa wie Berg. Und dennoch hatte dieses Haus etwas Majestätisches, wie es da so thronte. Eine Umgrenzungsmauer des Grundstücks gab es keine, als wolle das Haus damit demonstrieren: Mir gehört sowieso die ganze Gegend!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carol East
Das unheimliche Haus auf dem Hügel: Mitternachtsthriller
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Das unheimliche Haus auf dem Hügel: Mitternachtsthriller
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / Original: Das Haus auf dem Hügel
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen .
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Das unheimliche Haus auf dem Hügel: Mitternachtsthriller
Carol East
Das Haus auf dem Hügel war von fast jeder Stelle innerhalb der kleinen Stadt zu sehen. Zumal kein Haus in dieser Stadt höher war als ein Stockwerk – genauso wie das Haus auf dem Hügel. Als würden sich die Häuser der Stadt vor ihm ducken und sich bemühen, bloß nicht größer und prächtiger zu wirken.
Prächtig war das Haus auf dem Hügel durchaus, wie es da so einsam stand, als wäre es um Abstand zur übrigen Stadt bemüht. Kein Baum, kein Strauch behinderte die Sicht zu ihm hinauf. Die Gegend war absolut kahl. Selbst das Gras bildete höchstens ein paar mickerige Büschel, die sich verzweifelt in die wenigen und winzigen Ritze im allgegenwärtigen Felsboden klammerten.
Petra Hansen fiel besonders eines auf, was sie als viel merkwürdiger noch empfand im Vergleich zur kahlen Landschaft und dem seltsamen Haus auf dem Hügel: Es gab keinerlei Straßen! Nicht nur nicht innerhalb der Stadt, wo die Häuser standen wie von einem Riesenkind zufällig hingewürfelt, mit unterschiedlichen Abständen voneinander, sondern auch nicht zum Haus auf den Hügel hinauf. Und es gab keine Straße nach außerhalb.
Sie zog ihre hübsche Stirn kraus, die sie allerdings selber als alles andere als hübsch empfand, und schüttelte am Ende sogar den Kopf, während sie dieses Bild der Stadt mit ihrem Haus auf dem Hügel betrachtete.
Der Hügel war die höchste Erhebung weit und breit. Mit nur knapp hundert Fuß über der Stadt noch weit entfernt von einer Bezeichnung etwa wie Berg. Und dennoch hatte dieses Haus etwas Majestätisches, wie es da so thronte.
Eine Umgrenzungsmauer des Grundstücks gab es keine, als wolle das Haus damit demonstrieren: Mir gehört sowieso die ganze Gegend!
Petras blaue Augen verengten sich zu einem schmalen Spalt, als könnte sie dadurch besser sehen. Sie wunderte sich darüber, daß sie keinerlei Lebenszeichen entdeckte. Ohne Straßen gab es auch keine Autos. Aber zumindest hätte es Fußgänger geben können.
Am fernen Horizont senkte sich der Glutball der Sonne, um der Nacht Platz zu machen.
Petra grübelte darüber nach, wie sie denn überhaupt dazu kam, den späten Abend anzunehmen. Wer sagte ihr denn, daß es nicht im Gegenteil früher Morgen war und die Sonne sich nicht senkte, sondern erst jetzt erhob, um den Tag einzuleiten?
Sie spürte es einfach und hörte auf, sich darüber zu wundern. Genauso, wie sie sich keineswegs darüber wunderte, überhaupt hier zu sein, auf einem geradezu idealen Beobachtungsposten, von dem aus sie alles bis ins kleinste überblicken konnte. Sie befand sich irgendwie höher noch als das Haus auf dem Hügel, sonst könnte sie es doch nicht von schräg oben sehen, nicht wahr? Und das, obwohl es keinerlei höhere Erhebung als diesen Hügel hier gab?
Ihr Blick heftete sich auf die Zwischenräume zwischen den Häusern.
Wie eine Spielzeugsiedlung, fuhr es ihr durch den Kopf. Sie strich eine Strähne ihres langen, blonden Haares zurück, die ihr vor das linke Auge gefallen war. Ja, wie bei ihrem Bruder, der ein leidenschaftlicher Fan von Spielzeugeisenbahnen war und dafür ganze Landschaften in miniaturisierter Form erschuf.
Doch diese Stadt mit dem Haus auf dem Hügel vor ihr war viel zu realistisch, als daß es ein Modell hätte sein können. Das sah sie, wenn sie die Details mit ihren Augen regelrecht aufsaugte.
Sie ließ ihre Blicke weiterschweifen, auf der Suche nach dem, was man Leben hätte nennen können. War es denn möglich, daß es so etwas außer den mickrigen Grasbüscheln innerhalb dieses Bereiches gar nicht gab? Schon länger nicht?
Nein, die Häuser machten einen gepflegten Eindruck. Wenn die Bewohner sie verlassen hatten, dann war das noch nicht lange her.
Es gelang ihr, näher heranzugehen. Wie eine Riesin, die sich über die Landschaft beugte, um ihr Gesicht näher an das Geschehen zu bringen. Falls es denn so etwas wie ein Geschehen gab...
Die Sonne versank beinahe endgültig hinter der Horizontlinie. Die Landschaft wurde von einem wie blutigen Licht übergossen, das schaurige Assoziationen in Petra weckte. Sie betrachtete eines der Häuser genauer. Die Fenster blieben dunkel. Aber nicht mehr lange. Ein Licht glomm im Innern auf. Es zuckte unruhig hin und her wie ein aufgeregtes Glühwürmchen. Und dann... öffnete sich die Haustür, und ein junger Mann trat hervor, mit einer Kerze in der Hand, deren Licht unruhig flackerte. Das also war das nervöse Flackern, das sie durch das Fenster gesehen hatte?
Der Mann trat vor das Haus und schaute sich wie suchend um. Dann blieb sein Blick am Haus auf dem Hügel hängen.
Petra wandte nun ebenfalls ihre Aufmerksamkeit dem Haus auf dem Hügel zu: Dort hatten die Fenster zu glühen begonnen, als wären sie rotglühende Augen, die auf die Stadt hinabstarrten.
Sie schaute wieder nach dem jungen Mann, der nach wie vor dastand und hinaufstarrte.
Er war schlank-muskulös, so richtig durchtrainiert, wie es Petra am besten gefiel. Sie hatte die Theorie, nur deshalb auf dieser Art Mann zu stehen, weil sie selber sich als völlig unsportlich einschätzte. Überhaupt hielt sie von sich selber sowieso eher wenig.
Das Gesicht des jungen Mannes erinnerte sie an einen berühmten Schauspieler, der schmachtende Liebhaber genauso überzeugend spielen konnte wie bitterböse Schurken – und in jeder seiner Rollen sowieso stets und ständig der Schwarm aller Frauen blieb, ob jung oder alt.
Kaum hatte sie diesen Vergleich gezogen, als der junge Mann seinen Blick von dem Haus auf dem Hügel löste – und sie unmittelbar anstarrte.
Sein Gesicht zeigte so etwas wie Erschrecken. Er riß sogar wie abwehrend seinen linken Arm hoch und hätte vor Schreck beinahe die brennende Kerze verloren, deren Flamme jetzt flackernd erlosch.
*
Er – er kann mich sehen, dachte Petra konsterniert, denn in dieser skurrilen Situation war das alles andere als selbstverständlich.
Als der junge Mann begriffen hatte, daß von ihr keine unmittelbar Gefahr ausging, ließ er den Arm wieder sinken.
Inzwischen war die Sonne so tief gesunken, daß er kaum mehr als ein Schatten blieb. Doch jetzt entstand überall in den Häusern jenes Glühen, das sie zuerst im Haus auf dem Hügel bemerkt hatte, und da es keinerlei Vorhänge gab, warf es seinen unwirklichen Schein in die Zwischenräume der Häuser. Zwar war es nur ein eher dürftiges Licht, da es keinerlei sonstige Straßenbeleuchtung gab...
Logisch, es gibt ja auch keine Straßen, dachte Petra prompt und betrachtete sich den jungen Mann näher.
Dieser fuhr erschrocken einen Schritt vor ihr zurück, blieb dann jedoch wieder stehen.
“Wer – wer bist du?” stotterte er.
Petra hielt überrascht inne, ehe sie leise antwortete: “Ich heiße Petra Hansen.”
“Eine... Deutsche?”
“Ja, ich bin Studentin und will mich auf Indianergeschichte spezialisieren. Deshalb kam ich hierher, nach Amerika.”
“Indianergeschichte?” Der Mann schaute sich gehetzt um, als befürchtete er, es könnte gefährliche Zuhörer geben. “Das – das ist ja entsetzlich!”
Petra runzelte die hübsche Stirn und meinte: “Entsetzlich? Was ist denn daran...?” Sie brach ab und nagte an ihrer Unterlippe. Jetzt erst begann sie sich zu fragen, was sie hier überhaupt wollte – und wie sie überhaupt hierhergekommen war.
Sie schaute sich unwillkürlich um. Das hieß, sie wandte sich von der Stadt mit ihrem Haus auf dem Hügel ab und warf einen Blick zurück, über ihre Schulter.
Und damit war sie wieder dort, was die Menschen ihre Wirklichkeit nannten. Aber war diese Wirklichkeit denn tatsächlich wirklicher als das, was sie soeben gesehen und erlebt hatte?
Verwirrt schüttelte sie den Kopf, daß ihre langen, blonden Haare flogen.
Sie stand in dem Indianermuseum, das unter Insidern als absoluter Geheimtip galt. Dafür hatte sie viele Meilen durch die Wüste fahren müssen, um das Museum neben einer schäbigen und anscheinend kaum frequentierten Tankstelle zu finden. Aber auf einer Fläche von schätzungsweise dreihundert Quadratmetern hatte sie so viele Kostbarkeiten entdeckt wie nicht in ihrem bisherigen Leben und Forschen insgesamt! Sie hatte es doppelt und dreifach bedauert, allein hierhergefahren zu sein und nicht gewartet zu haben, bis ihr Kommilitone und Freund Fred Stinner hatte mitkommen können.
Gerade hatte sie eine eigenartig anmutende Anordnung von indianischen Totems und anderen Utensilien betrachtet, die sie trotz ihres immensen Fachwissens in keiner Weise einordnen konnte, als es geschehen war: Jetzt konnte sie sich deutlich daran erinnern!
Das Ganze war wie ein Vision gewesen, so realistisch, wie eine Vision überhaupt sein konnte.
Mehr noch als eine Vision war das gewesen, wenn sie berücksichtigte, daß jener junge Mann... sie gesehen und sogar zu ihr gesprochen hatte!
Und noch viel mehr: Sie hatte ihm sogar geantwortet und ihren Namen genannt.
Im nachhinein sah sie darin allerdings einen entscheidenden Fehler!
Sie schaute wieder nach vorn, auf die Anordung.
Es war eine Art magische Anordnung. Soviel war jedenfalls sicher. Obwohl sie noch vor Minuten angenommen hatte, so etwas könnte es gar nicht geben - eine echte magische Anordnung nämlich. Kein Wunder, denn es war das erste Erlebnis dieser Art überhaupt in ihrem ganzen Leben.
*
Erst draußen, in der Tageshitze, kam sie wieder zu sich. Sie hatte sich nach dem Erlebnis wie betäubt gefühlt. Ihre Gedanken waren nur träge und teilweise sogar unkontrollierbar gewesen. Die heiße Luft, die sie an einen Backofen erinnerte, brachte sie vollends in die Wirklichkeit zurück.
Mit hölzernen Schritten ging sie zu ihrem Wagen. Eigentlich seltsam, daß es im Museum so kühl war, obwohl die Sonne unbarmherzig auf das flache Dach knallte und eigentlich das Gebäude in seinem Innern gehörig aufheizen müßte. Eine Klimaanlage hatte sie weder gehört noch gesehen. Es war völlig still gewesen im Museum. Und sie war der einzige Gast gewesen.
Nein, nein, jetzt durfte sie nicht übertreiben: Es war schließlich nicht das erste Mal in ihrem Leben, daß sie mutterseelenallein in einem Museum herumstöberte. Außer den Touristen, die schubweise und dabei auch noch in Scharen über alle Sehenswürdigkeiten herfielen wie Heuschreckenschwärme über blühende Felder, interessierte sich kaum noch jemand für indianische Kultur. Sie hatte oft den Eindruck, als wollte man diese möglichst vergessen, auch von indianischer Seite selbst her.
Sie, Petra Hansen, konnte eine solche Einstellung weder teilen, noch billigen. Sonst wäre sie nicht spontan hierhergekommen, sobald sie endlich hatte erfahren können, wo sich dieses Museum überhaupt befand.
Aber jetzt war es an der Zeit, diesem Ort wieder den Rücken zu kehren. Das spürte sie tief in ihrem Innern. Je länger sie noch zögerte, desto stärker wurde dieser Drang, der sie beinahe wie zur Flucht drängen wollte.
Flucht vor was oder vor wem?
Sie startete den Motor und warf einen Blick auf die Tankanzeige. Es wäre riskant gewesen, die Tankstelle zu meiden. Unterwegs gab es keine andere. Das hatte sie bereits auf der Strecke hierher feststellen können. Also ließ sie den Wagen vor die Säule rollen, die so aussah, als sei sie selber bereits ein Museumsstück. Aus dem Häuschen, das nicht viel größer als eine Kabine war, trat ein Indianer. Besser gesagt: Die Mumie von einem uralten Indianer. So jedenfalls der Eindruck von Petra. Nur die Augen des Mannes schienen zu leben, obwohl er sie recht teilnahmslos betrachtete, selbständig den Tank öffnete und den Zapfhahn hineinhängte, ehe Petra noch ausgestiegen war, um ihm ihre Wünsche zu nennen.
Sie stieg trotzdem aus und beschloß, genauso schweigsam zu bleiben.
Während dem Tankvorgang stieg ihre Unruhe stetig an. Jetzt war es schon soweit, daß sie am liebsten einfach davongerannt wäre. Nur die Tatsache, daß sie in dieser flirrenden Hitze nicht weit kommen würde, hielt sie noch davon ab.
Als der Tank endlich voll war – nach einer schieren Ewigkeit, wie es Petra erschien -, fischte sie ihre Handtasche aus dem Fond des Wagens. Wieso hatte sie das nicht schon längst getan? Wo waren denn ihre Gedanken? Sie fingerte umständlich daran herum, bis es ihr endlich gelang, sie zu öffnen. Aber bevor sie das noch schaffte, hängte der mumifizierte Indianer den Zapfhahn an die Säule und schlurfte müde davon.
Petra hielt irritiert inne und folgte ihm mit geöffneter Handtasche in das Wärterhäuschen.
Dieses war leer!
Ja, sie hatte doch noch vor einer Sekunde den Alten hier eintreten sehen, vor ihren Augen war das geschehen. Sie konnte sich unmöglich geirrt haben. Aber das Häuschen war leer. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar: Darin war nicht nur kein Indianer, sondern überhaupt fehlte jegliche Möblierung. Also auch eine Kasse, an der sie zahlen konnte.
In dem Häuschen war es nach Empfinden von Petra mindestens doppelt so heiß wie außerhalb. Sie war überzeugt davon, man hätte nur einen Kochtopf auf den Boden stellen müssen, um innerhalb kürzester Zeit das Essen gar zu bekommen.
Fluchtartig verließ sie das Häuschen wieder und schaute sich suchend um.
Vor dem Museum war ein Schalter. Dort hatte sie ihr Ticket gelöst und war anschließend durch die Tür daneben eingetreten. Wieviel Zeit war seitdem vergangen? Jedenfalls, der junge Indianer, der hinter dem Tresen gesessen hatte, war jetzt nicht mehr da.
Die Unruhe schnürte ihr die Kehle zu und drängte sie zu ihrem Wagen zurück, obwohl sie eigentlich hinübergehen wollte, um nach dem Tankwart zu fragen. Schließlich wollte sie nicht ohne zu bezahlen einfach von hier verschwinden. Sie war ja keine Kriminelle.
Aber sie konnte nicht anders, als in ihren Wagen zu steigen. Achtlos warf sie die immer noch offene Handtasche neben sich auf den Beifahrersitz und startete wieder den Motor. Sie legte den ersten Gang ein und fuhr los.
Erst als sie die Tankstelle und das geduckt sich ausbreitende Museumsgebäude im Rückspiegel entschwinden sah, wurde ihr wieder bewußt, daß sie den Tankwart um sein Geld geprellt hatte.
Was aber sollte sie tun?
“Ich komme zurück, sowieso!” murmelte sie vor sich hin. “Dann werde ich bezahlen, mit Zins und Zinseszins.”
Noch während sie das sagte, glaubte sie in ihrem Innern eine Stimme zu hören, die sie eindringlich davor warnte, jemals wieder an diesen Ort zurückzukehren.
Nach ungefähr zwei Meilen Fahrt stieg sie plötzlich in die Bremsen. Ein erschreckender Gedanke war ihr gekommen:
Tatsächlich, ich bin regelrecht geflohen von diesem Ort! Dabei wäre es das Naheliegende gewesen, zumindest diese magische Anordnung näher in Augenschein zu nehmen. Aber nein, sie war nach diesem seltsamen Erlebnis einfach auf und davon. Für eine angehende Expertin in indianischer Geschichte nicht gerade typisch und irgendwie sogar... peinlich.
Ein Blick auf die Tankanzeige. Na, wenigstens hatte sie vollgetankt. Sie würde also die Fahrt zurück schaffen. Und verfahren würde sie sich auch kaum können. Immer auf der Hauptstraße bleiben, bis nach ein paar hundert Meilen einer der Highways kreuzte, und der war so gut ausgeschildert, daß sie keine Bange zu haben brauchte, den richtigen Weg zu verfehlen.
Und wieso hatte sie trotzdem Bange?
Sie hielt es nicht mehr länger aus und gab wieder Gas, um mit weit überhöhter Geschwindigkeit davonzubrausen, ungeachtet der drastischen Strafen, die ihr für zu schnelles Fahren in diesem Land drohten.
Bloß weg von hier, so schnell wie möglich! hieß die Devise. Und: Koste es, was es wolle!
*
Als Petra Hansen viele Stunden später ihre Wohnung betrat, hatte sie erneut den Eindruck, wie aus einem Traum zu erwachen. Es war dasselbe Gefühl wie nach dem Museumsbesuch, bevor diese Unruhe in ihr entstanden war und sie zur Flucht gedrängt hatte.
Ich habe den Tankwart nicht bezahlt! fuhr es ihr durch den Kopf. Als wäre dies das Wichtigste überhaupt gewesen, was sie dort draußen erlebt hatte.
Schwer ließ sie sich in ihren Lieblingssessel plumpsen. Sie schloß die Augen, um nachzudenken.
Der Tip mit dem Indianermuseum... Sie hatte immer wieder davon gelesen, daß sich jenes Museum irgendwo befinden sollte, mit unerhörten Kostbarkeiten. Das war zunächst eher ein Mythos gewesen als ein echter Tip, genauer betrachtet. Deshalb hatte sie lange Zeit auch angenommen, daß es dieses Museum überhaupt nicht wirklich gab. Bis gestern abend. Fred hatte sich mit Kumpels getroffen. Petra hatte es ihm gegönnt und sich einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher gönnen wollen. Gelangweilt hatte sie sich durch die einzelnen Programme gezappt. Und da war plötzlich diese Sendung gewesen – mit dem Hinweis, wo sich das Museum befand. Sie hatte gar nicht gewußt, auf welchem Sender dies ausgestrahlt worden war, geschweige denn, um welche Sendung es sich überhaupt handelte. Ihr Interesse war sofort geweckt gewesen. Zumal sie innerhalb von gut einem einzigen Tag hin- und zurückfahren konnte. So verhältnismäßig nah hätte sie jenes Objekt ihrer Begierde niemals vermutet.
Sobald nichts mehr von Interesse gesagt worden war, hatte Petra abgeschaltet und war ins Bett gestiegen, um am nächsten Tag fit zu sein. Vor lauter Aufregung hatte sie trotzdem kaum schlafen können. Dann war es in aller Frühe losgegangen. Und jetzt saß sie hier und konnte nicht wirklich begreifen, was sie überhaupt erlebt hatte.
Das Haus auf dem Hügel! Was, um alles in der Welt, hatte das mit Indianern zu tun? Wieso hatte ihr die magische Anordnung eine solche Vision ermöglicht? Oder mußte sie eher sagen: Wieso hatte ihr diese magische Anordnung eine solche Vision überhaupt aufgezwungen?
Nein, keine Vision! Mehr! Viel mehr!
Sie riß die Augen weit auf, als befürchtete sie, den Verstand zu verlieren. Sie schaute sich in ihrer engen Wohnung um. Alle Gegenstände waren ihr längst vertraut. Ihre Blicke saugten sie regelrecht auf. Dies alles hier war real, war die Wirklichkeit.
Aber was war in jenem Museum gewesen? Der beginnende Wahnsinn? Hatte sie es sich nur eingebildet? Und dann der Tankwart, der plötzlich verschwunden war, gewissermaßen vor ihren Augen?
“Das alles gibt es nicht!” hörte sie ihre Stimme sagen, und es klang, als hätte eine Fremde gesprochen.
Es raschelte an der Tür, und Petra fuhr erschrocken herum.
Jemand steckte einen Schlüssel ins Schloß und drehte ihn. Aber nur ein Mensch hatte einen Schlüssel, nämlich ihr Freund Fred Stinner.
Mit weitaufgerissenen Augen und offenstehendem Mund wartete Petra ab, unfähig, sich zu rühren.