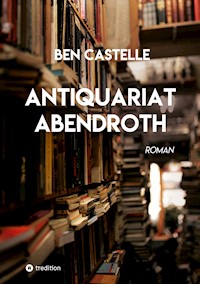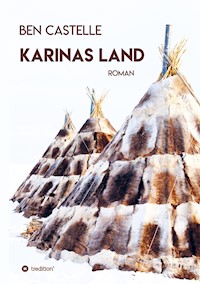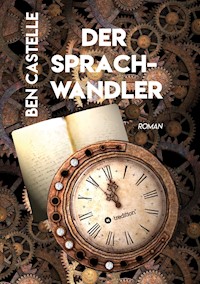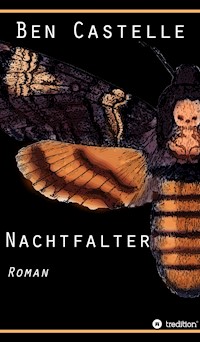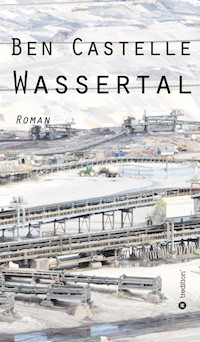2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Titelgeschichte dieses Erzählbandes treffen sich die einstigen Studienfreunde Arianne und Eddy, um gemeinsam mit einem Segelboot von der türkischen Küste aus in See zu stechen. Doch aus dem geplanten Wiedersehenswochenende wird schon bald ein Alptraum, als Eddy nach durchzechter Nacht beim morgendlichen Bad im offenen Meer verschwindet. Bei einem Polizeiverhör erinnert sich Arianne an Eddy, der als Verlegersohn zwar rasch Karriere machte, dessen Träume aber nie erfüllt wurden, weil sie unbestimmt blieben und sich nur in vagen Vorstellungen von einem anderen Leben äußerten. In einer weiteren Geschichte lernt man Klaus kennen, einen Fernfahrer, der Schmuggelware von Teheran nach Amsterdam transportiert, um die Ausbildung seiner Tochter finanzieren zu können, und der nicht ahnt, welche Fracht er an Bord genommen hat. Um eine gestandene Architektin, die sich in einen jüngeren Mann verliebt, geht es in der dritten Erzählung. Ihre neue Beziehung wird jedoch von einem Bauvorhaben überschattet, das für sie zum Referenzprojekt werden soll. Musiker André Strasser macht im Wochenendhaus seines verstorbenen Vaters, einem Astronomie-Professor, Bekanntschaft mit einer Frau, die er für die Geliebte seines Vaters hält, bis eine Nacht im väterlichen Observatorium ihn mehr erkennen lässt als nur einige ferne Sterne. Weiterhin wird von einer Finanzbeamtin erzählt, die einem in Asien operierenden Unternehmer Steuerhinterziehung vorwirft, doch irritiert ist, als sie erfährt, wofür das Geld benötigt wird. Eine Malerin trifft auf die ehemalige jüdische Bewohnerin ihres neu erworbenen Ateliers und erfährt die (Liebes)Geschichte eines ungewöhnlichen Bildes, das sie auf dem Speicher ihres Hauses gefunden hat. Und schließlich erzählt der Band noch vom Pressesprecher eines Braunkohlenkraftwerks, der sich nach einem Autounfall in einem Umweltaktivistencamp wiederfindet, wo er eine junge Tagebaugegnerin kennenlernt, die ihn an seine eigenen einstigen Ideale erinnert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ben Castelle
Der Blauwassertörn
Erzählungen
Über dieses Buch:
In der Titelgeschichte treffen sich die einstigen Studienfreunde Arianne und Eddy, um gemeinsam mit einem Segelboot von der türkischen Küste aus in See zu stechen. Doch aus dem geplanten Wiedersehenswochenende wird schon bald ein Alptraum, als Eddy nach durchzechter Nacht beim morgendlichen Bad im offenen Meer verschwindet. Bei einem Polizeiverhör erinnert sich Arianne an Eddy, der als Verlegersohn zwar rasch Karriere machte, dessen Träume aber nie erfüllt wurden, weil sie unbestimmt blieben und sich nur in vagen Vorstellungen von einem anderen Leben äußerten. Während die Küstenwache die Suchaktion einstellt, taucht Eddy plötzlich mit einer wundersamen Geschichte seiner Rettung wieder auf.
Impressum
© 2017 Ben Castelle
Umschlag, Illustration: Ben Castelle
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7439-2538-0 (Paperback)
978-3-7439-2539-7 (Hardcover)
978-3-7439-2540-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Blauwassertörn(Arianne und Eddy)
Arianne Schneider saß auf einem harten Holzstuhl vor einem abgenutzten Tisch in der Polizeistation von Marmaris und blickte seit Minuten stumm in den kreisenden und in seiner Arretierung leise quietschenden Ventilator an der Decke. Er erinnerte sie an die Rotorblätter des Hubschraubers, der ewig lange über dem Boot gestanden hatte, bevor übers Meer Hilfe gekommen war. Ihr gegenüber an einem dunklen Mahagoni-Schreibtisch saß der Kriminalbeamte Murad Kemal, der ein Konvolut loser Zettel durchblätterte und sich ab und an hochkonzentriert mit Zeige- und Mittelfinger über den schwarzen Oberlippenbart strich. Hinter ihm in der rechten Ecke lehnte die türkische Fahne, links daneben hing das Bild des Präsidenten. Murad Kemal sprach Deutsch und gab sich alle Mühe, Arianne Schneider zu verstehen. Doch immer wieder schüttelte er den Kopf, blätterte und las in seinen Aufzeichnungen, um sodann regelmäßig vor sich hin zu brummen: »Mehr Fragen als Antworten, deutlich mehr Fragen als Antworten.«
Arianne hoffte, jeden Moment ohnmächtig zu werden, sich aus alldem, was um sie herum vorging, verabschieden zu dürfen, um an einem besseren Ort wieder aufzuwachen. Doch wie sehr sie sich auch Mühe gab, ihr Bewusstsein zu verlieren, es ließ sich nicht auslöschen, sondern flackerte mit kleiner Flamme unaufhörlich weiter.
»Ich fürchte, Sie müssen mir das alles noch einmal erklären«, sagte Murad Kemal jetzt, während er aus den losen Blättern ein geordnetes Häufchen machte und es behutsam auf den äußeren rechten Rand seines Schreibtisches legte.
»Ich habe es Ihnen schon ein paar Mal erzählt«, sagte Arianne und sah Kemal mit müden Augen an.
»Das ist richtig«, sagte Kemal, »aber sie erzählen so durcheinander, geht es nicht mal der Reihe nach, geordnet und verständlich?«
Arianne seufzte nur und schüttelte resigniert den Kopf.
»Welchen Beruf üben Sie aus?« fragte Kemal.
»Ich bin Kinderbuchautorin«, sagte Arianne.
»Ah«, sagte Kemal, »und sind Sie erfolgreich?«
»Nein«, sagte Arianne, »leben kann ich davon kaum. Ich bin nebenher als Übersetzerin tätig.«
»Welche Sprachen?« fragte Kemal.
»Nur Englisch«, sagte Arianne und blickte zum Fenster hinaus in den Hafen von Marmaris, wo viele Segelboote vor Anker lagen. Der friedliche Anblick schien sie zu erschrecken. Sie zuckte zusammen und sah Kemal plötzlich hellwach an, so als ob sie zum ersten Mal an diesem Tag aus ihrer Lethargie erwacht wäre.
»Alles nochmal von vorn?« fragte sie. Kemal nickte nur und griff sich einen Stift und ein leeres Blatt Papier.
»Fangen Sie vorne an und lassen Sie rein gar nichts aus«, sagte er, als ob er sich kaum etwas Besseres vorstellen könnte, als Ariannes Geschichte erneut zu hören.
2
Mit einer halben Stunde Verspätung erreichte ich den Flughafen Dalaman. Ich stieg aus dem tiefgekühlten Airbus und quetschte mich kurz darauf mit all meinen Sachen in ein Taxi, als ob ich in Unkenntnis antiker Badekultur geradewegs aus dem Frigidarium in das Sudatorium eingetreten wäre. Schwitzend und dem Kreislaufkollaps nah, ließ ich mich die gut achtzig Kilometer bis zur Küste chauffieren. Der Taxifahrer hoffte offensichtlich auf reichlich Trinkgeld, denn er plauderte die ganze Zeit über recht charmant mit mir und fuhr mich direkt bis runter zum Bootskai, was, wie er mehrfach betonte, eigentlich verboten war. Dort hielt er Ausschau nach dem Segelboot, dessen Namen ich ihm genannt hatte. Als er die »Madame Joy« entdeckte, half er mir, meine Gepäckstücke aus dem Auto zu holen. Er drapierte sie sorgfältig um mich herum, direkt vor dem Bootssteg. Den Steg selbst wollte er nicht betreten. Ich hatte ihn noch nicht bezahlt, da rief jemand vom Boot herunter: »Zu behaupten, dass du dich kaum verändert hast, wäre eine Lüge, die man nicht einmal mehr charmant nennen dürfte.«
Es war Eddy Stein. Ich erkannte ihn nach all den Jahren sogleich wieder. Er hatte sich, sah man von seinem Gesicht einmal ab, äußerlich kaum verändert. Er besaß immer noch oder besser schon wieder lange Haare, die er zu einem Zopf zusammengebunden hatte, trug eines von diesen selbstgebatikten Hemden, die noch nie richtig modern gewesen sind, ausgelatschte Turnschuhe, eine Sonnenbrille mit kreisrunden Gläsern und eine Militärhose mit zahlreichen Taschen. Er sah aus, wie ein Hippie auf dem halben Weg zum Einzelkämpfer. Nur sein Gesicht war deutlich älter geworden. Er hatte es offensichtlich zu oft der Sonne ausgesetzt. Aber die Augen waren immer noch dieselben Augen, die mich schon während unseres Studiums angeschaut hatten. Zwanzig Jahre war das jetzt her, und in all der Zeit hatten wir uns kein einziges Mal gesehen.
»Danke für die charmante Begrüßung«, sagte ich. Wir umarmten uns herzlich auf der Mitte des Stegs.
»Ehrlich gesagt bin ich kurz davor, mir deinen Personalausweis zeigen zu lassen«, flüsterte er mir ins Ohr, damit der Taxifahrer es nicht hörte. Er nahm seine Sonnenbrille und steckte sie in den leicht ergrauten aber immer noch vollen Haaren fest, so dass er wie ein exotisches Insekt aussah, von dem man nicht wusste, welche Augen echt und welche nur Mimikry waren.
»Immer noch der alte Komiker«, antwortete ich. »Aber die Zeit ist auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen.«
»Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass du älter geworden bist oder älter aussiehst, ich meine, dass ich dichgar nichtmehr wiedererkenne, du siehst vollständig verwandelt aus. Wie ein anderer Mensch. Bist du es wirklich?«
»Wenn du Arianne Schneider meinst, ja, die bin ich.«
»Unglaublich. Na, ich werde dich schon noch wiederfinden, wenn wir erst ins Plaudern geraten. Bestimmt gibt es da Handbewegungen, sprachliche Eigenheiten und anderes, was mich wieder an dich erinnern wird. So ist es, als ob ich einen völlig fremden Menschen an Bord nehmen würde.«
»Wirsinduns völlig fremd, Eddy. Zwanzig Jahre sindein langes Leben, da kann man nicht einfach so an Gestern anknüpfen.«
»Na, komm aufs Boot, ich regel das mit dem Taxifahrer. Und dann wird erst einmal gegessen. Ich zeig dir deine Kajüte und die Dusche, und wenn ich dich danach immer noch nicht wiederkenne, dann fang ich halt noch mal von vorne an, dich kennenzulernen.«
»Wo fahren wir hin?« fragte ich Eddy, nachdem er den Taxifahrer bezahlt hatte. »Dazu hast du mir bislang nichts verraten.«
»Vorgestern wollte ich mit dir in Richtung Südosten nach Fethiye, Göcek, Kas und Kalkan segeln und dir ein paar weltentrückte lauschige Strände und romantische türkische Dörfer zeigen«, sagte Eddy und bewegte dazu asynchron seine Arme, so als ob seine Armbewegungen jedes Wort Lüge strafen wollten. »Aber dann drehte sich der Wind«, sagte er und wandte sich zum Boot hin. »Gestern beschloss ich also, mit dir in nordwestlicher Richtung nach Datca und Bodrum zu fahren«, redete er weiter und blickte auf seine ausgetretenen Turnschuhe. »Aber wie es der Zufall so will, hat sich der Wind heute schon wieder gedreht und bläst nun kräftig vom Land her aufs Meer hinaus. Also müssen wir nun ganz woanders hinreisen, quasi dahin, wo der Wind uns hinträgt. Lassen wir uns beide überraschen.«
Gemeinsam schleppten wir meine Sachen an Bord der »Madame Joy«. Dabei fiel mir auf, dass Eddy das rechte Bein ein wenig nachzog.
»Kriegsverletzung?« fragte ich und zeigte auf seinen Oberschenkel.
»Ein einziges Mal in meinem Leben bin ich deutlich zu schnell gefahren«, erzählte Eddy. »Das war zu meiner Zeit, als ich an der Uni in den Staaten war. Ich wollte ein paar Kommilitonen beweisen, dass wir Deutschen die besseren Autofahrer sind. Wir verabredeten uns zu einem Rennen auf dem Highway. Es war alles nicht ernst gemeint, mehr so ein Spaß. Ich fuhr in einem geschlossenen Jeep, den mir jemand geliehen hatte, und bekam schon nach zwei Kilometern auf dem Highway eine heftige Seitenböe ab. Der Jeep schlingerte, ich verlor die Kontrolle und wachte im Krankenhaus mit einem Oberschenkelbruch auf. Man hatte mir ein paar Implantate und Nägel eingesetzt und ich durfte mich nach Meinung der Ärzte glücklich schätzen, noch am Leben zu sein.«
»Das war blöd von dir«, resümierte ich mitleidlos.
»Saublöd«, sagte Eddy, »und damit mir das nicht noch einmal passiert, trage ich seither Tag und Nacht das hier um den Hals.« Eddy zog an einem dünnen, leicht glänzenden Lederband einen Metallnagel aus seinem Hemd. »Das ist ein Küntscher-Nagel. Damit zimmern sie dir einen gebrochenen Oberschenkel wieder zusammen. Mehr als einmal möchte ich diese Erfahrung nicht machen, deshalb schau ich mir bei allen halsbrecherischen oder gefährlichen Situationen stets diesen Nagel an.«
Ich wollte noch weitere Fragen zum Unfall stellen, doch Eddy wechselte das Thema: »Was du alles dabei hast«, zeterte er, »mein Boot ist doch kein Frachter.« Irgendwie schien er es eilig zu haben, den Hafen zu verlassen. Ich hatte noch nicht die Kajüte bezogen, da löste er das Haltetau vom Poller, startete den Motor und steuerte das Boot aus dem Liegeplatz heraus ins freie Wasser, vorbei an Dutzenden von edlen und weniger edlen Yachten.
»Bist du auf der Flucht?« fragte ich, nachdem ich mich in der Kajüte frisch gemacht hatte und mit einem Handtuch um den Kopf zurück an Deck kam.
»Ja, und das schon mein ganzes Leben lang«, sagte Eddy. »Aber keine Sorge, ich will nur rasch aus dem Hafen rausfahren, um den Sonnenuntergang besser zu sehen. Wir ankern ein paar Meilen vor der Küste, dann verschwinde ich in der Kombüse und koche uns etwas Schönes.«
»Das klingt gut«, sagte ich, »ich habe nämlich Hunger.«
Bevor es dann wirklich gemütlich wurde, bekam ich von Eddy eine längere Sicherheitsunterweisung. Das sei Vorschrift, sagte er mir. So erklärte er mir zum Beispiel, ich müsse immer eine Hand am Boot haben, solle meine Turnschuhe am besten niemals ausziehen und stets alle Luken schließen. Dann zeigte er mir, wo sich die Lenzpumpen, die Notpinne und die Rettungsinsel befanden und wie man diese Dinge fachgerecht bediente. Er erklärte mir, wie ich mich bei Feuer an Bord verhalten müsste und wie ich die Winschen zu bedienen hätte, ohne mir die Finger zu klemmen. Und schließlich brachte er mir bei, wie man einen Notruf mit dem Funkgerät absetzt. Da ich jedoch großen Hunger hatte, vergaß ich sogleich wieder, was er mir erklärte. Außerdem war mir etwas unwohl, von all diesen potenziellen Gefahren zu hören, hatte ich mich doch einfach nur auf ein paar Tage Entspannung mit einem alten Freund gefreut.
3
Die »Madame Joy« war 1977 in der Werft Thames Marine in England gebaut worden. Ihr Vorbesitzer war mit ihr viele Jahre vorwiegend in Küstennähe gesegelt, weil er beim Cruisen gesehen werden wollte. Eddy hatte aus ihr einen hochseetauglichen Segler gemacht, ohne bislang eine längere Fahrt mit ihr unternommen zu haben. Er hatte es schon immer geliebt, wenn Dinge Potenzial besaßen, auch wenn er dieses Potenzial nie ausnutzte. Er liebte die Möglichkeit, nicht die Wirklichkeit. So fuhr er ebenso gern motorstarke Autos, war aber kein Raser, sondern eher ein Mensch, dem auf der Autobahn die rechte Spur genügte. Zumindest war das früher so, bevor er Europa verlassen hatte, um in den USA zu studieren.
Der Rumpf der »Madame Joy« maß knapp neun Meter in der Länge und drei Meter in der Breite. Die Besegelung bestand aus einem zweiundzwanzig Quadratmeter großen Genua-Segel, einem Großsegel von achtzehn Quadratmetern, einem Blister von über vierzig Quadratmetern, einer Starkwindfock von gut elf und einer Sturmfock von fünf Quadratmetern. Die maximale Geschwindigkeit des Segelboots belief sich auf 6,5 Knoten. Das hat Eddy in der kurzen Zeit so oft erzählt, dass ich es behalten habe.
Ein Blick in den Technikraum hätte mich – insofern ich etwas von Technik verstanden hätte – sofort davon überzeugen müssen, dass dieses Boot zu mehr in der Lage war, als von einem lauschigen Küstenort zum anderen zu schippern. Eddy machte mich auf eine UKW-Seefunkstelle, ein Satellitentelefon und einen mobilen Datenfunk aufmerksam. Für die Navigation standen Papierseekarten und digitale Seekarten zur Verfügung sowie mehrere Plotter und GPS-Handgeräte. Eine aufwendige Wetterstation mit Datenabruf über Fax sorgte dafür, dass man vor Unwettern rechtzeitig gewarnt wurde, sich aber mit Barograph und Anemometer sowie einem Windrichtungsmesser auch selbst ein Bild von den sich ändernden Wetterverhältnissen machen konnte.
Aber warum war ich überhaupt hier? – Ich hatte mit Eddy zusammen vor zwanzig Jahren gemeinsam Anglistik in einer kleinen norddeutschen Universitätsstadt studiert. Wir hatten uns von Anfang an gut verstanden und fast alle Kurse gemeinsam belegt. Ich war in meinem Studium sehr zielstrebig, aber Eddy war ein Träumer, der mich immer wieder ausbremste, weil er mich zu Dingen überredete, die dem Studieren nicht zuträglich waren. Er schleppte mich zu Rockkonzerten, ging mit mir ins Theater oder in irgendwelche verrauchten Jazzkneipen und brachte mich manchmal erst am frühen Morgen nach Hause. Wir waren Freunde, mehr aber nicht. Wir mochten uns, liebten uns aber nicht. Obwohl man auch nicht sagen konnte, dass wir uns gar nicht liebten, das wäre falsch. Ich zumindest gewann ihn über all die Jahre sehr lieb, aber es blieb zwischen uns dennoch eine Barriere bestehen, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst wurden. Es war einfach so, wie es war. Eddy hatte eine Idee und schon ging es los. Wir fuhren mit seiner alten Ente nach Berlin, wo Freunde von ihm in der Hausbesetzerszene aktiv waren, blieben ein paar Tage dort, bis uns das dauernde Politisieren banalster Ereignisse auf die Nerven fiel, fuhren weiter nach Frankfurt zu einer Aufführung von Strawinskys »Le Sacre«, und weil das Wetter schön war, ging es anschließend an die holländische Küste, wo wir nach Terschelling übersetzten und dort ein paar Tage Sand und Sonne genossen.
Während es mir nebenher gelang, meine Studien voranzutreiben und die notwendigen Leistungsscheine zu absolvieren, dümpelte Eddy immer mehr auf der Stelle und verlor nach und nach die Lust am Studium. Eigentlich brauchte er auch nicht zu studieren, denn Eddys Eltern waren sehr reich. Seinem Vater gehörte ein Sachbuchverlag, und es galt als ausgemacht, dass Eddy die Verlagsleitung eines Tages übernehmen würde. Sein Vater hätte es allerdings lieber gesehen, wenn Eddy Betriebswirtschaft studiert hätte, anstatt Anglistik. Aber Eddy argumentierte, dass der Sachbuchverlag auf Dauer nicht nur auf eigene Autoren zurückgreifen dürfe, sondern sich in Richtung der englischsprachigen Märkte öffnen müsse. Dort gebe es erprobte Sachbücher in Hülle und Fülle, die man nur zu übersetzen brauche. Der Vater ließ seinen Sohn gewähren, weil er nicht ahnte, dass wir an der Uni vorwiegend Shakespeare, Lord Byron und Oscar Wilde lasen und keine Ratgeber mit Titeln wie:How to repair the car without tools.
An einem heißen Sommertag kurz vor den Semesterferien hatte mich Eddy zum Schwimmen abgeholt. Er stand plötzlich mit seiner Gitarre in der Hand und einem Handtuch um den Hals vor der Tür. Ich konnte seiner charmanten Aufforderung zum Nichtstun mal wieder nicht widerstehen. Wir fuhren raus aus der Stadt zu einem kleinen See, schwammen eine Runde, lagen dann nass auf unseren Handtüchern und blickten in den Himmel.
»Wie soll es jetzt mit dir weitergehen?« fragte ich Eddy, denn er hatte die Abschlussklausuren versäumt und konnte damit nicht einmal mehr sein Grundstudium abschließen.
»Ich weiß es nicht«, sagte er, »ich suche immer noch nach dem Ort, an dem ich leben möchte.«
»Und diesen Ort findest du hier nicht?«
»Nein, ich möchte irgendwo leben, wo man einfach nur sein darf, wo niemand Anforderungen oder Erwartungen an einen stellt und wo man selber den Dingen ganz unvoreingenommen und absichtslos entgegentritt.«
»Wo auf dieser Welt könnte das sein?« fragte ich.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete Eddy. »Wenn ich mir diesen Ort vorzustellen versuche, dann füllt sich mein Hirn nur mit blauer Farbe. Da ist nichts anderes als dieses Blau. Es ist weder ein majestätisches, noch ein himmlisches Blau, kein Königs- und kein Preußischblau, kein Indigoblau, kein Malvenblau, es ist ein Blau ohne Eigenschaften.«
»Vielleicht ein Marineblau…«, sagte ich.
»Nein«, sagte Eddy.
»Ein Kristallblau, Distelblau oder Jeansblau?«
»Auch Quatsch!«
»Ein Eisvogelblau, Enzianblau, Flieder-, Glockenblumen-, Chagall-, FDJ-, Lufthansa-, Turnmatten- oder Kornblumenblau?«
»Hör auf damit!«
»Oder ein Mitternachts-, nein Neptunblau?«
»Du machst dich über mich lustig…«
»Nein, jetzt habe ich es: Ein Kosmosblau, ja ein Kosmosblau, das ist es, was du suchst…«
In diesem Moment packte Eddy mich und hob mich in die Höhe. Ich kicherte und zappelte, doch er war viel stärker als ich. Er trug mich zum Seeufer und warf mich einfach ins Wasser.
»Waaasseeerblaaaau«, rief ich, nachdem ich wieder aufgetaucht war, doch Eddy wandte sich kopfschüttelnd ab und ging zurück zu unserem Liegeplatz.
Als ich wenig später ebenfalls dort eintraf, spielte Eddy Gitarre. Er sah mich an und sang:
All the men would turn their head
When she walked down the street
Clothes are fine and hair that shine
Smiling oh so sweet, smiling oh so sweet
Got a taste of all religion
Comes on with the new
In her hair a yellow ribbon
And she's decked out all in blue
Das Lied stammte von Van Morrison und hieß »Madame Joy«.
4
In den Semesterferien sahen wir uns nicht. Eddy war plötzlich nicht mehr erreichbar. Ich versuchte ein paar Mal, ihn anzurufen, aber die Mitbewohner in seiner WG hatten keine Ahnung, wo er steckte. Ich fuhr nach Hause, besuchte meine Eltern und einige Freunde, nahm einen Ferienjob in einem Buchladen an und kam erst im Oktober zurück an den Campus. Das Semester hatte begonnen und die ersten Seminare liefen schon, da tauchte Eddy eines Tages wieder auf. Seine Haare trug er kürzer als gewöhnlich und er sah deutlich gepflegter aus.
»Ich wollte mich verabschieden«, sagte er, als er vor meiner Tür stand. »Ich fange im Verlag meines Vaters an. Mir bleibt nichts anderes übrig. Der Alte hat mir den Geldhahn zugedreht.«
»Möchtest du nicht reinkommen?« fragte ich.
»Besser nicht«, sagte er, »mir dämmert gerade zum ersten Mal, was ich in meinem zukünftigen Leben vermissen werde.«
»Lord Byron? Oscar Wilde? Shakespeare?«
»Nein, Mrs. Taylor wird mir fehlen. Ich hatte mich so an sie gewöhnt.«
»Du hast ein Auto und könntest mich ab und an besuchen.«
»Nicht einmal das hat er mir gelassen. Ich muss jetzt mit der Bahn fahren. Aber wenn du mit dem Studium fertig bist, dann melde dich bitte mal«, sagte Eddy.
»Wozu das?« fragte ich ein wenig gereizt, weil es mich offensichtlich verletzte, dass er aus meinem Leben verschwinden wollte, ohne sich dabei die geringste Mühe zu geben, an so etwas wie eine Wiedersehensmöglichkeit auch nur zu denken.
»Wir können dann im Verlag bestimmt eine Übersetzerin gebrauchen«, sagte Eddy.
»Ich hatte nicht vor, einmal Ratgeber wieAlone and happyins Deutsche zu übertragen.«
»Ich hatte auch nie vor, einen Verlag zu leiten. Aber so ist das Leben. Man muss nehmen, was kommt.«
»Sie haben dir nicht nur die Haare geschnitten, oder?«
Eddy lachte. »Nein, sie haben mir auch alle Flausen aus dem Kopf entfernt, sogar meine Gitarre habe ich schon seit drei Monaten nicht mehr angerührt.«
»Und das ist jetzt der Ort, zu dem du wolltest, das ist das Blau ohne Eigenschaften?«
»Bitte nicht davon anfangen, sonst kommen mir die Tränen«, sagte Eddy und hörte auf zu lachen.
»Also«, sagte ich.
»Also«, sagte Eddy. Dann schwiegen wir beide. Schließlich reichten wir uns die Hand. Nicht einmal mehr eine Umarmung wollte uns gelingen. Eddy nickte, ich nickte, aber keiner von uns hätte zu sagen gewusst, was dieses Nicken bedeuten sollte. Es wirkte wie eine erzwungene Bejahung des Schicksals. Dann drehte sich Eddy um und ging fort. Das war vor zwanzig Jahren.
Es ist nicht so, dass wir danach keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Nur gesehen haben wir uns seither nicht mehr. Das Verrückte war, dass ich nach meinem Studium tatsächlich in seinem Verlag anfing, um Ratgeber aus dem Englischen zu übersetzen. Wir telefonierten ein paar Mal, er schickte mir einen Vertrag, den er bereits unterzeichnet hatte, und das war‘s. Die Bücher, die ich übersetzen sollte, kamen dann per Post. Ich las sie, übertrug sie ins Deutsche und schickte das Manuskript zurück an den Verlag. In den ersten Jahren war ich höchstens zwei- oder dreimal im Verlagsgebäude, um irgendwelche bürokratischen Dinge zu klären. Wenn ich ehrlich sein soll, ging ich nur dort hin, um vielleicht zufällig auf Eddy zu treffen. Doch er war nie vor Ort. Immerzu hielt er sich angeblich gerade geschäftlich im Ausland auf und seine Sekretärin fertigte mich stets mit einem einstudierten Ton des Bedauerns ab.
Einmal traf ich auf seinen Vater. Wir kamen ins Gespräch, und da ich schon mal die lange Reise gemacht hatte, lud er mich auf einen Kaffee ein. Der Vater war klein und wirkte in seinem feinen grauen Anzug mit rotem Einstecktuch auf mich wie ein Baron. Vor meinem inneren Auge sah ich ihn mit einem Monokel im Auge. In Wirklichkeit aber trug er nicht einmal mehr eine Brille. Wir sprachen ein wenig über meine Arbeit. Der Alte wollte wissen, ob mir das Übersetzen gefalle und wie ich Kontakt zu seinem Verlag aufgenommen hätte. Ich sagte ihm, dass ich mit seinem Sohn zusammen studiert hatte. Er lächelte.
»Studiert?« sagte er amüsiert. »Das mag auf Sie zutreffen, sonst wären Sie ja heute nicht hier. Aber mein Edwin hat bestimmt nicht studiert, der macht nur Sachen, die ihm von selbst in den Schoß fallen. Arbeiten, lernen, etwas aus sich machen, das sind Dinge, die sind ihm völlig fremd.«
Ich wunderte mich über das offenherzige Gespräch, das vielleicht zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter angebracht gewesen wäre, aber nicht zwischen zwei Menschen, die sich völlig fremd waren.
»Ich kenne ihn auch anders«, versuchte ich, eine Lanze für Eddy zu brechen, was ich sogleich bereute, denn auf Nachfrage des Alten fiel mir auf Anhieb nichts ein. Erst nach einigem Nachdenken sagte ich: »Er spielt gut Gitarre. Das hat er sich ganz allein beigebracht, quasi im Selbststudium.«
»Oh ja, Gitarre spielen kann er«, sagte der Alte und schien sich an etwas zu erinnern, das ihm offensichtlich Vergnügen bereitete. »Und es hätte aus ihm auch etwas werden können, wenn er sich mehr Mühe gegeben hätte. Ich wollte ihm einen Gitarrenlehrer besorgen, nicht irgendeinen, einen richtig guten, aber da hat er aus Trotz die Gitarre an den Nagel gehängt. So ist mein Sohn, glaubt immer, dass er bereits angekommen ist, statt sich auf den Weg zu begeben, um dem Ziel erst entgegen zu streben.«
Ich wandte ein, dass ich während unserer Studienzeit nicht das Gefühl gehabt hätte, dass er sich irgendwo angekommen fühlte, sondern es sei mir eher so vorgekommen, als ob er immerzu auf der Suche gewesen wäre.
»Waren Sie an der Universität ein Paar?« fragte der Alte mich jetzt geradeheraus.
»Nein«, sagte ich, »wir waren nur Freunde.«
»Schade«, sagte der Alte, »Sie hätten eine ganz passable Schwiegertochter abgegeben.« Er reichte mir die Hand und lachte. »Ich muss jetzt leider in den Aufsichtsrat«, sagte er dann, »den Herrn Sohn vertreten, der sich in Amerika herumtreibt. Wenn Sie mal wieder in der Nähe sind, dann besuchen Sie mich doch. Es war reizend, mit Ihnen zu plaudern.«
Ich versprach es ihm. Er war schon fast auf dem Flur verschwunden, da lief ich ihm hinterher.
»Sagen Sie, ist es nicht möglich, Ihren Sohn hier vor Ort einmal anzutreffen?«
Der Alte sah mich erschrocken an, und in meiner Phantasie fiel ihm dabei das Monokel aus dem aufgerissenen Baronsauge.
»Ich verrate Ihnen etwas«, sagte er, fasste mich am Arm und führte mich an den Rand des Flurs, so als ob wir dort vor eventuellen Lauschangriffen sicher wären. »Edwin studiert an der Universität in Oregon. Er macht dort seinen Abschluss in Verlagswesen. Den braucht er, um hier ernstgenommen zu werden. Hier in Deutschland würde er das nicht packen, deshalb Oregon. Wir haben dort unter den Dozenten Bekannte, verstehen Sie?«
Ich nickte.
»Es ist wie mit einem Arzt. Wenn er keinen Doktortitel hat, dann traut man ihm nicht«, sagte der Alte und fügte mit schelmischem Blick hinzu: »Dabei hätte man bei dem einen oder anderen Arzt allen Grund, ihm nicht zu trauen, wenn man wüsste, wie er zu seinem Doktortitel gekommen ist.« Der Alte lachte wieder, zwinkerte mir noch einmal zu und verschwand.
5
Murad Kemal stand auf, nahm von einem kleinen Glastischchen mit geschwungenen Bronzebeinen eine Karaffe Wasser und ein sauberes Glas und stellte beides vor Arianne auf den Tisch.
»Hier«, sagte er, »trinken Sie. Sie müssen von dem vielen Reden durstig sein.«
Arianne bedankte sich und trank das Glas in einem Zug leer. Murad Kemal goss sogleich nach und stellte die Karaffe neben das Glas auf den zerkratzten Tisch.
»Ich kann Ihnen einen heißen Tee kommen lassen«, sagte er.
Arianne winkte ab.
»Oder eine Kleinigkeit zu essen.«
»Vielen Dank«, sagte Arianne, »ich bekomme derzeit nichts runter.«
Kemal nickte voll Verständnis, setzte sich an den Schreibtisch zurück und strich zwei Mal ausführlich mit Zeige- und Mittelfinger über seinen Oberlippenbart.
»Stehe ich jetzt unter Mordverdacht?« fragte Arianne und sah Kemal direkt in die Augen.
Kemal hüstelte. »Wir haben weder eine Leiche, noch haben wir Spuren auf dem Boot entdeckt, die auf einen Kampf hinweisen. Wenn Sie eine plausible Antwort auf die Frage haben, wo Eddy Stein geblieben ist, dann sicherlich nicht. Aber selbstverständlich müssen wir auch in diese Richtung ermitteln, vor allem, wenn Sie nichts Aufklärendes zum Verbleib von Herrn Stein beitragen können.«
»Welches Motiv sollte ich gehabt haben, ihn umzubringen?« fragte Arianne.
»Nun Habgier war es sicherlich nicht«, sagte Kemal lächelnd. »Sie konnten das Segelboot ja nicht einmal mehr bedienen, was also hätten Sie damit anfangen wollen?«
»Na also«, sagte Arianne, als ob die Sache damit aus der Welt wäre.
»Aber es gibt selbstverständlich noch zahlreiche andere Motive, die man in Betracht ziehen müsste«, wandte Kemal ein, »zumal wenn es um eine Beziehung zwischen Mann und Frau geht, da ist einiges möglich. Vielleicht war es aber auch nur ein Unfall.«
»Sie dürfen nicht aufhören, ihn zu suchen«, sagte Arianne und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, so dass der Wasserspiegel in der Glaskaraffe hin- und her schwappte. »Er ist ein guter Schwimmer, er kann sich stundenlang über Wasser halten. Ich bin mir sicher, er lebt noch, er ist da draußen, er ... «
»Wir haben einen Hubschrauber und mehrere Boote im Einsatz«, sagte Kemal. »Wenn er noch lebt, dann werden wir ihn finden. Meine Leute geben so schnell niemanden verloren.«
»Sie werden ihn finden, ich bin mir ganz sicher, das Meer war ruhig, warum sollte er nicht ein paar Stunden ausgehalten haben?«
»Das ist möglich«, sagte Kemal, blickte dabei aber besorgt zur Uhr, nahm dann demonstrativ den Kugelschreiber wieder zur Hand und rückte die Papiere zurecht.
»Wollen wir weiter machen?« fragte er.
»Sofort«, sagte Arianne. »Ich muss nur noch ein wenig nachdenken.«
6
In all den Jahren haben wir uns, wie gesagt, nicht ein einziges Mal gesehen. Es gab Telefonate und in späteren Jahren ein paar kurze E-Mails, aber zu einem persönlichen Gespräch unter vier Augen ist es nie gekommen. Nachdem Eddy aus den USA zurückgekommen war, mied ich den Verlag. Der Grund war, dass ich zwischenzeitlich geheiratet hatte. Ich war mit meinem Mann rund zehn Jahre zusammen, dann trennten wir uns. Ich wollte ein Kind, er nicht. Aber das ist eine andere Geschichte, die mit Eddy nichts zu tun hat. Da mein Mann gut verdiente, hängte ich den Job als Übersetzerin eines Tages an den Nagel und versuchte mich als Kinderbuchautorin. Ich veröffentlichte fast jedes Jahr ein neues Buch, aber es reichte nicht aus, um davon leben zu können.
Nachdem ich mich von meinem Mann hatte scheiden lassen, traute ich mich nicht, die früheren Kontakte zum Stein-Verlag wieder aufzufrischen. Ich suchte mir also eine andere Übersetzungstätigkeit. Schon bald bereitete ich Klatschgeschichten über Prominente in Amerika für ein buntes deutsches Blatt auf. Zusammen mit meinem Honorar als Autorin kam ich mehr oder weniger gut über die Runden. Nein, wenn ich ehrlich sein darf, war mein Leben sehr bescheiden. Ich musste streng haushalten, konnte in all den Jahren keinen Urlaub machen und habe mir auch sonst vielerlei Genüsse versagen müssen.
Ab und an dachte ich in diesen Jahren schon noch mal an Eddy, und ich fragte mich, was gewesen wäre, wenn ich, so wie er, einen Vater als Verleger gehabt hätte. Wäre ich dann jetzt eine berühmte Autorin? Hätte ich dann Geld genug, um ohne Zeitdruck meine Bücher zu schreiben und sie in Ruhe reifen zu lassen? Wahrscheinlich war ich ein wenig neidisch, zumal ich mitbekam, dass der Stein-Verlag mittlerweile auch eine belletristische Abteilung eingerichtet hatte und das Geschäft sehr gut zu laufen schien. Man hatte sich einen neuen Verlagssitz auf der grünen Wiese gebaut. Der alte Stein war gestorben und Eddy regierte das Imperium jetzt allein, übrigens mit einem Doktortitel in Verlagswesen. Entweder waren die Beziehungen der Steins nach Oregon wirklich ungewöhnlich gut oder Eddy hatte sich geändert und war aufgewacht.
Man wundert sich, wie schnell zehn Jahre im Leben vergehen, wenn man kaum Abwechslung hat und jeder Tag sehr ähnlich abläuft. Ich stand nach meiner Scheidung Morgen für Morgen zur selben Stunde auf, setzte mich nach einer Tasse Kaffee an den Schreibtisch und schrieb ein paar Seiten. Die Qualität des gesamten Tages hing von dieser frühmorgendlichen Schreibtätigkeit ab. Verlief sie gut, und ich hatte ein paar gute Zeilen zustande gebracht, dann war der ganze Tag gut, gleichgültig, was noch geschah. Bekam ich aber am Morgen nichts Rechtes auf das Papier, dann war den ganzen Tag über schlechte Laune angesagt, auch wenn das Wetter noch so schön war oder ich freundliche Briefe von meinen Lesern erhielt. Am Nachmittag trieb ich meistens Sport. Ich bildete mir ein, dass mein Körper vom vielen Sitzen am Schreibtisch früher oder später aus der Form gehen würde. Aus diesem Grund glaubte ich, gegensteuern zu müssen. Ich war nie korpulent, aber an der Uni habe ich deutlich ein paar Kilo mehr auf den Rippen gehabt als heute. Freunde von mir sagen, ich sei durch den Sport viel zu ausgezehrt und zu dünn geworden, und selbst Eddy hatte mich nach zwanzig Jahren zunächst nicht wiedererkannt.
Ich will nicht verheimlichen, dass ich mit dem exzessiven Sportreiben erst nach ein oder zwei Jahren meines Alleinlebens angefangen habe. Der Grund dafür war nicht mein körperliches, sondern mein seelisches Befinden. Bevor ich mir das erste Paar Laufschuhe kaufte, saß ich ein halbes Jahr in der Psychiatrie. Und das kam so: Ich hatte ein neues Jugendbuch in Angriff genommen. Der Arbeitstitel lautete:Wofür es sich zu leben lohnt.Ich wollte eine Geschichte schreiben, die jungen Leuten Lebenssinn vermittelt, aber ich erlitt mit der Arbeit schweren Schiffbruch. Mir fiel einfach nichts ein, wofür es sich zu leben lohnt. Ich meine nichts, was nicht abgedroschen und besserwisserisch geklungen oder die altbekannten Weisen von Liebe, Freundschaft, Vertrauen und so weiter neu besungen hätte. Das waren aber alles nur Begriffe, Petrefakte, die man nicht empfinden konnte, wenn man über sie sprach. Man musste sie darstellen, musste zeigen, was sie bedeuteten, aber eben das gelang mir nicht. An die zehn Mal fing ich mit dem Buch an, und jedes Mal war nach fünfzehn bis zwanzig Seiten Schluss. Die Figuren besaßen kein Leben, sie dienten nur als Stellvertreter eines höheren Ideals und waren deshalb blutleer und langweilig. Ließ ich die Figuren aber ihr eigenes Leben leben, so liefen sie mir aus dem Ruder und stellten statt Liebe und Freundschaft allerhand Unsinn an, den ich auf gar keinen Fall an die junge Generation vermitteln wollte. Mehr und mehr wurde ich mir meiner schriftstellerischen Ohnmacht bewusst, mir wurde klar, dass nicht ich mit meinen Figuren schalten und walten konnte, wie ich wollte, sondern dass eine andere Macht sie lenkte, eine Macht, die aus ihnen selbst heraus erwuchs, aus der simplen Tatsache, dass sie aus Sprache bestanden und diese Sprache offensichtlich ihre eigenen Intentionen verwirklichen wollte und nicht die meinen. Tat ich ihnen aber Gewalt an, um sie quasi gegen ihren Willen hierhin oder dorthin zu dirigieren, dann versanken sie sogleich in die Bedeutungslosigkeit.Ich zweifelte immer mehr an mir, wurde schließlich depressiv und verlor all meine Lebensfreude. Eines Tages sah ich selber ein, dass ich Hilfe brauchte, und begab mich in Behandlung. In dieser Zeit fragte ich mich und wurde ich immer wieder gefragt, wo ich eigentlichhinwollte. Ich versuchte, für mich ein Ziel zu erkennen, ein persönliches kleines Ziel. Aber ich blickte nur ins Nichts. Und dann, dann dachte ich eines Tages immer öfter an das Blau, von dem Eddy einst gesprochen hatte, an dieses Blau ohne Eigenschaften. Wenn ich die Augen schloss, dann füllte es mich manchmal vollständig aus. Ich atmete tief und leicht und mein Körper fühlte sich schwerelos an. Zuweilen konnte ich über eine Stunde so in meinem Zimmer sitzen und mich in dieses Blau hineindenken. Immer mehr wurde dieses Blau für mich zu einem realen Ort der Geborgenheit, Ruhe und Innerlichkeit. Mein Leben, meine Niederschläge, meine Fehler, alles kam mir unwichtig und kleinlich vor, solange ich in dieses Blau zurückkehren durfte. Und dann begriff ich, dass auch meine Romanfiguren nur lebten und sinnvoll agierten, wenn sie auf der Grundlage dieses alles durchwirkenden Blaus ihren Eigensinn ausleben durften, wenn ich nicht mehr verlangte, dass sie dies und das zu bedeuten haben sollten, sondern wenn ich ihnen zugestand, von sich aus bedeutend zu sein.
Es war für mich ein Schock und eine Freude zugleich, als mich Eddy Stein vor einigen Wochen anrief, um mich zu fragen, ob wir uns nicht nach all den Jahren noch einmal persönlich treffen wollten. Was meine Gefühle aber besonders durcheinanderbrachte, das war nicht das Wiedersehen mit ihm, sondern dass er mir am Telefon verriet, er habe endlich den Ort gefunden, an dem er sich Zuhause fühle. Er drängte darauf, mir diesen Ort zeigen zu wollen, und ich willigte ein, und zwar fast so schnell, wie ich früher immer auf seine Vorschläge, die Uni zu schwänzen, eingewilligt hatte. Ich verstand nur so viel, dass er ein Segelboot besaß, auf das er mich einladen wolle, um mit mir eine kleine Fahrt zu machen. Da ich schon viele Jahre keinen Urlaub mehr gemacht hatte, kam mir das Angebot verlockend vor.
Ein paar Tage später wurde mir ein Brief mit einem bezahlten Flugticket zugestellt. Aus dem Brief ging hervor, dass Eddy schon längere Zeit in der Türkei auf seinem Boot lebte. Er hatte mir eine Liste beigelegt, was ich für unseren geplanten Törn alles benötigte, hatte mir genau aufgeschrieben, wie ich vom Flughafen Dalaman aus zu ihm in den Hafen von Marmaris gelangen könne und schrieb darüber hinaus, dass er sich sehr auf unser Wiedersehen freue.
7
»Weißt du, hier in Küstennähe hat die Farbe des Wassers, bedingt durch die vielen Schwebeteilchen und Nährstoffe, eine eher graue Farbe«, sagte Eddy, nachdem wir auf dem Vorderdeck ausgiebig zu Abend gegessen hatten und die Sonne nur noch eine Handbreit über dem Horizont hervorlugte. In der Ferne sah man die Küste, die aus einem gemischten Streifen weißer und orangener Lichter bestand, die über dem Meer zu schweben und zu flimmern schienen. Manchmal flogen Seevögel und durchreisende Kraniche über das Boot und sahen überrascht auf uns herab, als ob sie uns hier nicht erwartet hätten.
»Für uns sieht das graue Wasser nicht so hübsch aus, obwohl es weitaus nährstoffreicher ist als das Wasser inmitten des türkisfarbenen Ozeans.«
Eddy philosophierte wohl zehn Minuten über die Farbe des Meerwassers. Er erzählte von Nährstoffen und Schmutz und erklärte mir, dass Wassermoleküle die Eigenschaft besäßen, das blaue Licht am stärksten zu streuen, während die Planktonpartikel fähig seien, auch andere Farben als nur Blau zu reflektieren, so dass es aussehe, als ob das Wasser grau oder sogar leicht grünlich wäre.
Ich hörte ihm nur oberflächlich zu. Nach dem Essen war ich müde geworden. Eddys Kochkünste waren überwältigend gewesen. Er hatte ein perfektes Candlelight-Dinner an Deck veranstaltet, eine leichte Suppe mit frischem Brot serviert, zahlreiche Meeresfrüchte als Hauptgang zubereitet und zum Nachtisch türkischen Halva mit einer Feigensauce kredenzt. Wir tranken dazu nicht ganz stilecht Rotwein, obwohl Eddy betonte, dass Alkohol an Bord nicht gern gesehen werde, und genossen den herrlichen Sonnenuntergang. Manchmal flatterten handtellergroße Insekten um die Kerzen herum und ich zuckte zusammen. Doch Eddy sagte, ich brauche mich nicht zu fürchten, es seien harmlose Nachtfalter, die nur etwas irritiert seien, dass um diese Zeit noch Licht auf dem Meer brenne.
Als es etwas frischer wurde, drehte Eddy die Segel wieder in den Wind und sagte, wir seien noch längst nicht da, wo wir hinwollten, sondern müssten jetzt noch eine längere Strecke zurücklegen. Das Boot nahm sogleich Fahrt auf und ich stellte mich zu Eddy aufs Achterdeck neben das Steuerrad.
»Wenn der Wind so bleibt, dann kommen wir gut voran«, sagte Eddy.
»Müssen wir hier die ganze Zeit stehen?« fragte ich, da es ohne die Sonne von Minute zu Minute kühler wurde und mir eine schlaflose Nacht unterm Sprayhood auf dem Brückendeck wenig romantisch erscheinen wollte.
»Nein, ich schalte jetzt auf Autopilot und dann haben wir Zeit füreinander«, sagte Eddy.
Ich lachte, weil ich das für einen Scherz hielt, staunte aber nicht schlecht, als Eddy mir die Selbststeueranlage für Segelboote erklärte. Er stellte über eine digitale Anzeige den Kurs ein und schon fuhr das Boot ohne Kapitän.
»Und wenn uns ein anderes Boot entgegenkommt?« fragte ich besorgt.
»Dann schlägt der Autopilot Alarm oder weicht einfach von selber auf einen anderen Kurs aus«, antwortete Eddy.
»Wie haben die Menschen sich nur auf dem Meer zurechtgefunden, als es noch keine moderne Technik gab?« seufzte ich.
»Auch unsere Vorfahren hatten allerhand Tricks auf Lager«, sagte Eddy. »Ich habe mal einen Kursus in antiker Navigation mitgemacht. Da haben wir versucht, uns auf See nur mit Steinlot und Gnomon zu orientieren.«
»Waren die beiden nett?«
»Ach du! Ein Steinlot ist ein Senkblei an einem langen Seil, mit dem man die Meerestiefe misst und ein Gnomon ist ein Stöckchen oder etwas Ähnliches, mit dem man den Schatten der Sonne bestimmt.«
»Und damit ausgerüstet findet man exakt zur Bar des nächsten Yachthafens?«
»Ist mehr etwas für die grobe Orientierung«, sagte Eddy und führte mich unter Deck. Dazu gingen wir vier Holzstufen hinab. Rechts befand sich eine winzigkleine Küche mit Herd und Spüle, auf der linken Seite gab es ein WC und eine Dusche. Dann folgte eine Art Wohnraum mit zwei an den Wänden verschraubten Sofas, die sich gegenüberstanden. Dazwischen befand sich ein Tisch. Schließlich warf ich auch noch einen Blick in das Schlafzimmer, das schräg in den Kiel eingebaut worden war und das aus einem Doppelbett und einem Polsterstuhl bestand. Wir gingen zurück, nahmen auf den beiden zweisitzigen Sofas Platz und Eddy schenkte uns erneut Rotwein ein.
»Schon ein bisschen verrückt«, sagte ich, »wenn man bedenkt, dass dein Wohnzimmer mitten auf dem Meer schwimmt. Alles sieht so sicher und massiv aus, aber bei Sturm fliegt man bestimmt von einer Ecke in die andere.«
»Es ist erstaunlich, womit man einen Menschen beruhigen kann«, stimmte Eddy mir zu. »Vier Wände und ein Dach über dem Kopf und schon fühlt er sich sicher und geborgen.«
»Wir sind halt immer noch die alten Höhlenmenschen«, sagte ich.
»Mag sein«, erwiderte Eddy, »aber stelle dir vor, wir müssten immerzu unsere Ängste aushalten und könnten uns nicht über sie hinwegtäuschen. Welcher Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass man sich nicht nur auf dem Meer befindet, das jeden Moment vom Sturm aufgepeitscht werden und einen ersäufen kann, sondern dass man in dieser ohnehin schon lebensbedrohlichen Situation gleichzeitig noch auf einem Planeten durch den Weltraum jagt, der vielleicht im nächsten Moment mit einem riesigen Kometen zusammenkracht.«
»Und damit nicht genug, könnte man bei alldem auch noch einen richtig fiesen Schnupfen haben«, sagte ich.
Eddy blickte mich verwundert an. »Jetzt«, sagte er, »jetzt habe ich dich wiedererkannt. Ja, das ist typisch für dich. Eigentlich müsste ich dich sofort ins Wasser werfen.«
»Geschichte darf sich nicht wiederholen«, sagte ich, »das weißt du doch.«
»Ja, und dennoch habe ich das Gefühl, sie wiederholt sich gerade«, sagte Eddy und trank von seinem Wein.
»Werden es schöne zwanzig Jahre sein, die dir noch einmal bevorstehen?« fragte ich.
»Weißt du, am Anfang war alles wie ein Spiel«, antwortete Eddy und blickte plötzlich ernst auf den Tisch zwischen uns, als ob dieses Spiel dort stattfände. »Mein Vater gab mir die Spielfiguren und die Würfel in die Hand und ich würfelte fröhlich drauf los. Es konnte ja nichts passieren. Es ging ja um nichts oder nur um sehr wenig. Sagen wir, mein Vater konnte sich die Verluste des kleinen Herrn Edwin leisten. Eine ganze Zeit lang würfelte ich nur Einsen und Zweien, aber dann plötzlich war immer öfter auch mal ein Sechser dabei und das Spiel fing an, mir zu gefallen. Und je mehr es mir gefiel, desto besser und erfolgreicher wurde ich in diesem Spiel. Es schien fast, als ob ich die Würfel verhext hätte. Jeder Wurf, den ich tat, erwies sich als glücklich. Immer mehr Leute scharten sich um mich und sahen mir voller Bewunderung beim Spielen zu, weil sie glaubten, es stecke ein ausgeklügeltes System dahinter. Und je mehr Menschen es wurden, desto mehr keimte der Wunsch in mir auf, dieses Spiel nicht nur weiterhin für alle Zuschauer und Bewunderer gut zu spielen, sondern es auch wieder und wieder gewinnen zu wollen. Eine verhängnisvolle Entscheidung. Denn von da an lief auf einmal alles schief. Die sechs schwarzen runden Punkte des Würfels schienen plötzlich aus Blei zu sein und sorgten dafür, dass immer und immer wieder nur die Eins oben liegen blieb. Der Magier hatte ausgedient. Sein Zauber verfing nicht mehr. Die Bewunderer wandten sich von mir ab und wurden meine schärfsten Kritiker. Einmal muss ich es dir ja doch sagen, warum also nicht jetzt gleich: Ich habe den Verlag meines Vaters durch falsche Entscheidungen in die Insolvenz geführt. Ich wollte etwas Großes daraus machen, ein verlegerisches Flaggschiff, das stolz auf den sieben freien Weltmeeren kreuzt und seine Fahne frech im Wind knallen lässt, und jetzt liegt alles in Trümmern ganz tief unten auf dem Boden des Meeres. Das Unternehmen wurde abgewickelt, die Gläubiger bezahlt, die Mitarbeiter entlassen. Mir selbst gehört heute nichts mehr. Rein gar nichts, außer diesem Küntscher-Nagel um meinen Hals. Selbst dieses Segelboot ist schon verkauft. Der neue Besitzer wird es nächste Woche abholen kommen als Attraktion für einen albernen Dino-Park. Ich bin wieder da, wo ich angefangen habe, und könnte jetzt wieder studieren gehen. Anglistik vielleicht…«
»Ist das wahr?« fragte ich, »du bist pleite?«
»Ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht.«
»Ich bin ja nicht wegen deines vermeintlichen Reichtums hier…«
»Selbstverständlich nicht … entschuldige … ich weiß … «
»Und was willst du jetzt tun?«
»Das, was ich von Anfang an machen wollte, was mir aber niemand zugetraut hat.«
»Gitarrespielen?« »Nein.«
»Was dann?«
»Nichts. Einfach nichts.«
8
»Wir können eine Pause machen, wenn Sie wollen«, sagte Murad Kemal. »Sie sehen angestrengt aus.«
»Nein, das geht gleich wieder«, winkte Arianne ab. »Es ist nur so, dass ich glaube, hier meine Zeit zu verschwenden. Während ich Ihnen alles ausführlich erzähle, würde ich viel lieber bei der Suche helfen. Irgendwo da draußen auf dem Meer, wo man zumindest das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun, statt hier nur herumzusitzen.«
»Es gibt aber leider nichts, was Sie da draußen tun könnten«, sagte Kemal. »Das Vernünftigste, was Sie jetzt machen können, ist es, mit mir zu sprechen. Meine Leute leisten alles Menschenmögliche. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«
Kemal blickte erneut sorgenvoll auf die Uhr. »Ich will Ihnen aber nicht verschweigen, dass es von Minute zu Minute unwahrscheinlicher sein dürfte, Herrn Stein lebend zu bergen. Man kann da draußen im kalten Wasser nur eine begrenzte Zeit überstehen und diese Zeitspanne ist fast herum. Wenn man in diesem Zeitraum nicht gefunden wird, stirbt man an Auskühlung, da nützt es einem nichts, wenn man ein guter Schwimmer ist.«
Arianne schluchzte. Murad Kemal war auf diese Reaktion nicht vorbereitet. Er machte sofort einen Rückzieher und sagte: »Obwohl wir schon Menschen gerettet haben, die deutlich länger im Wasser waren als Herr Stein. Es kommt ja auch auf die Meerestemperatur an und derzeit haben wir Hochsommer, da ist das Meer ein paar Grad wärmer. Man sollte die Hoffnung daher nicht aufgeben.«
Arianne nickte nur und trank einen Schluck Wasser.
»Was Sie mir bislang erzählt haben, das war sehr informativ«, sagte Kemal in freundlichem Ton, erhob sich von seinem Schreibtischstuhl und trat ans Fenster. Er blickte auf die Segelboote im Hafen, rieb sich die müden Schläfen und fügte hinzu: »Wenn es stimmt, dass Herr Stein bankrott ist, dass er alles verloren hat, dann wäre es auch möglich, dass es eine Selbsttötung gewesen ist oder sagen wir besser ein Selbsttötungsversuch. Es fragt sich allerdings, warum er Sie eingeladen hat, dieser Tat beizuwohnen. Andererseits weiß man nie genau, was bei Menschen, die über einen Suizid nachdenken, im Kopf vorgeht. Einige wollen bei ihrer letzten Handlung unbedingt gesehen werden. Andere gehen im Stillen davon. Und wieder andere brechen ihre suizidalen Absichten ab, sobald sie einen körperlichen Schmerz empfinden. – Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein junger Mensch aus Verzweiflung in Istanbul von einer Brücke springen wollte. Um auf die Brücke zu gelangen, musste er aber einen Stacheldrahtzaun überklettern. Dabei verletzte er sich an den Händen und blutete sehr stark. Augenblicklich gab er seinen Selbsttötungsversuch auf und wandte sich, um sein Wohlergehen besorgt, an einen Arzt.«
Kemal lächelte, als er sich an diese Geschichte erinnerte, und Arianne hatte das Gefühl, dass es sich hier nicht um eine dienstliche, sondern eher um eine private Erinnerung handelte. Sie traute sich aber nicht, Murad Kemal nach den näheren Umständen der Geschichte zu befragen.
»Warum sprechen Sie so gut Deutsch?« fragte sie stattdessen.
Kemal wandte sich vom Fenster ab und blickte Arianne mit hochgezogenen Brauen an.
»Ich habe im Alter von zehn Jahren meine Eltern bei einem Autounfall in Istanbul verloren. Meine Tante und mein Onkel, die in Deutschland lebten, holten mich zu sich. Ich ging in Deutschland zur Schule, wuchs dort auf, lernte dort Freunde fürs Leben kennen und absolvierte eine Ausbildung bei der Polizei.«
»Und warum sind Sie nicht in Deutschland geblieben?«
»Der Geschmack der Pistazien«, sagte Kemal, »das Meer nach dem Sturm, die Sprache der Eltern, der Duft des frischen Fladenbrots, das heiße Teeglas zwischen den Fingerspitzen…«
»Ich verstehe«, sagte Arianne. »Haben Sie es nie bereut?«
»Niemals», sagte Kemal. »Wir Türken sagen zwar, Heimat ist da, wo du satt wirst, aber das ist nur ein Sprichwort. In Deutschland habe ich mal den Satz gehört: Es lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein. Auch schön. Die Wahrheit liegt offensichtlich irgendwo dazwischen.«
9
Wir lachten in dieser Nacht sehr viel. Und irgendwann holte Eddy seine Gitarre raus. Es war dasselbe Instrument, das er bereits in seiner Studienzeit besessen hatte. Er klimperte ein wenig darauf herum und sagte: »Das ist jetzt alles, was mir noch geblieben ist, leider habe ich verlernt, darauf zu spielen.« Dann holte er eine weiße Kerze aus einem der Wandschränke und forderte mich auf, mit ihm zu kommen.«
Wir gingen auf das Achterdeck zu einer Badeleiter, die direkt ins Meer führte. Eddy drehte das Segel aus dem Wind und wartete, bis sich das Boot beruhigt hatte und fast zu stehen schien. Er legte die Gitarre auf den Boden, zündete die Kerze an, ließ heißes Wachs auf den Korpus der Gitarre laufen und befestigte die Kerze in der Wachspfütze. Dann nahm er das Instrument, stieg ein paar Stufen an der Bordleiter herab und setzte es samt brennender Kerze behutsam auf das Wasser. Die Gitarre wippte ein wenig im Wellengang auf und ab und verschwand kurz darauf in der Dunkelheit. Nur die Kerze war noch lange in der Ferne zu sehen wie ein winziges flackerndes Irrlicht über dem Moor. Eddy drehte zurück in den Wind und wir segelten weiter.
Ich hatte zu dieser Zeit noch keine Ahnung, dass wir auf das offene Meer hinausfuhren. Ich glaubte, wir kreuzten immer noch in Küstennähe, wunderte mich nur, dass keine Lichter mehr zu sehen waren und der Wind immer stärker und frischer wurde. Eddy stellte eine neue Flasche Wein auf den Tisch, und ich wurde langsam betrunken. Wir fingen an, etwas albern zu werden, erzählten uns Geschichten von früher, von der Uni oder besser von unseren Abenteuern abseits der Uni. Es war eine sehr lustige Nacht, auch wenn die ganze Zeit über eine gewisse Traurigkeit in der Luft hing. Ich fragte Eddy, ob er sein Segelboot nicht vermissen werde, und er sagte, dass er gar nicht wisse, ob er es überhaupt abgebe. Ich wandte ein, dass es doch schon verkauft sei, aber er lachte nur.
»Geh mal unter Deck und schau in alle Schränke«, sagte er irgendwann. »Dort findest du Proviant für viele Monate. Ich kann durch das ganze Mittelmeer segeln, bei Gibraltar in den nordatlantischen Ozean übersetzen und von dort Richtung Südatlantik weiterfahren. Auf lange Zeit brauche ich keinen Fuß mehr an Land zu setzen. Ich habe an Bord alle Technik, die man für diesen Blauwassertörn rund um die Welt benötigt. Und niemand wird mich da draußen finden.«
»Und was mache ich?« fragte ich empört.
»Du musst halt mit mir fahren«, sagte Eddy, »ich brauche eine Crew. Allein zu segeln ist sehr schwierig«
»Und wenn ich das nicht möchte, weil ich vielleicht vorher gerne gefragt worden wäre?«
»Dann setze ich dich irgendwo unterwegs ab, auf irgendeiner griechischen Insel oder auf Sizilien oder wo immer du von Bord gehen möchtest.«
»Du bist verrückt.«
»Nein warte, bis du es selbst gesehen hast«, sagte Eddy.
»Na, was denn?« fragte ich.
»Die Farbe des Wassers weit draußen auf dem Meer«, sagte Eddy und strahlte mich freudig an, »ich glaube, es ist das Blau, das ich immer gesucht habe.«.
10
Ich weiß nicht mehr wie es in dieser Nacht weiterging. Ich weiß nur, dass wir noch mehr tranken, uns stritten, weil ich Eddy nicht abnahm, dass er im Ernst eine solche lange Reise auf sich nehmen wollte. Ich erinnerte ihn daran, dass er immer schon die Möglichkeit und das Potenzial einer Sache weit mehr geschätzt hatte als ihre Verwirklichung. Er gab mir recht, wir versöhnten uns wieder, um uns kurz darauf erneut zu streiten, bis sich am Ende alles heillos konfus in meinem Kopf anfühlte. Einmal in dieser Nacht tanzten wir auch. Ja, ich erinnere mich daran noch sehr gut, weil wir unter Deck unsere Köpfe einziehen mussten, was so komisch aussah, dass wir uns halb totlachten und schließlich auf den Knien weitertanzten, was für noch mehr überschwängliche Heiterkeit sorgte. Irgendwann dann bin ich auf einem der beiden Sofas zusammengebrochen und sofort eingeschlafen.
Das erste, was ich beim Aufwachen wahrnahm, war ein leises Plätschern. Als ich die Augen öffnete, sah ich, wie durch die offene Kajütentür ein rosafarbenes Licht drang. Es sah unwirklich und überirdisch aus, und ich wusste für einen Moment überhaupt nicht, wo ich mich befand. Dann hörte ich Eddys Stimme. Offensichtlich war ich von seinem Rufen wach geworden.
»Nun komm schon Arianne, deshalb sind wir doch hier. Du wirst diesen Moment ja wohl nicht verschlafen wollen.«
Ich raffte mich auf, aber mein Kopf fühlte sich an, als ob mir ein Bleigurt im Nacken säße. Ich hatte Sehstörungen, hinter der Stirn hämmerte es grässlich, meine Zunge klebte wie ein trockenes Stück Holz am Gaumen und ich wankte von einer Seite der Kabine zur anderen.
Mit Mühe kletterte ich die Stufen zum Cockpit aufs Achterdeck. Von Eddy war nichts zu sehen. Stattdessen umfing mich ein unglaubliches Licht. Die Sonne steckte in einer geschwungenen rosafarbenen Schleife, die sich kilometerweit über das Meer spannte. Über der Sonne strahlte durchsetzt von übereinander gestaffelten langen und hauchdünnen Wolkenstreifen ein tiefblauer Himmel, der zum Zenit hin fast schwarz zu werden schien und in dem noch immer ein paar Sterne blinkten.
»Arianne«, hörte ich Eddy erneut rufen. Und jetzt entdeckte ich ihn hinter dem Boot im Wasser. Sein nackter Körper zitterte unter der Wasseroberfläche wie ein Delphin. Zwei, drei Mal blitzte der silberne Nagel um seinen Hals in den ersten Sonnenstrahlen des Tages auf. Doch was mich überwältigte, das war die Farbe des Meeres. Es war von einem Blau, für das es niemals eine exakte Bezeichnung geben wird, ein Blau, das bislang nur in meiner Vorstellung existierte und das hier vor mir in der Realität zu sehen, mich plötzlich ängstigte. Auch kam es mir vor, als ob es nicht gänzlich mit dem von mir vorgestellten Blau identisch wäre. Nein, die Farbe schien zwar richtig zu sein, aber es war, als zeigte sie sich an einem falschen Ort.
Ich begann, mich langsam auszuziehen, aber ich spürte, dass meine Müdigkeit stärker war als der Wunsch, ins Wasser zu gehen. Ich schaffte es nicht einmal mehr, meine Bluse bis zur Hälfte zu öffnen, da sank ich neben dem Steuerrad zu Boden, drehte mich auf den Bauch und schlief wieder ein.
Ich erwachte erst, als die Sonne mir glühend heiß auf den Nacken brannte. Erschöpft erhob ich mich, wankte die Treppen zur Kajüte hinunter und stellte mich unter die Dusche, bis ich einigermaßen wieder klar im Kopf war. Dann ging ich erneut hinaus aufs Deck und suchte Eddy. Aber ich fand ihn nicht. Vor der Badeleiter lagen noch immer seine Kleider, aber von Eddy war weit und breit nichts zu sehen. Ich suchte ihn unter Deck in allen Räumen, aber auch dort war er nicht zu finden. Ich rief laut nach ihm, schrie, er solle rauskommen, weil ich dachte, er habe sich versteckt, aber nichts geschah. Aufgeregt lief ich an der Reling auf und ab und starrte aufs Meer. Dann holte ich ein Fernglas und suchte Zeile um Zeile das Meer ab, aber auch dort war nichts zu sehen. Mein Gemütszustand schwankte zwischen Panik und der Gewissheit, dass er jeden Moment wieder auftauchen würde. Bestimmt war er nur etwas weiter rausgeschwommen. Doch dann bemerkte ich erst, dass die Sonne schon sehr hoch am Himmel stand und Stunden vergangen sein mussten, seitdem ich ihn bei Sonnenaufgang im Wasser gesehen hatte.
In meiner immer größer werdenden Angst kramte ich mein Handy aus dem Rucksack und scrollte die Anrufe durch bis ich den von Eddy fand, mit dem er mich vor