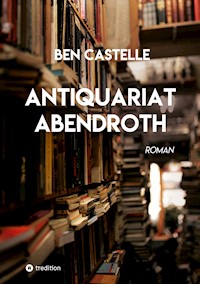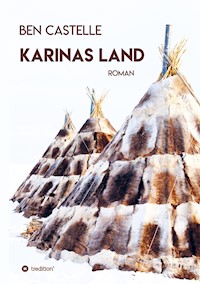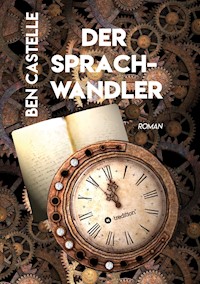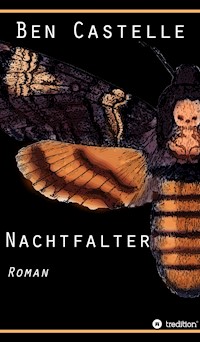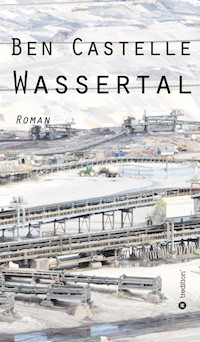
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jens Born, Reporter einer großen Zeitung, kehrt nach einer längeren Auslandsreise in psychisch desolater Verfassung heim. Kaum zu Hause, erfährt er, dass er zum Erben von Haus und Besitz seiner Tante Laura Lenzen bestellt ist, einer Tante, von deren Existenz er bislang nichts gewusst hat. Das Haus liegt jedoch inmitten des Rheinischen Braunkohlereviers und soll schon bald dem Schaufelradbagger weichen. In Gesprächen mit dem Pfarrer des Orts erfährt Jens Born vom erstaunlichen Leben seiner Tante, einem Leben, das sich vor allem der Naturmedizin, dem naturwissenschaftlichen Zeichnen von Blütenpflanzen und dem Kampf gegen den Tagebau verschrieben hatte. Fast nebenbei wird ihm jedoch von ihrem mysteriösen Tod berichtet. Jens Born versucht daraufhin, den angeblichen Unfalltod seiner Tante aufzuklären, und gerät dabei immer tiefer in seine eigene unbekannte Familiengeschichte hinein, in unerwartete Zusammenhänge, in denen sich nach und nach ein Geheimnis entdeckt, das ihn weit zurückführt bis in die Mitte der vierziger Jahre zu den Rumäniendeutschen ins Wassertal bei Oberwischau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ben Castelle
Wassertal
Roman
Über dieses Buch:
Jens Born, Reporter einer großen Zeitung, kehrt nach einer längeren Auslandsreise in psychisch desolater Verfassung heim. Kaum zu Hause, erfährt er, dass er zum Erben von Haus und Besitz seiner Tante Laura Lenzen bestellt ist, einer Tante, von deren Existenz er bislang nichts gewusst hat. Das Haus liegt jedoch inmitten des Rheinischen Braunkohlereviers und soll schon bald dem Schaufelradbagger weichen. In Gesprächen mit dem Pfarrer des Orts erfährt Jens Born vom erstaunlichen Leben seiner Tante, einem Leben, das sich vor allem der Naturmedizin, dem naturwissenschaftlichen Zeichnen von Blütenpflanzen und dem Kampf gegen den Tagebau verschrieben hatte. Fast nebenbei wird ihm jedoch von ihrem mysteriösen Tod berichtet.
Jens Born versucht daraufhin, den angeblichen Unfalltod seiner Tante aufzuklären, und gerät dabei immer tiefer in seine eigene unbekannte Familiengeschichte hinein, in unerwartete Zusammenhänge, in denen sich nach und nach ein Geheimnis entdeckt, das ihn weit zurückführt bis in die Mitte der vierziger Jahre zu den Rumäniendeutschen ins Wassertal bei Oberwischau.
Impressum
© 2018 Ben Castelle
Umschlag, Illustration: Ben Castelle Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7469-2100-6 (Paperback)
978-3-7469-2101-3 (Hardcover)
978-3-7469-2102-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
für Martina
in Erinnerung an unsere Kölner Jahre
WENN MAN NACH einem längeren Auslandsaufenthalt nach Hause kommt, hat man fast immer das Gefühl, die Wohnung sei kleiner geworden, die Wände stünden dichter beieinander und durch irgendeine Perfidie sei es dem Obermieter gar gelungen, die Decke um einen halben Meter absenken zu lassen. Auch stößt man sich nicht selten an Möbelstücke, an denen man sich bislang noch nie gestoßen hat, empfindet die einst sorgfältig ausgesuchte Tapete als kolossalen Missgriff, erkennt in den Bildern, die vor dieser Tapete hängen, nur deren disharmonisches Verhältnis zur Umgebung und begreift im großen und ganzen nicht, wie man es nur jemals in einer solchen geschmacklosen Enge hat aushalten können.
Doch als ich nach vier Wochen Abwesenheit meine Wohnung betrete, wirkt merkwürdigerweise alles heller, größer und aufgeräumter auf mich. Und auch die Bilder an den Wänden erscheinen mir keinesfalls so, als ob ein Farbenblinder sie dort aufgehängt hätte oder jemand, der für Proportionen nicht das geringste Augenmaß besaß, sondern sie erscheinen mir, kurz gesagt, überhaupt nicht. Denn die Bilder und mit ihnen die Hälfte meines Mobiliars haben sich in Luft aufgelöst. Ganze Bücherregale samt Büchern und Schränke mit ihrem Inhalt sind verschwunden, und nur ein paar helle Konturen an den Zimmerwänden scheinen unaufdringlich vorschlagen zu wollen, wie eine clevere Auf- und Einteilung der Wohnung aussehen könnte, vorausgesetzt, jemand verfügte über die finanziellen Möglichkeiten, die nur angedeuteten Schemen mit materieller Wirklichkeit auszufüllen.
Zwar steht mein alter Schreibtisch noch dort, wo er immer gestanden hat, und auch ein Sessel sowie der Computertisch samt Computer haben dem um sich greifenden Nichts getrotzt, doch scheint die Wohnung insgesamt an Wirklichkeit verloren und an Möglichkeiten gewonnen zu haben. Weil ein Teil der Teppiche fehlt, hat allerdings die Akustik der Räume stark gelitten, und als ich ein paarmal »eins-zwei-eins-zwei« rufe, als ob ich eine Lautsprecheranlage testen wollte, stelle ich fest, dass es eine Art von Kellerhall ist, der jetzt in meiner Wohnung herrscht.
Besonders drastisch aber ist der Anblick, der sich mir im Schlafzimmer bietet. Eines von den beiden Betten, die viele Jahre hindurch Seite an Seite wie fest miteinander vertäute Boote im Hafenbecken ruhten, hat den Anker gelichtet und ist in See gestochen. An seiner Stelle befindet sich auf dem Fußboden ein ungefähr zwei Meter mal ein Meter großes Rechteck aus circa einem Zentimeter dicken Staub.
Noch im Mantel öffne ich den Besenschrank, um den Staubsauger zur Hand zu nehmen, doch greift meine Hand ins Leere, denn auch Staubsauger, Besen, Eimer und die Hälfte der Putzutensilien sind nicht mehr an ihrem Ort.
Einzig im Badezimmer hat sich kaum etwas verändert. Nur blickt man jetzt unmittelbar in den Spiegel, ohne dass der Blick durch Kosmetikartikel aller Art, Puderpinsel und Cremedosen, Parfümfläschchen und Lidschattendöschen noch verstellt oder abgelenkt wird.
Immer noch im Mantel setze ich mich in den einzigen im Wohnzimmer verbliebenen Sessel und rauche zwei Zigaretten. Dann höre ich den Anrufbeantworter ab. Das Gerät ist randvoll mit Sprachnachrichten, doch unter den vielen Anrufen sind nur vier, die für mich von Interesse sind.
Der erste ist von Anne. Sie entschuldigt sich dafür, dass ihr Auszug während meiner Abwesenheit vonstattengegangen sei, behauptet aber gleichzeitig, dass es so das Beste für uns beide wäre. Sie wirkt ganz ruhig und sachlich und gibt mir zum Schluss ihre neue Telefonnummer und Adresse. Dann bittet sie mich noch, ihre Pflanzen zu gießen, bis sie diese abholen kommt.
Die zweite Nachricht ist von meinem Vater. Noch bevor er ein Wort gesagt hat, weiß ich, dass er es ist. Wie immer atmet er zunächst einmal tief ein und aus, um sodann sein zurechtgelegtes Sätzchen auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Es ist eine im aufgesetzten Ton des belanglosen Smalltalks vorgetragene Beschwerde, die Anne und mich daran erinnern soll, dass wir ihn lange nicht mehr besucht haben. Er wird sich damit abfinden müssen, dass aus einem gemeinsamen Besuch auch vorläufig wohl nichts mehr werden wird. Und allein zu ihm zu fahren und ihm von Annes Auszug zu berichten, dazu fühle ich mich augenblicklich erst recht nicht in der Lage.
Die dritte Nachricht ist von meinem Chef.
»Born«, brüllt es aus dem schwarzen Gerät, »wenn Sie wieder zu Hause sind, melden Sie sich sofort bei mir!« Dann aber fügt er versöhnlicher hinzu: »Es ist nicht gut, wenn Sie jetzt allein sind. Sie wissen, wir haben für unsere Auslandskorrespondenten einen psychologischen Beratungsdienst eingerichtet. Ich versichere Ihnen, nach ein paar Sitzungen sind Ihre Depressionen wie weggeblasen. Eigene Erfahrung. Also, Kopf hoch, und bitte sofort bei mir melden!«
Schließlich ist da noch eine vierte Nachricht, die ich mir zweimal anhöre, weil ich nicht das Geringste von dem verstehe, was man mir mitteilt.
»Guten Tag, Herr Born. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen hier auf das Band spreche, aber ich versuche seit Tagen, Sie telefonisch zu erreichen, doch geht nie jemand an den Apparat. Mein Name ist Pfarrer Lebbing. Ich rufe an wegen Ihrer Tante Laura Lenzen. Besser gesagt wegen des Hauses Am Marktplatz 3 in Benden. Wie Sie sicherlich bereits von Notar Bärheim erfahren haben, stehen Ihnen Haus und Einrichtung ab sofort für eine Besichtigung zur Verfügung. Sollten Sie daher in den nächsten Tagen anzureisen gedenken, bitte ich Sie, mich vorher zu benachrichtigen, da ich im Besitz der Hausschlüssel bin. Meine Telefonnummer lautet ...«
Ich glaube, hier kann nur eine Verwechslung vorliegen, denn ich habe keine Tante mit dem Namen Laura Lenzen, wundere mich aber, dass dieser Pfarrer mich mit meinem Namen anspricht. Doch dann fällt mir ein, dass meine Mutter eine geborene Lenzenowitsch war und Lenzen vielleicht eine Eindeutschung sein könnte.
Ich beschließe, die Sache morgen in Ordnung zu bringen, während mein Blick die Fensterbank streift, wo Anne meine Post der vergangenen vier Wochen gestapelt hat. Ich blättere sie oberflächlich durch. Das meiste scheint Zeit zu haben. Schließlich aber halte ich einen Brief von Notar Bärheim in Händen. Ich fetze den Briefumschlag mit dem kleinen Finger auf. Er erhält einige DIN-A4-Blätter, Kopien zumeist, und ein an mich adressiertes Schreiben. Ich lese es nur oberflächlich. »Sehr geehrter Herr Born ... Betrifft: Eröffnung des Testaments bezüglich des Erbnachlasses von Frau Laura Lenzen, wohnhaft in Benden, Am Marktplatz 3. Wie Sie aus beigefügter testamentarischer Verfügung von Frau Lenzen entnehmen können, sind Sie zum Alleinerben des Grundbesitzes ›Am Marktplatz 3‹, Benden, Liegenschaftsnr.: AO/13-4b-6923 ernannt. Des Weiteren ist verfügt worden, dass auch die sich im Nachlass befindlichen Wohnungseinrichtungs- und Wertgegenstände ... Ich, Laura Lenzen, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, verfüge hiermit ... Das Testament wurde unterzeichnet im Beisein der Zeugen: Dr. Julius Bärheim, Notar. Albert Lebbing, Pfarrer ...«
Ich hole mir eine angebrochene Flasche Rotwein aus dem Kühlschrank und lasse mich zurück in den Sessel fallen. Weil der Wohnzimmerschrank mit den Weingläsern verschwunden ist, trinke ich aus der Flasche. Es ist billiger Chianti, der wahrscheinlich eine gute Portion blutdrucksteigerndes Tyramin enthält, denn mir wird sehr schnell sehr warm.
Ich versuche, ein Resümee meiner momentanen Lebenssituation zu ziehen: Ich komme zurück von einer vierwöchigen Auslandsreise, auf der ich Dinge erlebt habe, die mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens nicht mehr ruhig schlafen lassen werden. Anne hat mich verlassen. Ich sitze in einer fast leergeräumten Wohnung. Und ich habe am selben Tag, da ich erfahre, eine Tante zu haben, diese Tante auch schon wieder verloren. Das einzig Positive: Irgendwo soll angeblich ein komplett eingerichtetes Haus auf mich warten. Aber auch daran wird wahrscheinlich irgendein Haken sein, und wer weiß, vielleicht habe ich ja nicht nur ein Haus, sondern mit dem Haus auch einen Haufen Schulden geerbt. Vielleicht wäre es also besser, das Erbe gar nicht erst anzutreten.
MEINE ERSTE NACHT zu Hause verläuft sehr unangenehm. Erstens wegen des Rotweins, zweitens wegen des Rechteckes aus Staub neben meinem Bett, das mich beständig glauben lässt, ich müsse ersticken, so dass ich mir gegen drei Uhr in der Nacht eine Isomatte aus dem Abstellraum hole, meinen Schlafsack im Wohnzimmer ausrolle und auf dem Boden schlafe. Drittens wegen der Alpträume, die sich einstellen, sobald ich ein wenig eingenickt bin. Nein, eigentlich komme ich noch gar nicht dazu, einen Alptraum zu haben, weil ich bereits, bevor er zu beginnen droht, mit einem Schrei aus dem Schlaf schrecke.
Dreimal in dieser Nacht erwache ich mit rasendem Puls, wische mir den Schweiß von der Stirn und gehe zur Beruhigung im Zimmer auf und ab. Schließlich gelingt es mir, doch noch einzuschlafen, und ich werde erst am frühen Morgen von der Türklingel geweckt.
– Anne, denke ich nur, und so, als ob ich mich für die Meisterschaft im Sackhüpfen fit machen wollte, bewege ich mich in meinem Schlafsack springend so rasch wie möglich auf die Haustür zu.
Es ist aber nur Thilo Hawemann. Ein Kollege aus der Redaktion.
»Tag«, sagt er, »der Chef schickt mich, soll mal nachsehen, ob du wieder daheim bist.«
Ich bitte Thilo hinein.
Thilo betrachtet mich skeptisch. »Du kannst dir wohl das Biwakieren nicht von heute auf morgen abgewöhnen, was?«
Ich antworte nicht, frage nur, ob er einen Kaffee will, und pelle mich aus dem Schlafsack.
Eine halbe Stunde später sitzen wir am Küchentisch, trinken Kaffee ohne Milch aus zwei henkellosen Kaffeetassen und teilen uns einen Schokoriegel, den Thilo aus der Jackentasche gezogen hat.
»Du musst schreckliche Dinge erlebt haben«, beginnt er die Konversation. »Meinst du, du wirst irgendwann darüber schreiben können?«
»Bist du deshalb hergekommen?« frage ich.
»Nun ja«, druckst er, »der Chef meint, es wäre für dich selbst am besten, wenn du darüber schreiben könntest. Ich glaube, er sprach von der Notwendigkeit eines psychischen Verarbeitungsprozesses.«
»Sprach er auch davon, in wie viele Spalten ich meine Psyche verarbeiten soll?«
»Reg dich nicht auf«, sagt Thilo, »wir ahnen alle, was du durchgemacht hast. Der Chef meint es diesmal wirklich nur gut.«
»Eben das bezweifle ich«, sage ich und muss husten, weil mir ein paar Nusssplitter des Schokoriegels im Hals steckengeblieben sind. Dann aber werde ich versöhnlicher und biete Thilo eine Zigarette an.
Thilo Hawemann ist der Jüngste bei uns in der Redaktion. Er ist verheiratet und träumt von einem Häuschen im Grünen. Er hat wenig Ambitionen, was seine Karriere anbelangt. Thilo schreibt jede Woche einen langweiligen Artikel im Ressort Wirtschaft. Und ich glaube, es interessiert ihn selbst kaum, was er schreibt. Er hat noch nie Ärger mit dem Chef gehabt. Wahrscheinlich liest auch der seine Artikel nicht. Thilo ist gutmütig, etwas introvertiert, doch irgendwie wird man bei ihm das Gefühl nicht los, er habe auch noch eine andere, unbekannte Seite. Den wahren Thilo spart er sich wohl für Zuhause auf, für seine Frau. Doch scheint er beziehungsmäßig gesehen nicht schlecht mit dieser Schizophrenie zu fahren.
Anne und ich waren ein paarmal bei den Hawemanns. Wir pflegten eine oberflächliche Bekanntschaft, wie sie Kollegen halt so pflegen. Anne schien die Hawemanns zu mögen, wenigstens war sie in meiner Abwesenheit auch öfter mal allein bei ihnen. Kam noch hinzu, dass Thilo und Anne seit zwei Jahren im selben Verein Tennis spielten.
»Ziehst du um?« fragt Thilo mich jetzt und deutet nur unbestimmt in das leere Wohnzimmer.
»Anne«, sage ich, »sie hat meine Abwesenheit genutzt, um auszuziehen.«
Thilo blickt einen Moment zum Fenster hinaus, als ob er einen tröstenden Gedanken fassen wollte, sieht mich dann wieder an und sagt nur ganz leise: »Mist« – ein Wort, das Thilo eigentlich nicht benutzt. Normalerweise ist auch seine Alltagssprache die eines nüchternen und sachlichen Wirtschaftsexperten, so dass man meinen könnte, alle zwischenmenschlichen Probleme seien für ihn letztlich nur Ausdruck einer falsch aufgestellten Kosten-Nutzen-Rechnung.
»Das tut mir leid«, fügt er hinzu. »Ausgerechnet jetzt. Weiß sie, was du mitgemacht hast?«
Ich verneine.
»Willst du es ihr erzählen?«
Ich verneine abermals.
Thilo nickt verständnisvoll. Er fragt mich, ob er irgendetwas für mich tun kann, aber ich zucke nur mit den Schultern. Angenehm an Thilo ist, dass er auf jede Art von Floskel verzichtet. Solche Dinge wie »Kopf hoch!« und »Wird schon wieder!« kommen ihm einfach nicht über die Lippen. Da sagt er lieber gar nichts, rührt ein bisschen in seinem Kaffee und sieht betroffen aus.
»Der Chef meint, du solltest unbedingt in die psychologische Beratung. Er hat dir schon einen Termin besorgt. Heute Nachmittag um vier Uhr in der Severinstraße.«
»Danke«, sage ich, »aber ich habe momentan keine Zeit. Ich muss da eine Erbschaftsangelegenheit klären.«
»Darf man gratulieren?« fragt er schelmisch, wohl, um unser Gespräch wieder auf eine für beide angenehmere Ebene zu bringen.
»Das wird sich erst noch herausstellen«, sage ich, »im Augenblick ist die Sache noch etwas zwielichtig, weil ich ein Haus von einer Tante geerbt haben soll, deren Existenz mir bislang gar nicht bekannt war.«
»Eine Schwester deiner Mutter oder deines Vaters?« fragt Thilo.
»Allem Anschein nach eine Schwester meiner Mutter«, sage ich.
»Und die hat dir nie davon erzählt, dass sie eine Schwester hat?«
»Nein«, sage ich, »hat sie nicht.«
»Deine Mutter lebt noch?« fragt Thilo vorsichtig.
»Leider nein«, antworte ich, »sonst hätte ich sie längst angerufen, um eine Erklärung zu bekommen.«
»Und dein Vater?«
»Auch nicht«, lüge ich Thilo an, weil ich es nicht fertigbringe, ihm zu erklären, dass Anne und ich es nicht geschafft haben, ein Leben zu führen, in dem für meinen Vater Platz gewesen wäre. Seit zwei Jahren ist er daher in einem privaten Altenheim untergebracht. Ich kann jetzt nur hoffen, dass Anne Thilo davon nichts erzählt hat.
»Sonstige Geschwister deiner Eltern?«
»Beide Eltern waren Einzelkinder«, sage ich, obwohl ich weiß, dass mein Vater noch zwei Brüder hatte, die im Krieg gefallen waren.
»Hast du gedacht!« sagt Thilo und gießt sich einen zweiten Kaffee ein.
»Richtig«, sage ich, »aber welchen Grund kann es dafür geben, eine Schwester zu verschweigen?«
»Ich denke«, sagt Thilo, »dafür kommt nur eine bitterböse Familienfehde in Betracht. Es sei denn, deine Mutter hat selbst nicht gewusst, dass sie eine Schwester hatte.«
Ich erkläre Thilo, dass dem Brief des Notars eine Sterbeurkunde meiner Tante beiliegt, aus der hervorgeht, dass meine Tante nur zwei Jahre jünger war als meine Mutter. So dürfte es unwahrscheinlich sein, dass sie ihre Schwester nicht gekannt haben soll.
»Vielleicht irgendeine Erbsache«, sagt Thilo, »viele Geschwister befehden sich bis aufs Blut, wenn es um Erbangelegenheiten geht.«
»Mag sein«, sage ich und zeige wenig Interesse, die Spekulationen weiter fortzusetzen.
»Wo soll das Haus denn liegen?« fragt Thilo.
»In Benden«, sage ich, »in der Nähe von Viersheim.« Thilo stellt seine Kaffeetasse mit einem harten Schlag auf den Tisch zurück, wohl weil die Finger ihm an der henkellosen Tasse zu heiß geworden sind, denke ich, doch sieht er mich jetzt nur noch mitleidiger als vor wenigen Minuten an.
»Jens«, sagt er, »du hast wirklich nur Pech im Leben. Erinnert dich der Name Benden denn an nichts?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sage ich.
»Benden«, sagt Thilo, »das ist doch das Synonym für den Braunkohletagebau. Die Dörfer Enderath und Viersheim sind bereits von der WESTKOHLE AG plattgemacht worden. Benden und zwei weitere Dörfer sollen als nächstes an der Reihe sein. Ist alles schon beschlossene Sache. Mittlerweile wird längst darüber gestritten, ob der Anschlusstagebau Benden II genehmigt werden soll. Dann müssen noch einmal fünf Dörfer zwangsumgesiedelt werden. Liest du denn unsere Zeitung nicht? Über Benden hatten wir im vergangenen Jahr mindestens drei lange Artikel. Einer war übrigens von mir. Ich habe darin sehr sachlich die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts Benden II infrage gestellt, ganz emotionslos, einzig auf der Basis rein ökonomischer Überlegungen und der Tatsache, dass die erneuerbaren Energien seit Jahren beständig an Zuwachs gewinnen.«
Ich muss Thilo eingestehen, dass ich seinen Artikel nicht zur Kenntnis genommen habe. Er scheint darüber aber nicht sehr erstaunt zu sein, wundert sich vielmehr, dass ich grundsätzlich so desinformiert bin.
»Ich bin oft in Benden gewesen«, sagt er jetzt. »Ich war sogar eine Zeitlang dort in der Bürgerinitiative. Hat aber alles zu nichts geführt. Wenn du mich fragst, fahr gar nicht erst dorthin. Nimm dir einen Anwalt, der mit der WESTKOHLE AG verhandelt und die Dinge für dich klärt. Benden ist ein einziger Alptraum. Nichts für deine schwachen Nerven.«
»Du warst in der Bürgerinitiative?« frage ich ihn und bin ehrlich erstaunt.
»Das ist eine lange Geschichte«, antwortet Thilo, »bei Gelegenheit werde ich sie dir vielleicht mal erzählen.«
ICH BIN AUF der Fahrt nach Benden. Ich habe Pfarrer Lebbing angerufen und mit ihm einen Termin für den Nachmittag ausgemacht. Zum ersten Mal bemerke ich, dass wir bereits Spätsommer haben. Der Himmel ist überwiegend blau, und nur hier und da von einem porösen Weiß, das aussieht, als ob es mit einem Schwamm aufgetupft worden wäre. Ich rauche und höre Radio. Als ich ein wenig das Seitenfenster öffne, strömt sogleich der Geruch von Blumenkohl ins Innere des Wagens. Rechts von der Autobahn sehe ich ein großes Gemüsefeld. Ein Trecker mit Anhänger fährt im Schritttempo hindurch. An der linken Seite des Anhängers ist eine freischwebende Metallplatte angebracht, auf der fünf Frauen bäuchlings aufliegen. Sie schneiden mit einem scharfen Messer die Blumenkohlköpfe aus dem Grün und legen sie vor sich auf ein Fließband, das auf gleicher Höhe mitläuft. Es sind Polinnen oder Rumäninnen, jedenfalls Saisonarbeiter.
Vor einigen Jahren habe ich einmal eine Reportage über sie gemacht. Die meisten von ihnen bekamen nur einen Hungerlohn, für den deutsche Arbeiter nicht einmal mehr den Trecker gefahren hätten. Dennoch schienen sie froh, diese Arbeit machen zu dürfen. Ihre Genügsamkeit hatte mich damals fast an den Rand der Verzweiflung gebracht. Ich wollte ihnen klar machen, dass man sie ausbeutete. Aber sie empfanden einen Journalisten, der sie aufforderte, an ihre soziale Absicherung zu denken und Rechte einzuklagen, die ihnen doch zweifellos vorenthalten wurden, wie eine Bedrohung, ja wie etwas, das ihr kleines Glück zerstören wollte, indem es mit einem scheinbar größeren Glück lockte, welches doch, so waren sie sich sicher, reine Illusion bliebe. Und sie hatten ja recht. Denn sie hatten tatsächlich nur die Wahl zwischen Ausbeutung und Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit – das könnte für mich selbst auch bald schon ein Thema werden. Denn wenn es mir nicht gelingen sollte, in wenigen Wochen wieder voll einsatzfähig zu sein, wird man sich in aller Form von mir verabschieden. Klingenstein, mein Chef, wird mir einen langen Vortrag halten, warum es trotz seines guten Willens so mit uns nicht weitergehen kann. Er wird sagen, wie leid ihm das alles tut, und dass er alles in seiner Macht Stehende versucht habe, aber am Ende dieser kleinen Unterredung werde ich vom Parkplatz aus noch einmal zur Redaktion hinaufwinken, vielleicht zu Thilo, der gerade am Fenster steht, und werde nach Hause fahren. Vierzig Jahre alt. Hingehalten mit möglichen Festanstellungsverträgen, die mir nie zur Unterschrift vorgelegt wurden. Entlassen im Status eines Freien Mitarbeiters, was woanders soviel zählt, als ob man zehn Jahre lang Leserbriefe verfasst hätte, in denen man erfolglos für mehr Sauberkeit in öffentlichen Pissoirs kämpfte.
Aber ich will meinen Kopf jetzt nicht mit düstren Zukunftsaussichten strapazieren. Ich nehme die nächste Abfahrt und fahre schon bald auf einer breiten Bundesstraße Richtung Westen. Von der Bundesstraße komme ich auf eine schmalere Landstraße und kurve eine gute halbe Stunde durch die Gegend. Die Straße ist an der rechten Seite mit alten Alleebäumen bepflanzt. Ich glaube, es sind Ahornbäume. Dann reißt der angenehme Schatten, durch den ich fahre, plötzlich ab, und die Straße macht einen großen Bogen durch gleißendes Sonnenlicht. Links von mir erstreckt sich jetzt eine tiefe Ebene, die mit Pappeln bestanden ist. Ich scheine mich also bereits im Tagebaugebiet zu befinden. Und was ich sehe, wird wohl die Glanzleistung landschaftlicher Rekultivierung sein, die die WESTKOHLE AG dem ausgebeuteten Land nach der sogenannten »zeitweiligen Inanspruchnahme« angedeihen lässt.
Ein Schild weist Benden aus. Noch drei Kilometer. Plötzlich ist die sichtbehindernde Begrünung fort. Zäune schießen rechts und links an der Straße empor. Es sind große und zum Teil stark ramponierte Zäune. Alle fünfzig Meter steht eine Tafel »Betriebsgelände. Betreten verboten!« Hinter den Zäunen erahne ich eine unendliche graue Tiefe, die von Planierraupen zerfahren zu sein scheint. Dann verhindern Kabelstränge die Sicht.
Natürlich habe auch ich schon vom Tagebau gehört, aber ihn zu sehen ist etwas ganz anderes. Ich versuche, mir vorzustellen, dass links und rechts von mir einmal Dörfer existiert haben, Kirchen, Schulen, Marktplätze, alles mit Leben erfüllt, schattige Dorflinden, alte Leute, bellende Hunde, Pferde, Kühe, Bäckereien, Tante Emma Läden. Eben das ganze Arsenal der vermeintlich heilen Welt. Aber kaum blicke ich wieder aus dem Fenster, sind alle Vorstellungen wie weggeblasen. Es ist, als ob man dort unten mit Ausschachtungsarbeiten für eine Metropole wie Sidney oder New York begonnen hätte.
Kurz vor Benden geschieht etwas Überraschendes. Bäume säumen auf einmal den Weg, wachsen zusammen zu einer breiten Allee. Das Loch zu meiner Rechten ist plötzlich verschwunden, stattdessen grüne Hecken, Schwarzdorn und Rosengewächse. Schließlich fahre ich in Benden ein. Auf das Ortseingangsschild ist das Bild eines Totenkopfs gesprüht. Mein Wagen zittert plötzlich über uraltes Kopfsteinpflaster. Ich erreiche geradewegs die Mitte des Ortes: einen alten Ziehbrunnen, der wohl nur noch dekorative Funktion besitzt.
Auf dem Brunnen sitzen zwei junge Leute und rauchen. Ich kurbele das Seitenfenster meines Wagens herunter und frage nach Pfarrer Lebbing.
»Einfach die Straße lang«, sagt ein hageres, ungefähr sechzehn Jahre altes Mädchen. »Sie können das Pfarrhaus gar nicht verfehlen. Es gibt nur diese eine Straße.« Ich bedanke mich und fahre weiter.
AM ENDE DER Straße steht eine kleine unscheinbare Backsteinkirche. Ihr Turm ist etwas in die Jahre gekommen, wenigstens weist er eine bedenkliche Schiefneigung auf. Neben der Kirche steht ein schmales Fachwerkhaus. Zwei Stockwerke, grün gestrichene Fensterrahmen. Vor dem Haus befindet sich ein ungefähr sechzig Quadratmeter großer Garten, umfriedet von einem schmiedeeisernen Gartenzaun mit runden Kugeln auf jeder siebten Stange.
Im Garten liegt auf allen vieren ein älterer Herr in schwarzer Hose und – wie es scheint – dickem Norwegerpullover, obwohl die Temperaturen fast tropisch zu nennen sind. Als ich aus dem Wagen aussteige und die Tür zuwerfe, dreht der Knieende seinen Kopf auf die Seite wie ein altersschwacher Hofhund, der es aufgegeben hat, bei jedem Fremden kläffend ans Tor zu fliegen, richtet sich dann aber rasch auf und kommt schließlich an den Zaun.
»Sie müssen Herr Born sein«, sagt er und reicht mir seine Hand über den brusthohen Zaun.
»Pfarrer Lebbing, nehme ich an«, sage ich und begrüße ihn.
»Es sind die Schnecken«, sagt Pfarrer Lebbing, während er sich seine Hände an der Hose abwischt, »die mich immer wieder in diese einem anderen Kulturkreis zugehörende Haltung zwingen. Sie sitzen im Salat und fressen sich dick und fett. Da kann unsereins dann sehen, wo er bleibt. Man muss sie einzeln entfernen. Am besten geht das bei Nacht mit einer Taschenlampe. Aber augenblicklich sind die Schnecken so dreist, dass sie selbst am helllichten Tag ihren Vergnügungen nachgehen. Schauen Sie mal«, fügt er hinzu und weist auf eine runde Blechdose, in der einmal Dänisches Buttergebäck gewesen sein muss. »Schon halbvoll die Dose.«
Ich sehe vom Zaun aus nur, dass irgendetwas Schleimiges in der Dose wabert, bin aber nicht sehr neugierig auf Einzelheiten und gebe Pfarrer Lebbing zu verstehen, dass ich vom Gemüseanbau nicht das Geringste verstehe.
»Das ist schade«, sagt Pfarrer Lebbing, »zumal gerade jetzt eine fürsorgliche Hand im Garten Ihrer Tante fehlte. Sind doch im Moment so viele Dinge reif: Blumenkohl, Zucchini, Erbsen, Fenchel, Tomaten, Sellerie, Gurken, Kürbis, Porree und Möhren. Von den Heidelbeeren, Birnen, Weintrauben, Pfirsichen, Johannis- und Brombeeren ganz zu schweigen.«
Ich zucke bedauernd die Achseln, wenn mir auch gleichzeitig der Schreck in die Glieder fährt, meine Tante könnte so etwas wie eine kleingewerbliche Obstund Gemüseplantage besessen haben.
»Nun kommen Sie aber erst einmal herein«, sagt Pfarrer Lebbing, der wohl ahnt, dass er mich etwas überrumpelt hat, »Sie müssen müde und durstig von der Reise sein.«
EINE GUTE VIERTELSTUNDE später sitzen wir im Pfarrhaus auf einer hölzernen Eckbank. Vor uns auf dem Tischchen zwei Gläser, ein Pappkarton mit Orangensaft und eine Dose Dänisches Buttergebäck. Über Pfarrer Lebbings Haupt schwebt ein gewaltiges Kruzifix, hinter dessen Korpus staubige Palmzweige stecken. Auf einem Stehpult, nahe dem Fenster, ruht eine in Leder gebundene Bibel, aus der einige bunte Lesebändchen ragen. Auf der Bibel liegt ein kleines blaues Büchlein.
»Mir ist immer etwas zu kalt«, sagt Pfarrer Lebbing und deutet auf seinen dicken Norweger. »Zu niedriger Blutdruck. Selbst im Hochsommer muss ich mich warm anziehen. Zwar hat mir Ihre Tante Weißdorntee verordnet, doch bei dieser Hitze mag ich ihn einfach nicht trinken.«
Ich empfehle ihm, es einmal mit billigem Chianti zu versuchen, und frage ihn dann, ob er meine Tante gut gekannt habe. Statt zu antworten, nickt er nur ganz bedächtig, so als ob ihn ein artikuliertes »Ja« sogleich die Fassung verlieren lassen könnte. Dann räuspert er sich aber und sagt: »Ich habe sie mehr als gut gekannt. Ich betreue diese Gemeinde seit fast dreißig Jahren. Als ich hier begann, hatte ich es zunächst sehr schwer. Die Leute mochten mich nicht besonders, denn sie hatten ihren alten Pfarrer sehr geliebt, und verglichen mich dauernd mit ihm, wobei ich – zugegeben – sehr schlecht abschnitt. Was sie vor allem an mir nicht mochten, das war mein Alter. Ich war vierzig Jahre alt und in den Augen der meisten Leute nur ein junger Mensch ohne Erfahrung. Daran sehen Sie, wie sich die Zeiten geändert haben. Heute gehört man mit vierzig schon fast zum alten Eisen.«
»Wie recht Sie haben«, sage ich, und er sieht mich für einen Moment lächelnd an, so als ob auf meiner Stirn mein Geburtsjahr eintätowiert wäre.
»Ihre Tante«, so fährt er fort, »war der einzige Mensch in diesem Dorf, der von Anfang an zu mir gehalten hat, obwohl nun gerade Ihre Tante sich nicht einmal mehr zur Glaubensgemeinde zählte. Ein wenig lag es wohl daran, dass sie ebenfalls zu den Außenseitern des Dorfes gehörte. Sie wohnte zwar schon ein paar Jahre hier, aber da sie eine Zugezogene war, hielten sich viele Bendener weiterhin zu ihr auf Distanz. Und zwei Außenseiter – so können Sie sich bestimmt leicht vorstellen – finden immer schnell zusammen, es sei denn, sie sind beide sehr egozentrisch. Aber egozentrisch war Ihre Tante nicht, höchstens ein wenig exzentrisch, oder sagen wir einfach nur, sie war etwas ungewöhnlich.«
»Das müssen Sie mir näher erklären«, sage ich.
»Nun«, sagt Pfarrer Lebbing, »sie hatte halt so ihre Vorstellung vom Leben und vor allem von der Natur, die die meisten hier nicht teilen konnten. Und dann ihre Vorliebe für den Kräutergarten und die Naturmedizin. Da kamen schon allerlei Gerüchte auf. Manche glaubten sogar, sie verfüge über gewisse Kräfte.«
»Sie meinen wohl Zauberkräfte?« falle ich Pfarrer Lebbing ins Wort.
»In der Tat könnte man es so nennen«, sagt Pfarrer Lebbing, »wenn natürlich auch nichts an solchen Vorwürfen dran war.«
»Was genau hat sie denn so in Verruf gebracht?« frage ich. »Hat sie Schwarze Messen zelebriert oder kleine Kinder verhext?«
»Gewöhnlich nicht«, lacht Pfarrer Lebbing, »aber wenn Menschen lange Zeit allein leben, dann werden sie mitunter etwas sonderlich, skurril, verstehen Sie, und sie bieten dann allerlei Anlass zum Gerede. Hauptberuflich war Ihre Tante übrigens eine Zeit lang Illustratorin für wissenschaftliche Bücher, aber nebenbei war sie auch – wie gesagt – in der Kräutermedizin sehr bewandert, und in den letzten Jahren kamen viele Leute, die sich von Ihrer Tante Heilung versprachen. Sie hatte sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht. Dabei hat sie sich alles selber beigebracht. Aus Büchern und durch eigene Experimente. Aber sie hat nie etwas ausprobiert, was für irgendjemanden außer für sie selbst hätte gefährlich werden können. Ganz gewiss nicht. Sie hat sich übrigens selbst gar nicht für naturheilkundig gehalten. Sie hatte auch in diesem Sinne keine Praxis. Ihre Patienten kamen nur aufgrund von Mundpropaganda. Auch nahm sie meistens kein Geld für ihre Medizin, es sei denn, sie musste einige kostspielige Dinge aus der Apotheke besorgen. Ansonsten bestand sie darauf, nichts als ihre Erfahrung weiterzugeben. Doch die Leute steckten ihr aus Dankbarkeit oft größere Beträge zu. Das hat manchen hier im Dorf neidisch gemacht. In den letzten Jahren dann kamen die Menschen von immer weiter her. Sie wissen ja, man glaubt immer, dass die Menschen, die einem wirklich helfen können, die großen Kapazitäten auf ihrem Gebiet sozusagen, weit weg wohnen müssen. Denn jemand, mit dem man Tür an Tür lebt, der kann unmöglich für irgendetwas Besonderes befähigt sein, und zwar aus dem einfachen Grund nicht, weil man es selber auch nicht ist. Denn man erkennt in seinem Nachbarn immerzu Zweidrittel von sich selbst, und höchstens ein Drittel des Nachbarn empfindet man als Terra incognita, die eine Entdeckung vielleicht lohnen könnte. Es ist wie mit den Wolken. Wir sehen in ihnen immerzu Gesichter und Gestalten, nur weil wir selbst ein Gesicht und eine Gestalt haben. Was die Wolken aber an sich selbst sind, das sehen wir nicht.«
Pfarrer Lebbing unterbricht seine Rede und führt lächelnd seinen Orangensaft an den Mund.
»Ich muss Ihnen etwas erklären«, sage ich. Er schaut mich erwartungsvoll an. »Ich habe bis gestern nicht gewusst, dass meine Mutter eine Schwester hatte. Ich begreife nicht, warum sie es mir nie gesagt hat.«
Pfarrer Lebbing stellt das Glas behutsam auf den Holztisch zurück. Dann sagt er: »Es gibt viele Geheimnisse in der Welt und fast alle lassen sich eines Tages lösen. Nur bei Familiengeheimnissen, Herr Born, bei Familiengeheimnissen ist jeder Versuch, sie lösen zu wollen, so gut wie zwecklos. Ein Familiengeheimnis nämlich wird stets wie von zwei Halbkugeln umschlossen, die einzig durch das Vakuum, das in ihrem Inneren herrscht, zusammengehalten werden. Da können Sie ziehen und zerren wie Sie wollen. Sie bekommen die beiden Hälften niemals auseinander. Die einzige Chance, die Sie haben, besteht darin, Luft in das Innere dieser Kugeln zu injizieren, um quasi einen atmosphärischen Ausgleich zu schaffen, dann, nur dann kann es passieren, dass die beiden Halbkugeln auseinanderfallen und ihr Geheimnis preisgeben.«
»Sie meinen, es gibt in jeder Familie immer zwei Seiten, die ein Interesse daran haben, dass irgendetwas unentdeckt bleibt?«
»So ist es«, sagt Pfarrer Lebbing, »ansonsten wäre nämlich alles Geheimnisvolle schnell ausgeplaudert, weil der Mensch von Natur aus nichts für sich behalten kann. Wenn aber alle Beteiligten gleichermaßen davon überzeugt sind, dass etwas, was in der Familie geschehen ist, besser verschwiegen wird, weil es so für alle Beteiligten am besten ist, dann erzeugt die Familie rund um dieses Geschehnis einen atmosphärischen Unterdruck in Form eines dauerhaften Schweigens, und niemand Außenstehender wird in der Lage sein, Luft an das so verschlossene Geheimnis zu bringen.«
»Es wäre also von vornherein vergebens, die Sache aufklären zu wollen?«
»Das will ich nicht sagen. Aber Sie brauchen schon so etwas wie eine Schwachstelle, in die Sie Ihr Ausgleichsventil einschlagen können.«
»Meine Mutter ist tot«, sage ich, »und mein Vater, der all die Jahre geschwiegen hat, wird weiter schweigen.«
»Mag sein«, sagt Pfarrer Lebbing. »Aber man soll in solchen Dingen nichts unversucht lassen.«
»Ich nehme an«, sage ich, um mit Pfarrer Lebbings Vorschlag gleich ernst zu machen, »dass meine Tante auch zu Ihnen nie ein Sterbenswort gesagt hat?«
Pfarrer Lebbing nimmt die Hände aus dem Schoß und streicht sich mit den Fingerspitzen einmal durchs Haar.
»Sehen Sie, Herr Born«, sagt er dann, »ich könnte die Art und Weise, wie Sie Ihre Frage gestellt haben, nun ganz einfach als umgangssprachliche Floskel verstehen. Jemandem kein Sterbenswort sagen. Das sagt man wohl so. Und ich könnte Ihnen antworten: In der Tat, Ihre Tante hat mir von ihren Familienangelegenheiten nie ein Sterbenswort gesagt. Aber jenseits des bloß umgangssprachlichen Verständnisses hat das Wort, das Sie gebrauchten, auch noch eine andere Bedeutung. Und deshalb muss ich Ihnen sagen: Ja, sie hat mir etwas gesagt von diesen Dingen, aber eben als Sterbenswort, will sagen: Ich habe ihr vor einigen Jahren, als sie einmal sehr schwer erkrankt war, die letzte Beichte abgenommen. Und somit unterliegt dieses Sterbenswort, auch wenn es im Nachhinein gar keines war, nun leider dem Beichtgeheimnis. Selbst wenn ich wollte, so dürfte ich Ihnen doch nichts von diesem Gespräch mit Ihrer Tante sagen. Es tut mir leid. Sie müssen Ihr Familiengeheimnis wohl allein lösen.«
Ich mache einen schwachen Versuch, zumindest einen Hinweis in dieser Sache zu bekommen, doch Pfarrer Lebbing winkt ab.
»Dies ist keine Quizshow, Herr Born, ich bitte Sie, mein Schweigegelübde ernst zu nehmen.«
Ich erhebe beschwichtigend die Arme.
»Tut mir leid«, sage ich, »ich wollte Sie keinesfalls in Verlegenheit bringen.«
Pfarrer Lebbing lacht einmal laut auf, wobei er seine Augen unnatürlich weit aufreißt und sein Gesicht dabei während der Dauer einer Sekunde zu einer Maske erstarrt. Dann entspannt er sich wieder, tunkt einen Butterkeks in den Orangensaft und wirft ihn sich zielsicher in den Rachen.
WIR GEHEN DIE Dorfgasse entlang zu Laura Lenzens Haus. Ich bin ein wenig neugierig auf die Dinge, die mich erwarten. Die Straße ist leer, wie ausgestorben. Wir gehen an einigen kleinen Fachwerkhäusern vorbei. Die Fenster der Erdgeschosse reichen mir gerade mal bis an die Schultern. Einige der Häuser sind in den fünfziger Jahren mit Eternitplatten vertäfelt worden. Eternisieren bedeutet verewigen. Dies gilt nun leider nicht mehr nur für die Häuser. Denn seitdem man festgestellt hat, dass die Asbestfasern in den Eternitplatten krebserregend wirken können und daher hochgefährlichen Sondermüll darstellen, trifft das Eternisieren nun wohl auch in einem viel makabereren Sinn auf einige der Hausbewohner selbst zu.
Wir biegen links in eine kleine Gasse ein. Sie ist kopfsteingepflastert wie alle anderen Straßen hier auch, aber hier ist das Kopfsteinpflaster so spiegelglatt, als ob Generationen von eisenumspannten Kutschenrädern darüber hinweggedonnert wären. Die Gasse ist für den Autoverkehr gesperrt. Es würde auch wohl jeder zweite Wagen in der engen Gasse steckenbleiben. Viele der Häuser sind in einem erbärmlichen Zustand. Manche scheinen dem Verfall überantwortet, an anderen sind die Fensterläden mit Querlatten vernagelt, als ob man sich für einen Bürgerkrieg rüstete.
»Die meisten Dorfbewohner sind längst fortgezogen«, sagt Pfarrer Lebbing. »Man darf es ihnen nicht verübeln. Vor allem die, die Kinder haben, sind gegangen, sind als erste gegangen, als klar war, dass es hier keine Zukunft mehr geben würde. Ja, seitdem bekannt wurde, dass Benden dem Tagebau geopfert werden sollte, brach das Dorfleben von einem Tag auf den anderen zusammen. Alles schien plötzlich bedeutungslos. Niemand wollte hier noch irgendetwas investieren.«
Pfarrer Lebbing hält in seinem Gang inne. Er schaut mich an und blickt dann zurück auf die leere Gasse.
»Erst heute habe ich begriffen, dass die Zerstörung des Dorflebens mit zur psychologischen Kriegsführung der WESTKOHLE AG gehört«, sagt er. »Zunächst lassen sie so ein Dorf in Ungewissheit darüber, ob es eine Zukunft haben wird oder nicht. Das sorgt für Gerüchte, Ängste, und die ersten Dorfbewohner spielen schon einmal mit dem Gedanken, von hier fortzuziehen. Dann heißt es plötzlich: Der Bagger kommt, das Dorf muss weg. Kurz darauf aber wieder eine Entwarnung. Es wird mit Jahreszahlen jongliert. Mal gibt man so einem Dorf noch zehn Jahre, mal nur noch fünf. Mit solchen ungewissen Zukunftsaussichten kann aber auf Dauer niemand leben. Finanzielle Investitionen lohnen erst recht nicht. Geschäfte schließen, neue Geschäfte werden nicht eröffnet. Die Infrastruktur bricht langsam zusammen. Und viele Menschen wandern aus dem Dorf ab, noch bevor es eine definitive Entscheidung über dasJa oder das Nein zum Tagebau gegeben hat. Sie halten dieses Hin und Her nicht aus. Sie lassen ihre Häuser zurück, die niemand kaufen will, und die Häuser verfallen. Schließlich verhandelt die WESTKOHLE mit dem Restdorf über eine kollektive Umsiedlung, in der komplizierte Rechnungen aus Grundstücksguthaben und Neubaufinanzierung aufgestellt werden. Einige bleiben bei diesen Rechenkünsten aber auf der Strecke, weil sie für ihre alten Häuser nicht so viel Geld bekommen wie sie für ein neues Haus bräuchten.«
Wir sind an das Ende der schmalen Gasse angelangt und stehen vor einem zwei Meter hohen Holzlattenzaun, der über und über von Zaunwinden sowie gelber und roter Kapuzinerkresse überwachsen ist. Neugierige Dahlien stecken ihren Kopf zwischen die Holzlatten auf die Gasse und scheinen den Spätnachmittag angenehm zu verplaudern.
»Es ist das Damoklesschwert, das sie über eine ganze Region hängen, oder wenn Sie, so wie ich, die christliche Metaphorik vorziehen, so ist es einer der apokalyptischen Engel, ein Cherub, der eines Tages mit dem Flammenschwert über einem der Dörfer auftaucht. Und er kann dort sehr lange schweben. Manchmal kann es zwanzig Jahre dauern, bis er von dort oben hinabstürzt und denen, die solange ausgehalten haben, das Ende bringt. Die alten Leute hier entwickeln übrigens eine bedenkliche Strategie, wie sie dem prophezeiten Ende ihrer alten Welt entgehen. Sie versuchen einfach, vorher zu sterben und nicht mehr da zu sein, wenn der Bagger auf ihr Haus zurollt. Sie hoffen, dass sie unter der Erde endlich ihre Ruhe haben werden. Die Ironie des Schicksals will es aber, dass sie auch unter der Erde keine Ruhe finden werden. Oder glauben Sie etwa, der Schaufelradbagger machte vor den Friedhöfen halt?«
Inmitten des Holzzauns ist eine kleine Tür eingelassen, die erst auf den zweiten Blick als solche erkenntlich wird.
»Wir gehen von hinten an das Haus heran«, sagt Pfarrer Lebbing, »denn so wäre es Ihrer Tante sicherlich am liebsten gewesen.«
Er öffnet das Holztürchen an einem kleinen drehbaren Eisenknauf, und wir treten in einen dichten, von nur schmalen Wegen durchzogenen Garten ein. Gleich hinter dem Zaun befindet sich eine Wiese, auf der das Gras kniehoch steht. Die Wiese wird eingegrenzt von Apfel-, Kirschen- und Pflaumenbäumen, denen man ihr Alter deutlich ansieht. Die Kronen der Bäume haben sich längst zu einem undurchschaubaren Gewirr verflochten, so dass hier und da Pflaumen und Äpfel an ein und demselben Baum zu wachsen scheinen. Mitten auf der Wiese steht eine ausgediente Badewanne, von der die Emaille an vielen Stellen abgeplatzt ist. Daneben schlängelt sich ein Wasserschlauch durchs Gras und verschwindet in einem sich hinter der Wiese anschließenden Gemüsegarten.
Wir treten durch eine dichte Schwarzdornhecke, die nur an einer schmalen Stelle passiert werden kann, in den Gemüsegarten ein. Hier befinden sich parzellierte Felder, die zum Großteil noch dicht mit Salat- und Porreereihen, Kohlköpfen und Kürbispflanzen bewachsen sind. Hinter dem Gemüse, vor einer weißgetünchten Wand, leuchten die roten Früchte einiger Tomaten, daneben Johannisbeeren- und Brombeersträucher.
Ich bemerke, dass jemand erst kürzlich den Pflanzen Wasser gegeben haben muss. Zwischen den Pflanzen stehen kleine Pfützen.
»Der gute Geist des Gartens«, sagt Pfarrer Lebbing nur und lächelt.
Den Gemüsebeeten gegenüber liegt ein merkwürdiges, spiralenförmiges Beet, das mich an das schraubenförmige Minarett von Samarra im Irak erinnert.
»Die Kräuterspirale«, ruft Pfarrer Lebbing mir triumphierend zu, als ob sie das Ziel unseres kleinen Ausflugs gewesen wäre.
»Ihre Tante hat sie selbst angelegt. Innerhalb dieser Spirale finden sich die Pflanzen nach ihren Ansprüchen geordnet. Ganz oben wachsen die, die wenig Wasser und viel Sonne zu ihrem Gedeihen benötigen, und ganz unten die Schattenpflanzen, die es gerne sumpfig haben wie etwa die Pestwurz dort. Innerhalb dieser Spirale kann nun für jede Pflanze ein perfekter Platz bezüglich der benötigten Feuchtigkeit und der Sonneneinstrahlung gefunden werden. Betrachten Sie die Raffiniertheit dieses Systems. Hier, gleich neben der Pestwurz, schon im Halbschatten, doch immer noch im feuchten Milieu Mädesüß und Sauerampfer, gefolgt von Scharfgabe, Knoblauchsrauke, Taubnessel und Lungenkraut. Hier mittig wachsen Kerbel, Klatschmohn, Wiesenknopf, Wermut und andere weniger wasserfreundliche Kräuter. Und wenn Sie den Blick hinauf wandern lassen: Rosmarin, Wegwarte, Thymian, Melisse, und das da ganz oben ist Steinklee und Johanniskraut. – Dort rechts von der Kräuterspirale wachsen die größeren Pflanzen. Estragon und Baldrian. Der Dost. Die Königskerze. Balsamkraut und Beifuß. Dill und Borretsch. Eibisch. Liebstöckl. Beinwell. Fenchel. Engelwurz. Brennnessel. Kümmel und Odermennig. Und dort, sozusagen im kleinen Extrakäfig und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen: der Giersch, der leider an einer Charakterschwäche leidet, nämlich die ihm angetragene Gastfreundschaft hemmungslos auszunutzen und es sich, wenn man nicht achtgibt, im ganzen Garten gemütlich zu machen. Er wächst daher nicht direkt in der Erde, sondern Laura hat ihn in eine mit Teichfolie ausgelegte Mulde gepflanzt. Allem Anschein nach ist es ihm noch nicht gelungen, die Folie zu durchbohren und neues Territorium zu erobern. Dort hinten sind die Gemüsebeete und einige Obststräucher, für die uns heute leider die Zeit fehlt. Hier vorne aber, schauen Sie, hier ist ein ganz besonderes Beet, ein Hexenbeet. Alles, was hier wächst, sollten Sie besser nicht anfassen. Das dort ist Schwarzes Bilsenkraut, daneben Bittersüßer Nachtschatten und Schierling. Diese wunderschönen schwarzen, kirschähnlichen Früchte gehören der Tollkirsche. Sie enthalten – Laura hat es mir verraten – giftige Alkaloide, unter anderem das Alkaloid Atropin, das eine pupillenvergrößernde Wirkung besitzt. Aus diesem Grunde führt der wissenschaftliche Name dieser Pflanze, nämlich Atropa, auch das Epitheton belladonna. Dass Frauen in früheren Zeiten ein paar Kirschen davon gegessen haben sollen, um einen besonders verführerischen Blick zu bekommen, wird allerdings wohl ein Gerücht sein. Möglich eher, dass sie sich ein wenig von dem Saft ins Auge geträufelt haben. Das dort ist bekannterweise Mohn und das daneben Eisenhut. Eisenhut enthält eines der stärksten pflanzlichen Gifte überhaupt, das Aconitin. Es lähmt das zentrale Nervensystem. – Aber kommen Sie weiter, wir haben Lauras Haus fast erreicht.«
Mir ist aufgefallen, dass Pfarrer Lebbing in seiner Begeisterung nur noch von Laura spricht. Seitdem er den Garten betreten hat, scheint er überhaupt ein anderer Mensch. Kein Wort mehr von den Machenschaften der WESTKOHLE AG. Irgendwie erinnert er mich nun an einen Pflanzenführer in einem Botanischen Garten, den man für seine Unterweisungen bezahlt hat, und dessen Kaskade aus Fachbegriffen und angelesenen Weisheiten einen immer sprachloser werden lässt. Jetzt geht er, nein, er eilt auf eine große, gemauerte Halbkugel zu, die in der Nähe des Hauses steht, eines Hauses, das ich erst in diesem Moment wahrnehme, weil es sich hinter dichtem Hopfen- und Clematisbewuchs versteckt hält. Pfarrer Lebbing baut sich neben der Steinkugel auf, die ihm ungefähr bis zu den Schultern reicht, beklopft sie wie einen großen Hund und sieht meinem Näherkommen gespannt entgegen, um endlich euphorisch in die Worte ausbrechen zu dürfen: »Lauras Backofen. Darin hat sie jeden ersten Samstag im Monat, den Gott werden ließ, ihr Brot gebacken. Hier unten wird eingeheizt mit Holzscheiten. Und dort ist die Brennkammer. Der Rauch wird hinten durch den Schornstein abgeleitet. Die Backröhre aber ist hier oben, direkt über der Brennkammer. Sie besteht aus Schamottstein und speichert die Wärme stundenlang. Selbst wenn die Glut in der Brennkammer schon erloschen ist, kann man mindestens noch drei, vier Brote backen.«
»Sagen Sie nicht, den Ofen hat meine Tante auch selbst gebaut«, sage ich, als ob ich die Begeisterung Pfarrer Lebbings teilte.
»Aber selbstverständlich«, ruft er denn auch sogleich aus. »Sie hat ihn eigenhändig aufgemauert. Und zwar nach einer Zeichnung, die sie ebenso eigenhändig von einem Ofen in einem Heimatmuseum angefertigt hat.«
»Meine Tante muss mit vielerlei Begabungen gesegnet gewesen sein«, sage ich.
»Fürwahr«, pflichtet Pfarrer Lebbing mir bei, »aber was Sie hier sehen, das sind nur nebensächliche Dinge. Kommen Sie ins Haus, da werden Sie etwas über die eigentlichen Interessen Ihrer Tante erfahren.«
Ich atme auf, höre aber fast im selben Moment Pfarrer Lebbing erneut in Begeisterung ausbrechen.
»Das Gewächshaus«, ruft er, »dort vorne: Laura hat es aus alten Fensterscheiben zusammengesetzt. Es sind Fenster aus Gunten. Als dort die Abrissbirne geschwungen wurde, lief Laura gleich hin, um zu retten, was noch zu retten war.«
Beiläufig blicke ich auf ein mannshohes Gewächshaus, von dessen Fenstern die weiße Farbe in breiten Streifen abblättert und das mit einer Seite an das Haus anschließt. Es ist vollständig leergeräumt. Schließlich aber bin ich froh, dass Pfarrer Lebbing nun endlich einen Hausschlüssel aus der Tasche zieht, um eine alte grünlackierte Tür mit einem auf der Spitze stehenden viereckigen Fenster zu öffnen.
Dann treten wir endlich ein in Laura Lenzens Haus.
ES IST BEREITS dunkel, als ich Benden verlasse. Pfarrer Lebbing hätte mich am liebsten dortbehalten. Er sprach von einem Gästezimmer, das er mir zur Verfügung stellen könnte. Aber ich lehnte dankend ab.
Als ich ein Stück weit aus Benden heraus bin, stoppe ich den Wagen. Ich steige aus und zünde mir eine Zigarette an. Es liegt ein gleichmäßiges Brummen in der Luft, und ich fühle, wie die Straße rhythmisch vibriert. Ich gehe auf die andere Seite der Straße und starre in ein schwarzes Nichts. Aber irgendwo in der Tiefe erscheinen plötzlich einige Lichter. Es sind Scheinwerfer, die auf einen Fleck konzentriert sind. Dazwischen kleine Lichtpunkte, die mehrere Geraden bilden, welche parallel durch die Tiefe verlaufen wie auf einem nächtlichen Rollfeld. Es muss einer der Bagger sein, der sich dort unten Meter um Meter voran arbeitet. Ich kann ihn nicht sehen. Nur an einer Stelle ragt ein gewaltiges Eisengestänge in den Lichtfokus eines Scheinwerfers. Doch dann erkenne ich die Kabelbäume, die bis an das stählerne Ungetüm heranreichen. Und mir kommt plötzlich der Gedanke, ich sei Zeuge eines geistlosen, selbstzweckhaften Kreislaufs zwischen der vom Bagger geförderten Kohle, die auf Fließbändern zur Verbrennung in die Kraftwerke gefahren wird, und dem Strom, der aus dem Kraftwerk zurückkommt, um wiederum den Bagger anzutreiben, damit dieser noch mehr Kohle fördern kann.
Obwohl ich kein sentimentaler Mensch bin, bekomme ich eine leichte Gänsehaut und gehe zurück zum Wagen. Ich starte den Wagen und fahre los.
Erst als ich zurück auf der Bundesstraße bin, atme ich auf. Ich suche im Handschuhfach meines Wagens nach einer bestimmten CD von Van Morrison. Als ich sie habe, stecke ich sie in den Schlitz des Players. Nach kurzer Suche finde ich das Lied, das mich seit fast zehn Jahren begleitet, das ich jedoch noch nie verstanden habe und das ich aus irgendeinem mir unbekannten Grund jetzt unbedingt hören möchte. Mitten im Lied singe ich laut mit:
And then one day you came back home
You were a creature all in rapture
You had the key to your soul
And you did open that day
You came back to the garden
Pfarrer Lebbing hatte mir eine komplette Hausbesichtigung geboten. Zwar war es mir zunächst unangenehm, die Sachen eines Menschen zu betrachten, den ich nicht gekannt hatte, aber Pfarrer Lebbing ging so selbstverständlich von Zimmer zu Zimmer, dass man hätte meinen können, es sei sein Eigentum, das er hier offerierte.
Das Haus hatte zwei Stockwerke. Unten befand sich eine kleine Küche mit allen notwendigen Gerätschaften. Pfannen und Töpfe hingen zum Teil an Ketten von der Decke. Die Küche war sauber und aufgeräumt, so als ob ihre Besitzerin nicht gestorben, sondern nur für ein paar Wochen verreist wäre. Neben der Küche befand sich eine kleine Nische, in der ein Tisch und zwei Stühle standen. Die Nische erhielt ihr Licht durch ein Butzenglasfenster, durch das man nach vorn auf den Marktplatz schaute. Ich war überrascht, als ich nur wenige Meter entfernt den Marktbrunnen sah, auf dem noch immer die beiden jungen Leute saßen. Der Weg, den mich Pfarrer Lebbing geführt hatte, musste mir die Orientierung geraubt haben.
In der unteren Etage befanden sich eine Toilette und ein Wohnraum. Über dem WC hing ein uralter Spülkasten, den man über eine lange Kette entleeren konnte. Im Wohnraum standen ein paar wahllos zusammengewürfelte Sessel, Stehlampen und Tischchen. Die Wände waren vom Boden bis zur Decke mit Bücherregalen zugestellt. Ein oberflächlicher Blick, den ich auf die Bücher warf, ließ mich eine Gesamtausgabe der Werke Alexander von Humboldts erkennen sowie eine französische Erstausgabe des zehnbändigen Werks Souvenirs entomologiques von Jean Henri Fabre. Über eine schmale Holztreppe gelangten wir sodann in das erste Stockwerk. Pfarrer Lebbing zeigte mir das Schlafzimmer, einen kleinen, fast leeren Raum, der nur ein Bett enthielt, das auf einem penibel sauber gewischten Holzfußboden stand.
Neben dem Schlafzimmer befand sich das Arbeitszimmer von Laura Lenzen. Es schien einzig vom Schlafzimmer aus erreichbar zu sein. Was ich zunächst etwas merkwürdig fand, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass meine Tante ihre Patienten durch ihr Schlafzimmer ins Arbeitszimmer führte. Die Tür, die die beiden Räume einmal getrennt hatte, war durch einen Holzperlenvorhang ersetzt worden, der, als Pfarrer Lebbing und ich durch ihn hindurchgingen, Klänge von sich gab, als ob winzige Steinchen auf ein Xylophon rieselten. Das Arbeitszimmer schien der einzige Raum zu sein, an dem aller Ordnungswille hoffnungslos gescheitert war. Bücher und Zeitschriften standen in Kisten am Boden. In einem stabilen Metallregal ruhten medizinische Destillierkolben sowie große bauchige Flaschen, in denen irgendetwas in Gehrung zu sein schien, das alle paar Sekunden gluckste, als ob sich irgendwo im Raum ein Kind mit Schluckauf versteckt hielte.
An der größten Wand des Zimmers befand sich ein massiver Schrank mit großen Glasfenstern, hinter denen weiße Porzellangefäße ruhten, auf die mit schöner Schrift lauter lateinische Namen geschrieben standen, die einer alphabetischen Reihenfolge zu unterliegen schienen. Ich las: Adónis vernális L. – Aloe férox Miller – Ammi visnága (L.) Lam. – Ananas comósus (L.) Merr...
Von dem Schrank ging ein betörender Duft aus, so dass ich nicht umhinkonnte, einige der großen Glasfenster zu öffnen, was den Duft noch verstärkte. Ich hatte ganz vergessen, wie überwältigend Sinneseindrücke sein können, die einem über den Geruch vermittelt werden. Es ist, als ob man geradewegs in die tieferen, archaischen Schichten seines Bewusstseins eindränge, um von dort Erinnerungen herauf zu fördern, die den ganzen Körper ausfüllen und doch unaussprechlich bleiben.
Pfarrer Lebbing lächelte mir zu, als ob er sagen wollte, stecken Sie Ihre Nase ruhig noch tiefer hinein. Ich tat es, nahm wahllos einige der Porzellangefäße aus dem Schrank und öffnete sie. Hier schlug mir der lakritzartige Duft von Fenchel und Anis entgegen, dort betäubte mir eine exotische Frucht so süßlich die Sinne, dass ich gar ein Jucken in den Zähnen verspürte. Da stieg auf einmal ein Kindheitserlebnis konturlos zur Decke, ohne dass ich seiner habhaft wurde, dort holte mich der muffige Geruch von ranzigem Leinsamen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Hier gab es einen Duft, der hatte mit Weihnachten zu tun, da einen, der sprang mich an wie zwei spitze Stecknadeln. Ich steckte meine Nase in getrocknete Brombeer- und Erdbeerblätter, in Hagebuttenschalen und Pfingstrosenblüten, in Hibiskus und Spitzwegerich, in Melisse und den mich ein wenig an Fisch erinnernden Weißdorn. Ich schloss ab mit Lavendel und Kornblumen und hatte nicht einmal mehr ein Zehntel der Porzellangefäße geöffnet. Schließlich aber erinnerte ich mich daran, nicht allein zu sein, und so schloss ich die Glastüren wieder, mich insgeheim darauf freuend, hier demnächst einmal ganz ungestört eine Duftorgie abzuhalten.
Als nächstes fiel mein Blick auf einen großen, dunkelgebeizten Schreibtisch, der aussah, als ob jemand den Inhalt eines ganzen Büroschranks auf ihm ausgebreitet hätte, um nach irgendetwas zu suchen. Über dem Schreibtisch türmten sich auf dicken Eichenbohlen schön eingebundene Bücher, auf deren Rücken jeweils die Namen von Pflanzenfamilien kalligraphiert waren. Diese Bücher schienen Laura Lenzens Rezepte und Erfahrungen zu enthalten, die sie mit ihren Kräutern gemacht hatte, denn als ich eines der Bücher in die Hand nahm, um in ihm zu blättern, fand ich allein zwanzig engbeschriebene Schönschriftseiten zu Calendula officinalis, der Ringelblume. Minutiös war aufgelistet, wie man die Pflanze bei Abschürfungen, Quetschungen, Blutergüssen und Geschwüren einsetzen konnte, und zum Schluss fanden Patienten von Laura Lenzen Erwähnung, die gut oder weniger gut auf bestimmte Verarbeitungsformen und Anwendungen reagiert hatten.
Pfarrer Lebbing wies mich darauf hin, dass dies – vorausgesetzt ich träte das Erbe an – nun alles mir gehöre, und er sprach die Hoffnung aus, dass ich nichts vorschnell dem Sperrmüll oder Altpapier überantworten möchte, was ich nicht zuvor auf seinen Wert überprüft hätte. Vor allem die Manuskripte von Laura bedürften einer genauen Durchsicht. Dann bat er mich, auf dem Schreibtischstuhl Platz zu nehmen, während er sich selbst einen Hocker herbeizog, der zunächst von einigen Zeitungen befreit werden musste, und begann damit, mir sehr detailliert aus Lauras Leben zu erzählen.
Doch ich war sehr müde und vermochte Pfarrer Lebbings ausführlichen Berichten kaum zu folgen. Die Erschöpfung holte mich wieder ein, und ich fühlte mich ein wenig überfordert und von den Ereignissen des Tages überrollt.
Ich bat Pfarrer Lebbing daher, den Besuch für heute abbrechen zu dürfen. Er zeigte Verständnis, legte plötzlich vertrauensvoll eine Hand auf meine Schulter und sagte: »Sie sehen wirklich aus, als könnten Sie etwas Schlaf gebrauchen. Aber etwas anderes in Ihrem Gesicht sagt mir, dass der Schlaf es momentan nicht gut mit Ihnen meint. Ich werde Ihnen daher auf alle Fälle etwas mitgeben.«
Darauf öffnete er die Glastüren des Kräuterschranks und holte mehrere der Porzellanbehälter heraus, die er auf den Rand des Schreibtisches stellte, wobei er die Unordnung, die auf dem Schreibtisch herrschte, dadurch bereinigte, dass er alles, was ihm im Weg war, mit der Handkante zur Seite schob.
»Sie können sich in dieser Sache ganz auf mich verlassen«, sagte er, »denn soviel habe ich von Laura gelernt, dass ich mir bei kleineren Unpässlichkeiten selbst zu helfen weiß. Zunächst gebe ich Ihnen etwas zum Einschlafen. Eine Handvoll Melisse, eine Handvoll Hopfenzapfen, etwas Baldrian und dazu noch herzstärkenden Weißdorn. Davon kochen Sie sich vor dem Schlafengehen einen starken Tee. Wenn Sie dann morgen früh aufwachen, werden Sie, so glaube ich, ein Antidepressivum gebrauchen können. Dazu nehmen wir etwas Echtes Johanniskraut. Allerdings brauchen Sie auch ein wenig Geduld. Die stimmungsaufhellende Wirkung stellt sich meistens erst nach zweiwöchiger Einnahmedauer ein. Ich gebe Ihnen daher noch etwas Kava Kava hinzu. Kava Kava bekämpft vor allem nervöse Angst-, Spannungs- und Unruhezustände. Es handelt sich dabei übrigens um eine Pfefferart. Die Polynesier bereiten aus dem getrockneten Wurzelstock seit Jahrhunderten ihr Nationalgetränk. In der Südsee ist der Kava-Trunk ein wichtiger Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens, fast so wie bei uns im negativen Sinne der Alkohol. Missionare brachten die Pflanze in die Labors der pharmazeutischen Forschung. Man entdeckte dort das Kavain, das einen angstlösenden Effekt besitzt. Der Name Rauschpfeffer braucht Sie übrigens nicht zu ängstigen. Rausch-, Narkose- oder Suchtsymptome konnten bislang nicht festgestellt werden. Sie können ihn also ruhigen Gewissens etwas überdosieren.«
Ich sagte Pfarrer Lebbing, dass ich im Augenblick auch nichts gegen ein Narkosesymptom einzuwenden hätte, wenn ich nur einmal acht Stunden durchschlafen könnte.
Pfarrer Lebbing füllte die Tees in zwei Papiertütchen, die er beschriftete, und gab sie mir. Dann verließen wir das Haus durch den Haupteingang.
Auf dem Marktplatz war es zunächst still, dann aber knallte irgendwo ein Rollladen herunter. Keine der alten Laternen brannte. Man sah kaum die Hand vor Augen.
Es war, als ob Benden bereits von jeglicher Stromzufuhr abgetrennt worden wäre. Schließlich trat der Mond ein wenig hervor.
Wir gingen die Sackgasse bis zum Pfarrgarten und der Backsteinkirche zurück. Jetzt erst erkannte ich, dass an der Ostseite der Kirche ein Friedhof lag. Einige rote Grablichter brannten dort, und dunkle Kreuze erhoben sich vor dem mittlerweile mondblassen Himmel. Pfarrer Lebbing bemerkte meinen Blick und sagte: »Nein, Herr Born, dort liegt sie nicht. Obwohl sie es sich gewünscht hätte. Aber hier darf niemand mehr beerdigt werden. Die dort Begrabenen werden umgebettet. Dann wird der Friedhof eingeebnet. Lauras Grab befindet sich in Neu-Viersheim. Morgen, Herr Born, können wir dort hinfahren. Für heute haben Sie genug. Kommen Sie gut nach Hause.«
ICH HABE ZWEI Tassen von dem Tee getrunken, den Pfarrer Lebbing mir zum Einschlafen zusammengestellt hat. Ich beginne bereits, ein wenig in meinem Schlafsack zu schwitzen. Nach einer guten halben Stunde spüre ich aber eine innere Entspannung, die ähnlich ist, wie die angenehme Müdigkeit nach einem Tag, an dem man viel geleistet zu haben glaubt.
Während ich mir noch Gedanken zu machen versuche, ob es mir wohl diesmal möglich sein wird, ohne große Umstände einzuschlafen, bin ich bereits eingeschlafen. Zum ersten Mal seit langem schrecke ich auch in der Nacht nicht auf, sondern habe Ansätze von ganz normalen Träumen, die jedoch am anderen Morgen wieder vergessen sind.
Gegen acht Uhr wache ich auf. Die Sonne scheint in den Raum. Ich liege noch eine Weile still da und überlege, wie ich den Tag beginnen soll. Mein Blick fällt auf die beiden Tütchen mit Tee. Ich muss zugeben, dass der Schlaftee in der Tat eine Wirkung hatte, und warum sollte ich daher jetzt den Tag nicht mit Johanniskraut oder diesem Zeug mit dem komischen Namen Kava Kava beginnen?
Als ich gerade mein Tässchen Rauschpfeffer aufgebrüht habe, klingelt es an der Tür. Es ist wieder einmal Thilo. Diesmal hat Thilo Brötchen, Butter, Käse und Marmelade dabei.
»Dein Kaffee sieht nicht gut aus«, sagt er, während er sich zu mir an den Tisch setzt, und er bittet mich um die Erlaubnis, sich in der Küche einen richtigen Kaffee kochen zu dürfen.
Wenig später frühstücken wir.
»Du entwickelst dich ja zu einer Art ständigen Frühstücksbegleitung«, sage ich. »Steckt Klingenstein dahinter?«
»Ja«, sagt Thilo, und es gefällt mir, dass er wieder einmal nichts zu kaschieren versucht.
»Der Chef sagt, das Aufstehen sei immer der schwerste Moment am Tag, wenn es einem nervlich nicht gut gehe. Deshalb bat er mich, nach dir zu schauen und dich auf die Beine zu bringen.«
»Das ist nett«, sage ich und beiße in mein Brötchen. »Aber du hast ihm nicht auch zufällig von mir und Anne erzählt?«
»Nur ein bisschen«, gibt Thilo zu, »damit er weiß, dass du augenblicklich mehr als nur ein Problem hast.«
»Danke«, sage ich, und dann erzähle ich Thilo von Benden und meinem gestrigen Tag im Braunkohlerevier.
Thilo versucht mir daraufhin sehr eindrücklich nahe zu legen, dass es wirklich besser für mich wäre, mich jetzt nicht zuviel in Benden aufzuhalten. »Es ist eine Gegend, die einen depressiv werden lässt«, sagt er. »In deinem Zustand der denkbar schlechteste Ort, den man sich vorstellen kann. Du solltest besser ein paar Tage an die See fahren. Wenn du willst, kann ich für dich mit der WESTKOHLE AG verhandeln. Ich kenne mich mit solchen Verhandlungen aus. Ich werde denen schon noch ein wenig Geld für das Haus deiner Tante abknüpfen.«
Ich bedanke mich, sage aber, dass dies nicht nötig sei. Ich käme ganz gut allein zurecht. Und dann bitte ich Thilo, mir etwas über den Braunkohletagebau zu erzählen. Er fragt mich, was genau ich wissen möchte, und ich sage: »Alles, was du weißt!«
Darauf schluckt Thilo umständlich an seinem Brötchen, setzt sich etwas aufrechter hin, so als ob er ein Referat halten wollte, zieht einen kleingefalteten Zeitungsartikel aus der Jackentasche, lächelt und sagt: »Schon merkwürdig wie man sich, sobald man erst einmal selbst betroffen ist, plötzlich brennend für Dinge interessiert, die einen bislang kalt gelassen haben. Ich bin auf deine Frage übrigens gefasst gewesen und habe mir daher erlaubt, meinen Artikel, den zu lesen du nicht für nötig befandest, mitzubringen. Als Grundlage sozusagen, schließlich bin ich kein Zahlenfetischist, der immer alle Daten im Kopf hat.«
Zwar bin ich da ganz anderer Meinung, doch will ich jetzt mit Thilo keinen Streit. Vielmehr bitte ich ihn, ohne Umschweife einfach mit seinem Wissen herauszurücken.
»Fangen wir also mit der Tatsache an«, so beginnt er,
»dass gut ein Viertel des deutschen Energiebedarfs aus Braunkohle gewonnen wird ...«
Schon nach diesem ersten Satz ahne ich, dass Thilo nun wohl eine Reihe von Wirtschaftsdaten dozieren wird, und ich bereue es fast, ihn dazu auch noch ermuntert zu haben.
»Im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern entstehen beim Abbau von Braunkohle die geringsten Kosten«, so referiert er weiter. »Strom aus Braunkohle ist also für die Energieproduzenten eine preiswerte Angelegenheit. Kommt hinzu, dass Deutschland der drittgrößte Braunkohleförderer der Welt und zumindest bei dieser Energiequelle nicht von Weltmarkt und Weltpolitik abhängig ist. Das klingt zunächst ganz positiv, wenn man aber bedenkt, dass nennenswerter Braunkohletagebau in Westdeutschland nur vor den Toren Kölns, Aachens und Düsseldorfs betrieben wird, dann kann man sich vorstellen, in welchen Dimensionen dort auf einem sehr eng begrenzten Gebiet gebaggert werden muss, um bis zu 90 Millionen Tonnen Braunkohle im Jahr zu fördern. Denn so viel Kohle ist notwendig, um die Kraftwerke mit Brennstoff zu versorgen.«