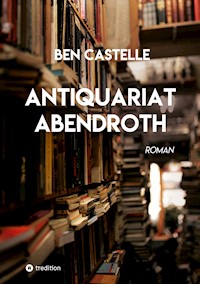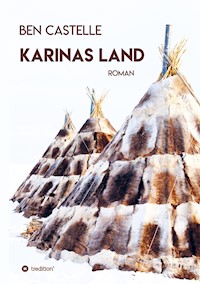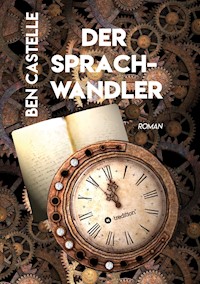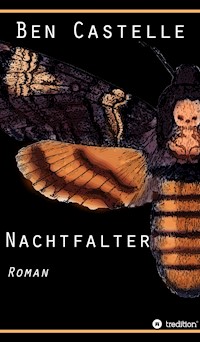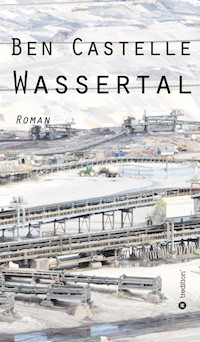4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Psychiatrie Friedhain, dem einstigen Grand Hotel Europa, geht in dieser Nacht alles drunter und drüber. Nachtschwester Paula trifft auf einen neuen Patienten, der behauptet, ein Máma der Kágaba-Indianer und gleichzeitig ein renommierter Klimaforscher zu sein. Während der Fremde aus seiner Initiationszeit in der kolumbianischen Sierra Nevada de Santa Marta erzählt, verliert Paula, die seit Jahren tablettenabhängig ist, langsam die Wirklichkeit unter ihren Füßen. Bei ihrem Versuch, dem Máma bei der Wiederbeschaffung einer spirituellen Holzmaske aus präkolumbianischer Zeit zu helfen, die seinem Volk während des Ersten Weltkriegs von einem deutschen Ethnologen entwendet wurde, verwischen sich ihr mehr und mehr die Grenzen zwischen Realität und Phantasie. »Klimawandel, Umweltzerstörung, Eurozentrismus: In diesem "Nachtstück", das gewissermaßen in der Tradition der Romantik steht, wird eine höchst eigenwillige Antwort auf die Fragen unserer Zeit gegeben.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ben Castelle
Die Masken der Mámas
Roman
Über dieses Buch:
In der Psychiatrie Friedhain, dem einstigen Grand Hotel Europa, geht in dieser Nacht alles drunter und drüber. Nachtschwester Paula trifft auf einen neuen Patienten, der behauptet, ein Máma der Kágaba-Indianer und gleichzeitig ein renommierter Klimaforscher zu sein. Während der Fremde aus seiner Initiationszeit in der kolumbianischen Sierra Nevada de Santa Marta erzählt, verliert Paula, die seit Jahren tablettenabhängig ist, langsam die Wirklichkeit unter ihren Füßen. Bei ihrem Versuch, dem Máma bei der Wiederbeschaffung einer spirituellen Holzmaske aus präkolumbianischer Zeit zu helfen, die seinem Volk während des Ersten Weltkriegs von einem deutschen Ethnologen entwendet wurde, verwischen sich ihr mehr und mehr die Grenzen zwischen Realität und Phantasie.
Impressum
© 2021 Ben Castelle
Umschlag, Illustration: Ben Castelle unter Verwendung eines Aquarells von Herry Geschwind.
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-39646-3 (Paperback)
978-3-347-39647-0 (Hardcover)
978-3-347-39648-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Šibalanēumáñ hava alēki éįzuakala nauihi kultšálula hava nasuñ ižgáua guatéį naukáį narlalá salinga kágaba lulatši hava, salinga zitaukáį nálatši hava na narlalá.
Die Mutter der Gesänge (Šibalanēumáñ), die Mutter unseres ganzen Geschlechts, gebar uns im Anfang.
Sie ist die Mutter aller Arten von Menschen und ist die Mutter von allen Stämmen.
(Aus dem Schöpfungsmythos der Kágaba-Indianer)
*
Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts (…) Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit.
(Johann Georg Hamann)
für Martina und Anna
1Die Nacht beginnt
Jeden Abend, wenn Paula die Klinik betritt, nimmt sie für einen kurzen Moment den eigentümlichen Geruch des alten Gebäudes wahr. Es riecht nach feuchtem Mauerwerk, verstaubten Büchern und kaltem Zigarrenrauch. Durch diesen Basisduft wabern amorphe Blasen aus täglich variierenden Essensaromen. Und einmal in der Woche, nachdem die Putzkolonne durchs Haus gezogen ist, gesellen sich die Ausdünstungen scharfer Putzmittel, Holzpolituren und Teppichreiniger hinzu. Jetzt im Spätsommer wird diese olfaktorische Disharmonie durch die kräftigen Muskat- und Zitronenaromen der Geranien bereichert, die von den Fensterbänken der Patientenzimmer die Hausfassaden hinabranken. Ihr würziger Duft drückt wie schwerer Rauch durch die geöffneten Oberlichter ins Innere der Klinik.
Neun Jahre ist es her, seitdem Paula in der Psychiatrie Friedhain die Nachtwache übernommen hat. Damals hatte sie sich eingeredet, diesen Dienst nur für ein paar Monate ausüben zu wollen, bis sie einen angemesseneren Job gefunden haben würde. Doch mittlerweile hat sich ihr Tag- und Nachtrhythmus so verkehrt, dass sie sich für keine Arbeit am Tage mehr geeignet fühlt. Aber auch die Nachtarbeit fällt ihr in letzter Zeit immer schwerer. Sie hat öfter unerklärliche Magenschmerzen, hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und kämpft immer wieder mit einer aufziehenden aber sich nicht durchsetzenden Migräne. Meistens treten diese Probleme mitten in der Nacht ohne Vorwarnung auf. Dazu leidet sie an einer chronischen Müdigkeit, kann aber nicht einschlafen, sobald sie in ihrem Bett liegt. Sie nimmt daher am Tag Schlaftabletten, und nachts gönnt sie sich Stimmungsaufheller. Sie hat sich schon so an die Medikamente gewöhnt, dass sie vom Nachtschwesterdasein direkt in den Patientenstatus wechseln könnte. Aber das würde sie sich niemals eingestehen.
Paulas Privatleben hat vor geraumer Zeit aufgehört zu existieren. Die wenigen Freunde, mit denen sie einmal verkehrte, sind aus ihrem Leben verschwunden. Sie ist ja auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Morgens, wenn sie von der Arbeit kommt, erledigt sie mit müdem Kopf rasch ein paar Haushaltsangelegenheiten und isst zu Mittag. Nachmittags dann begibt sie sich frühzeitig zu Bett, um mindestens sieben Stunden zu schlafen oder besser, es zu versuchen, bevor die Nachtwache aufs Neue beginnt.
Zu Beginn ihrer Tätigkeit war Paula stolz darauf, in dieser stilvollen Klinik arbeiten zu dürfen, die am Ufer eines großen Sees liegt und an deren Rückseite sich ein kiefernbestandener Hügel erhebt. Über dem Haupteingang hängt noch immer eine steinerne Tafel, auf der »Grand Hotel Europa« zu lesen ist, um bis heute daran zu erinnern, dass das Gebäude eine lange Geschichte hat und ursprünglich nicht als Klinik, sondern als Hotel errichtet worden war. Gehalten wird die Tafel von zwei pausbäckigen nackten Engeln, die Paula jeden Abend bei Dienstantritt spöttisch anlächeln. Die Engel stammen noch aus der Zeit, da das Grand Hotel internationalen Ruf genoss.
Paula hatte sich in ihren ersten Nachtwachen oft in Träumen verloren, in denen sie sich die Menschen dieser anderen Epoche vorstellte. Sie sah vor ihrem inneren Auge Damen mit weißen Sonnenschirmen und Herren mit schwarzen Zylindern, die paarweise auf der Uferpromenade lustwandelten. Oder sie stellte sich vor, wie sich die Gesellschaft am späten Nachmittag in festlicher Abendgarderobe im Speisesaal traf und zur Musik eines Streichorchesters dinierte. Manchmal war sie in Gedanken so tief in die Vergangenheit des Hauses eingetaucht, dass sie beim Wiederauftauchen darüber erschrak, wie weit die Zeit im Hier und Jetzt bereits vorangeschritten war.
Doch mittlerweile hat das Haus für Paula viel von seinem einstigen Charme verloren. Die alltägliche oder besser allnächtliche Arbeit darin hat ihr manches verleidet. Wenn sie nachts über die spärlich beleuchteten Flure eilt, um nach einem Patienten zu sehen, der ihrer Hilfe bedarf, dann ist es ja auch unwesentlich, ob sie sich in einem geschichtsträchtigen Hotel oder in einer modernen Klinik befindet. Paula hat zu arbeiten, und diese prosaische Tatsache tötet mehr und mehr die Phantasie in ihr, der sie sich früher so gern wie im Rausch überließ. Nicht einmal der einstige Ballsaal mit seinem knarzenden Parkettboden, den glitzernden, mit Swarovski-Kristallen behängten Kronenleuchtern und der aufwendigen Mahagoni-Wandtäfelung – seit hundert Jahren Quelle des kalten Zigarrenrauchs – vermag ihr beim Durcheilen noch eine Vorstellung von den rauschenden Ballnächten in alter Zeit zu verschaffen, von sich im Rhythmus der Orchestermusik wiegenden Paaren, von Frauen in weißen Kleidern und von strammen Offizieren, die verträumt mit einem Sektglas in der Hand an der Wand lehnen und in deren Monokeln sich der flackernde Kerzenschein von Dutzenden Kronleuchtern spiegelt wie der Widerschein ferner Flakgeschütze.
2Durchs Physikum gerasselt
Wie jeden Abend vor Antritt ihrer Nachtwache besucht Paula zunächst Stefan. Stefan ist Medizinstudent, der drei Tage in der Woche den Portierjob übernimmt, den Ankommenden und Abreisenden zur Hand geht, Papierformalitäten für sie erledigt und darüber hinaus die gläsernen Eingangstüren im Auge behält, damit keine unangekündigten Besucher in die Klinik einfallen und keine Patienten ohne Erlaubnis einen Ausflug unternehmen.
Stefan sitzt in einem runden Vorbau, der aus Eichenholz gefertigt ist und dessen Marmortresen von aufwendig verzierten, jedoch schadhaften Alabastersäulen gestützt wird. Hier riecht es aus unerfindlichen Gründen immer ein wenig nach nasser Kreide. Die Wand hinter ihm besteht aus Eichenpaneelen. Nur die mittlere Paneele ist ein künstlicher Nachbau aus Laminat. Dahinter befindet sich der Schacht eines Lastenaufzugs, den man vor vielen Jahren stillgelegt hat. Bei leichtem Sturm pfeift der Wind vom schadhaften Dach des Gebäudes herab bis in den Rezeptionsbereich. Aber von der Existenz des Schachts weiß Stefan nichts, und so wirkt das unerklärliche Heulen des Windes an manchen Tagen auf ihn immer etwas gespenstisch.
Über dem Tresen des Vorbaus prangt in goldenen Lettern noch immer das Wort Reception. Stefans Arbeit unterscheidet sich kaum von der des Rezeptionisten im einstigen Grand Hotel. Er ist die Schnittstelle zwischen Gebäude und Gast. Er empfängt die Patienten, verteilt Schlüssel, händigt die Post aus und hat immer ein freundliches Wort für jedermann parat. Auch die Patienten unterhalten sich gern mit ihm, vor allem dann, wenn sie erfahren haben, dass er Medizin studiert.
Stefan ist Mitte zwanzig. Auf der Nase sitzt ihm eine altmodische Nickelbrille mit Goldrand, die seine Augen aufgrund der hohen Dioptriezahl etwas kleiner erscheinen lässt, als sie es tatsächlich sind. Meist trägt er ein weißes Hemd zu einer schwarzen Jeans und roten Turnschuhen. Das scheint sein selbstgewähltes Markenzeichen zu sein. Stefan ist nicht sehr groß, sein Rücken ein klein wenig bucklig, was er selbst gern als »juvenile Kyphose« bezeichnet, um den Begriff »Scheuermann«, den er hasst, nicht aussprechen zu müssen, da er als Kind damit gehänselt wurde.
Stefans Arbeit endet heute um 22 Uhr, dann wird das Foyer geschlossen. Danach macht er sich auf den Weg zu seinem zweiten Studentenjob. Er arbeitet zusätzlich als Nachtwächter im Ethnologischen Museum, wo er oft das gesamte Wochenende verbringt. Wenn Paula in die Klinik kommt, sitzt er meistens hinter seinem Tresen, trinkt Tee und liest. So auch heute.
»Ich sehe, du bist noch immer auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, begrüßt Paula Stefan, während sie einen Blick auf den Stapel Zeitungen wirft, der jeden Abend auf der rechten Ecke des Tresens liegt. Da er noch recht dick ist, scheinen heute nur wenige Patienten in der Klinik zu sein. Es gibt allerdings selten Tage, an denen man am Abend kein einziges Blatt mehr vorfindet.
»Ist erst der fünfte von zehn Bänden«, antwortet Stefan und blickt über den Rand seiner Nickelbrille. »Da wird mich die Suche noch etwas in Anspruch nehmen.«
»Lies doch einfach den letzten Band zuerst, dann findest du sie schneller wieder.«
»Das verstehst du nicht, die verlorene Zeit stellt sich nicht wie die Auflösung eines Mordfalls auf den letzten Seiten eines Krimis ein, sondern sie entfaltet sich mit jedem Satz. Die Suche und das Wiederauffinden geschehen quasi gleichzeitig. Es ist nicht wie … wie … na, wie das da!« sagt Stefan und zeigt auf den Zeitungsstapel.
»Hm«, macht Paula und schnuppert ein paar Mal wie ein Hase in der Luft herum, »benutzt du neuerdings ein neues Aftershave? Es duftet hier irgendwie ein bisschen nach Zimt und komischerweise nach Limettensaft?«
»Was wäre das denn für ein Aftershave?«
»Stimmt, du hattest also Damenbesuch, ja?«
»Ganz gewiss nicht.«
»Ist ja auch nicht wichtig. Was gibt es denn Neues?« lenkt Paula ein, während sie nach der obersten Zeitung greift und die erste Seite überfliegt. Stefan weiß jedoch, dass die Frage nicht an die Zeitung, sondern an ihn gerichtet ist. Es ist ein eingeübtes Ritual. Deshalb wartet Stefan mit seiner Antwort, bis Paula den Tresen an einer unscheinbaren Stelle, die nur Eingeweihten bekannt ist, geöffnet hat, hindurchgeschlüpft ist und neben ihm auf einem alten Brokatstuhl Platz genommen hat. Der Stuhl hat schon bessere Tage gesehen, seine Messingbeschläge haben längst Grünspan angesetzt.
»Die Fensterputzer waren da und haben einen solchen Durchzug veranstaltet, dass Dr. Butlers gesammelte Werke eine luftige Neuordnung erfahren haben. Er bekam einen Tobsuchtsanfall, der Einlieferungspotenzial besaß. Aber der Herr Doktor sitzt ja bereits in der Klinik«, berichtet Stefan und legt sein Buch zur Seite.
Facharzt Dr. Jerome Butler, medizinischer Leiter der Klinik, ist Experte für Psychotraumatologie und schreibt zurzeit an einem großen Werk, das Bahnbrechendes für sein Fach leisten soll. Leider schreibt er nur auf losen Zetteln, die er nach einer für Fachfremde nicht nachvollziehbaren Ordnung auf seinem Schreibtisch stapelt.
»Hat er sich wieder beruhigt?« fragt Paula.
»Ja, ein interessanter Fall, für den in der Charité kein Platz war, hat ihn wieder mit der Welt versöhnt und ihn zu einem neuen Kapitel im Buch der Bücher inspiriert.«
Paula schüttelt den Kopf und lässt die Augen rollen.
»Vielen Dank übrigens«, sagt Stefan, »du hast meinen Job gerettet. Die Geschäftsführung hat mir gesteckt, dass du dich mächtig für mich ins Zeug gelegt hast.«
»Das war reines Eigeninteresse«, erwidert Paula. »Ich hatte keine Lust, zukünftig jeden Abend mit einem Hausmeister über verstopfte Rohre zu fachsimpeln, der nebenher die Eingangstür im Blick behält, allerdings nicht, um unsere Patienten freundlich zu empfangen, sondern um zu überprüfen, ob sie beim Betreten der Klinik die Schuhe abgetreten haben.«
»Das Haus hätte aber Geld gespart, wenn der Hausmeister nebenher …«
»… an Geld gespart und an Stil verloren«, fällt Paula Stefan ins Wort. »Unser Hausmeister soll sich weiter um das Haus kümmern, an die Pforte gehört jemand, der sich um die Menschen kümmert. Und da du schon mal Medizinstudent bist …«
»Trotzdem danke«, sagt Stefan. »Und falls ich mal etwas für dich tun kann …«
»Dann tust du es, ohne dass ich dich lang darum bitten muss.«
»Ja, richtig.«
»Weißt du, was ich mich manchmal frage«, erwidert Paula und blickt streng auf Stefans Lektüre, »ich frage mich, ob du die richtige Literatur liest. Nach einem medizinischen Fachbuch sieht das ja nicht gerade aus.«
»Da du dir Sorgen um mein Wohlergehen machst, sei dir verraten, dass ich in der Tat die Absicht hege, das Studienfach zu wechseln. Ich bin nämlich durchs Physikum gerasselt«, gesteht Stefan und blickt etwas verlegen zu Boden.
»Tut mir leid, das wusste ich nicht. Aber kannst du die Prüfung nicht wiederholen?«
»Doch, aber ich spüre in mir leider mehr und mehr eine Abneigung gegen alles, was mit Medizin zu tun hat. Wir sprechen dort immerzu von der ärztlichen Heilkunst, aber ich sehe nirgends Kunst, sondern überall nur Technik. Das missfällt mir.«
»Hm, die Medizin ist eine praxisorientierte Erfahrungswissenschaft, da muss die Kunst zwangsläufig auf der Strecke bleiben.«
»Ach ja, du bist ja auch vom Fach«, sagt Stefan und lacht. »Das vergesse ich immer.«
»Nein, ich habe nur Krankenschwester gelernt«, gibt Paula sich bescheiden, »und mich danach überwiegend um psychisch Kranke gekümmert, da kommt man mit der ärztlichen Diagnostik nicht sehr weit, sondern muss meistens feststellen, dass der Patient nicht seinem Krankheitsbild entsprechen will und sein Verhalten daher nicht das Geringste mit dem Verhalten zu tun hat, wie man es im Lehrbuch beschrieben findet. Es ist dann meist mehr Interpretation als Diagnostik gefragt.«
»Das meine ich ja«, ereifert sich Stefan. »Jeder Mensch ist ein Individuum. Und wenn ich einen grippalen Infekt habe und du hast einen, dann ist das nicht derselbe Infekt, selbst dann nicht, wenn wir uns bei einem leidenschaftlichen Kuss gegenseitig angesteckt haben sollten. Und folglich darf man uns in der ärztlichen Praxis auch nicht dasselbe Heilmittel verabreichen. «
»Na hör mal … leidenschaftlicher Kuss … du leidest wohl an Wahnvorstellungen. Aber du weißt ja wo die Schlüssel hängen, such dir ein schönes Zimmer aus, der Doktor kommt gleich!«
»Das war ja nur als Beispiel gemeint.«
»Eben drum.«
»Wie bitte?«
»Ach, vergiss es und verrate mir lieber, was du anstatt Medizin studieren möchtest.«
»Wenn ich das wüsste«, lamentiert Stefan und massiert sich mit beiden Händen die Schläfen, so als ob er hoffe, auf diese Weise einen Gedanken produzieren zu können, der ihm einen Ausweg aus seiner misslichen Lage verspricht.
»Deinem Literaturgeschmack nach würde ich es mal mit Romanistik versuchen«, sagt Paula und zeigt auf Marcel Prousts Roman, den Stefan zurzeit liest.
»Ich glaube nicht, nein. Das wäre auch nichts für mich.«
»Oder vielleicht Slawistik? Weißt du, dass Turgenjew und Dostojewski einmal in diesem Hotel übernachtet haben?«
»Aber bestimmt nicht zusammen, oder?«
»Nein, gewiss nicht. Das hätte Krach gegeben. Ein Westler und ein Slawophiler unter einem Dach, auwei. Aber im abgesperrten Obergeschoss gibt es noch ein Zimmer, in dem sie im Abstand von einigen Jahren eingecheckt haben sollen.«
»Wir können ja mal zusammen hinaufgehen«, sagt Stefan und deutet vielsagend auf das Schlüsselbrett hinter sich.
»Irrtum«, sagt Paula, »den Schlüssel findest du dort nicht, der ist woanders versteckt. Und was sollten wir dort oben auch?«
»Na, mir würde schon was einfallen«, sagt Stefan und zieht spaßeshalber ein wenig diabolisch die Augenbrauen hoch.
»Vorsicht, es droht ein grippaler Infekt«, wehrt Paula ab und erhebt sich von ihrem Stuhl.
»Nicht von mir, ich bin kerngesund.«
Paula lacht laut auf. »Das glaubst du doch wohl selber nicht«, sagt sie und öffnet den Durchlass am Tresen.
»Warte!« ruft Stefan. »Können wir nachher wieder ein wenig telefonieren, quasi von Anstalt zu Anstalt, um uns die Zeit zu vertreiben? Ich verbringe die Nacht nämlich wieder mal im Museum.«
»Da stör ich dich doch nur bei deinen postpubertären Träumereien«, sagt Paula.
»Aber nein, du störst mich niemals«, erwidert Stefan und wirft Paula eine Kusshand zu.
3Der Neue auf Zimmer neun
Gegen 20.30 Uhr muss Paula im Schwesternzimmer sein. Dort steckt sie sich jeden Abend ihr Namensschild an die Bluse und bekommt mitgeteilt, was am Tag geschehen ist und worauf sie in der Nacht besonders achtzugeben hat. Heute ist Peter Weber vor Ort, der die Pflegeleitung vertritt, ein leicht überdrehter Mittfünfziger, nur gut eineinhalb Meter groß, dafür aber fast genau so breit. Weber scheint alles komisch zu finden, bekommt zuweilen jedoch ohne Grund einen hysterischen Anfall. Auch Dr. Butler hat sich im Schwesternzimmer eingefunden. Der Vorfall mit den Fensterputzern am Nachmittag ist ihm nicht anzusehen, er wirkt entspannt und heiter.
Ab und an stößt zur Übergabe auch noch eine von den Psychologischen Psychotherapeutinnen hinzu oder jemand von der Geschäftsführung gibt sich ein Stelldichein, falls es verwaltungstechnische Probleme gibt. Doch heute ist man nur zu dritt.
»Wir haben auf Zimmer neun einen Neuzugang«, berichtet Dr. Butler ohne jegliche Begrüßung an die Adresse von Paula, so als ob sie seit gestern gar nicht fort gewesen wäre.
Dr. Butler hat von seiner indischen Mutter einen leicht olivfarbenen Teint geerbt und eine für einen Mann erstaunliche Zierlichkeit. Wenn er spricht, dann hört man jedoch meist seinen Vater sprechen, einen englischen Unternehmer, der mit indischer Baumwolle auf den europäischen Märkten reich wurde, seinen sieben Kindern eine gute Ausbildung finanzieren konnte und einen fatalen Hang zur Ironie besaß, die es einem schwer machte, seine wahre Einstellung und Meinung zu einem Thema zu erraten. Er war wie eine gehäutete Tomate, sagt Dr. Butler gern, wenn er von seinem Vater spricht. Wenn man ihn zu fassen versuchte, flutschte er einem aus der Hand.
»Ach, Sie meinen unser Aschenputtel«, feixt Peter Weber, der sich anscheinend schon einen Spitznamen für den Neuzugang erdacht hat. »Es hat sogar seine drei Nüsse dabei.« Weber kichert und singt halblaut: »Cinde… rella Rocke… fella.«
Vor ihm auf dem kniehohen Glastisch liegt sein Smartphone, das alle paar Sekunden ein pulsierendes Fiepen von sich gibt, so als ob Weber mit einer interstellaren Raumflotte in ständigem Kontakt stünde, die ihn jeden Moment aus der Runde zurück ins Mutterschiff beamen könnte. Daneben liegt sein lackroter Autoschlüssel mit einem silbernen Ferrari-Pferdchen als Konterfei.
»Nach Rockefeller sieht der leider nicht aus«, wehrt Dr. Butler ab und rekelt sich müde auf einem durchgesessenen Zweisitzersofa, das, so viel ist klar, keinesfalls zum luxuriösen Kernbestand des Hotels gehört.
»Wie jetzt? Es oder er?« fragt Paula irritiert, während sie immer noch damit beschäftigt ist, die Sicherheitsnadel ihres Namensschilds durch den dünnen Stoff ihrer Bluse zu stoßen und die Nadel korrekt zu verschließen. »Kann mich jemand aufklären?«
»Noteinweisung«, sagt Dr. Butler und gähnt, während er seine Füße, die in ausgelatschten No-name-Turnschuhen stecken, auf die Kante des Glastisches drapiert, als ob er ein Nickerchen halten wollte. »In der Charité gab es keinen Platz mehr für ihn, und da hat man uns gebeten, ihn zwei, drei Tage unter Beobachtung zu halten. Morgen früh kommen zwei Polizeibeamte und wollen noch einmal versuchen, mit ihm zu sprechen«, fügt er hinzu, wobei die Hälfte seiner Worte von einer Gähnattacke verschluckt wird.
»Und was hat das offensichtlich männliche Aschenputtel angestellt?« fragt Paula, die ihr Schild mittlerweile befestigt hat und sich einen Kaffee eingießt, der vom Nachmittag stammt und nur noch lauwarm ist.
»Es hat versucht, in das Ethnologische Museum einzubrechen «, erklärt Weber und findet es komisch, weiterhin von einem Neutrum zu sprechen. »Aber der Nachtwächter konnte es dabei stellen, als es gerade eines der Dachfenster aufhebelte. Die Polizei fragt sich, wie unser Puttel überhaupt auf das Dach des Museums gekommen ist, es hatte weder eine Leiter noch ein Seil dabei und war darüber hinaus barfuß.«
»Aber es war nicht zufällig unser Stefan, der den Eindringling stellte?« fragt Paula, die sich wundert, dass Stefan ihr vorhin von dem Vorfall nichts erzählt hat. Vielleicht war er zu sehr mit seinem misslungenen Physikum beschäftigt.
»Was? Ach nein, der war es nicht. Der arbeitet doch nur am Wochenende dort, oder?« fragt Dr. Butler und fügt hinzu: »Erschrecken Sie sich nicht, der Neue sieht aus wie ein Indianer. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Studenten aus Südamerika handelt, der komplett durchgeknallt ist, was auch immer das für ein Krankheitsbild sein mag. Vielleicht widme ich Komplett durchgeknallt in meinem Buch ein eigenes Diagnosekapitel, oder was meinen Sie? Auf mich jedenfalls macht er nicht den Eindruck, als ob er noch studierte. Er sieht viel älter aus als ein Student.«
»Und was sagt er selber zu seiner Aktion?« fragt Paula, die immer noch Schwierigkeiten hat, das verwirrende Gerede der beiden in einen sinnvollen Zusammenhang einzuordnen.
»Das ist das Problem«, antwortet Dr. Butler. »Er spricht nicht. Weder auf der Wache, noch bei uns hat er auch nur ein Wort gesagt. Er sieht dich an, als ob er nichts verstünde. Aber er kann ja nicht direkt aus dem Regenwald hierher transloziert worden sein.«
»Wer weiß, wofür die Zaubernüsse gut sind«, kichert Peter Weber schon wieder.
Da Paula ihn nur sehr ernst und verständnislos ansieht, erklärt er nüchtern: »Es trägt so eine bunte Umhängetasche bei sich, wie man sie in Eine-Welt-Läden kaufen kann, und darin befinden sich drei Nüsse.«
»Und eine Holzflöte und ein paar Blätter«, fügt Dr. Butler hinzu. »Doch was das Merkwürdigste ist, er hat auch eine Holzspule dabei, auf die ein langer Goldfaden aufgewickelt ist. Vielleicht können Sie den Patienten nachher dazu überreden, etwas zu sich zu nehmen. Er hat bislang weder gegessen, noch getrunken.«
»Ich kann es versuchen«, sagt Paula. »Gibt es für ihn einen Medikamentenplan?«
»Nein«, antwortet Dr. Butler, »der Mann verweigert selbst Vitamintabletten. Ich bin mir auch überhaupt noch nicht sicher, mit welcher psychischen Disposition wir hier konfrontiert sind. Ehrlich gesagt habe ich bislang rein gar nichts aus ihm herausbekommen und daher keine Ahnung, ob hier irgendeine schizophrene Struktur oder eine massive Persönlichkeitsstörung oder was auch immer vorliegt. Er spielt diesen Indianer so gut, dass ich heute Nachmittag ein paar Mal daran zweifelte, ob er ihn wirklich nur spielt, verstehen Sie?«
»Zieht das Ethnologische Museum nicht gerade ins neue Humboldtforum um?« fragt Paula, die sich an ein Gespräch erinnert, das sie kürzlich mit Stefan geführt hat. Dieses Gespräch war der Grund dafür gewesen, warum sie sich bei der Geschäftsführung für ihn eingesetzt hatte, denn Stefan befürchtete, seinen Job im Museum aufgrund des Umzugs bald verlieren zu können. Im neuen Forum benötige man keine Studenten mehr als Aushilfe, dort arbeiteten angeblich nur noch ausgebildete Fachkräfte. Und da ein Unglück selten allein kommt, beschloss die Geschäftsführung der Klinik zur selben Zeit, den Hausmeister nebenher den Türdienst versehen zu lassen, um ein paar jämmerliche Euro einzusparen. In diesem Moment war Paula für Stefan in die Bresche gesprungen, damit er nicht beide Jobs auf einmal verlor und dadurch sein Studium in Gefahr geriet.
»Sie meinen, es handelte sich beim Besteigen des Daches in Indianerkleidung um eine politische Protestaktion? « fragt Weber und grinst. »Wir Indianer wollen, dass unser Tomahawk im Ethnologischen Museum begraben bleibt. Howgh, ich habe gesprochen.«
»Vielleicht«, sagt Paula, »obwohl Sie da jetzt Nord- und Südamerika verwechseln.«
»Etwas spät«, meint Dr. Butler. »Der Umzug ist doch seit Jahren beschlossene Sache. Außerdem hätte er dann ja ein Transparent oder so etwas ausgerollt und nicht das Dachfenster aufgehebelt.«
Paula nippt an ihrem Kaffee, verzieht ihr Gesicht und gießt den Inhalt der Tasse in den Ausguss des Waschbeckens. Sie denkt darüber nach, ob sie gleich Brot und Tee für den Neuen aus der Küche herbeischaffen soll. Die Nacht ist ja noch lang, und vielleicht überlegt es sich der merkwürdige Patient anders und gibt seine Blockadehaltung auf.
»Ansonsten war heute alles ruhig«, ergreift Dr. Butler erneut das Wort. Anscheinend will er über den Vorfall mit den Fensterputzern nicht sprechen. »Frau Stingler hat ein paar Ölfarben an die Wand geklatscht, weil sie in der Therapiestunde nicht malen wollte. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr los war. Sie war ganz außer sich, geradezu fremdgesteuert, und Rechtsanwalt Folz hatte kurz darauf eine Fressattacke und hat sich die abgehungerten zwei Kilogramm von vergangener Woche in zehn Minuten wieder auf die Rippen geladen. Darüber hinaus gab es drei Entlassungen, die Sieben, die Vierzehn und die Achtzehn, so dass heute Nacht nur drei Patienten zu betreuen sind.«
»Das mit Herrn Folz ist ja nicht das erste Mal«, bemerkt Paula.
»Nein«, sagt Dr. Butler, »unser Herr Rechtsanwalt entwickelt sich zu einem verlässlichen Dauergast. Paradoxerweise ist es so: Je weniger er seinen eigenen Grundumsatz zu steigern vermag, desto größer wird der unsrige.«
»Dafür, dass Sie sein Therapeut sind, sind Sie manchmal sehr zynisch«, kritisiert Paula Dr. Butler.
»Wie könnte die Wahrheit zynisch sein? Wenn Sie meine Worte als zynisch empfinden, dann verstehen Sie nichts von Klinikmanagement. Mit zu rasch gesundenden Patienten lassen sich keine Erfolgsbilanzen schreiben. Da muss man realistisch sein.«
»Seit wann interessieren Sie sich für Verwaltungsangelegenheiten? « fragt Paula spöttisch.
»Das sollten Sie auch tun«, antwortet Dr. Butler. »Es ist immer gut zu wissen, wie die da oben ticken, denn dann werden Sie mit Entscheidungen, die unter Umständen Ihr Leben verändern können, nicht aus heiterem Himmel konfrontiert.«
»Ich bitte Sie«, sagt Peter Weber, der eine Kritik an der Verwaltung auch als Kritik an ihn als Pflegeleiter versteht, »transparenter kann man Verwaltungsarbeit kaum leisten. Sie wissen, dass wir hier nicht in einem Heim der Barmherzigen Schwestern arbeiten. Wenn es unserer Einrichtung nicht gelingt, aus eigener Kraft auf wirtschaftlich gesunden Beinen zu stehen, dann reicht uns niemand eine UAG, an der wir uns getrost festklammern dürfen, sondern es wird uns auch noch in den Allerwertesten getreten, um uns schneller zu Fall zu bringen. So ist das nun mal mit privaten Einrichtungen.«
»UAG?« fragt Paula irritiert.
»Er meint wahrscheinlich eine Unterarmgehstütze«, kichert Dr. Butler, »Sie wissen doch, Herr Weber hat ein Faible für blumige Ausdrücke.«
»Auf solch feinziselierte Metaphorik war ich in der Tat nicht gefasst«, gesteht Paula, »obwohl Herr Weber den Geist dieses Hauses damit ja aufs Beste verinnerlicht hat.«
»Sie meinen die allgegenwärtige bürgerliche Nachahmung aristokratischer Lebensverhältnisse, die sich in ihrer Stuckornamentik als eine brüchige erweist?« fragt Dr. Butler vergnügt, »und Sie spielen an auf das einstigeGrand Hotel als Surrogat für ein dem Bürger verwehrtes Leben im echten Schlossambiente?«
»Nein«, sagt Paula, »ich meine die Angewohnheit der Klinik, genauer der Verwaltungsspitze, immerzu Unverständliches von sich zu geben.«
»Ach so«, sagt Dr. Butler, klatscht in die Hände und springt auf, »und ich dachte, wir wollten in einen kulturkritischen Diskurs eintreten. Na, dann lassen wir Sie jetzt mal allein und wünschen eine ruhige Nacht.«
Weber erhebt sich ebenfalls von seinem Stuhl, jedoch weitaus schwerfälliger als Dr. Butler.
»Viel Spaß beim Flötespielen und gemeinsamen Nüsseknacken«, flüstert er Paula zu und grinst dabei anzüglich. Dann begibt er sich gemeinsam mit Dr. Butler zur Tür. Kurz darauf wird es ruhig. Paula hört noch ein paar Türen schlagen und das Anlassen von Automotoren. Dann ist sie wie jeden Abend allein. Allein mit ihren Patienten.
4Die Bibliothek am Ende des Patientenflurs
In der Privatklinik Friedhain, die aus der Luft betrachtet an einen Passagierdampfer erinnert, der in einem Kiefernwald auf Grund gelaufen ist, gibt es nachts nicht sehr viel Licht. Zum einen muss man sparen, zum anderen befinden sich jetzt im Spätsommer nur wenige Patienten im Haus. Die meisten von ihnen treffen erst Ende September oder Anfang Oktober ein, wenn die kalten Tage kommen und sie sich aufgrund der melancholischen Herbststimmung wieder mehr auf sich selbst und ihre Probleme besinnen.
Der überwiegende Teil der Zimmer ist auch im Winter unbewohnt. Vollausgelastet ist das Haus nie. Das gesamte Obergeschoss beispielsweise ist abgesperrt und hat rein musealen Charakter. Die Räume, in denen Tschaikowski genächtigt haben soll, als er als Dirigent auf Europatournee war, oder Turgenjew, von dem behauptet wird, er habe in Zimmer 22 einen Brief an seine Geliebte Pauline Viardot verfasst, bleiben das Jahr über verschlossen. Auch das Zimmer 29, in dem einst Franz Liszt während einer Tournee nächtigte, und in dem hinter Glas noch eine seiner Locken (oder ein Büschel Haare seines Hundes) zu finden ist, wird nur selten geöffnet. Eigentlich nur dann, wenn eine Gruppe Interessierter nach Voranmeldung die Räume besichtigen möchte.
Das in antikem Stil gehaltene Schwimmbad im Keller mit seinen Trompe-l’œil-Malereien, die dreidimensionale zerbröckelnde Säulen zeigen, hinter denen halbnackte, lediglich von Weinlaub berankte Nymphen den Betrachter zu sich locken, um den Gefoppten dann vor eine Wand laufen zu lassen, wird ebenfalls seit langem nicht mehr benutzt. Immer wieder verschwand ein großer Teil des Wassers aus dem Becken, und man wusste nicht wohin. Jetzt ist das Becken seit Jahren nur noch bis zur Hälfte gefüllt, und das Wasser riecht abgestanden und faulig, sobald es in Bewegung gerät.
Paula mag die Räumlichkeiten dort unten nicht. Neben dem alten Wasser stinkt es im Keller nach Chlor und Schweiß. Vielleicht hat es damit zu tun, dass einige Patienten hin und wieder die angerosteten Fitnessgeräte benutzen und dabei vergessen, die Klimaanlage einzuschalten, deren Lüftungsschächte mit dicken Spinnweben verhängt sind. Zu den Gerüchen von Chlor und Schweiß gesellt sich ein dritter Geruch: der von faulem Holz. Paula ist sich sicher, dass dieser aus den Bodenbrettern der alten Saunaanlage kriecht, die noch aus den 1960er Jahren stammt. Sie hat aber wenig Interesse, dieser Vermutung im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen.
Einer der wenigen Räume, die bis heute im Originalzustand erhalten sind, allerdings ebenso selten genutzt wird, ist die Bibliothek am Ende des Patientenflurs. In den schweren Regalen aus schwarzer Mooreiche findet man hinter Glastüren mit eingravierten weißen Ornamenten Tausende von Büchern, die zum einen an einstige Hotelgäste erinnern, zum anderen wohl dem Namen »Europa«, den das Grand Hotel sich erwählt hatte, Rechnung tragen sollten. Das quergetäfelte Eichenparkett, die Bogenfenster mit bunten Oberlichtern, die etwas großkotzig wirkenden Marmorsäulen, die keinerlei statische Bedeutung haben und die hier und da tiefe runde Löcher aufweisen, in die man einen ganzen Zeigefinger verschwinden lassen kann – ein Umstand, der angeblich auf Schießübungen zurückgeht, die einige Rotarmisten 1945 dort aus Übermut vornahmen – und auch die breiten Lesetische mit den Tischleuchten, von deren ovalen grünen Lampenschirmen Metallkettchen zum Ein- und Ausschalten hängen, entsprachen seinerzeit wohl ganz den bürgerlichen Vorstellungen von einer repräsentativen Bibliothek. Einen Sammelschwerpunkt, und sei er noch so weit gefasst, vermisst man allerdings. Neben den wenigen deutschen, jedoch zahlreichen englischen und vor allem russischen und französischen Hochkarätern des Literaturbetriebs im 19. Jahrhundert, von denen einige auch zu den Hotelgästen gezählt haben sollen, findet man hier vor allem medizinische Fachbücher. Mit den Arbeiten von Christoph Wilhelm Hufeland, Paul Ehrlich, Robert Koch oder auch Friedrich Theodor von Frerichs wollte man auf berühmte Ärzte der Charité verweisen, von denen ebenfalls einige im Grand Hotel genächtigt oder dort regelmäßig ihre Vorträge gehalten haben.
In seinen Freistunden findet man Dr. Jerome Butler oft in der Bibliothek, wo er sein Wissen über Medizingeschichte zu erweitern sucht. Ganz allein sitzt er dann an einem der Lesetische, während das grüne Lämpchen einen ovalen Lichtkreis über ein paar Bücher wirft, die, sobald sie berührt werden, feinglitzernden Staub wie nach einer mikroskopisch kleinen Explosion in diesen Lichtschein entlassen. Mal steht Dr. Butler auf und niest kräftig, dann wieder sitzt er minutenlang unbeweglich da und in den Gläsern seiner Lesebrille spiegeln sich alte Zeichnungen von nackten, beschrifteten Menschen.
Auch Paula findet sich gern in der Nacht, wenn Dr. Butler längst zu Hause ist, in der Bibliothek ein, um wahllos in Romanen und Erzählungen, Fachbüchern und besonders gern in Reisebeschreibungen zu stöbern und sich so die Zeit der Nachtwache zu verkürzen. Und hier muss man zugeben, dass die Bibliothek des ehemaligen Grand Hotels doch eine Besonderheit besitzt, die nicht alltäglich ist. Denn neben den großen Forschungsreisenden, wie beispielsweise Alexander von Humboldt, dessen Werke gleich mehrere Meter an Regalbrettern vereinnahmen, hat eine Ethnologische Gesellschaft, die bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs regelmäßig im Hotel tagte, in der Bibliothek zahlreiche Reisebücher zusammengetragen, die heute nicht einmal mehr fleißigen Lesern bekannt sein dürften. So manche Nacht hat sich Paula mit diesen fast Vergessenen des 19. Jahrhunderts auf große Reise begeben. So war sie beispielsweise mit Paul Herrmann auf Island, erkundete mit Hermann Zschokke Spanien, trieb sich mit Georg von Martens in den Lagunen von Venedig herum, besuchte mit Leopold von Buch Norwegen und Lappland, war mit Pierre Loti in Persien, mit Adolf Bastian in Sumatra, reiste mit Moritz Schanz quer durch Südamerika und mit Adolph Erman sogar einmal um die ganze Welt.
Hunderte und aberhunderte dieser Reisebücher gibt es hier, Bücher, die gleichermaßen nach Staub und alter Schokolade riechen, Bücher, die geschrieben und vergessen wurden, aufwendige Drucke mit Bildtafeln im Ledereinband, aber auch wissenschaftlich-sachliche Werke, geheftet in orange-braunem Karton und in unhandlicher Din-A4-Größe.
Die meisten Autoren traten ihre Reise unter wissenschaftlichen Aspekten an, interessierten sich für Geologie, Bodenschätze, Flora, Fauna oder einfach nur für das soziale und gesellschaftliche Leben fremder Völker. Paula las daher meistens nur den ersten Teil der Bücher, in denen oft ausführlich beschrieben wurde, wie die Forscher auf abenteuerliche Weise – denn Reisen war im 19. Jahrhundert, also vor Beginn des Massentourismus, noch ein Abenteuer – an das Ziel ihrer Studienobjekte gelangten. Danach wurde es ihr manchmal zu wissenschaftlich, und sie legte das Buch fort, um es sogleich mit einem anderen zu versuchen.
Und was gab es da nicht alles zu entdecken: Samuel Ludvighs Reise nach Griechenland, Franz Reuleauxs Fahrt quer durch Indien, wobei sich der Forscher für Paulas Geschmack etwas zu viel für die Entwicklung der Werkzeuge und weniger für die Menschen interessierte. Felix Speisers reißerischer Titel »Südsee, Urwald, Kannibalen« hielt Paula gleich mehrere Nächte gefangen. Offensichtlich gab es bis zur Jahrhundertwende eine solche Flut von Reiseliteratur, dass es auch an Spott nicht mangelte. So las Paula Friedrich David Jaquets »Reise in meinem Zimmer« und musste kurz darauf feststellen, dass es eine ganze Reihe solcher Zimmerreisen gab, die älteste, die sie auffinden konnte, stammte von Xavier de Maistre aus dem Jahre 1794, in der bereits die zahlreichen Reiseberichte der damaligen Zeit parodiert wurden.
Manchmal, wenn keiner der Patienten sie störte, verging die Nacht mit solcher Art von Literatur im raschen Flug, und Paula musste aufpassen, dass sie ihre Nachtschwesterarbeit nicht ganz aus den Augen verlor. Zuweilen war das Lesen wie ein Rausch, dem sie sich nur schwer entziehen konnte, so plastisch erschienen vor ihrem inneren Auge all die exotischen Pflanzen, Tiere, Landschaften und Menschen, ja sie konnte das Fremde um sich herum geradezu riechen und trug den Duft der fernen weiten Welt noch ein Weilchen in ihren Kleidern und ihrem Haar mit sich herum, bis sie sich zu Hause in ihr Bett legte und zu schlafen versuchte.
5Pfefferminztee für den Indianer
Bevor Paula in die Küche geht, erledigt sie in ihrem Büro einen Haufen Schriftkram. Die Ärzte und Therapeuten haben den Tag über für jeden Patienten ein Protokollblatt geführt. Die Daten und Notizen darauf müssen jetzt ordentlich in die jeweiligen Krankenakten übertragen werden. Jeder Krankheitsverlauf und jeder Tag in der Klinik wird lückenlos dokumentiert. Paula blättert die Zettel durch. Ein Protokollblatt trägt den Namen »Aschenputtel«. Sie erkennt darin unschwer die Handschrift von Peter Weber, dem Oberkomiker. Das Blatt ist fast leer. Paula liest: »Patient wirkt distanziert, gleichgültig, gefühlsarm und desinteressiert. Auf Fragen antwortet er nicht. An Bildern und Piktogrammen ist er nicht interessiert. Dennoch scheint es, als ob er alles rund um sich her sehr genau verfolge. Klassifikation derzeit noch nicht möglich. Patient sollte unter Beobachtung bleiben. Suizidgefahr nicht ausgeschlossen. «
Die Vermerke sind von Dr. Butler. Paula wundert sich, dass Dr. Butler ihr nichts von einer Suizidgefahr gesagt hat. In diesem Fall wird sie mehrmals in der Nacht nach dem Patienten sehen müssen. Dafür gibt es klare Vorschriften. Sie beschließt, gleich einen ersten Kontrollgang vorzunehmen.
Doch zunächst geht sie in die Küche, wobei sie den alten Ballsaal durchqueren muss, in dem nur ein paar winzige orangene Orientierungslämpchen brennen. In der Küche ist um diese Zeit niemand mehr. Sie schaltet das grelle Neonlicht an und geht zum Brotschrank, um dort einen Laib Weißbrot zu entnehmen, schneidet davon einen Kanten ab und legt ihn auf einen Teller. Dann kocht sie eine Kanne Tee und begibt sich mit diesem kargen Mahl geradewegs die Treppe hinauf in die erste Etage zu Zimmer Nr. 9.
Sie klopft drei Mal, bevor sie in den dunklen Raum eintritt. Nur eine Notbeleuchtung, ähnlich wie die im Ballsaal, erleuchtet das Zimmer. Sie tastet nach dem Lichtschalter, doch dann denkt sie, dass der Patient sich erschrecken könnte, und wartet einen Moment, bis sich ihre Augen an das spärliche Licht gewöhnt haben.
Sie sieht einen Mann in der Mitte des Zimmers auf dem Fußboden sitzen. Er trägt eine weiße Hose und eine Art langes weißes Hemd aus dickem Stoff. Neben ihm liegen ein spitzer Strohhut und eine Umhängetasche, von der Peter Weber bereits gesprochen hat. Der Mann rührt sich nicht. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Paula stellt Brot und Tee auf den Tisch und beschließt, sein Schweigen zu ignorieren.
»Ich habe Ihnen Brot gebracht und etwas Tee. Sie müssen doch hungrig und durstig sein. Möchten Sie nicht etwas zu sich nehmen?« fragt Paula. Doch der Mann bleibt reglos am Boden sitzen. Paula lässt sich davon nicht irritieren. In den letzten neun Jahren hat sie in der Klinik einige sonderbare Menschen erlebt, so dass man sie nicht schnell verunsichern kann. Sie schenkt aus der Kanne den Tee in eine Tasse und stellt diese vor den Patienten auf den Boden. Auch das Brot stellt sie neben ihn. Dann schenkt sie eine weitere Tasse Tee für sich selbst ein und setzt sich damit zu dem Patienten auf den Boden, weil es ihr komisch vorkäme, würde sie sich auf einen Stuhl setzen.
»Das ist Pfefferminztee«, sagt sie. »Eigentlich mag ich den nicht besonders. Man hat immer das Gefühl, krank zu sein. Aber ich dachte mir, Kaffee ist jetzt nicht das Richtige für Sie. Probieren Sie doch mal! Es gibt auch Brot, weißes Brot ohne jeden Schnickschnack.«
Langsam hebt der Mann seinen Kopf. Paula sieht in ein dunkles, von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht. Die langen schwarzen Haare, die einen leicht blauen Schimmer zu haben scheinen, fallen dem Mann über die Augen. Er streicht sie sich langsam mit schmalen dunkelbraunen Händen hinter die Ohren zurück. Unter seinen Fingernägeln klebt Dreck. Paula erschrickt ein wenig und zeigt auf den Tee und das Brot. Dann trinkt sie einen Schluck, um ihr Gegenüber zu animieren, es ihr nachzutun. Doch statt zu trinken, schaut der Fremde zu seiner Umhängetasche hin, öffnet sie und holt eine der Nüsse hervor, die bei Peter Weber für unerklärliche Heiterkeit gesorgt haben. Jetzt greift er hinter sich und hat plötzlich ein Messer in der Hand. Paula denkt, dass es wohl doch keine gute Idee gewesen ist, dem Fremden Gesellschaft zu leisten. Aber ihre Angst bleibt aus. Die langsamen und präzisen Bewegungen des Mannes haben etwas Beruhigendes. Er nimmt die Nuss in die linke Hand und raspelt von ihr mit dem Messer ein paar hauchfeine Flocken ab, die er sich in seine Teetasse fallen lässt, wo sie sich sogleich auflösen, als ob sie aus Butter wären. Dann schaut er Paula an. Wie hypnotisiert hält Paula ihm ihre Tasse hin, und der Mann raspelt erneut von der Nuss ein paar Flöckchen ab, die er geschickt, ohne sie mit den Fingern zu berühren, in Paulas Teetasse befördert.
»Ist das ein Gewürz?« fragt Paula, die jedoch gleichzeitig an psychoaktive Naturdrogen denken muss, sich ihre Sorge aber nicht eingestehen will. »Oder so eine Art natürlicher Zuckerersatzstoff?«
Der Fremde antwortet nicht, sondern trinkt jetzt einen Schluck von seinem Tee, bricht sich ein Stück Brot ab und beißt hinein.
Paula nippt an ihrem Tee. Unter der Pfefferminze nimmt sie ein erdiges Aroma wahr. Sie nippt noch einmal und noch einmal, versucht dabei zu ergründen, ob sie von dem Tee wacher oder müder wird, oder ob sonst etwas mit ihr geschieht, doch sie kann nicht die geringste Veränderung feststellen.
»Ich hätte ja zu gern gewusst, was es mit dieser Nuss auf sich hat«, sagt Paula.
»Ganz einfach«, antwortet der Fremde, »dank dieser Nuss können Sie jetzt verstehen, was ich sage.«
»Sie sprechen ja doch unsere Sprache«, zeigt sich Paula überrascht.
»Nein«, sagt der Mann, »ich spreche Tairona, die Sprache meiner Vorfahren, aber die Nuss macht es möglich, dass Sie mich verstehen.«
Paula fragt sich für einen kurzen Augenblick, ob so etwas möglich sein kann und ob eine solche Art von Droge wirklich existiert. Doch dann sagt sie energisch: »Sie wollen mich auf den Arm nehmen.«
»Ja«, sagt der Mann und lächelt sanft, so dass man seine weißen und unterschiedlich großen Zähne erkennen kann. »Ich wollte nur sehen, ob sie etwas, was Ihrem Verstand zuwiderläuft, dennoch eine Sekunde lang für möglich halten, oder ob Sie mich, ohne Atem zu holen, als armen Irren beschimpfen würden.«
»Und?« fragt Paula.
»Sie haben für einen winzigen Moment gezögert, also sind Sie offen für das, was Ihnen nicht auf Anhieb erklärlich ist.«
»Und was ist jetzt mit der Nuss?«
»Das ist nur eine Kolanuss, ich dachte mir, ein bisschen Koffein könnte uns beiden Nachtschwärmern nicht schaden.«
»Wie wäre es dann lieber gleich mit einem Kaffee?«
»Ich hätte nichts dagegen einzuwenden.«
»Darf ich Sie fragen, woher Sie kommen?« fragt Paula ganz ungezwungen, so als ob sie sich danach erkundigen wollte, in welchem Stadtteil der Fremde zu Hause sei.
»Ich gehöre zum Volk der Kágaba«, sagt der Mann. »Mein Name ist Máma Alejo. Es reicht aber, wenn Sie mich Alejo nennen. Wir Kágaba leben an den Abhängen der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien, dem größten Küstengebirge der Welt.«
»Paula«, sagt Paula und reicht Alejo die Hand.
Alejo nimmt Paulas Hand, betrachtet sie ungewöhnlich lange im Zwielicht und sagt: »Ich habe genau wie Sie viele Jahre in der Dunkelheit verbracht. Das gehört bei uns mit zur Ausbildung. Viele Jahre lang schlafen wir am Tag und lernen bei Nacht. Dann erst dürfen wir das erste Mal einen Sonnenaufgang sehen, und der Máma, unser spiritueller Lehrer, zeigt uns, dass alles, was er uns von der Welt gelehrt hat, nicht nur Geschichten sind, nicht nur Worte, sondern dass alle Worte Wirklichkeit sind. Es ist der größte Moment in unserem Leben, es ist unsere Geburt bei vollem Bewusstsein. Anschließend sind wir selber Mámas und dafür verantwortlich, dass das Gleichgewicht der Natur erhalten bleibt.«
»Das ist eine verdammt große Aufgabe«, sagt Paula und muss lachen, weil sie nach dem Vorfall mit der Nuss den Worten des Fremden nicht mehr so schnell Glauben schenken will.
»Ja, ja, ich weiß«, sagt Alejo, »das klingt nach Hollywood, aber unsere Spiritualität ist über tausend Jahre älter als Hollywood.«
»Aber warum sprechen Sie unsere Sprache so gut?« fragt Paula und nippt erneut an ihrem Tee wie an einem alten kostbaren Whiskey.
»Ich habe Deutsch am Colegio Andino in Bogotá gelernt«, sagt Alejo, »und dann in Deutschland Klimatologie studiert. Ich bin promovierter Klimaforscher. Mein Spezialgebiet ist die thermohaline Zirkulation. Ich habe gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam in den vergangenen Jahren wissenschaftlich nachgewiesen, was wir Kágaba seit jeher wissen, nämlich dass es ein globales Förderband gibt, eine Kombination von Meeresströmungen, die vier der fünf Ozeane miteinander verbinden und sich dabei zu einem Kreislauf von weltweiter Dimension vereinen.«
»Sie sind also ein wilder Indianer und gleichzeitig ein promovierter Wissenschaftler?« fragt Paula erstaunt.
»Nein, ich bin ein kultivierter Indianer«, protestiert Alejo, »und ein zugegeben augenblicklich etwas verwilderter Wissenschaftler.«.
»Haben Sie in diesem Outfit an der Universität unterrichtet? « fragt Paula, die immer noch skeptisch ist, ob sie glauben darf, was der Mann ihr erzählt.
»Natürlich nicht«, antwortet Alejo. »Schauen Sie im Internet nach unter Dr. Alejo de Santa Marta. Dort finden Sie Bilder von mir, auf denen ich einen Anzug trage, eine Krawatte und sogar eine Brille, womit ich dann wohl perfekt Ihrer eingeschränkten Vorstellung von einem Wissenschaftler entsprechen dürfte.«
»Aber warum steigt ein renommierter Wissenschaftler bei Nacht auf das Dach des Ethnologischen Museums?« fragt Paula, die den Vorwurf, sie habe in Sachen Wissenschaftler eine eingeschränkte Vorstellung, nicht auf sich sitzen lassen will und daher zum Gegenangriff ausholt.
»Na, um dort einzubrechen«, sagt Alejo ganz ungeniert. »Ich wollte etwas zurückholen, was meinem Volk gehört und dringend benötigt wird. Sie müssen wissen, es ist auch Aufgabe eines Máma, durch spirituelle Handlungen das System der weltumspannenden Wasserläufe in Bewegung zu halten.«
»Ah, und dazu benötigen Sie bestimmt so ein altes goldenes Amulett aus prähistorischer Zeit, das magische Kräfte besitzt«, spottet Paula. »Das kennt man ja aus Indiana Jones und Co.«
»Hören Sie«, sagt Alejo, »vielleicht ist es besser, wir brechen unsere kleine Unterhaltung hier ab. Ich sollte Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen. Sie müssen sich doch bestimmt um die Patienten kümmern.«
»Sie sind mein Patient«, sagt Paula.
Alejo lächelt. »Ja, gewiss«, sagt er. »Ich hatte schon vergessen, dass ich eigentlich ein Psychopath bin.«
»Überzeugen Sie mich vom Gegenteil!« fordert Paula ihn auf.
»Warum sollte ich das tun?« fragt Alejo und sieht Paula müde an.
»Na, umso schneller sind Sie wieder draußen«, antwortet Paula.
»Ich gehe, sobald ich gehen möchte.«
»Es war nicht ernst gemeint«, lenkt Paula ein. »Ich bin ohnehin nur die Nachtschwester. Was ich über Sie denke, ist völlig unerheblich. Die Ärzte müssen über Sie entscheiden.«
»Ich entscheide selbst über mich«, sagt Alejo und trinkt von seinem Tee.
»Wie Sie möchten«, sagt Paula. »Aber verraten Sie mir doch, was Sie im Ethnologischen Museum wollten.«
»Ich benötige eine Maske«, sagt Alejo, »die Maske des Máma Nuikukui Uakai Noavaca. Sie gehört meinem Volk. Der deutsche Archäologe und Ethnologe Konrad Theodor Preuß hat sie zusammen mit einer anderen Maske, der Maske des Máma Uakai, zu Beginn des Ersten Weltkriegs für ein paar Münzen zwei Streithähnen unseres Volkes abgekauft und seither gelten sie als preußischer Kulturbesitz.«
»Wir haben hier ein Zimmer im oberen Stockwerk, das nach Preuß benannt ist.«
»Preuß war Professor für Ethnologie und Leiter der nord- und mittelamerikanischen Sammlung im Ethnologischen Museum. Bestimmt hat er hier mal übernachtet oder den ein oder anderen Vortrag gehalten. Das Hotel war früher berühmt für seine volkskundlichen Veranstaltungen. «
»Ist die Maske wertvoll?« fragt Paula.
»Die Maske ist aus Holz und nur für uns von großem Wert. Sie hat ein beträchtliches Alter. Sie stammt, wenn man wissenschaftlichen Untersuchungen Glauben schenken darf, aus dem 15. Jahrhundert, wurde anlässlich der Gründung eines Tempels hergestellt und seither von einer Priester-Generation an die nächste vererbt. Wir Kágaba glauben jedoch, dass sie noch viel älter ist und vom Anbeginn der Zeit stammt.«