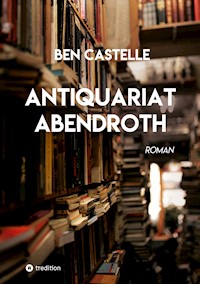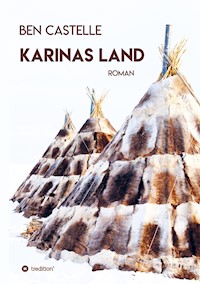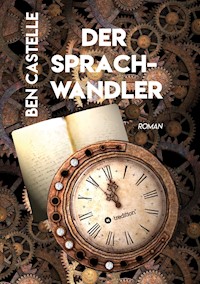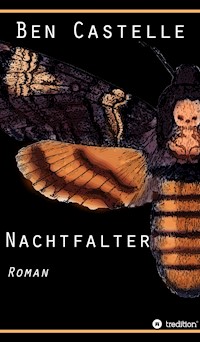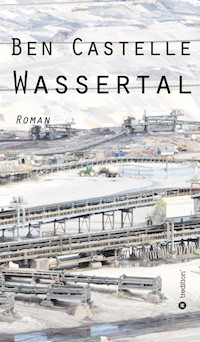2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Frühling 1832 reist der Berliner Erfinder Georg Friedrich Linde nach Weimar, um mit seinem Klangschreiber - einer technischen Apparatur zur grafischen Aufzeichnung von Schall - die Stimme Goethes für die Nachwelt zu konservieren. Im September 2004 treffen sich fünf ehemalige Germanistikstudenten und ihre einstige Professorin, um anhand von Briefen, die Linde kurz vor seinem Tod 1858 aus dem Gefängnis schrieb, und in denen er von seiner Begegnung mit Goethe berichtet, Erkenntnisse über den Verbleib dieser Sprachaufzeichnungen zu gewinnen. Doch der verheerende Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, in der Lindes Briefe lagern, und andere mysteriöse Ereignisse machen den Geisteswissenschaftlern langsam klar, dass sie nicht die Einzigen sind, die sich für die ersten Sprachaufzeichnungen der Menschheitsgeschichte interessieren. Auf der Suche nach Goethes Stimme verschwimmen die Grenzen zwischen Geschichte und Fiktion, Realität und Phantasie. Ein Roman, der von der Pionierzeit der Akustikforschung und einem ihrer späten Erfolge und mehr noch von Sprache und Literatur handelt sowie von der Liebe, von der jeder der sechs Protagonisten seine eigene Geschichte zu erzählen weiß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ben Castelle
Der Klangschreiber
Roman
Impressum
© 2017 Ben Castelle
Umschlag, Illustration: Ben Castelle unter Verwendung einer Phonautographen-Zeichnung von 1882 aus der Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo Universidad de Sevilla. Wikimedia Commons, lizenziert unter:
CreativeCommons-Lizens Attribution 2.0 Generic, (CC BY 2.0),
URL: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7439-6581-2 (Paperback)
978-3-7439-6582-9 (Hardcover)
978-3-7439-6583-6 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit und verdirbt dadurch die Poesie.(Goethe)
You live your life as if it’s real ...(Leonard Cohen)
1
Eine Stimme aus der Vergangenheit
Ich hörte den Anrufbeantworter gleich drei Mal hintereinander ab, halb fasziniert von der immer noch vertrauten Stimme, halb irritiert von dem, was sie mir zu sagen versuchte. Fünf Jahre waren vergangen, in denen ich keinerlei Kontakt mehr zu Professor Bertram gehabt hatte, fünf lange Jahre, in denen ich mich manchmal schämte, ihr nicht wenigstens zum Geburtstag einen kleinen Gruß gesendet zu haben. Und jetzt hatte sie den ersten Schritt getan und war einfach wieder in meinem Leben aufgetaucht.
Sie hielt sich nicht lange mit irgendwelchen Vorreden auf, sondern kam direkt zu ihrem Anliegen. Aber meinte sie das ernst? Ich sollte sofort zu ihr in das alte Universitätsstädtchen kommen. Sie brauche mich dort. Die anderen Ehemaligen kämen auch. Punkt 17 Uhr bei ihr zu Hause. Ich sei der Letzte, auf dessen Zusage sie warte. Sie sei sich aber sicher, dass ich kommen werde, denn es ginge um niemand anderen als um Lisa Kohn. Sie stecke in Schwierigkeiten. Und ob ich schon von dem schrecklichen Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar gehört habe? Gestern Abend seien dort zigtausend einzigartige Bücher verbrannt. Eine Katastrophe. Sie und Frau Kohn seien da seit einigen Monaten an einer interessanten Sache dran. Das könne sie alles jetzt nicht erklären, aber wenn sich das, was sie seit heute Morgen vermuteten, bewahrheite, dann wäre es wohl eine kleine Sensation zu nennen.
Da ich als langjähriger Student von Professor Bertram wusste, dass das Wort Sensation normalerweise nicht in ihrem Wortschatz vorkam, oder falls doch, dann nur in einem ironischen Zusammenhang, musste wirklich irgendetwas Ungewöhnliches geschehen sein. Darüber zu spekulieren wäre jedoch reine Zeitverschwendung gewesen. Ich versuchte also, Professor Bertram zurückzurufen, doch sie ging nicht ans Telefon. Ich schaute auf die Uhr: Es war jetzt acht Uhr in der Früh. Ich war soeben vom Joggen am Strand zurück in meine Wohnung gekommen und hatte weder geduscht noch gefrühstückt. Zudem war es Freitag, und ich musste also mit starkem Verkehr auf den Autobahnen rechnen. Ich würde mich also sehr beeilen müssen, wenn ich heute noch bei Professor Bertram eintreffen wollte. Aber wollte ich das wirklich? Natürlich wollte ich, denn ich spürte, dass mein Herz zu klopfen begann, als ich den Namen Lisa Kohn hörte. Und außerdem wollte ich meiner Professorin, auch wenn es schon fünf Jahre her war, dass sie mir die Doktorwürde verliehen hatte, nach all den verpassten Geburtstagsgrüßen nicht noch einmal untreu werden.
Ich packte also rasch meine Sachen und fühlte mich dabei wunderbar erleichtert, das Wochenende und damit meinen eigenen Geburtstag nicht in diesem verschlafenen Küstenort verbringen zu müssen, wo mir zwei lange Tage nichts weiter einfallen würde, als bei langen Strandspaziergängen meine Depressionen zu pflegen.
2
»The Sum Of Human Knowledge«
Im Autoradio war der Bibliotheksbrand das beherrschende Thema. Rund dreißigtausend Bücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, so hieß es, eine wertvolle Musikaliensammlung sowie ein Deckengemälde und mehr als dreißig Bilder im Rokokosaal seien durch das Feuer zerstört worden. Die Radiomoderatoren rätselten über die Ursache des Brandes, weil sie anscheinend den Bericht der Brandsachverständigen nicht abwarten konnten. Kurzschluss oder Brandstiftung, das schienen die beiden Alternativen zu sein, an denen sie ihre Phantasie entzündeten. Da die Bücher bereits in fünf Wochen aus der Anna Amalia Bibliothek in ein neues Magazin hätten umziehen sollen, wollte einer der Sprecher nicht ausschließen, dass man bestimmt auch in Richtung eines versuchten Versicherungsbetrugs ermittele.
Nach fast fünf Stunden Autofahrt, von denen ich allein anderthalb in einem Stau verbracht hatte, erreichte ich endlich mein Ziel. Ich fuhr nicht gleich zu Professor Bertram, denn ich wollte mich zunächst in der Stadt umsehen, ein wenig entspannen und in Ruhe einen Kaffee trinken.
Ich parkte den Wagen in einer unbelebten Seitenstraße am Stadtrand. Von dort schlenderte ich gemächlich in Richtung Universität. Vieles hatte sich in der Stadt verändert. Zwischen den alten Häusern standen Neubauten aus Glas und Beton oder, was wahrscheinlicher war, man hatte sie anstelle der alten Gebäude errichtet, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Einzig die spätgotische Kirche und das glattgewetzte Kopfsteinpflaster des Marktplatzes waren unverändert geblieben. Als ich von dort weiter in Richtung Universität ging, sah ich schon aus der Ferne, dass die Zeit auch hier nicht stehengeblieben war. Über dem First des langgezogenen Satteldachs am Philologischen Institut erhob sich jetzt eine gläserne Kuppel. Oben vom Dach, so wurde es damals von einer Studentengeneration zur anderen kolportiert, sollte sich Ende der sechziger Jahre ein Student aus politischen Gründen in den Tod gestürzt haben. Einige behaupteten, es habe sich um eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg gehandelt, andere meinten, der Kommilitone habe gegen das Establishment protestieren wollen. Seither gab es neben dem Haupteingang ein kleines metallenes Kreuz, das aber die letzten Renovierungsarbeiten wohl nicht überstanden hatte, denn ich suchte es vergebens.
Früher ging man durch zwei mit Parolen bekritzelten und mit Graffiti versehenen Schwingtüren in das Gebäude hinein. Nun verrichteten elektronisch gesteuerte Schiebetüren ihren Dienst. Als ich eintrat, wehte mir eine trockene, keimfreie Luft entgegen.
Auch im Gebäude selbst hatte sich einiges geändert. Dort, wo man früher mit einem Gruß an den Studienkollegen, der in einem winzigen Glashäuschen zur Aufsicht abgestellt war, in die Bibliotheksräume entschwand, war jetzt der Eingang zugemauert, und ich ahnte nicht, wie man in das Innere des Instituts gelangen sollte, ja fragte mich, ob es dieses Innere überhaupt noch gab. Selbst das kleine Bistro im Keller, wo man für wenig Geld einen Kaffee im Pappbecher erstehen konnte, war verschwunden und mit ihm die vielen Studenten, die auf klapprigen Stühlen, auf Treppenstufen und Heizungskörpern saßen und rauchend und Kaffee trinkend miteinander plauderten.
Nur den Hinterausgang gab es noch, der direkt auf die Grünfläche zwischen dem Institut und der Universitätsbibliothek führte. Und selbst die Ruhebänke an der kleinen gepflegten Rasenfläche waren noch immer dieselben, ebenso wie die japanischen Kirschbäume, die im Frühling stets zu voller Pracht erblühten, während man aus den überfüllten Hörsälen in ihre Kronen geblickt und sich ins Freie gesehnt hatte.
Ich setzte mich auf eine der Bänke und sah mich um. Der ruhige Innenhof, der von den einzelnen Fakultäten, dem altsprachlichen und dem neusprachlichen Seminar und der kleinen Kirche gebildet wurde, war mir noch immer vertraut, und als die Kirchturmuhr ihre dezenten Schläge erklingen ließ und ich für einen Moment die Augen schloss, schien ein wenig vom Flair der einstigen Studienzeit zurückzukehren. Doch das nostalgische Gefühl währte nicht lange.
Hinter den Kirschbäumen erkannte ich die Universitätsbibliothek, die wie ein großer Wal mit geöffnetem Maul auf der Grünfläche gestrandet zu sein schien. Sie hatte ein weiteres, in der Farbe etwas heller wirkendes Stockwerk erhalten, schien aber ansonsten wenig verändert. Ich entschloss mich, noch einmal den Lesesaal aufzusuchen, in dem ich so viele Tage meines Studiums verbracht hatte.
Ich war immer gerne im Lesesaal gewesen. Denn wo sonst in der Welt kann man gemeinsam mit vielen Menschen in einer fast sakralen Stille arbeiten? All die Leute, die vor ihren Büchern sitzen, die mit schiefgestellten Köpfen zwischen den Regalen suchend unterwegs sind, die sich Exzerpte machen, grübelnd zum Fenster hinausblicken und dabei so gut wie keinen Laut von sich geben! Nur ab und an hört man jemanden flüstern oder halblaut mit der Bibliotheksaufsicht reden. Aber ansonsten ist es wohltuend still wie in einem buddhistischen Kloster.
Nachdem ich meine Jacke in einem abschließbaren Spind verstaut hatte, durfte ich in den Lesesaal eintreten. Viel hatte sich hier auf den ersten Blick nicht verändert. Ich wunderte mich allerdings, dass meine Orientierung komplett fort war. Früher hätte ich sogleich gewusst, welche Bücher wo zu finden waren, jetzt sah ich mich hilflos um wie ein Erstsemester. Ich schritt ziellos an den Regalen entlang, fand theologische Fachliteratur, die in weißgegerbtes Rindsleder eingebunden war, betrachtete die Reihen mit Nachschlagewerken und Zeitschriften und atmete genüsslich den trockenen Duft der Bücher, der noch immer den großen Saal erfüllte. An einer kleinen Rezeption konnte man sich per Aufzug dicke Folianten und gebundene Zeitungsbestände aus dem Universitätskeller in den Lesesaal kommen lassen. Das war noch alles fast so wie früher, nur dass man heute über elektronische Terminals bestellte und keine Bestellscheine mehr ausfüllen musste. Eine Dame mittleren Alters, die dort ihren Dienst verrichtete, nickte mir freundlich zu. Wahrscheinlich hielt sie mich aufgrund meines vorgerückten Alters für einen Dozenten.
Während ich umherwanderte, traf mein Blick auf eine Frau, die an einem der Fensterplätze saß. Sie fiel mir auf, weil sie mehrmals aufstand und aus dem Fenster blickte und dabei sehr nervös wirkte. Ihre Bewegungen kamen mir bekannt vor. Dieses Aufstehen mit gestrecktem Oberkörper und die Art, wie sie dabei gleichzeitig eine Haarsträhne hinters Ohr zurückstrich. Doch mir fiel nicht ein, an wen sie mich erinnerte. Ich schlich entlang der Bücherregale etwas näher zu ihr. Jetzt sah ich sie von der Seite und erschrak: Es war Lisa Kohn.
Ich hatte mit ihrem Wiedersehen erst heute Abend gerechnet und fühlte mich völlig unvorbereitet, mit ihr von jetzt auf gleich ein paar Worte zu wechseln. Dennoch war es schön, sie zu sehen und sie unbemerkt ein wenig beobachten zu können. In meiner Neugierde wurde ich allerdings unaufmerksam auf meine Umwelt und warf einen dicken Folianten um, den ich mit der Schulter gestreift hatte und der mit einem lauten Knall aufs Bücherbrett kippte. Für einen Moment sahen mich einige der Lesenden teils erschrocken, teils verärgert, teils aber auch gleichgültig an. Auch Lisa zuckte zusammen, blickte zu mir hinüber, schien aber durch mich hindurch zu sehen.
Ich wollte sie jetzt etwas mehr von vorn betrachten, um festzustellen, ob sie sich verändert hatte. Dazu durchquerte ich in einer Riesenrunde den gesamten Lesesaal. Die Dame an der Rezeption blickte mich mit hochgestellten Brauen an. Wahrscheinlich verhielt ich mich nicht annähernd so, wie sie es von einem Dozenten gewohnt war. Möglich also, dass mich jeden Moment jemand beiseitenehmen und mich untergehakt zum Ausgang geleiten würde. Als ich Lisa schließlich aus einer anderen Perspektive beobachtete, kam sie mir plötzlich fremd vor. Sie war älter geworden, ohne Frage, aber in ihrem Gesicht lag noch etwas anderes, das mir unbekannt war. Ich ging noch ein paar Schritte näher an sie heran, doch da erblickte sie mich plötzlich, wie ich sie durch die Lücke einiger fehlender Bücher in einem der Regale beobachtete, zuckte zusammen, sprang rasch auf, packte hastig ihre Sachen und verließ geradezu fluchtartig den Raum.
Aus einem Impuls heraus folgte ich ihr, so wie ein Fuchs einem weglaufenden Kaninchen folgt, zögerte dann aber kurz, weil ich mir bewusst wurde, dass mein Verhalten immer absonderlicher wurde. Lisa lief die breite Treppe in Richtung Freihandmagazin hinab. Nachdem ich einige Sekunden innegehalten hatte, eilte ich ihr hinterher. Es ging drei, vier Etagen in die Tiefe, zunächst noch über grünen Teppichboden, dann über dunkelrote Terrakotta-Fliesen und schließlich über grauen Beton. Am Ende der Treppe stieß ich auf eine blaulackierte schwere Eisentür mit der Aufschrift »Eingang Magazin! Tür geschlossen halten!« Ich zog an der Klinke, trat ein, und die Tür fiel mit einer Art Schrei hinter mir zurück ins Schloss.
Man hätte meinen können, in eine Tiefgarage eingetreten zu sein. Eine Tiefgarage, in der allerdings statt Fahrzeugen Bücherregale parkten. Der Magazinkeller der Bibliothek war schon immer eine besondere Welt gewesen. Er war gewissermaßen ein Sinnbild dafür, welchen Wert wir unserem Wissen heute noch beimessen. Es wird nicht mehr, wie in vergangenen Jahrhunderten, in kostbar ausgeschmückten Räumen ausgestellt, sondern im dunklen Keller gebunkert, als schäme man sich seiner.
Hier unten konnte man nicht einfach herumstöbern, hier musste man eine exakte Signatur kennen, um das gesuchte Buch zu finden. Buchstaben und Zahlen wiesen den Weg. Es gab keine speziellen Ecken für schöne Literatur oder historische Reisebeschreibungen, hier stand Goethe neben einem Jahrbuch für Optiker und Kafka neben einer Unfallstatistik. Ohne Kataloge war man hoffnungslos verloren, so wie man es auf offenem Meer in einem Boot gewesen wäre, das über keine Navigationsinstrumente verfügte.
Zwischen den Hunderten von Stahlregalen, die sich auf einmal wie ein Irrgarten auftaten, war es sehr schwer, Lisa zu folgen. Einmal glaubte ich, sie in weiter Ferne zu sehen, wie sie gerade in einem der Gänge zwischen zwei Regalen verschwand. Doch als ich die Stelle wenig später erreicht hatte, war die Gasse leer. Warum nur rief ich sie nicht einfach laut bei ihrem Namen?
Um mich herum stand überwiegend Literatur des 19. Jahrhunderts. Ich ging weiter, bog intuitiv in einen der nächsten Gänge ein, durchlief ihn bis ans Ende und stand sodann vor einer neuen breiten Straße, von der links und rechts wieder Dutzende von weiteren Regalstraßen abzweigten. Kein Mensch war zu sehen. Als ich mich gerade entschlossen hatte umzukehren, glaubte ich, jemanden leise hüsteln zu hören. Ich schlich an den Kopfseiten von fünf weiteren Regalen entlang und trat schließlich in einen der vielen weiteren Gänge ein. Dort standen gleich mehrere Ausgaben der Encyclopædia Britannica aus den Jahren zwischen 1801 und 1890, jede an die zwanzig Bände stark. Alle Bände waren eng aneinandergepresst, nur ein Band, so erkannte ich im Vorübergehen, fehlte. Eine der ansonsten tadellosen Reihen war dadurch leicht in Unordnung geraten.
Ich ging bis zum Ende auch dieses Regals und blickte vorsichtig um die Ecke, gespannt, ob ich Lisa nun endlich entdecken würde. Im selben Moment spürte ich einen gewaltigen Schlag gegen meine Stirn. Es war, wie sich später herausstellte, exakt der fehlende Band der Britannica, der mich mit solcher Wucht am Kopf traf, das man hätte glauben können, mir sollte die vielbeschworene Sum of Human Knowledge auf einen Schlag eingetrichtert werden. Doch angesichts des geballten Wissens, das ohne Vorwarnung auf mich niederging, stürzte ich wie ein frommer Beter auf die Knie und verlor augenblicklich Verstand und Bewusstsein.
3
Ein sicheres Versteck
Es kam mir vor, als ob ich eine Unendlichkeit lang an einem warmen, hellen Ort gelegen hätte. Aus irgendeinem Grund aber trug man mich nun von dort fort. Jetzt war auf einmal ein Rauschen um mich her, als ob man mich nach draußen in den Regen legen würde. Und dann: ein Knistern, ein Zischen und schließlich eine Stimme inmitten des Rauschens. Ich versuchte, einzelne Worte zu verstehen, aber vergeblich. Dann jedoch sah ich etwas: Zunächst war es ein milchiges, fadenförmiges Licht und schließlich ein Gesicht, das sich langsam vor das Licht schob. Es war ein schönes Gesicht. Es war Lisas Gesicht, ja Lisa Kohns Gesicht. Daran gab es jetzt überhaupt keinen Zweifel mehr. Sie sprach zu mir. Aber ich verstand sie nicht. Das Rauschen übertönte ihre Stimme fast vollständig. »Lisa«, sagte ich, »schön dich zu sehen«, aber aus meinem Mund drangen nur ein paar Labiallaute, so als hätte es der Zahnarzt bei der Betäubung meines Unterkiefers etwas zu gut mit mir gemeint. Dann aber floss das Rauschen in nur einer Sekunde ab und Lisas Gesicht schien schlagartig mit einer Tonspur synchronisiert worden zu sein. »Alex, bitte, komm zu dir«, sagte sie.
»Bin ja hier«, flüsterte ich.
»Es tut mir leid, ich habe dich überhaupt nicht erkannt und hätte dich auch nie im Leben hier erwartet«, stammelte Lisa, »und außerdem bist du so dünn geworden.«
»Das sieht nur perspektivisch so aus, weil ich liege«, scherzte ich, doch Lisa blieb ernst. Vielleicht sprach ich immer noch zu undeutlich.
»Nun komm rasch wieder auf die Beine«, sagte sie und hielt mir beide Hände hin. Ich ließ mir helfen und rappelte mich langsam auf, musste mich aber noch für einen Moment an einem der Stahlregale festklammern.
»Ach Alex, dich schickt der Himmel«, sagte Lisa, als ich gerade wieder ohne Hilfe stehen konnte, und fiel mir um den Hals, so dass ich erneut leicht zu straucheln begann. »Es ist so schön, dich wiederzusehen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte ich und rieb mir die Stirn, die sich heiß und geschwollen anfühlte, während mich gleichzeitig Lisas Überschwänglichkeit irritierte. Früher hatten wir uns höchstens mal die Hand gegeben. In den ersten zwei Jahren bei Professor Bertram nannten wir uns zwar beim Vornamen, siezten uns aber in den Seminaren. Wir kannten uns bereits aus dem Grundstudium, und es war mehr so ein Spielchen zwischen uns gewesen. Unser späteres »Du« hatte uns dann eigentlich nicht näher zueinander gebracht. In gewisser Weise hatte es uns sogar wieder voneinander entfernt, da unsere Kommunikation kein Anlass mehr zu einem Lächeln bot. Denn wenn Lisa in Abwesenheit von Professor Bertram das Seminar leitete und zu mir sagte: »Alexander, können Sie uns bitte mal den dritten Abschnitt auf Seite 24 vorlesen«, dann ging dies nie, ohne dass wir uns beide kurz zulächelten, wie zwei heimlich Verliebte, die für andere eine Rolle spielen. Das hatte zuweilen etwas angenehm Geheimnisvolles. Mich wunderte auch, dass Lisa mich jetzt Alex und nicht wie früher Alexander nannte.
»Ich werde deine Stirn mit Eis kühlen, sobald wir bei Professor Bertram sind. Morgen früh ist davon nichts mehr zu sehen«, sagte Lisa und berührte ganz leicht meine Beule. Dabei kam sie mir so nah, dass ich ihr Parfüm wahrnehmen konnte. Es erinnerte mich an eine Mischung aus Vanille und frisch geschnittenem Gras.
Dann fing sie wieder an, nervös zu werden, blickte sich zu allen Seiten um und erschrak plötzlich, als sie Schritte hörte, die den Gang entlang kamen. Sie legte einen Finger auf ihre Lippen. Die Schritte kamen näher. Wir bemerkten eine alte Bibliothekskraft, die zurückgegebene Bücher wieder an ihre Standorte brachte. Die Dame schob einen kleinen Wagen vor sich her, auf dem die Bücher in großen Stapeln lagen. Sie rollte damit an uns vorbei, ohne uns zu beachten.
»Alex, du musst jetzt gehen«, flüsterte Lisa. »Wir sehen uns heute Abend bei Professor Bertram, dann werde ich dir alles erklären, auch das mit der Britannica«, sagte sie und wies dabei noch einmal auf meine Stirnbeule. »Und bitte, nimm dies hier für mich mit und verliere es nicht. Es ist sehr wichtig!« Sie hob mitbeiden Händen den Britannica-Band vom Boden auf, so dass ich schon dachte, es könne nicht ihr Ernst sein, mich mit diesem Folianten unterm Hemd auf die Straße schicken zu wollen. Doch legte sie das Buch mit der Frontseite auf ein Regalbrett, klappte dann den hinteren Buchdeckel auf und holte aus einer dort eingeklebten Papiertasche, die früher einmal, als noch nicht alles digitalisiert war, den Ausleihzettel enthalten hatte, eine kleine Speicherkarte heraus. Sie gab mir die Karte, die nicht viel größer war als eine Sonderbriefmarke der Post zur Weihnachtszeit.
»Ich dachte, bei über drei Millionen Büchern, die hier unten lagern, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn ausgerechnet jemand in einem Lexikon des 19. Jahrhunderts etwas nachschauen möchte«, sagte Lisa. »Aber wenn du die Speicherkarte an dich nimmst, dann dürfte sie noch viel sicherer sein.«
Kaum hatte sie mir die Speicherkarte übergeben, machte sie auch schon Anstalten zu verschwinden.
»Was ist denn Wichtiges darauf?« fragte ich.
»Erzähle ich dir alles später«, antwortete sie und eilte rasch davon.
Da ich noch nicht wieder über genügend Kraft verfügte, um ihr hinterherzulaufen, ließ ich sie einfach gehen. Als ich mich etwas erholt hatte, nahm ich den Britannica-Band, wischte mit dem Ärmel ein wenig Staub von seinem Rücken und stellte ihn sodann behutsam zurück an seinen Platz.
4
Bilder einer Handschrift
Wenig später schlenderte ich wieder durch die Straßen der kleinen Universitätsstadt und fragte mich, was ich hier eigentlich machte. Was immer hier vorging, es hatte sicherlich nichts mit mir zu tun. Vielleicht hatte Lisa ein psychisches Problem, litt an Verfolgungswahn oder an Paranoia. So etwas kommt ja häufiger vor, als man glaubt. Andererseits hatte man mich um Hilfe gebeten, und es schien mir moralisch nicht in Ordnung zu sein, diese zu verwehren, zumindest solange nicht, bis ich wissen würde, in welcher Angelegenheit ich denn hilfreich wirken sollte. Und schließlich – aber das gestand ich mir am allerwenigsten ein – ging es hier um Lisa Kohn, um die Frau, die ich einst wie keine andere bewundert hatte, deren Nähe mich stets einschüchterte und die mich dennoch in ihren Bann zog, sobald sie zu einem längeren Diskurs über ein literarisches Problem ansetzte, als ob die Göttin Minerva mir ihre tiefsten Weisheiten zur Dichtkunst vermitteln wollte.
Ich sah auf die Uhr. Ich hatte noch ein paar Stunden, bis ich bei Professor Bertram erwartet wurde. Ich beschloss daher, mich in der Stadt umzusehen und mir die Zeit zu vertreiben. In der Nähe des Studentenviertels stieß ich auf ein Internet-Café. Da kam mir plötzlich eine Idee: Ich trat ein, bestellte mir einen Espresso und setzte mich an einen der freien Terminals. Dann kramte ich die Speicherkarte hervor, steckte sie mit einigen Verrenkungen in einen der schmalen Schlitze des Computers, der am Boden stand, und klickte mit der Maus auf »Öffnen«. In einem Unterordner befanden sich zahlreiche Bilddateien. Ich klickte eine der ersten an. Es zeigte sich eine alte Handschrift auf dem Monitor, aber ich war nicht in der Lage, auch nur ein Wort davon zu entziffern. Weitere Dateien enthielten ebenfalls Fotografien dieser Handschrift. Es folgten noch ein paar Bilder von einer barocken Hausfront mit orange eingefassten Fenstern. Bei einem flüchtigen Blick auf die Zeitangaben der Dateien erkannte ich, dass alle Bilder an nur einem Tag und in nur wenigen Stunden gemacht worden waren. Dann sah ich auf einer der Handschriftenseiten einen blass-blauen Stempel. Ich zoomte näher heran und entzifferte »Herzogin Anna Amalia Bibliothek«. Ich erschrak, blickte dann noch einmal auf das Datum der Fotografien. Sie waren allesamt gestern Morgen angefertigt worden, also wenige Stunden bevor das Feuer im Dachstuhl der Bibliothek ausgebrochen war. Meine Phantasie spielte sogleich verrückt. Vor meinem geistigen Auge sah ich Lisa Kohn als psychopathischen Feuerteufel. Vielleicht hatte ich sie gerade dabei erwischt, als sie auch im Keller der Universitätsbibliothek zündeln wollte. Aber fotografiert man zunächst alte Handschriften, um sie sodann in Rauch aufgehen zu lassen?
Als ich im Ordner nach unten scrollte, stieß ich auf weitere Dateien, die aber vier Monate älter waren und aus dem Frühling stammten. Ich klickte die erste Datei an und sah eine Landschaft am Meer mit dunklen Wolken darüber. Auf dem nächsten Bild lachte mich ein Mann mit bloßem Oberkörper an, der in die Sonne blinzelte. Dann war eine Dünenlandschaft zu sehen, rot und blau lackierte Haustüren, kleine im Hafen dümpelnde Fischerboote, ein unterbelichteter Sonnenauf- oder -untergang sowie kreisende unscharfe Möwen. Das kam mir alles sehr bekannt vor und hatte Ähnlichkeit mit der Welt, die ich erst heute Morgen verlassen hatte.
Und dann sah ich plötzlich Lisa: Sie trug eine dunkle Sonnenbrille und einen hellblonden Strohhut mit roter Schleife. Sie saß in einem Strandcafé. Und als ich weiter klickte, da stand sie plötzlich nackt inmitten der Dünen, nur mit einem Armreif und einer Halskette bekleidet. Ich klickte das Bild schnell wieder weg, weil ich mich wie ertappt fühlte, so als hätte ich in einem fremden Nachtschränkchen gewühlt. Was ging mich diese Frau an? Zugegeben, sie war mit ihren knapp vierzig Jahren noch immer genau so attraktiv wie einst. Aber die Zeiten unseres Studiums waren lange vorbei. Und die Zeiten, da ich sie bewundert und nachts von ihr geträumt hatte, waren ebenfalls längst Geschichte. Ich verließ das Internet-Café und trat zurück auf die Straße.
Beim Herumstreunen durch die Stadt stieß ich auf eine der alten Studentenkneipen von einst. Das »Blaue Krokodil« war früher unser Rückzugsort gewesen. Auf dem ramponierten Mobiliar tummelten sich bei spärlicher Beleuchtung nicht nur Studenten, sondern auch zahlreiche Künstler. Hier traten die Jazzgrößen der Region auf, die unbekanntesten aber keinesfalls unbegabtesten Musiker der Welt, die allesamt von einer großen Karriere träumten, die aber für die meisten von ihnen nie eintreffen sollte.
Aber was war das? Die blaue Front der einstigen Kneipe war weggerissen. Vor das Gebäude hatte man einen großen quadratischen Glasbau gesetzt. Kellnerinnen in lila Schürzen glitten elegant darin herum wie Prachtfische in einem Tropenaquarium. Statt der maroden Stühle gab es jetzt chromblinkende Sitzgelegenheiten und ebenso blitzende Tische. Als ich eintrat umfing mich eine sanfte afrikanische Musik, und es roch statt nach Nikotin nach Kaffee und Schokolade.
Ich setzte mich in eine der hintersten Ecken, die von der Straße aus nicht einzusehen waren. An einem mannshohen Holzständer, dessen Kopf aus einem runden Stahlring bestand, hingen die täglichen Gazetten, ihr dünnes Rückgrat klemmte in einer Holzleiste, so hielt es wenigstens einen Tag lang stand. Der Brand in der Bibliothek war das beherrschende Thema neben dem »Geiseldrama« im russischen Beslan, wo Terroristen eintausendzweihundert Menschen, darunter mehr als achthundert Kinder in einer Schule festhielten und damit drohten, das Gebäude zu sprengen, falls in Inguschetien inhaftierte tschetschenische Kämpfer nicht aus der Haft entlassen würden.
»Einsturzgefahr des Unesco-Weltkulturerbes nicht mehr akut« titelte eine der Zeitungen. Daneben stand zu lesen: »Terroristen wollen das Gebäude sprengen«. Eine andere Zeitung vermeldete: »Brandursache weiterhin unklar« und eine dritte: »Bund sichert vier Millionen Euro Soforthilfe zu«. Rund fünfzigtausend Bücher, so erfuhr ich bei einem raschen Crossreading, habe man retten können, davon seien jedoch vierzigtausend durch Rauch und Löschwasser beschädigt worden. Während die Ursache von zwei Explosionen in der Nähe der Schule ungeklärt blieben, hätten die Geiselnehmer drei Frauen und ihre Säuglinge freigelassen. Zehntausende Bücher werde man in das Zentrum für Bucherhaltung nach Leipzig bringen. Dort wolle man sie einfrieren. Das Gewicht der bisher in Leipzig eingetroffenen Bücher liege im »zweistelligen Tonnenbereich«. Russische Sicherheitskräfte machten sich bereit, die Schule zu stürmen. Für dreißigtausend weitere Bücher habe es keine Rettung mehr gegeben, sie seien im Feuer verbrannt.
5
Die Freitagsgesellschaft
Ich war in früheren Jahren mehrfach bei Professor Bertram gewesen. Aber jetzt konnte ich mich nicht mehr erinnern, wie man in das Viertel kam, in dem sie wohnte. Ich erinnerte mich noch, dass sie mit all ihren Büchern in einem Haus aus der Jahrhundertwende lebte, ein Haus mit schönen Stuckornamenten und zwei auffälligen Karyatiden im Eingangsbereich.
Auf der Suche nach ihrem Haus erinnerte ich mich daran, dass sie ihren Lehrstuhl an der Universität immer nur ungern verlassen hatte. Tagungen, Symposien oder Vorträge, die ihre Anwesenheit jenseits des Campus erforderten, waren ihr lästig. Sie liebte ihr bescheidenes Büro mit den wenigen Möbeln aus Kirschholzimitat, die noch aus den fünfziger Jahren stammten, und ihren an Kratzern reichen aber stets aufgeräumten Schreibtisch mit der altmodischen grünen Schirmlampe. Auch ihr kleines Bücherregal, auf dem immer nur die Werke zu finden waren, die sie für das jeweilige Semester benötigte, und der winzige runde Tisch mit drei Beinen, an dem sie sich gern mit uns Studenten niederließ, um bei einer Tasse Tee Gespräche über Literatur zu führen, waren ihr für das alltägliche Wohlbefinden unersetzlich.
Getrennt von einem kleinen Vorhang, als ob sich dahinter Unschickliches verbergen würde, befand sich in einer Ecke des Büroraumes eine winzige Küchenzeile, die Professor Bertram gern scherzhaft als ihre »Küchensilbe« bezeichnete. Dort war ein Teekessel, eine elektrische Herdplatte sowie ein meist mit nur einer einzigen Flasche Milch bestückter Kühlschrank zu finden. Die Milch benötigte sie für ihren Fünf-Uhr-Tee. Auf einem ungefähr brusthohen Sideboard, in dem sich die zur Verwaltung ihrer universitären Aufgaben unerlässlichen Aktenordner befanden, stand eine undefinierbare Gipsbüste eines klassischen Dichters, die immer ein wenig angestaubt wirkte und die das Geschenk ihres ersten Doktoranden nach bestandener Prüfung gewesen war.
An den Wänden fand man des Weiteren eine Reihe gerahmter Handschriften, die nur für Menschen von Interesse waren, die sich die Mühe machten, die Schriften sehr genau in Augenschein zu nehmen. Dies kam aber selten vor, und selbst für Professor Bertram schienen die einst mit viel Bedacht ausgesuchten graphischen Meisterwerke langsam an Materialität zu verlieren. Sie wurde nur noch auf sie aufmerksam, wenn die Putzfrau sie mit ihrem Staubwedel aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Beim Zurechtrücken kam es dann schon einmal vor, dass sie philosophische Betrachtungen darüber anstellte, wie durch eine entstandene Unordnung wieder Dinge ins Bewusstsein treten, die im Zustand der Ordnung wie verschluckt und nicht mehr existent sind. Sie hatte, so erinnerte ich mich jetzt wieder, ein paarmal von diesem Gedanken ausgehend sogar eine kleine Literaturtheorie entworfen, die besagte, dass ein Autor nur dann neue Erkenntnisse stiften könne, wenn er in der Lage sei, die Form, die er gewählt habe, nicht exakt in allen ihren Anforderungen zu erfüllen, sondern wenn er diese Form ganz bewusst hier und da beschädige. Goethe war ihr dafür ein gutes Beispiel, und einige Stellen in seinen Dramen aber auch Gedichten schienen der Professorin diese kleine Theorie aufs Schönste zu bekräftigen. In kleiner Runde wurde sie nie müde, uns diese und andere zuweilen kuriosen Überlegungen in allen Einzelheiten vorzustellen. Eine Frage aber beschäftigte sie immer wieder, und auch die hatte mit Goethe zu tun: Sie konnte sich einfach nicht erklären, warum Goethe, der doch nicht nur Dichter war, sondern sich als Universalgelehrter mit fast allen Fragen seiner Epoche auseinandersetzte, warum dieser nie intensiv über die Sprache selbst reflektiert hatte und das, obwohl er doch in Kontakt zu Wilhelm von Humboldt stand. Das war ein immer wiederkehrendes Rätsel für sie. Und sie träumte oft davon, dass sie den Geheimrat eines schönen Tages zu diesem Thema einmal intensiv befragen dürfte.
Ich glaubte damals, bevor ich zum ersten Mal ein Seminar von Professor Bertram besuchte, mit meinem Studium in zwei bis drei Semestern fertig zu sein. Mir fehlten nur noch wenige Leistungsnachweise. Wie viele andere Studierende hatte ich mich einst für die Literatur interessiert, weil sie mir bedeutend für mein Leben erschien. Doch schon nach den ersten Semestern war ich vom Studium enttäuscht gewesen. Wir lernten Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch lesen und übersetzen, bekamen Einführungen in Metrik und Rhetorik, mussten Sekundärliteratur zu einem bestimmten Thema recherchieren und wurden mit wissenschaftlichen Arbeitsmethoden vertraut gemacht, mit dem Anlegen von Karteikästen und einem peniblen Gliederungsfetischismus, als ob wir fürs Katasteramt ausgebildet werden sollten. Mit Literatur selbst kamen wir nur am Rande in Berührung, und wenn, dann diente sie nur als Exempel, um an ihr bestimmte literaturwissenschaftliche Arbeitsweisen zu demonstrieren.
In den Hauptseminaren änderte sich das zwar ein wenig. Aber jetzt diente die Literatur überwiegend dazu, um aus ihr die gesellschaftlichen und sozialen Strukturen einer Epoche herauszulesen. Niemand hätte es gewagt, einzugestehen, dass er sich von einem Gedicht oder einem Roman in seinem Innersten berührt fühlte, alle versuchten nur immerzu, Literatur aus den Bedingungen ihrer Entstehung zu begreifen und Texte zu lesen, als ob sie eine verborgene Botschaft an den Leser enthielten, die es galt, mit schwerem wissenschaftlichen Gerät für jedermann erkenntlich ans Tageslicht zu hieven.
Professor Bertram war anders. Gleich im ersten Seminar, das ich bei ihr absolvierte, glaubte ich, meinen Ohren nicht zu trauen. Anders als ihre Kolleginnen und Kollegen vermittelte sie uns als Einzige etwas von der existenziellen Bedeutung der Literatur, nach der wir unbewusst unser ganzes Studium lang gehungert hatten. Für sie war Literatur kein Vehikel, aus dem man alles Mögliche extrahieren konnte, sondern ganz zuvorderst eine andere Sprache, anders vor allem als jene, der wir täglich im Alltagsgerede und in den Medien ausgesetzt waren und die wir auch selber sprachen. Sie forderte uns immer wieder auf, genau hinzuhören, nicht viel zu lesen, sondern das, was wir lasen, genau zu lesen. »Literatur ist kein Produkt, von dem es gilt, in kürzester Zeit so viel wie möglich zu konsumieren, sondern sie ist für den Moment des Lesens Ihre ganz persönliche Realität und Ihr unmittelbares Bewusstsein. Durch sie können Sie lernen, sich zu sammeln, statt sich zu zerstreuen«, sagte sie uns. Oder: »Literatur vermittelt Ihnen kurzzeitig eine Bewusstseinserweiterung, aus der heraus Sie erahnen können, mit welchen geistigen Reduzierungen Sie normalerweise durch Ihr Alltagsleben gehen.«
Viele von uns konnten damit nichts anfangen. Sie bereiteten sich auf eine Karriere als Lehrer vor und wollten Wissen vermittelt bekommen, das sie abspeichern und wieder abrufen konnten. Der Kreis um Professor Bertram war daher von jeher sehr klein. Und er wurde noch kleiner in den späteren Doktorandencolloquien. Wir waren gerade einmal fünf Studenten, die sich regelmäßig im Büro von Professor Bertram trafen. Jeden Freitag um Viertel nach fünf Uhr ging es los. Reihum berichteten wir bei einer Tasse Tee und einigen stets von der Professorin gespendeten Keksen über den Fortschritt unserer Studien, oder wir trugen Probleme vor, von denen wir hofften, dass sie im Colloquium gelöst werden konnten. Professor Bertram wurde nicht müde, uns zuzuhören.
So ging es viele Jahre lang, denn jeder von uns hatte nach nur einem Semester bemerkt, dass er keineswegs, wie er gedacht hatte, dem Ende seines Studiums entgegenging, sondern dass dieses Studium eigentlich erst jetzt richtig begonnen hatte.
Ich erinnerte mich an unsere kleine Freitagsgesellschaft, die fast fünf Jahre Bestand hatte, noch sehr genau. Da war Albert Steibel, ein zwei Meter Mann, der sehr langsam sprach, sich manchmal auch verhaspelte und dann in ein leises Gelächter über seine eigene Verwirrung ausbrach. Oder Karla Fenten, die fast nie ein Wort sagte, weil sie die vielen Gespräche über Sprache und Sprechen so verunsicherten, dass sie Angst hatte, etwas Verkehrtes zu sagen. Sie taute erst langsam auf, nachdem Professor Bertram ihr und uns allen klar gemacht hatte, dass wir nicht in einem Rhetorik-Seminar saßen, sondern dass ein Satz auch aus lauter Fehlern bestehen und trotzdem richtig sein konnte. Nicht zu vergessen Paul-Peter Bentler, der hellste Kopf von uns allen, ein eloquenter und unglaublich belesener Mensch, dem selbst Professor Bertram gerne längere Zeit lauschte. Paul-Peter hatte seit seiner Geburt eine Contergan-Schädigung. Seine Arme waren zu kurz geraten. In den Pausen drehte er sich daher sehr geschickt Zigaretten mit den Füßen. Nur in der Bibliothek war er manchmal auf Hilfe angewiesen, weil er die obersten Buchreihen trotz Leiter nicht erreichen konnte.
Und dann war da schließlich noch Lisa Kohn. Sie wirkte immer etwas hektisch, war aber stets mit einhundert Prozent bei der Sache. Alles was sie dachte oder tat, erfüllte sie stets von Kopf bis Fuß, so als ob es nichts anderes auf der Welt mehr gäbe, als eine Seminararbeit anzufertigen, ein paar Bücher zu lesen oder sich auf ein Referat vorzubereiten. Sie war die rechte Hand von Professor Bertram, ihre Wissenschaftliche Assistentin, und wenn einer von uns jemals eine Universitätskarriere einschlagen würde, dann, so waren wir uns alle einig, war es Lisa. Sie war nicht nur fachlich versiert, sie war auch eine gute Organisatorin und unterstützte Professor Bertram, wo sie nur konnte. Darüber hinaus war sie auch eine Art Vermittlerin und sprach uns an, wenn Professor Bertram uns zu sehen wünschte. Umgekehrt konnten wir sie mit Problemen betrauen, die sie dann für uns mit Professor Bertram besprach.
Von den fünf Studenten war ich damals der stillste und mit Abstand auch der schwergewichtigste. Mein Körpergewicht befand sich im dreistelligen Kilogrammbereich. Ich hatte mir seit den ersten Semestern langsam aber sicher einen dicken Schutzpanzer angefressen. Eigentlich war ich von Kindheit an eher schmächtig gewesen, aber an der Universität hatte sich das plötzlich geändert. Ich trieb keinen Sport, aß schlecht und trank auch zu viel Alkohol. Manchmal fragte ich mich, ob ich nicht nur durch Zufall in dieses Colloquium geraten war und hier eigentlich gar nichts zu suchen hatte, und was man wohl von mir halten würde, wenn sich herausstellte, dass ich mich nachts in irgendwelchen Jazz-Spelunken herumtrieb und oft nicht vor dem Morgengrauen wieder nach Hause kam.
Doch meine Arbeiten hatten Professor Bertram gefallen, und sie hatte auch nichts dagegen, als ich ihr nach dem Magisterexamen erklärte, dass ich gerne bei ihr promovieren möchte. An den Diskussionen im engen Kreis beteiligte ich mich allerdings nur selten, weil ich immer das Gefühl hatte, mit meinen Gedanken nicht schnell genug rund zu kommen. Im Grunde war das Unsinn, aber ich litt seit meiner Schulzeit an einem mangelnden Vertrauen in die eigene Sprachfähigkeit. Es war mir manchmal unangenehm, ja fast peinlich, laut zu sprechen. Das bezog sich allerdings nur auf Situationen, die mir gekünstelt vorkamen, etwa im Schulunterricht und später in den Seminaren, wenn die Lehrenden Fragen stellten, deren Antworten sie ja längst kannten. Mit meinen Freunden konnte ich hingegen die ganze Nacht reden, ohne dass es mir auch nur einmal peinlich gewesen wäre. Gleichzeitig hörte ich jedoch gerne anderen beim Sprechen zu, hatte allerdings das Problem, dass ich sehr schnell von Worten ergriffen wurde, so dass ich mir stets größte Mühe gab, mich unter Fremden nicht emotional auf etwas einzulassen. Das ließ mich dann von außen betrachtet manchmal etwas autistisch erscheinen. So kam es auch des Öfteren vor, dass mich Professor Bertram im Colloquium direkt ansprach und beispielsweise fragte: »Und Sie, Herr Eckstein, wie beurteilen Sie unser Problem? Sie scheinen bei dem bislang Vorgetragenen noch keine gemeinsame Schnittmenge mit Ihren eigenen Gedanken gefunden zu haben. Zumindest deutet Ihr Gesichtsausdruck darauf hin.« – Das war nicht böse gemeint, dennoch brachten mich solche direkten Ansprachen oft mächtig aus der Fassung, führten aber auch manches Mal dazu, dass ich einfach aufs Geratewohl etwas erwiderte und dabei unwillkürlich ins Schwarze traf, während ich doch nur ins Blaue hinein gesprochen hatte.
6
Vollzählig versammelt
Ich kurvte mehrmals durch das Zentrum der kleinen Stadt, bis ich mich an einige markante Punkte erinnerte: das barocke Schlösschen aus dem 18. Jahrhundert, eine auffällige romanische Kirche, ein von zwei großen Kastanien begrenzter Parkeingang sowie das Museum für Paläontologie. Langsam schob sich unter die neuen Eindrücke der altbekannten Wegmarken ganz von selbst das noch immer tief in mir existierende Wissen, wohin welche Straße führte, so als ob ich Traumpfaden folgte, die auf einer inneren Karte tief in mir drinnen verzeichnet waren. So geriet ich schließlich in die Vorstadt, in ein Viertel, in dem vorwiegend alte Villen aus der Gründerzeit standen.
Das Haus von Professor Bertram fand ich allerdings erst, nachdem ich mein Auto in einer Seitenstraße abgestellt hatte und das Viertel zu Fuß durchstreifte. Ich erkannte es gleich an den beiden Karyatiden: Zwei steinerne Frauen in Gewändern mit schwungvollem Faltenwurf, die scheinbar ohne große Kraftanstrengung das schwere Vordach des Hauses auf ihren Köpfen trugen und dabei noch in einem angeregten Gespräch miteinander vertieft waren. Ich erstieg die breite Treppe, deren Aufstieg von Terrakotta-Töpfen mit Heidebepflanzungen in unterschiedlichen Farbtönen gesäumt war, und die zu einer mit zahlreichen Schnitzereien versehenen massiven Haustür führte. Ein aus vielen bunten Gläsern kunstvoll zusammengesetztes Oberlicht kam mir plötzlich so vertraut vor, als hätte ich es erst gestern das letzte Mal gesehen. Ich schaute auf die Uhr, es war jetzt kurz nach fünf Uhr. Auf dem Klingelschild stand noch immer »Eleonore Bertram«. Ich atmete auf, war aber gleichzeitig auch sehr aufgeregt. Dann klingelte ich zaghaft. Doch auch der mehr als behutsame Druck auf den bronzenen Klingelknopf änderte nichts daran, dass im Haus sogleich mehrere schwere Röhrenglocken anschlugen. Als diese verhallt waren, öffnete sich plötzlich die Tür, eine Dame, die kleiner war, als ich sie in Erinnerung hatte, blickte mich einmal von oben bis unten an und sagte: »Dr. Alexander Eckstein, wie freue ich mich, dass Sie gekommen sind. Lisa hat mir bereits verraten, dass Sie in der Stadt sind. Kommen Sie herein, Sie werden schon erwartet.«
Lisa wartete in der Bibliothek auf mich.
»Hast du die Speicherkarte dabei?« fragte sie, ohne sich noch im Geringsten für meine lädierte Stirn zu interessieren.
»Ja«, erwiderte ich kurz und knapp, kramte die Karte aus meiner Hosentasche und reichte sie ihr. Sie drückte sie ans Herz, lachte und überreichte sie sogleich an Professor Bertram, die sie wiederum betont beiläufig in ihrer Rocktasche verschwinden ließ.
In diesem Moment dröhnten die Röhrenglocken noch einmal los. »Wir werden das alles gleich in Ruhe aufklären«, sagte Professor Bertram, die zu bemerken schien, dass zwischen Lisa und mir noch sehr viel im Unklaren war. »Doch zuvor wollen wir weitere Gäste begrüßen.«
Schon wurde es laut auf dem Flur, Gelächter brandete auf und es schien eine große Wiedersehensfreude zu herrschen. Als ich nachsehen ging, glaubte ich, meinen Augen nicht zu trauen: Dort standen tatsächlich Albert Steibel, Paul-Peter Bentler und Karla Fenten. Sie führten große Koffer mit sich, als ob sie gleich mehrere Tage bleiben wollten, und als sie mich entdeckten, da wurde noch eine weitere Schüppe Kohle auf die Wiedersehensglut geworfen, so dass die Funken nur so stoben.
Da saßen wir also wieder wie vor fünf Jahren rund um Professor Bertram geschart, als ob es keine Zeit dazwischen gegeben hätte. Und wie damals wurden Tee und Kekse gereicht. Nur das Ambiente war jetzt deutlich komfortabler, da wir nicht mehr mit harten Seminarstühlen vorliebnehmen mussten, sondern uns in einer weichen Polsterrunde lümmeln durften und umgeben waren von einer der exquisitesten Büchersammlungen, die man in diesem Land finden konnte. Wie ich erfuhr, so war die Freitagsgesellschaft für alle außer meiner Person ein festes Ritual in ihrem Leben geblieben, auch wenn man sich nicht mehr regelmäßig einmal in der Woche traf. Manchmal waren zwischen den Treffen angeblich Monate, einmal sogar fast ein Jahr vergangen. Dass ich in all der Zeit kein einziges Mal dabei war, hatte ich mir selbst zuzuschreiben. Denn nach meinem Studium war ich abgetaucht, hatte mit niemandem mehr Kontakt aufgenommen und galt quasi als verschollen, bis Professor Bertram mich an diesem Morgen im Internet auf der Touristikseite für das Wattenmeer ausfindig gemacht hatte.
»Normalerweise nutze ich den Computer nicht, um ehemalige Studenten aufzuspüren«, sagte sie. »Aber heute Morgen habe ich es einfach mal versucht und sofort einen Treffer gelandet.« Sie schien sichtlich etwas stolz auf ihre gelungene Recherche. Dann aber bat sie, sich für kurze Zeit entschuldigen zu dürfen und verschwand in ihrem Arbeitszimmer. Ich war mir sicher, dass sie in Ruhe einen ersten Blick auf die Schriftdateien der Speicherkarte werfen wollte.
Professor Bertram hatte in den vergangenen Jahren die oberste Etage ihres Hauses zu einer Art Pension ausbauen lassen. Hier hatte jeder ihrer ehemaligen Doktoranden sein eigenes Zimmer, denn die Freitagsgesellschaft diskutierte nicht mehr wie früher nur ein, zwei Stunden, sondern stets ein ganzes Wochenende lang. Manchmal ging man auch gemeinsam ins Theater oder sogar ins Kino und hatte danach viel Spaß, das Gesehene in allen Einzelheiten zu sezieren.
Alle schienen sich wirklich zu freuen, mich nach all den Jahren wiederzusehen. Nachdem wir gegenseitig unsere Falten gezählt hatten, und man sich genügend über meinen Gewichtsverlust gewundert hatte, erzählte jeder mir zuliebe in groben Zügen, was ihm seit seiner Promotion zugestoßen war. Der lange Albert Steibel berichtete, dass er Lektor in einem großen Verlag geworden sei, was mich zunächst ein wenig mit Neid erfüllte. Doch dann fügte er kichernd hinzu: »Leider in einem Verlag für Wirtschafts- und Steuerrecht«, worauf alle in lautes Gelächter ausbrachen.
Paul-Peter Bentler berichtete, er sei Vater von Zwillingen, und da seine Frau als Rechtsanwältin für das Familieneinkommen sorge, habe er nach der Promotion zunächst eine Weiterbildung als Hausfrau in Angriff genommen und sodann, aufgrund leidvoller Erfahrungen in zahlreichen VHS-Kursen, eine Küche entworfen, in der jede Schublade, jede Herdplatte und auch der Wasserhahn ohne Probleme von Menschen mit seiner speziellen Armlänge bedient werden könnten. Doch leider werde diese Erfindung bislang noch von keinem Möbelhersteller in Serie produziert. Und, ach ja, darüber hinaus schreibe er Gedichte, die schon unter dem Dach fast aller großen deutschen Verlage zu finden gewesen seien. Ich beglückwünschte ihn aufrichtig dazu. »Moment, ich bin noch nicht fertig«, sagte er und fügte unter dem erneuten Gelächter der anderen hinzu: »bevor man sie mir dann ungelesen wieder zurückschickte.«
Karla Fenten berichtete, dass sie nach vielen vergeblichen Bewerbungsversuchen ein kleines Antiquariat gegründet habe, damit aber geradewegs in die Insolvenz geschlittert sei. Daraufhin habe sie ihre Verkaufs-Tätigkeiten ins Internet verlagert und sich in den letzten Jahren ein gut florierendes Geschäft aufgebaut, indem sie für reiche Sammler und Institute auf die Suche nach Erstausgaben oder anderen wertvollen Werken gehe. Zu ihrem Kundenstamm gehörten sogar Scheichs aus den Arabischen Emiraten.
Lisa Kohn schließlich hatte sich, so wie ich es mir immer gedacht hatte, schnurstracks nach ihrer Promotion weiter in Richtung Habilitation vorgearbeitet. Die Professur bereits in Sicht war dann aber irgendetwas mit ihr geschehen, das sie mir an diesem ersten Abend noch nicht erzählen wollte, da es der fröhlichen Runde Abbruch täte. Die anderen schienen das auch so zu sehen und widersprachen ihr nicht. Seit der Sache damals ließe sie sich nur noch für spezielle Recherchen anheuern.
Nun wollten alle wissen, was mit mir in der Zwischenzeit geschehen war. Ich berichtete wahrheitsgemäß, dass ich mich eine Zeitlang unter die Journalisten begeben und als freier Mitarbeiter in Tages- und Wochenzeitungen meinen bescheidenen Unterhalt bestritten hätte. Schließlich sei ich bei mehreren Institutionen für Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen und seit drei Jahren nun lebte ich an der Küste, um Erlebniswanderungen im Nationalpark Wattenmeer zu vermarkten.
7
Die geistigen Realitäten
»Nachdem wir uns alle so ausgiebig begrüßt haben und uns besonders freuen, dass unser alter Mitstreiter Alexander Eckstein wieder mit uns in einem Boot sitzt, erlauben Sie mir nun, Ihnen allen zu erklären, aus welchem Grunde ich Sie heute hierher einbestellt habe«, ließ plötzlich Professor Bertram ihre Stimme ertönen, nachdem sie zuvor drei Mal vernehmlich mit dem Löffel an Lisas Teetasse geschlagen hatte. Professor Bertram war fast eine halbe Stunde lang fort gewesen, und meine Annahme, dass dies mit der Speicherkarte zu tun hatte, schien sich zu bestätigen, denn sie gab diese beim Eintritt in die Bibliothek sogleich an Lisa zurück und sah sie dabei lächelnd und sehr zufrieden an.
Ihre Autorität schien unangetastet. Kaum hatte sie an die Teetasse geschlagen, da wurde es still im Raum. Für einen Moment waren wir alle wieder Studenten, für die es sich schickte, aufmerksam auf die Einlassungen ihrer Dozentin acht zu geben.
»Sie alle wissen, dass die menschliche Stimme mehr ist als nur ein Instrument, mit dem wir für den Kampf ums Dasein ausgerüstet wurden. Mit ihr kann der Mensch sich vielmehr mitteilen, kann zur Sprache bringen, was in seinem tiefsten Inneren vorgeht, und er kann erinnernd oder aus der Phantasie Geschichten erzählen, an denen die Realität zu reflektieren und zu hinterfragen ist«, begann Professor Bertram, und es klang, als ob es der Auftakt zu einer längeren Vorlesung werden sollte.
»Lange bevor wir eine Schriftkultur besaßen, war es allein die menschliche Stimme, die Geschichte, Religion und Kultur eines Volkes durch die Jahrhunderte trug. Indem die Wahrheiten einer Gemeinschaft immer wieder neu gesagt und damit erinnert werden mussten, blieben sie im Geist der Menschen lebendig. Und es waren gewissermaßen die Dichter, die einer Gemeinschaft ihre Geschichten und ihre Geschichte gaben und so das Selbstbewusstsein der Zeitgenossen in gesprochener Sprache immer neu manifestierten.«
Während Professor Bertram weitersprach, blickte ich verstohlen zu Lisa hinüber. Sie saß ganz weit vorn auf ihrem Sessel, so als ob sie auf dem Sprung wäre, und lauschte angespannt mit geradem Rücken auf die kleine Ansprache. Mir fiel erst jetzt auf, dass sie sehr müde aussah, so als hätte sie die Nacht über nicht geschlafen. Als sie meinen Blick bemerkte, schaute ich schnell woanders hin.
»Erst die Schrift, darauf macht uns bereits Platon im Phaidros aufmerksam, hat uns träge und vergesslich gemacht. Denn was man schwarz auf weiß zu besitzen glaubt, braucht man nicht mehr in seinem Herzen zu bewahren. Dennoch wissen Sie alle, dass das Wort heute genau wie vor Tausenden von Jahren unsere geistigen Realitäten bestimmt. Aber wie kümmerlich sind diese Realitäten doch angesichts der Tatsache, dass es zumeist die Worte der Medien sind, von denen wir uns die Grenzen unseres Bewusstseins festlegen lassen, statt immer wieder aufs Neue einzig und allein das grenzenlose Dichterwort als Horizontbegrenzung zu akzeptieren.«
Albert Steibel lag geradezu in seinem Sessel, die langen Beine weit von sich gestreckt, den Kopf tief ins Polster gedrückt. Er lächelte still in sich hinein, so als ob er durch Zufall ein altes Lieblingslied im Radio wiederhörte. Paul-Peter Bentler hingegen hatte einen sehr kritischen Gesichtsausdruck aufgesetzt, so als formuliere er im Kopf bereits eine kleine Gegenrede oder als ob er noch einige zusätzliche Anmerkungen beitragen wollte, an denen es Professor Bertrams Vortrag entschieden mangelte. Am meisten aber faszinierte mich Karla Fenten. Sie war eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Die stille graue Maus von einst trug einen kurzen Lederrock, und wenn sie die Beine übereinanderschlug, was sie in schöner Regelmäßigkeit alle fünf Minuten tat, um mal das rechte und mal das linke Bein nach oben zu legen, sah man ihr neonrotes Höschen aufblitzen. Auch ihre Bluse war derart modisch geschnitten, dass die Knopfreihe erst dort anzufangen schien, wo normalerweise die Speiseröhre in den Magen mündet.
»Und bedenken Sie darüber hinaus, wie einzigartig die Stimmen der Dichter gewesen sein müssen, die einst in einer rein mündlichen Erzählkultur die Geschichten, Fabeln und Legenden der Menschheit von Generation zu Generation weitergaben. Welche tiefen Empfindungen müssen sie bei ihren Zuhörern ausgelöst haben, damit das Erzählte sich tief in deren Herzen senkte, statt nur einen kurzfristigen emotionalen Kick zu verursachen, wie das heute tagtäglich in den Berichterstattungen der Medien der Fall ist!«
Ich staunte über den »emotionalen Kick« aus dem Mund von Professor Bertram, da es neben der »Sensation« von heute Morgen schon das zweite ungewöhnliche Wort in ihrem Wortschatz war, während ich erneut mit den Augen Karla Fentens langen braunen Beine entlang strich. Als sie es bemerkte, lächelte sie mir komplizenhaft zu und ließ wie zufällig noch einmal ihr Höschen aufblitzen. Dann aber wurde meine Aufmerksamkeit einzig und allein von Professor Bertrams Worten in Anspruch genommen. Was sagte sie denn da?
»Niemand wird uns jemals vorführen können, wie einst das Nibelungenlied geklungen hat, auch nicht die Stimme Walthers von der Vogelweide wird einst wieder zum Leben erweckt werden. Aber haben Sie es nicht auch schon manches Mal als äußerst bedauerlich empfunden, dass die Grammophontechnik erst erfunden wurde, nachdem unsere bedeutendsten Dichter schon ein paar Jahrzehnte tot waren? Was wäre gewesen, wenn Edison den Phonographen nicht erst 1877, sondern ein wenig früher entwickelt hätte? Könnten wir dann heute den Stimmen einiger dieser Großen lauschen? Aber was, wenn ich Ihnen sagte, dass es schon lange vor Edison die Möglichkeit der Schallaufzeichnung gab? Was, wenn es Wissenschaftlern schon Jahrzehnte vorher gelang, Musik oder Sprache zu konservieren? Doch darüber zu sprechen bin ich nicht befugt. Lassen Sie es sich von ihrer einstigen Kommilitonin Lisa Kohn erzählen. Es ist eine wundersame Geschichte.«
8
Lisa und Martin
So recht begriffen hatten wir wohl alle nicht, worauf die Rede von Professor Bertram eigentlich hinauslief. Selbst Lisa sah Professor Bertram nur mit großen Augen an, so als ob auch sie eine nähere Erklärung erwartete.
»Es tut mir leid, dass wir Sie zunächst einmal mit Dingen belästigen müssen, von denen Sie wahrscheinlich ebenso wenig Ahnung haben wie ich sie hatte«, nahm Professor Bertram das Wort wieder auf. »Aber wir können Ihnen einen kleinen Exkurs in die Technikgeschichte leider nicht ersparen«, fügte sie hinzu. »Ich darf daher jetzt Lisa Kohn bitten, Sie über ein paar Dinge aufzuklären, die nicht zur Allgemeinbildung gehören, die zu wissen aber nötig sind, damit Sie ahnen, worin unsere Mission überhaupt besteht.«
Lisa stand wie gewohnt mit geradem Oberkörper auf und strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Sie trat hinter unsere kleine Polsterrunde, stand im Verlauf ihres Vortrags mal hinter diesem, mal hinter jenem der Sitzenden und stützte dabei die Hände auf die Kopfteile der Sessel, so dass es aussah, als sollte uns allen nacheinander der Kopf gewaschen werden.
»Zuerst muss ich mich bedanken, dass ihr alle gekommen seid, um mir zu helfen«, sagte sie sehr leise. »Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, zumal ihr alle euer eigenes Leben und eure eigenen Probleme habt. Albert, du hast kurzfristig deinen Urlaub geopfert, Paul-Peter, du läufst Gefahr, dich mit deiner Frau zu entzweien, die du mit den Zwillingen und dem kompletten Haushalt hast sitzen lassen, und du, Karla, wirst vielleicht auf ein paar gute Geschäfte mit deinen arabischen Freunden verzichten müssen. Schön aber auch, dass Alexander zu uns gestoßen ist, damit sind wir endlich wieder komplett.«
Alle sahen mich kurz an und lächelten freundlich.
»Wie ihr wisst«, fuhr Lisa fort, »stelle ich seit einigen Jahren für verschiedene Auftraggeber Recherchen an, das können sowohl bibliographische als auch biographische Nachforschungen sein, und verfasse Chroniken sowie Geschichten für Firmen und Institute aber auch für Städte und Gemeinden. Von den zahlreichen Fähigkeiten, die mir einst in meiner literaturwissenschaftlichen Ausbildung vermittelt wurden, habe ich also nur noch ein paar wenige technische im alltäglichen Gebrauch. Ich weiß nicht einmal mehr, wann ich das letzte Mal einen Text interpretiert habe. Aber das geht euch allen bestimmt auch nicht anders.
Um euch nicht unnötig zu verwirren, möchte ich meine Geschichte einfach der Reihe nach erzählen und die technischen Details, die ihr wissen müsst, einfach hier und da bei Gelegenheit einfließen lassen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne?«
Wir nickten alle gleichzeitig, als ob wir es einstudiert hätten.
»Es geht also damit los, dass ich im Frühling dieses Jahres einen Auftrag bekam, der … «
»Meine Liebe«, unterbrach Professor Bertram Lisas Ausführungen, »bitte erzählen Sie auch, wie es dazu kam, denn mir scheint, dass dies sehr wichtig ist. Ich weiß, es ist nicht leicht für Sie, hier und jetzt über Gefühle zu sprechen, aber ich fürchte Ihre Kollegen werden den Zusammenhang nicht richtig begreifen und ihn unter Umständen sogar falsch interpretieren, wenn Sie nicht von Ihrer ersten Begegnung mit Martin Benslauer berichten.«
Lisa sah Professor Bertram unglücklich an.
»Also gut«, sagte sie, »jetzt da ich mich soeben von Martin getrennt habe, könnt ihr auch dies erfahren: Im Frühling hatte ich einen Unfall. Ich war wie jeden Morgen mit dem Auto aus dem Hinterhof des Hauses, in dem ich lebe, auf die Straße gefahren. Die Sicht ist dort aufgrund all der am Straßenrand parkenden Fahrzeuge immer sehr schlecht, und ein bisschen ist die Ausfahrt wie Russisches Roulette, aber bis zu diesem Tag im Frühling war noch nie etwas passiert. An diesem Morgen Ende April knallte mir jedoch beim Verlassen des Hofes ein Fahrzeug in meinen Wagen. Ein junger Mann hatte mich angeblich nicht gesehen und mich mit seinem Auto am Heck touchiert. Er stieg gleich aus, entschuldigte sich aufrichtig und nahm alle Schuld auf sich, obwohl die Verkehrssituation nicht ganz eindeutig war. Schließlich war ich es ja gewesen, die einfach auf die Straße gefahren war. Andererseits hatte ich das Gefühl, dass seine Geschwindigkeit alles andere als den Verkehrsverhältnissen angepasst schien. In der Folge rief er mich fast täglich an, übernahm auch meine Autoreparaturen, lud mich zum Essen ein, war in allem sehr charmant, und, nun ja … «
»Quäl dich nicht, wir waren alle schon einmal verliebt«, erlöste Albert Lisa.
»Wir verlebten ein paar schöne Wochen, machten im Mai an der Küste Urlaub und zogen bereits im Juni zusammen in Martins Wohnung, da diese viel größer und geräumiger war als meine. Aber jetzt muss ich euch erst was zu Martin erzählen. Martin Benslauer arbeitet an der Technischen Hochschule zusammen mit Professor Marcel Dubois am Institut für Akustik. Da geht es hauptsächlich um Gutachten und Beratungen zur Bauakustik, zu Themen wie Lärm am Arbeitsplatz und um Immissionsschutz sowie um Labor- und Prüfstandmessungen. Das alles klingt für unsere Ohren recht langweilig. Aber Professor Dubois hat neben diesen Dingen noch eine andere große Leidenschaft. Er interessiert sich nämlich sehr für die Geschichte der Akustik. Darüber hält er nicht nur Vorlesungen, sondern er erwartet auch von seinen Studenten, dass sie sich mit der Historie ihres Fachs einigermaßen gut auskennen. Martin verriet mir, dass Professor Dubois neuerdings an einem geheimen Projekt arbeite, dass mit der Geschichte der Klangaufzeichnung zu tun habe. Ich zeigte mich sehr interessiert und wenig später fragte mich Martin, ob ich nicht Lust hätte, eine Recherche für Professor Dubois zu übernehmen. Es ging dabei um einen Mann, der im 19. Jahrhundert gelebt haben soll. Professor Dubois hätte gerne alles über ihn gewusst, weil er für die Geschichte der Akustik ein wichtiger und bis dato kaum beachteter Zeitgenosse gewesen sei. Er selbst habe aber weder die Zeit noch die nötige Erfahrung, um biographische Nachforschungen anzustellen. Ich war sofort einverstanden und wurde bereits am anderen Tag zu Professor Dubois in die Sprechstunde gebeten.«
9
»Mary had a little lamb«
Professor Dubois empfing mich sehr freundlich. Er war ein Mann um die sechzig Jahre, mit einer hohen Stirnglatze, kleinen blitzenden Augen und vielen Lachfalten im Gesicht. Er bot mir einen Platz auf einem futuristischen Stuhl an, der aus Edelstahl bestand und kräftig in Schwingung geriet, wenn man sich nur leicht auf ihm bewegte. »Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich etwas Musik eingeschaltet habe«, sagte er entschuldigend, aber er könne am besten arbeiten, wenn im »Background« irgendeine swingende Jazzmelodie ertöne.
»Michel Petrucciani«, schwärmte er, »ein wahres Genie. Wenn Sie jemals nach Paris kommen, besuchen Sie sein Grab und legen Sie für mich dort eine Rose nieder. Hier ist er gerade zu hören mit Steve Gadd am Schlagzeug und Anthony Jackson am Bass. Die drei Musiker gaben vor ein paar Jahren ein fantastisches Konzert im Blue Note Tokyo. Wenn ich den Titel Home höre, könnte ich losheulen.«
Ich lächelte. Wie die meisten Frauen mache ich mir nicht viel aus Jazz. Besonders wenn man sich unterhalten will, finde ich diese Musik eher störend.
»Sie haben es gut«, sagte Professor Dubois wenig später zu mir, »Sie können nach Herzenslust in den Bibliotheken stöbern und Spurensuche nach vermissten Personen oder Werken betreiben. Wie gerne würde ich mal ein Semester mit Ihnen tauschen. Aber ich muss mich um meine Studenten kümmern, die gerade bis zum Hals, nein besser bis zu den Ohren im Diplom stecken. Sehen Sie sich all diese Arbeiten an, die hier auf meinem Schreibtisch liegen: Beschreibung der Geräuschquellen und Transferpfade für einen Personal Computer, Tomographie der Glottis durch Messung der elektrischen Transferimpedanz, Untersuchung der Akustik von Klassenräumen mit binauralen Methoden und so weiter und so fort. Das ist sicherlich nicht die Literatur, die Sie bevorzugen, nicht wahr?«
Ich stimmte ihm zu und sagte, dass es halt für jede Wissenschaft ein eigenes Fachchinesisch gebe.
»Richtig«, sagte Professor Dubois, »aber darüber hinaus gibt es etwas in jeder Fachrichtung, das von jedermann zu verstehen ist, nämlich die Geschichte, die jede Wissenschaft zu erzählen hat, eine Geschichte, die aus den Taten der großen Männer und Frauen besteht, die Wesentliches in ihrem Fach geleistet haben. Meine Studenten können zwar heute schon nach wenigen Semestern die kompliziertesten Schallberechnungen anstellen, aber von Helmholtz, Mach, Seebeck, Weber, Duhamel oder Koenig haben die meisten von ihnen auch im Hauptstudium noch nie irgendetwas gehört.«
»Das ist bedauerlich«, sagte ich, während die Musik immer lauter und ausdrucksstärker dem Finale entgegenzusteuern schien.
»Eine wunderschöne Stelle, hören Sie genau zu, achten Sie darauf, wie Petrucciani jetzt die Wendung hinbekommt, um gewissermaßen ganz entspannt zu Hause einzutreffen.«
Professor Dubois lehnte sich weit in seinen Stuhl zurück und schloss für kurze Zeit die Augen, bis das Stück verklungen war. »Aber jetzt mal zu Ihnen«, sagte er dann und schaute mich plötzlich mit sehr hellwachen Augen an. »Was ich von Ihnen möchte, das ist eigentlich ganz einfach, aber es zu erklären erfordert doch ein wenig Zeit, da Sie, ohne Ihnen nahetreten zu wollen, von der Geschichte der Akustik sicherlich nicht annähernd so viel wissen wie von der Geschichte der deutschen Literatur. Ich muss also ein wenig ausholen, damit Sie verstehen, worum es geht.«
Professor Dubois stand auf, eilte mit zwei großen Schritten auf seine Musikanlage zu und schaltete sie aus.
»Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass so eine Hifi-Anlage, wie sie hier vor uns steht, nicht denkbar wäre, wenn der geniale Thomas Alva Edison nicht 1877 den Phonographen erfunden hätte, also eine Apparatur, mit der man Klänge aufnehmen und sodann wieder abspielen konnte. Und was denken Sie, nahm der gute Mann als Erstes mit seinem Maschinchen auf? Nun, es war der Vers Mary had a little lamb. – Das Lied kennen Sie doch bestimmt? Edison schrieb später, er sei sehr ergriffen gewesen, als er seine eigene Stimme das erste Mal selbst gehört habe. Wahrscheinlich war er so ergriffen wie ich beim Hören von Petrucciani. Im November 1877 wurde der Phonograph erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, und am 19. Februar 1878 erhielt Edison das Patent. So steht es in allen Schulbüchern. Und es ist ja auch richtig. Ja, weiß Gott, der alte Edison hat es verdient, dass wir ihm bis heute die Füße dafür küssen, allein schon deswegen, weil er die Vorarbeiten dazu lieferte, dass man später einmal die großen Jazzmusiker bei der Arbeit konservieren konnte, gerade noch rechtzeitig, bevor sie das Zeitliche segneten. Jeder junge Mensch, der mit Kopfhörern auf den Ohren durch die Gegend läuft, sollte mindestens einmal am Tag an Edison denken oder aber gefälligst selber singen.«