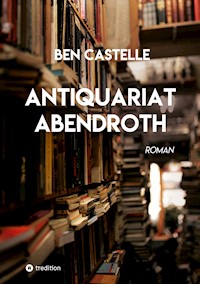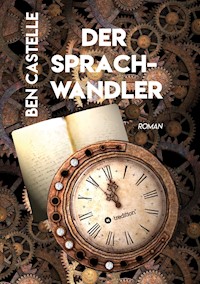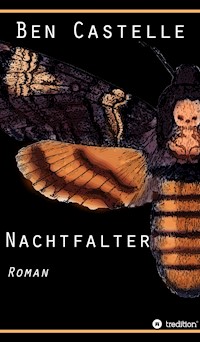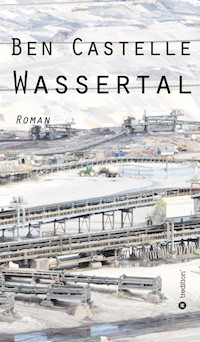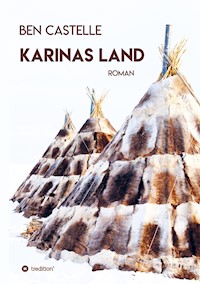
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei gänzlich unterschiedliche Frauen, die russische Literaturstudentin Anna und die arbeitslose deutsche Autolackiererin und Amateurboxerin Manu, schließen Freundschaft, um das Geheimnis eines alten Manuskripts zu enträtseln, das ein Naturforscher hinterließ, der ein Vorfahre von Anna war. Dieser, so erfahren Anna und Manu bei der Lektüre, unternahm zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Expedition zum Volk der Samojeden, um mehr über deren Giganten-Epen zu erfahren, Lieder, in denen bösartige Riesen eine Rolle spielen. Auf seiner langen Reise mit den Samojeden zum Polarmeer will Annas Vorfahre eine schreckliche Entdeckung gemacht haben. Knapp 200 Jahre später scheint diese Entdeckung plötzlich das Interesse eines ehemaligen DDR-Sportwissenschaftlers, Schöngeists und Kopfs einer dubiosen internationalen Forschungsgruppe zu finden. Schon bald erkennt Anna in diesem Mann einen der Hintermänner, den sie für den Tod ihrer Mutter verantwortlich glaubt, einer ostdeutschen Schwimmathletin und Olympiasiegerin, die während ihrer aktiven Zeit unwissentlich Dopingexperimenten ausgesetzt worden war, an deren Spätfolgen sie schließlich verstarb. Da Annas Vater, der das Manuskript entdeckt hat, plötzlich verschwunden ist, beschließen Anna und Manu, ihn zu suchen. Seiner Spur folgend, geraten sie von Moskau über St. Petersburg bis ans Ende der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ben Castelle
Karinas Land
oder
Die Giganten
Roman
Über dieses Buch:
Zwei gänzlich unterschiedliche Frauen, die russische Literaturstudentin Anna und die arbeitslose deutsche Autolackiererin und Amateurboxerin Manu, schließen Freundschaft, um das Geheimnis eines alten Manuskripts zu enträtseln, das ein Naturforscher hinterließ, der ein Vorfahre von Anna war. Dieser, so erfahren Anna und Manu bei der Lektüre, unternahm zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Expedition zum Volk der Samojeden, um mehr über deren Giganten-Epen zu erfahren, Lieder, in denen bösartige Riesen eine Rolle spielen. Auf seiner langen Reise mit den Samojeden zum Polarmeer will Annas Vorfahre eine schreckliche Entdeckung gemacht haben. Knapp 200 Jahre später scheint diese Entdeckung plötzlich das Interesse eines ehemaligen DDR-Sportwissenschaftlers, Schöngeists und Kopfs einer dubiosen internationalen Forschungsgruppe zu finden. Schon bald erkennt Anna in diesem Mann einen der Hintermänner, den sie für den Tod ihrer Mutter verantwortlich glaubt, einer ostdeutschen Schwimmathletin und Olympiasiegerin, die während ihrer aktiven Zeit unwissentlich Dopingexperimenten ausgesetzt worden war, an deren Spätfolgen sie schließlich verstarb. Da Annas Vater, der das Manuskript entdeckt hat, plötzlich verschwunden ist, beschließen Anna und Manu, ihn zu suchen. Seiner Spur folgend, geraten sie von Moskau über St. Petersburg bis ans Ende der Welt.
Impressum
© 2022 Ben Castelle
Umschlag, Illustration unter Verwendung eines Bildes von Grigorii Pisotckii unter der Lizenz von iStock.com
ISBN
Softcover:
978-3-347-56834-1
Hardcover:
978-3-347-56835-8
E-Book:
978-3-347-56836-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Für Martina und Anna,meine unermüdlichen Lektoren
Pflege deinen Schlitten, bevor du zu alt wirst.Er trägt dich bis zum Ende der Welt.
(Traditionelles Lied der Jamal-Nenzen)
Die wichtigsten der im Roman auftauchenden Figuren:
Anna Pawlowa Sidorowa, Slawistik-Studentin
Manu, Annas arbeitslose Freundin
Alexej Alexejewitsch Sidorow, Naturforscher und Annas Vorfahre
Pawlow Iwanowitsch Sidorow, Annas Vater
Maria Melnikowa, Haushälterin und rechte Hand von Annas Vater
Prof. Kolewski, Annas Prüfer
Karina, Annas Mutter
Dr. Paul Wendler, Kopf einer dubiosen internationalen Forschungsgruppe
Horst Jäger, ehem. Trainer von Annas Mutter
Maxim Kostlew, Schriftsteller
Sergej Aksakov, Lyriker
Michail Jergow, Doktorand der Philosophie
Dr. Claudia Scharapova, Ethnologin
Ludmilla, Lehrerin in der Nenzen-Schule in Yar-Sale
Mil, Afghanistan-Veteran und Hubschrauberpilot auf Jamal
Ganja, Nenze und Freund von Mil
Ganjkka, Nenze und Freund von Alexej Alexejewitsch Sidorow
ERSTER TEIL
1
Mein liebes Täubchen!
In dem Paket, das ich Dir heute geschickt habe, findest Du die Kopien eines wertvollen Büchleins. Sie dürfen auf keinen Fall in falsche Hände geraten, deshalb möchte ich sie aus Moskau verschwinden lassen. Dass das Original in die »richtigen« Hände geraten ist, dafür habe ich bereits Sorge getragen. Pass gut auf diese Kopien auf. Ich werde sie in Kürze vielleicht noch einmal benötigen. Wenn Du magst, dann kannst Du die Aufzeichnungen lesen, aber Du solltest aus ihnen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Alexej Alexejewitsch Sidorow, der Verfasser der Handschrift, war, wie du weißt, ein Vorfahre von uns, ein Natur- und Volkskundler, der heute leider längst vergessen ist. Und das, obwohl er in jungen Jahren vom Akademischen Rat der Universität Moskau als einer der wenigen Nachwuchswissenschaftler für würdig befunden worden war, den von seiner Russlandexpedition heimkehrenden Alexander von Humboldt kennenlernen zu dürfen. Anders als viele seiner Forscherkollegen soll Sidorow mit dem berühmten Deutschen auf einer der endlosen Soireen, die man Humboldt zu Ehren in Moskau und St. Petersburg abhielt, aber weder – wie es damals so üblich war – über Lord Byron, noch über Alexander Puschkin gesprochen, sondern er soll mit ihm über die Eigentümlichkeit pflanzlicher Wuchsformen in der Permafrostzone diskutiert haben. Mit diesem Thema, das für eine gesellschaftliche Veranstaltung doch alles andere als comme il faut war, hatte er, so wurde damals in der Klatschspalte einer der letzten Ausgaben des Moskovskij Vestnik berichtet, Humboldt jedoch weitaus mehr gefesselt, als alle anderen Gäste mit ihrem nur der Höflichkeit geschuldeten Salongeplauder.
Aber das sind alte Geschichten, und ich glaube, ich habe sie Dir schon dutzendfach erzählt. Wichtig ist jetzt nur eines, nämlich, dass Du Dir keine Sorgen um Deinen alten Vater machst, der für ein Weilchen von der Bildfläche verschwinden wird. Ich habe ein paar für mich sehr wichtige Dinge zu erledigen, die mit diesem Büchlein in direkter Verbindung stehen. Sobald alles in Ordnung gebracht ist, werde ich zu Dir nach Köln kommen, oder Du besuchst mich hier zu Hause und ich werde Dir eine detaillierte Erklärung für alles das geben, was Du jetzt noch nicht verstehen kannst, eine Erklärung, die nichts auslässt und nichts beschönigt. Bis dahin sorge Dich nicht, mein Täubchen, sei tausendfach geküsst und geherzt von deinem alten Väterchen und unternimm nichts, bis Du wieder von mir hörst. Übrigens: Maria Melnikowa ist in mein Vorhaben nicht eingeweiht. Ich habe ihr erzählt, dass ich für zwei Wochen auf einem zahnärztlichen Kongress in St. Petersburg weile. Die Praxis bleibt solange geschlossen …
2
Anna Pawlowa Sidorowa hat den Brief schon mindestens ein Dutzend Mal gelesen. Sie liegt auf dem Sofa in ihrer kleinen Kölner Wohnung und starrt an die Decke. Sie fragt sich, was das alles zu bedeuten haben soll. Sie hat mehrfach versucht, ihren Vater telefonisch zu erreichen, doch es war immer nur seine Sprechstundenhilfe und Haushälterin, Maria Melnikowa, am Apparat, die sogleich in Tränen ausbrach und sich das Verschwinden von Pawlow Iwanowitsch einfach nicht erklären konnte. Die Geschichte mit dem Kongress in St. Petersburg wollte sie ihm nicht abnehmen. Kein Wunder, denn Annas Vater ging nie auf solche Kongresse. Gleichzeitig gab sie sich geheimnisvoll und wollte am Telefon nicht viel sagen. »Komm nach Hause, Liebelein«, schluchzte sie, »dann wollen wir den Papa gemeinsam suchen gehen.«
Anna Pawlowa nimmt erneut die grob zusammengehefteten Zettel in DIN-A4-Format zur Hand, die in dem Paket lagen. Sie blättert das Konvolut durch und blickt auf die sehr eng gesetzten sauberen kyrillischen Schriftzeichen. Hier und da gibt es Korrekturen und durchgestrichene Wörter, alles in allem aber muss man die Aufzeichnungen fast makellos nennen. Die Kopien beginnen jedoch mit zwei Seiten, auf denen nur Zahlenkolumnen stehen, die aussehen, als ob jemand hier seine Ausgaben notiert hätte. Und die beiden letzten Seiten enthalten ebenfalls Zahlen und dazu noch mehrere Zeichnungen von einer nicht sehr hübschen Pflanze, die genau wie die Zahlen auf dem Kopf stehen.
Zweimal schon hat Anna versucht, die ersten Seiten zu lesen, doch stets gingen ihre Gedanken auf Reisen. Auch jetzt denkt sie wieder an ihren Vater und an ihre Kindheit in dem großen, ganz in Weiß gestrichenen Moskauer Wohnhaus mit den hohen Stuckdecken und den weißen Sprossenfenstern, in dem sie schon so lange nicht mehr gewesen ist. Im dritten Stockwerk verbrachte sie ihre Kindheit, auf derselben Etage, auf der ihr Vater bis heute seine Zahnarztpraxis führt.
»Was machst du nur für einen Unfug, Papa?« flüstert sie und zieht dabei eine gerahmte Fotografie von der Kommode, die neben ihrem Sofa steht. Darauf ist ihr Vater im Sonntagsanzug vor dem schmiedeeisernen Tor der Tretjakow-Galerie zu sehen. Neben ihm steht ein etwa zehnjähriges Mädchen in einem weißen Kleid und mit einem blauen Band im Haar. Es ist Anna. Beide stehen sie da und halten die Arme ebenso verschränkt und blicken streng nach links unten ins Imaginäre wie im Hintergrund die steinerne Statue des Kunstsammlers Pawel Tretjakow.
3
Eine Wohnungstür weiter schaut Manu an diesem Vormittag schon seit einer halben Stunde durch das geschlossene Küchenfenster auf den Morgenverkehr draußen auf der Straße. Durch das schallgedämmte Glas vernimmt sie nur ein leises Rauschen und ab und an das Schnarren der Straßenbahn. Sie nippt an einer großen Tasse Kaffee mit der Aufschrift One day I’ll fly away, die sie zum vergangenen runden Geburtstag von einer Freundin geschenkt bekommen hat. Das ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her. Ihr Körper ist offensichtlich auf die Röstaromen des Kaffees konditioniert, denn sobald ihre Nase der Tasse nahekommt, schlägt ihr Herz schneller, und sie verspürt den Wunsch, sich augenblicklich anzuziehen und auf die Straße hinauszugehen. Doch statt in Aktion zu geraten, blickt Manu wie hypnotisiert auf die lange Kette bunter Autos, die vor der Ampelanlage in Höhe des Supermarkts jede Minute aufs Neue zerreißt und in zwei Teile zerfällt. Für einen Moment sieht man dann den schwarzen, von Straßenbahnschienen durchzogenen Asphalt der Kreuzung, der abgenutzt und löchrig ist und über den rasch ein paar Fußgänger mit Aktenkoffern hinwegeilen, bevor die bunte Kette sich wieder schließt.
Seit fast einer Woche ist Manu arbeitslos. Der pulsierende Verkehrsstrom erinnert sie Tag für Tag aufs Neue daran, dass das Heer der Arbeitenden sie ausgemustert und wie einen verwundeten und verwendungsunfähigen Soldaten einfach am Wegesrand zurückgelassen hat.
Manu steigt zwar immer noch, wie gewohnt, früh am Morgen aus dem Bett, doch sie zieht sich nicht mehr an. Sie trägt nur noch Boxershorts und ein Top und erinnert an eine Kämpferin, die glaubt, jeden Moment wieder in den Ring zurückgerufen zu werden, und das, obwohl sie bereits ausgezählt wurde.
In den ersten Tagen nach der Kündigung war sie manchmal stundenlang auf und ab durch ihre Wohnung gegangen, wie ein Zoo-Tiger in einem zu engen Käfig, und hatte sich dabei in Rage geredet oder auf ihren mit Sand gefüllten Boxsack eingeschlagen, der an einer Kette von der Decke hing. Sie hatte geflucht und gebrüllt und irgendjemanden einen Heuchler und Betrüger genannt. Dann wiederum war sie fast weinerlich geworden, hatte betont, dass sie ihren Job seit vielen Jahren zur Zufriedenheit des Konzerns erledigt habe. Man könne sie daher doch nicht so einfach von heute auf morgen auf die Straße setzen. Das alles müsse ein Irrtum sein.
Freitag vor einer Woche war sie in die Chefetage beordert worden, wo ihr die dreiköpfige und nach Rasierwasser duftende Führungsspitze – allein hatte sich wohl keiner der hohen Herren getraut – in wohlgesetzten Worten darlegte, warum man in Zukunft auf ihre Dienste leider Verzicht leisten müsse. Dabei legte man viel Wert darauf, immer wieder zu betonen, dass die Entlassung keinerlei persönliche Gründe habe. Man sei, im Gegenteil, all die Jahre hoch zufrieden mit Manus Arbeit gewesen, ihre »Freisetzung« sei daher einzig und allein der Neuorientierung des Unternehmens geschuldet. Dazu hatten die Herren mehrmals das Wort »Industrie 4.0« beschworen, so als ob Manus Entlassung nur eine zwangsläufige, auch von ihr selbst leicht einzusehende Konsequenz dieser neuen digitalen Revolution wäre. Manu hatte diesen Begriff, »Industrie 4.0«, den man in der Führungsetage für ihr Schicksal verantwortlich machte und den man dort dennoch mit einer gewissen Hochachtung aussprach, so als ob man sich neben den unvermeidbaren Kollateralschäden vor allem Großes von ihm erhoffte, noch nie zuvor gehört.
Manu wusste nicht, was sie jetzt machen sollte. Eine Umschulung? Ein ganz neuer Job? Sie konnte sich in Gedanken in keine andere Arbeitswelt projizieren als in die Lackierstraße ihres Werks, wo sie in den vergangenen Jahren den korrekten Ablauf von zigtausend Autolackierungen überwacht und gesteuert hatte. Wenn sie die Augen schloss, dann sah sie noch immer, wie die nackten, reifenlosen Karosserien auf einer unendlich langen Schiene auf sie zuliefen, wie die automatisch betriebenen Roboterarme, die wie gigantische Zahnarztbohrer aussahen, sich mit leisem Zischen in Position brachten, und wie die exakt berechnete Lackmenge zielgenau aus den runden Düsen sprühte.
4
Anna fährt mit dem Fahrrad zum Slavischen Institut am Albertus-Magnus-Platz. Sie trägt ein hellblaues Kleid und hat ihre Haare zu einem langen Pferdeschwanz geflochten, der über ihrem Rucksack hin und her pendelt, je nach dem, ob sie in das linke oder das rechte Pedal tritt.
Es liegt an diesem späten Märztag bereits ein wenig Frühling in der Luft. Die meisten Studenten, die Anna entgegenkommen, scheinen genau wie sie zum ersten Mal in diesem Jahr ihren dicken Wintermantel zu Hause gelassen zu haben. Allüberall herrscht eine gewisse Erleichterung, die das warme Wetter nach einer langen Reihe von kalten Tagen stets mit sich bringt, eine Erleichterung, die von Anna aber diesmal nicht so stark empfunden wird, zu sehr denkt sie noch immer an das mysteriöse Verschwinden ihres Vaters.
Sie hat heute einen wichtigen Termin mit Professor Kolewski. Es geht um das Thema ihrer Abschlussarbeit. Sie betritt das Institut und geht geradewegs zu Kolewskis Büro. Seine Sekretärin bittet Anna, noch einen Moment zu warten. Dann darf sie eintreten. Sie beginnt sogleich, über ihr Thema zu sprechen und hat gleichzeitig das Gefühl, neben sich zu stehen. Ein paar Mal verheddert sie sich bei der Vorstellung ihres Vorhabens.
»Grundsätzlich halte ich das Thema für durchaus ergiebig«, sagt Professor Kolewski, nachdem er sich Annas Ideen in Ruhe angehört hat. Er sitzt an seinem altertümlichen Schreibtisch, neben sich eine kleine Lampe mit grünem Schirm, die die Thesenpapiere beleuchtet, die Anna ihm vorgelegt hat.
»Mir gefällt vor allem, dass sie nicht zum x-ten Mal Turgenjews Einfluss auf den sogenannten melancholischen Impressionismus in Westeuropa beleuchten wollen oder seinen Kampf gegen die Leibeigenschaft. Stattdessen also mal ein Blick auf sein satirisches Schaffen in seinen späten Romanen Rauch und Neuland. Darf ich Sie fragen, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind?«
Anna wirft einen Blick auf die Lesebrille, die der Professor sehr weit vorne auf der Nasenspitze trägt und von der aus zwei silberne Kettchen bis hinauf zu seinem Nacken laufen. Jetzt nimmt er die Brille ab und faltet sie in der Mitte zusammen, so dass es aussieht, als ob ein drittes Auge vor seiner Brust baumelte.
»Ich gebe zu, dass mir andere Bücher von Turgenjew zunächst besser gefallen haben«, sagt Anna und blickt immer noch auf die kleingefaltete Brille, »aber dann bemerkte ich auf einmal, wie unglaublich aktuell diese beiden letzten Romane von ihm sind, nicht so sehr wegen ihrer speziellen Thematik, sondern weil er in diesem Buch politische Ideen, persönliche Überzeugungen und Konventionen als nichtssagendes Geschwätz darstellt, das wie Rauch um eine Lokomotive wabert, mal hinten, mal vorn, mal links, mal rechts vom Zug auftaucht, sich sammelt, dann wieder zerrissen wird, um sich an anderer Stelle neu zu sammeln, während die Lokomotive immer größere Fahrt aufnimmt. Mir erschien das äußerst modern und geradezu ein erschreckendes Sinnbild unserer heutigen europäischen Lebenswirklichkeit, die einem sprachbewusstlosen Fortschritt frönt, der …«
»… ja, das kann man so sehen«, unterbricht Professor Kolewski, faltet die Brille wieder auseinander und setzt sie zurück auf seine Nase. »Aber Sie müssten das selbstverständlich sehr genau herausarbeiten: zum einen sollten Sie die historische Perspektive des realen Hintergrunds, auf dem Turgenjew schreibt, klarmachen, zum anderen Schlussfolgerungen ziehen, die generell auf Möglichkeiten sprachlichen Handelns abzielen. Da werden Sie auch um ein wenig Sprachphilosophie nicht herumkommen. Und darüber hinaus möchte ich Sie ermuntern, das Thema noch um einen Autor zu erweitern. Ich denke, es wäre gut, wenn Sie auch Michail Jewgrafowitsch Saltykow-Schtschedrin in ihre Überlegungen mit einbeziehen.«
»Turgenjew hat ihn nicht sehr gemocht und seine Bücher für unliterarisch gehalten«, wendet Anna ein.
»Das schadet nichts. Umgekehrt hat Saltykow-Schtschedrin Turgenjews Arbeit sehr geschätzt. Aber auch das ist belanglos. Wichtig ist nur, dass Sie herausarbeiten, welchen Unterschied es zwischen diesen satirischen Romanen gibt, ja, ob es überhaupt Unterschiede gibt, oder ob sie sich am Ende nicht doch näher stehen, als die Forschung es bislang wahrhaben möchte. Ein Tipp: Achten Sie nicht so sehr auf die vermittelten Inhalte, sondern vielmehr darauf, wie beide die Sprachlichkeit ihrer Figuren darstellen. Also nicht darauf, was sie sagen, sondern wie sie es sagen.«
Anna nickt nur.
»Und wo wir gerade dabei sind, möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Autor ans Herz legen, nämlich Dostojewski. Ich weiß, wenn er heute lebte, würde er mit seinen slawophilen Ideen wahrscheinlich vom Verfassungsschutz überwacht«, sagt Kolewski und lacht. »Ich möchte Ihnen aber dennoch empfehlen, sich mit einem Text aus dem Tagebuch eines Schriftstellers auseinanderzusetzen, nämlich mit seiner Kritik am sogenannten Kroneberg-Prozess. Darin geht es um einen Vater, der seine siebenjährige Tochter mit Spitzruten, also mit dornentragenden Zweigen, grausam gezüchtigt hatte und von den Geschworenen nach einer manipulativen Rede seines Anwalts freigesprochen wurde. Dostojewski hat in diesem Text die Argumentation des Anwalts auf beeindruckende Weise in der Luft zerpflückt. Er zeigt, wie der Anwalt mit sprachlicher Raffinesse aus einem siebenjährigen Engel ein verschlagenes Mädchen, eine Lügnerin und eine Diebin mit schlimmen heimlichen Lastern macht, und wie er dadurch bei den Geschworenen jede Sympathie für das Kind vernichtet. Was Dostojewski da leistet, könnte gut zwanzig Jahre später 1:1 in der Fackel des Österreichers und wohl größten deutschsprachigen Satirikers Karl Kraus stehen. Wenn Sie das alles im Blick behalten, dann begreifen Sie erst die unglaublich aufwühlende humane Leistung, die darin besteht, instrumentalisierte Sprache zu erkennen und zu benennen.«
Professor Kolewski blättert noch einmal in den Thesenpapieren vor sich auf dem Schreibtisch, doch dann sieht er Anna streng über seinen oberen Brillenrand an und sagt: »Frau Sidorowa, entschuldigen Sie, wenn ich das Thema wechsele, aber Sie wirken auf mich heute ein wenig zerstreut und nervös. Gibt es vielleicht Probleme, bei deren Lösung ich Ihnen behilflich sein kann?«
»Nein«, antwortet Anna, »vielen Dank. Es ist nur so … also mein Vater ist erkrankt und ich mache mir Sorgen.«
»Schwer?«
»Das weiß man noch nicht.«
»Vielleicht sollten Sie ihn besuchen. Sie sind ja zeitlich mit Ihrer Arbeit noch ganz gut im Rennen. Ein paar Tage werden Sie sicherlich erübrigen können. Und für das Hauptseminar entschuldige ich Sie gern bis auf Weiteres.«
»Das ist lieb von Ihnen, ich will es mir überlegen«, sagt Anna und kramt rasch ihre Papiere und Bücher zusammen.
Professor Kolewski erhebt sich von seinem Stuhl und begleitet Anna zur Tür. »Sie können mich jederzeit anrufen«, sagt er. »Ich bin mir bei Ihnen ohnehin sicher, dass Sie die Prüfung mit Bravour meistern werden. Sie sind schließlich Muttersprachlerin. Bei einigen Ihrer Kommilitonen mache ich mir da schon weitaus mehr Sorgen.«
Anna lächelt. »Danke«, sagt sie, »ich melde mich, sobald ich mehr weiß.«
5
Manu hat nie zuvor in ihrem Leben das Arbeitsamt besucht. Das Gebäude stammt noch aus der Gründerzeit. Die hohe graue Fassade mit ihren Erkertürmchen und den schmalen Treppenhausfenstern über dem Haupteingang, die an Schießscharten erinnern, hat etwas Wehrhaftes, so als ob die Arbeit in diesem Haus vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden sollte. Drinnen jedoch herrscht eine freundliche Helligkeit, und bunte Wegweiser dienen wie in einem Kindergarten der Orientierung. Manu kramt einen kleinen Zettel aus der Tasche, auf dem sie sich notiert hat, welches Büro sie aufsuchen soll. Sie findet es in der zweiten Etage und muss dazu nur brav einem blauen Pfeil folgen.
Im Flur vor der Zimmertür 108 sitzen bereits zwei Menschen an einem kleinen runden Glastisch, ein Mann und eine Frau. Die Frau steht jedoch gerade auf, als Manu den Flur betritt. Die zuständige Sachbearbeiterin öffnet die Tür, blickt über ihre Lesebrille, hält der Frau ihre Hand hin und zieht diese sodann, ohne ihre Hand loszulassen, in das Büro hinein, so wie ein Krake, der sich einen kleinen vorbeischwimmenden Fisch zum Mittagessen greift. Der Mann bleibt allein am Tisch sitzen. Als Manu den Tisch erreicht, blickt der Mann kurz auf und grüßt. Manu grüßt zurück und setzt sich auf den freigewordenen Stuhl.
Auf dem Tisch liegen Infoschriften für die Wartenden, die auf interessante Berufe aufmerksam machen wollen. Die Titelseiten werden von lächelnden Frauen im Blaumann mit wohlkalkulierten Schmutzapplikationen auf der Wange und von Männern mit weißem Helm und einem Zollstock in der Hand geschmückt. Sie alle sehen so selbstzufrieden aus und blicken einen so verklärt an, als ob sie sich im Paradies der Arbeit befänden und ihre Betrachter auffordern wollten, doch auch zu ihnen zu stoßen und fortan ein glückliches Arbeitsleben zu führen.
»Du bist heute das erste Mal hier, ja?« fragt der Mann. Manu wunderte sich, dass sie geduzt wird, denkt sich aber, dass diese Vertraulichkeit wahrscheinlich normal ist unter Arbeitslosen. Man gehört ja jetzt quasi derselben sozialen Schicht an, denkt sie. Manu nickt nur stumm.
»Es ist nur, weil du dich noch für den Müll da interessierst.«
Manu weiß nicht, was sie darauf erwidern soll. Sie hofft auch nicht, dass sie von nun an regelmäßig hier sitzen wird, sondern dass man ihr schnell eine adäquate andere Stelle besorgt.
Eine weitere Tür geht auf, und der Mann, der neben Manu gesessen hat, erhebt sich und verschwindet durch diese Tür. Nachdem Manu zehn Minuten lang allein im Flur gesessen hat, öffnet sich auch das Zimmer mit der Nummer 108. Die Frau kommt heraus und entfernt sich ohne ein Wort. Manu muss noch eine Weile warten, bis sie hineingerufen wird und der Krake sie in seine Bürohöhle zieht.
Auf dem Flur ist es jetzt ganz still. Nichts geschieht. Nur der Minutenzeiger an der großen Uhr, die an der Stirnseite des Flurs hängt, knackt jedes Mal leise, wenn er über die Zwölf streicht. Dann fällt irgendwo eine schwere Tür ins Schloss.
Kurz darauf verlässt Manu das Büro mit einem Stapel Formulare, die sie sämtlich ausfüllen und in ein paar Tagen wieder beim Arbeitsamt einreichen soll. Sie ist froh, wieder draußen zu sein, und genießt die frische Luft. Doch ihre gute Laune hält nicht lange an. Schon wenig später stapft sie in Gedanken versunken durch eine blühende Kirschbaumallee. Beim kleinsten Lufthauch schneien die weißen Blüten auf sie nieder, aber sie hat dafür keinen Blick übrig. Sie geht, als stecke sie von Kopf bis Fuß in einem Futteral, abgeschottet von der Wirklichkeit um sie her, nur mit ihren eigenen kleinen Gedanken beschäftigt. Auf den Parkbänken sitzen Liebespaare und blicken mit winzigen übernächtigten Augen in die wärmenden Sonnenstrahlen des Vorfrühlingstags. Radfahrer fahren klingelnd und gut gelaunt an Manu vorüber. Alte Damen füttern unten am Weiher ein paar Enten und Schwäne, und große weiße Wolken ziehen gemächlich in der Ferne am Himmel entlang wie Eisberge durch die Eisberggasse vor der Küste Neufundlands.
Manu hätte sich irgendwo setzen und den Tag genießen können. Doch stattdessen hat sie die ganze Zeit das Gefühl, dass der schöne Tag nicht für sie gemacht ist oder besser nicht mehr für sie gemacht ist. In ihrem Kopf hat sich die strenge Abfolge von Arbeit und Freizeit längst zu einem Naturgesetz etabliert. Man hat kein Recht, als Müßiggänger durch den Tag zu schlendern, wenn man nicht zumindest eine anstrengende Nachtschicht hinter sich hat. Hat man aber eine anstrengende Nachtschicht hinter sich, so wusste Manu aus eigener Erfahrung, dann stand einem nicht nach Müßiggang, sondern nur noch nach Schlaf der Sinn. Kurz: Eigentlich kam der Müßiggang in ihrem Leben gar nicht vor. Es gab ihn nur in Büchern, in Romanen, aber nicht im wirklichen Leben.
6
Ein Fahrrad klingelt neben Manu, die noch immer missgelaunt auf dem Heimweg ist und, ohne links und rechts zu schauen, apathisch vor sich auf den Gehweg starrt. Das plötzliche Bimmeln hat sie erschreckt, und sie will dem Radler gerade einen Vogel zeigen, als sie erkennt, dass es ihre Wohnungsnachbarin Anna ist, die sie lächelnd vom Rad aus ansieht.
»Was machst du denn hier?« fragt Anna. »Hast du heute frei?«
»Heute, morgen, übermorgen …«, antwortet Manu.
»Urlaub?« fragt Anna.
»Nein, ich hab die Rente durch.«
Anna lacht und steigt vom Rad. »Erzähl keinen Unsinn«, sagt sie.
Die beiden Frauen kennen sich noch nicht sehr lange. Obwohl sie schon seit zwei Jahren nebeneinander im selben Haus wohnen, haben sie sich nur selten gesehen. Zu unterschiedlich ist ihre Lebensweise. Wenn Manu von einer Nachtschicht kommt, dann schläft Anna noch, und wenn Manu morgens zur Frühschicht geht, dann schläft Anna ebenfalls noch. Nur bei einer von Manus Spätschichten besteht oder besser bestand die Möglichkeit, dass man sich vor dem Mittag auf dem Flur traf, beispielsweise beim Herunterbringen des Mülls oder beim Heraufholen der Post. Viel geredet hatten sie dann nie miteinander. Für Manu ist Anna eine Studentin und somit jemand, der eigentlich gar nicht in dieses Haus gehört, da es doch überwiegend von Menschen bewohnt wird, die einer geregelten Arbeit nachgehen.
»Mich hat‘s erwischt«, sagt Manu, »wahrscheinlich war ich einfach an der Reihe.«
»Hast du dich verliebt?« fragt Anna vorsichtig.
Manu sieht Anna an und beginnt auf einmal loszuprusten. »Wie bitte? Verliebt? Na du bist ein Herzchen. Die haben mich an die Luft gesetzt. Meine Arbeit macht jetzt Industrie 4.0, was immer das für ein Scheiß ist. Ist aber auf jeden Fall billiger, gibt keine Widerworte und ist auch nicht in der Gewerkschaft.«
»Du hast deine Arbeit verloren?«
»Nein, ich habe sie nicht verloren, so blöd kann man ja gar nicht sein, sie haben sie mir weggenommen, gestohlen, verstehst du?«
»Das tut mir leid, was willst du denn jetzt machen?«
»Vielleicht studieren«, sagt Manu.
»Das ist eine sehr gute Idee«, pflichtet Anna ihr bei.
»Spinnst du, das war ein Scherz, ich habe nicht einmal Abitur.«
»Das kann man am Abendgymnasium nachholen.«
»Oh ja, und wer bezahlt in der Zwischenzeit meine Miete?«
»Vielleicht bekommst du eine Unterstützung vom Arbeitsamt.«
»Hm, ja, vielleicht«, sagt Manu versöhnlicher, »aber was soll ich studieren? Ich kann ja nichts.«
»Maschinenbau vielleicht«, sagt Anna.
»Das ist eine sehr gute Idee«, sagt Manu und versucht dabei, Annas Tonfall zu imitieren. Doch dann lässt sie die Schultern sinken, als ob ihre Anspannung schlagartig verschwunden wäre, und sagt: »Wollen wir vielleicht mal einen Kaffee zusammen trinken, Frau Nachbarin?«
»Ja, gerne, aber wenn, dann bei mir zu Hause, mein Geld für diesen Monat ist nämlich fast aufgebraucht.«
»Ich lade dich selbstverständlich ein.«
»Ich würde dennoch lieber in meiner Wohnung mit dir einen Kaffee trinken, ich erwarte nämlich einen wichtigen Anruf.«
»Verliebt?« fragt Manu.
»Nein, ich warte auf eine Nachricht von meinem Vater.«
7
»Du musst entschuldigen, ich habe heute noch nicht aufgeräumt«, sagt Anna, als sie die Haustür aufschließt und Manu in ihre Wohnung bittet.
»Immerhin geht die Tür noch auf«, erwidert Manu und betritt den kleinen Flur, dessen Garderobe so voll mit Jacken, Mänteln und Mützen hängt, dass man kaum an all dem Zeug vorbei in den eigentlichen Wohnraum kommt.
»Ist das fürs Winterhilfswerk?« fragt Manu und weist auf die Kleidungsstücke, doch Anna scheint den Scherz nicht zu verstehen.
Der Wohnraum ist klein, aber gemütlich: In der Mitte steht ein runder Glastisch, der von einer von der Decke hängenden Korblampe beleuchtet wird. Davor befinden sich zwei Stühle. Vor dem Fenster ruht ein altmodischer Schreibtisch mit großen verschnörkelten Türen, auf dem Dutzende von Büchern und lose Blattsammlungen liegen. Neben dem Schreibtisch stehen zwei Holzregale, die ebenfalls überfüllt sind. Einige Bücher wurden quer in die Lücken über den stehenden Büchern gequetscht. Und auf dem Boden stapeln sich diejenigen, die gar keinen Platz mehr gefunden haben.
An den Wohnraum schließt sich eine kleine Küche an sowie das Bad und das Schlafzimmer. Bis vor einem Monat hatte Anna hier mit einer Kommilitonin gelebt, die aber nach erfolgreichem Universitätsabschluss nach Hamburg gezogen ist, wo sie jetzt als Übersetzerin bei einer Importfirma arbeitet. Allein ist Anna die Wohnung eigentlich zu teuer, und sie überlegt einen Moment, ob sie nicht Manu fragen soll, ob sie aufgrund ihrer neuen Lebenslage nicht Interesse hat, hier einzuziehen. Doch dann denkt sie, dass es für so eine Frage wohl noch zu früh ist. Man kennt sich ja kaum.
Manu blickt sich ganz ungeniert in der Wohnung um, schaut auf all die vielen Bücher und stößt einen leisen Pfiff zwischen den Zähnen aus, der alles Mögliche bedeuten kann. Dann aber scheint sie plötzlich überrascht und ruft laut: »Ich glaub‘ es nicht.« Dabei eilt sie geradewegs auf die kleine Kommode neben dem Sofa zu, auf der vor dem Bild von Annas Vater etwas liegt, das sie offensichtlich in diese helle Begeisterung versetzt hat.
»Du hast eine echte Goldmedaille gewonnen? In welcher Sportart denn? Das ist ja sensationell.«
Anna wiegelt ab. »Nein, die ist nicht von mir, die ist von meiner Mutter. Olympische Sommerspiele 1980 in Moskau.«
Manu nimmt die Goldmedaille in die Hand und betrachtet sie aus der Nähe: Am linken Medaillenrand sitzt eine Frau, die in einem sehr faltenreichen, wenig sportlich wirkenden Gewand steckt und mit der rechten Hand eine Fackel über dem Kopf schwenkt. In der linken Hand hält sie ein paar Palmen- oder Lorbeerzweige. Rechts von ihr steht eine große Vase und links unten neben ihr ziehen in der Ferne zwei kleine Pferdchen einen antiken Streitwagen, der nur mit einem halben Rad angedeutet ist, darüber wölbt sich, ebenfalls nur rudimentär, mit zwei Fensterreihen das römische Amphitheater. Manu liest ganz langsam und als wäre es in deutscher Sprache geschrieben: »Mockba 1980.« Die anderen kyrillischen Buchstaben kann sie nicht entziffern. Auf der Rückseite ist das olympische Feuer eingraviert, die olympischen Ringe, über die sich ein aus sechs Linien skizziertes Hochhaus mit einem Stern auf der Spitze erhebt, sowie irgendetwas, das aussieht wie die Kurve einer mehrspurigen Rennbahn.
»Meine Mutter hat die Medaille im Schwimmen gewonnen. Sie war Deutsche und ist damals mit dem DDR-Damenteam nach Moskau gereist. Die Spiele wurden 1980 leider von vielen westlichen Nationen boykottiert, weil sowjetische Truppenverbände ein Jahr zuvor nach Afghanistan einmarschiert waren. Nicht zuletzt aus diesem Grund waren die DDR-Schwimmerinnen bei diesen Spielen äußerst erfolgreich und stellten allein sechs neue Weltrekorde auf.«
»Wow, und diese Medaille liegt hier einfach so herum?«
»Meine Mutter hat diese Goldmedaille nur gewonnen, weil sie über viele Jahre gedopt wurde, allerdings ohne es zu wissen. Weißt du, in der DDR war das Doping staatlich organisiert. Alle Schwimmerinnen in der Nationalmannschaft wurden ab dem 14. Lebensjahr in Anabolika-Programme des Verbandes aufgenommen. Man gab ihnen Tabletten und sagte, das seien Vitamintabletten. Meine Mutter war quasi ein Versuchskaninchen des politischen Klassenkampfs. Und als sie das eines Tages verstanden hatte, warf sie ihre Goldmedaille in den Müll. Ich habe sie dann wieder da herausgefischt …«
»Überall dieselbe Scheiße«, sagt Manu und legt die Medaille zurück auf die Kommode. »Da verstehe ich, dass sie die Auszeichnung nicht mehr haben will.«
»Meine Mutter ist schon seit vielen Jahren tot«, sagt Anna. »Mein Vater glaubt, sie sei an den Spätfolgen dieses Dopings gestorben, so wie andere ihrer Kameradinnen auch.«
»Und ich dachte, ich hätte Probleme«, sagt Manu und lässt sich auf einen der Stühle fallen, der unter ihr ein beängstigendes Knarzen ertönen lässt. »Aber das ist dagegen ja alles nur kalter Kaffee«, fügt sie hinzu und testet die Stabilität des Stuhls, indem sie etwas mit den Hüften hin und her schwingt.
»Im Grunde genommen hast du dennoch mit meiner Mutter etwas gemeinsam«, sagt Anna.
»Oh nein«, wiegelt Manu ab, »ich schwimme nicht, ich boxe, und das ohne irgendwelche Mittelchen. Ich gewinne zwar selten einen Kampf, aber darum geht es auch nicht. Es entspannt mich einfach.«
»Du boxt?«
»Ja, in einem Verein. Wir sind nur Mädels. Kannst gern mal mitkommen.«
»Danke, ich überlege es mir. Aber was ich mit der Gemeinsamkeit meinte, war, dass ihr beide Opfer einer beschleunigten Optimierungsgesellschaft geworden seid.«
»Opfer von was?« fragt Manu. »Hör mal, du solltest dringend die Schrauben an diesem Stuhl wieder anziehen, bevor du irgendwann mit ihm zusammenbrichst.«
8
Während die beiden Frauen beim Kaffee sitzen, erzählt Anna auf Wunsch von Manu, wie sich ihre Eltern kennengelernt haben:
»Das war 1980 bei der Olympiade. Mein Vater gehörte damals mit zum medizinischen Team, das sich im Olympischen Dorf um das Wohlergehen der russischen Sportler kümmern sollte und in dieser seiner Eigenschaft lernte er meine Mutter kennen. Beim ersten Aufwärmtraining in der Schwimmhalle hatte sie plötzlich starke Zahnschmerzen. Ihr Trainer befürchtete, dass er daher zumindest im ersten Wettbewerbsdurchgang auf sie verzichten müsse. Selbst ein starkes Schmerzmittel, das man ihr verabreicht hatte, schlug nicht an. Da man keinen eigenen Zahnarzt mit nach Moskau gebracht hatte, verwies ihn jemand auf die ambulante Zahnarztpraxis von Dr. Pawlow Iwanowitsch Sidorow. Der Arzt wurde sogleich alarmiert. Mein Vater kam also zu den deutschen Athleten ins Olympische Dorf und diagnostizierte bei meiner Mutter eine Fistel unter einem der Eckzähne. Im Zahnfleisch hatte sich bereits ein kleiner kreisrunder Ausgang gebildet, doch war offensichtlich noch kein Eiter abgeflossen, so dass die Schmerzen sehr groß sein mussten. Angesichts der Tatsache, dass die Schwimmerinnen in vierundzwanzig Stunden das erste Mal auf dem Startblock stehen sollten, griff mein Vater beherzt zur Zange und entfernte den Eckzahn. Du musst wissen, mein Vater war damals ein gut aussehender junger Arzt, der selbst kein schlechter Leichtathlet war, wenn er es auch nicht bis nach Olympia gebracht hatte, und der dazu noch sehr lustig sein konnte. Kurz: Er gefiel meiner Mutter trotz Zahnschmerzen ausnehmend gut, so dass sie sich sogleich drei weitere Behandlungstermine geben ließ, wozu eigentlich keinerlei Notwendigkeit bestand. Und auch mein Vater konnte den Blick kaum von seiner Patientin lassen, obwohl diese aufgrund ihrer dicken Backe noch längst nicht mit allen Vorzügen ihres Äußeren glänzen konnte. – Warum lachst du? – Ein paar Tage später, nachdem die Schwimmerinnen ihre großen Erfolge mit so mancher Medaille feierten, gingen die beiden dann das erste Mal miteinander aus. Ein Jahr später heirateten sie und zogen nach Moskau. Ich wurde erst zehn Jahre später geboren, als der Eiserne Vorhang sich bereits geöffnet hatte, das große sowjetische Reich unter Michael Gorbatschow langsam aber sicher auseinanderbrach und alle Unionsrepubliken sich für souverän und Litauen und Georgien sogar für unabhängig erklärten. Doch auch wenn die Zeiten turbulent waren und die Politik zuweilen verworren, so war dies in gewisser Weise nur ein Grund mehr, dass die Menschen häufig an Zahnschmerzen litten. Und so kamen meine Eltern recht gut über die Runden, machten im Sommer Urlaub auf Jalta und besaßen sogar ein Ferienhäuschen an der deutschen Ostseeküste. Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich an der Universität Lomonosov einige Semester russische Sprache und Literatur studiert sowie romanisch-deutsche Philologie. Dann aber hat es mich gereizt, das Land meiner Mutter kennenzulernen, auch wenn es die DDR da längst nicht mehr gab.«
»Du hast eine lustige Art, Geschichten zu erzählen«, sagt Manu, die die ganze Zeit über nicht einmal von ihrem Kaffee getrunken hat, sondern Anna, mit Ausnahme eines leichten Lachanfalls, mit offenem Mund anstaunte.
»Tut mir leid, wenn mein Deutsch … «
»Nein, nein, das war keine Kritik. Erzähl ruhig weiter, das entspannt mich fast so, als ob ich boxen würde.«
»Nun, viel mehr gibt es da nicht zu berichten«, sagt Anna und scheint ein wenig irritiert.
»Und dein Vater? Wie geht es dem heute? Wartest du nicht auf seinen Anruf?«
»Mein Vater hat mir einen merkwürdigen Brief geschickt und ist seither verschwunden. Ich wünschte, er würde sich melden.«
Manu will nicht zu neugierig erscheinen, deshalb schweigt sie.
»Schau her!« sagt Anna und zieht das Paket unter dem Sofa hervor. »Er hat mir Kopien von einem alten Buch zugesandt und gesagt, dass ich darauf aufpassen solle, es sei sehr wichtig. Und er müsse etwas erledigen, was mit diesem Buch zu tun habe. – So ist mein Vater, statt mir zu sagen, was genau los ist, macht er irgendwelche geheimnisvollen Andeutungen und lässt mich dann mit meinen Sorgen allein.«
»Worum geht es denn in dem Buch?« fragt Manu.
»Keine Ahnung, ich habe es bislang noch nicht gelesen.«
»Na, du bist witzig. Wenn das Buch so wichtig für ihn ist, warum hast du dann noch keinen Blick reingeworfen?«
»Es ist irgendeine alte Aufzeichnung von einem meiner Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert. Er war so eine Art Forscher, der sich für indigene Völker jenseits der Zivilisation interessierte. Ich glaube daher kaum, dass aus dem Büchlein hervorgeht, wo mein Vater sich derzeit befindet.«
»Wenn ich das richtig sehe, so hast du aber keine andere Spur als diese«, sagt Manu und wendet sich endlich ihrem Kaffee zu.
»Spur?«
»Ja, man muss logisch an die Sache herangehen. Alles, was man weiß, vor sich ausbreiten und es dann wie ein Puzzle zusammenlegen.«
»Du liest gern Krimis, oder?«
»Ich lese eigentlich gar nicht.«
»Dann schaust du viel fern?«
»Ich habe nicht einmal mehr einen Fernseher, allerdings einen Laptop.«
»Aber wie verbringst du deine Freizeit?«
»Freizeit hatte ich bislang auch keine.«
»Ich glaube, dann ist die Arbeitslosigkeit das Beste, was dir widerfahren konnte«, sagt Anna und lacht.
8
Anna liest Manu den Brief ihres Vaters vor. Manu ist erstaunt, weil Anna ihn simultan ins Deutsche übersetzt.
»Ich könnte den Brief nicht mal mehr auf Deutsch so schnell vorlesen«, sagt sie. »Verrückt. Aber entschuldige, dass ich gelacht habe. Es war nur, weil dein Vater dich Täubchen nennt. Verstehst du dich gut mit ihm?«
»Normalerweise verstehe ich mich sehr gut mit ihm, aber manchmal ist er ein ausgesprochener Egoist. Jetzt zum Beispiel weiß ich wieder einmal nicht, wo er steckt und was er treibt.«
»Auf jeden Fall ahne ich, woher du so schön erzählen kannst. Und wenn dein Vorfahre sich auch darauf versteht, dann wird es bestimmt eine interessante Lektüre, die dich da erwartet. – Es muss angenehm sein, so einen Vater zu haben.«
»Was ist mit deinem Vater?« fragt Anna.
»Och, der hat sich totgesoffen, als ich sechzehn Jahre alt war. Vorher, als ich noch ein Kind war, haben wir viele lustige Sachen zusammen gemacht. Aber dann wurde er immer merkwürdiger. Meine Mutter sagt, er sei mit seinem Leben nicht parat gekommen. In seiner Jugend wollte er die Welt retten und später sollte die Welt ihn retten. Er hatte einen Rückfall nach dem anderen, bis er dann eines Nachts im Winter volltrunken auf einer Parkbank eingeschlafen ist. Das war’s. Meine Mutter jammert seither nur noch rum. Es macht keinen Spaß, sie zu besuchen. Im Grunde genommen laufen alle unsere Gespräche immer nur auf eine Sache hinaus: Sie braucht Geld und versucht es, von mir zu bekommen. Dafür erfindet sie die schönsten Geschichten. Leider sind sie alle erlogen. Aber ich tue immer so, als ob ich ihr glaubte, und gebe ihr fast Monat um Monat die Hälfte von meinem Lohn. Sie nimmt das Geld, ohne danke zu sagen.«
»Das ist nicht schön von ihr«, sagt Anna und scheint ehrlich empört.
»Sie schämt sich halt, danke zu sagen. Ich glaube, wir Deutschen sind alle so. Wenn uns jemand etwas schenkt, das wir dringend benötigen, es uns aber selber nicht leisten können, dann ist es uns trotzdem unangenehm, es geschenkt zu bekommen. Allein, dass ein anderer zu diesem Geschenk einfach so in der Lage ist, das er übrig hat, was wir brauchen, macht die Sache so unerfreulich. Wir können einfach nichts annehmen. Schenken ja, das ist kein so großes Problem. Aber etwas annehmen, das ist uns geradezu peinlich. Die Deutschen nehmen daher gern etwas vom Sperrmüll anderer Leute mit, weil sie es eben ganz anonym mitnehmen können. Wenn du als Sperrmüllbesitzer aber vor die Tür gehst, während andere in deinem Müll wühlen, dann entsteht jedes Mal eine peinliche Situation. Die Sperrmülljäger wollen sich nicht den Anschein geben, etwas zu benötigen, sondern geben sich nur irgendwie interessiert an altem Plunder, mehr so aus antiquarischer Neugier. Daher stecken sie auch meistens demonstrativ die Hände in die Taschen, wenn der Ex-Besitzer auftaucht. Und dem Sperrmüllbesitzer ist es peinlich, etwas an die Straße gestellt zu haben, was andere offensichtlich noch gebrauchen können. Er tut dann oft so, als sei er in dem Haus nur zu Besuch gewesen und wühlt selbst etwas neugierig in dem Plunder herum und nimmt vielleicht sogar ein kleines Teil mit, das er dann an der nächsten Ecke wieder entsorgt.«
»Nein, das glaube ich nicht. Das denkst du dir doch jetzt nur aus. Aber mal ehrlich: Der Schenkende schenkt doch, weil er Freude am Schenken hat. Warum also soll man ihm diese Freude nehmen?«
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das die Kehrseite des Kapitalismus. In einer Gesellschaft, wo sich alle über den Besitz von Geld und tausend Habseligkeiten definieren, ist es einem unangenehm, wenn man weder Geld noch Dinge besitzt. Es wird einem dann bewusst, dass man nicht zu dieser Gesellschaft dazugehört. Geschenke sind dann keine Geschenke, sondern Almosen. Aber niemand möchte, dass man Mitleid mit ihm hat. Jeder möchte doch ein ganz normaler und vollständiger Mensch sein. Aber ganz normal und vollständig ist man eben nur, wenn man Geld und Besitz hat. Da schließt sich der Kreis.«
»Das ist interessant«, erwidert Anna, »du willst sagen, dass die Gesellschaftsform, in der man heranwächst, bewusstseinsprägend auf das Individuum wirkt. Und dass geistige Freiheit daher immer nur in diesen Bewusstseinsschranken stattfinden kann und genaugenommen also nie absolute Freiheit ist, sondern eine durch die Gesellschaft determinierte?«
»Nee, das will ich ganz bestimmt nicht sagen. Individuum und Bewusstseinsschranken, was redest du denn da?«
»Entschuldige, ich schreibe gerade an meiner Examensarbeit, deshalb drücke ich mich wahrscheinlich so akademisch aus.«
»Na ja, im Grunde ist es wahr. Egal, in welcher Gesellschaft man heranwächst, man geht nie vorurteilsfrei auf die Welt zu, sondern sieht die Welt immerzu durch eine hinter den Augäpfeln eingebaute Brille. Ja, so stelle ich mir das vor: Die Gläser dieser Brille sind mal bunt gefärbt, mal konkav, mal konvex und manchmal auch einfach nur mit Ruß beschmiert oder mit einem Sprung drin. Eine solche Brille wird jedem Menschen bereits im Kindesalter einoperiert und sie wächst dann bis zu seinem Tode mit. Dabei fabriziert jede Gesellschaft ihr eigenes unsichtbares Nasenfahrrad. Gefährlich wird es nur, wenn man glaubt, dass so, wie man selber die Welt sieht, die Welt einzig und allein richtig betrachtet wird. Dann sind nämlich alle anderen Unwissende, Unkultivierte, Idioten, Aufwiegler, Störenfriede oder was auch immer.«
Anna betrachtet ihr Gegenüber sehr aufmerksam. Sie wundert sich ein wenig über Manus bildreiche Sprache, vor allem über das unsichtbare Nasenfahrrad. Sie ahnt so schnell nicht, was damit gemeint sein könnte. Gleichzeitig bemerkt sie, dass Manu immer noch weiterdenkt. Sie scheint etwas auszubrüten.
»Nun aber zurück zum Schenken und Beschenktwerden«, sagt sie, als wäre sie zu einem weiteren wichtigen Ergebnis ihrer Überlegungen gekommen. »Müssen wir uns nicht die Frage stellen, warum dein Vater dir ein paar billige Kopien von einem alten Buch geschenkt hat, statt dir das Buch selbst zu schenken? Warum behauptet er, er habe dafür Sorge getragen, dass das Buch in die richtigen Hände gekommen ist? Welche Hände könnten denn in diesem Fall richtiger sein als die deinen? Nicht nur, dass es sich bei dem Autor um einen deiner Vorfahren handelt, nein, es geht auch um einen russischen Text aus dem 19. Jahrhundert. Und gerade dafür bist du doch, wenn ich das mit deinem Studium bislang richtig verstanden habe, die unumschränkte Expertin.«
Anna lächelt verlegen. »Du sprichst da etwas aus, was ich mir insgeheim auch schon gedacht, es aber dann rasch wieder verdrängt habe. Ich gebe zu, dass ich mich für einen Moment verletzt fühlte, als ich seinen Brief las. Aber bestimmt gibt es einen wichtigen Grund dafür, dass mein Vater so gehandelt hat, wie er gehandelt hat.«
»Davon muss man ausgehen. Du solltest die Kopien bekommen, weil sie deinem Vater weitaus wichtiger sind als die Originale. Aber warum ist das so? Darauf fällt mir keine Antwort ein. Und das ärgert mich.«
»Ich wünschte, er würde mich einfach mal anrufen.«
»Hat er kein Handy?«
»Mein Vater? Nein. Er hält das Smartphone für eine Erfindung der Mächtigen, durch die die Menschen freiwillig ihre Köpfe nach unten beugen, um eine für sie bunt und abwechslungsreich inszenierte Realität im Blick zu behalten. So erkennen sie nicht, was über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Die Mächtigen können dadurch tun und lassen, was sie wollen.«
»Das gefällt mir«, sagt Manu. »Das könnte von mir sein, wenn ich die Gabe hätte, es so auszudrücken.«
Anna geht in die Küche, um noch Kaffee zu holen. Doch als sie zurückkommt, hat sie den Kaffee vergessen und sieht Manu an, als ob sie einen plötzlichen Einfall hätte: »Ich glaube, du hast recht. Ich sollte das Buch einfach mal lesen. Vielleicht weiß ich dann mehr. Es muss ja einen Grund geben, warum er es mir geschickt hat.«
»Ja, bestimmt«, pflichtet Manu ihr bei. »Ich verzieh mich jetzt und dann wirfst du einfach mal einen Blick rein. Das Arbeitsamt hat mir einen Stapel Zettel mitgegeben, lauter Formulare, die soll ich alle hübsch ausfüllen. Am besten schon bis morgen, damit ich so rasch wie möglich Arbeitslosengeld bekomme.«
»Willst du nicht lieber hierbleiben und wir lesen das Buch zusammen?«
»Das will ich dir nicht zumuten. Du müsstest dann ja wieder den Simultanübersetzer geben, das dürfte anstrengend werden.«
»Ist eine gute Übung für mich«, sagt Anna.
»Also gut, ich habe nichts dagegen. Viel langweiliger kann mein Leben ja derzeit nicht werden.«
»Dann hole ich uns noch Kaffee, und schon geht es los.«
Wenig später sitzen Anna und Manu gemeinsam auf dem roten Sofa neben der Kommode. Anna hat das Textkonvolut aus den Klammern befreit, und jedes Mal, wenn sie eine Seite zu Ende gelesen hat, reicht sie die Seite an Manu weiter, die diese glattstreicht und auf die Kommode legt. Da Anna immer erst lesen und dann übersetzen muss, kommen sie nur sehr langsam voran.
9
Die Entdeckung der Gojin
von Alexej Alexejewitsch Sidorow
ICH BIN ZURÜCK UND HABE GÄSTE EINGELADEN
Vor gut drei Tagen bin ich von einer langen Reise zurückgekehrt, die mich bis an die nordwestliche Grenze des russischen Reichs geführt hat, und nachdem ich allerhand Mitbringsel aus der Fremde in mein Kabinett einsortiert sowie meine schriftlichen Aufzeichnungen noch einmal durchgesehen habe, ließ sich ein Empfang einiger meiner Gönner, engsten Freunde und Familienmitglieder nicht mehr länger aufschieben.
Zunächst erschien an diesem warmen Spätherbsttag Tante Maxima Feodora in einem blauen, bei jeder kleinen Bewegung knisternden Kleid, zu dem sie einen weißen Hut mit drei passend zum Kleid gefärbten Schleifen und ebensolche blauen Handschuhe trug. Sie war kaum der Kutsche entstiegen und hatte trotz ihres fortgerückten Alters eilig mit hochgerafften Rockschößen die breite Eingangstreppe meines Hauses mit nur vier Schritten erklommen, als sie bereits im Hausflur mehrfach rief: »Oú est mon enfant terrible?1«.
Denn wie alle russischen Adelspersonen, die auf sich halten, liebte sie es, sich mit französischen Phrasen zu schmücken, um ihre Kultiviertheit und europäische Aufgeklärtheit zu unterstreichen, auch wenn dieselben Sätze, spräche man sie auf Russisch, eher die zuweilen außergewöhnliche Borniertheit meiner Tante zum Ausdruck gebracht hätten.
Maxima Feodora war meine Patentante und konnte äußerst ungehalten reagieren, wenn sie nicht zu den Ersten gehörte, die mit den Ergebnissen der Forschungsreise ihres Neffen vertraut gemacht wurden. Dabei interessierte sie sich grundsätzlich nicht für Einzelheiten, die ich bei den »Wilden« erlebt hatte, sondern es reichte ihr durchaus, wenn sie am Abend beim Empfang in höheren Kreisen über meine Rückkehr sagen konnte: »C’est complètement dingue!2«
Angesichts meiner finanziell nicht immer glücklich zu nennenden Lage war ich allerdings auf das Wohlwollen von Tante Maxima Feodora angewiesen, so dass ich alles daran setzen musste, sie stets bei bester Laune zu halten und jeden Affront mit ihr zu vermeiden.
»Mit Ihnen, liebe Tante, steht und fällt die Expedition zu den letzten freien Völkern unseres heiligen Russlands und damit auch die Möglichkeit, Erkenntnisse zu sammeln, die uns doch vielleicht allen eines Tages mehr als nützlich sein können«, schmeichelte ich ihr gerne.
Maxima Feodora war eine Schwester meiner Mutter. Als Tante hatte sie mich nach dem frühen Tod meiner schwindsüchtigen Eltern in ihr Haus aufgenommen und wenn schon nicht wie einen Sohn, so doch wie einen nahen Verwandten aufgezogen und behandelt.
Als freier Forscher, das sei am Rande angemerkt, der dennoch ungern auf die Unterstützung des Zarenhauses verzichtet – man hofft dort im Gegenzug immer, ich könnte auf einer meiner Reisen eine Goldmine oder sonst etwas Wertvolles entdecken – geht mir ein spezielles Forschungsgebiet ab. Ich versuche, stets offenzubleiben für das, was mich erwartet. So interessiere ich mich beispielsweise seit vielen Jahren für den Schamanismus in unserem Land, wovon ich aber selten und schon gar nicht in der Öffentlichkeit spreche, da das Praktizieren solcher Rituale als ganz und gar unchristlich gilt, ja sogar von manchen Teilen der Gesellschaft für teuflisches Hexenwerk gehalten wird. Stattdessen gebe ich mich außerhalb meines Freundeskreises lieber bescheiden und behaupte, dass mein Hauptaugenmerk auf den Märchen und Geschichten fremder Volksgruppen liege, also primär auf ihrer Mythologie und Weltanschauung, die der unsrigen oft gänzlich entgegengesetzt ist.
Doch ich will weiter erzählen: Von ganz anderem Kaliber als meine Tante waren an diesem Tag zwei weitere Gäste: Fjodor Romanowitsch Mendelejew und Pjotr Wladimirowitsch Schipulin, zwei meiner engsten Freunde, die ich noch aus der Schulzeit und meiner späteren kurzen militärischen Laufbahn kannte. Beide Freunde waren mir im Grunde herzlich zugetan und an allem interessiert, was ich auf meinen Reisen an Erkenntnissen gewann, hatten sich aber in den letzten Jahren nicht nur äußerlich, sondern auch von Seiten ihres Charakters her stark verändert. Fjodor Romanowitsch war Offizier in der kaiserlichen Armee geworden und litt seither, wie alle Militärs, an einer beschränkten Wahrnehmung der Wirklichkeit. Pjotr Wladimirowitsch hingegen sympathisierte mit Kreisen, die eine gesellschaftliche Umwälzung für dringend erforderlich hielten, wenn er auch konkret nie sagen konnte, wie diese Umwälzungen im Einzelnen aussehen sollten. Beide Freunde waren daher nur bis zu dem Zeitpunkt gemeinsam zu genießen, da die Konversation nicht auf militärische oder soziale Probleme übergriff.
Zu den beiden Freunden gesellten sich noch weitere Bekannte und Verwandte, auf die ich aus unterschiedlichsten Gründen nicht verzichten konnte, so beispielsweise ein Monokel tragender Oheim, der gern einen schwarzen Stock mit silbernem Schlangenkopf wie einen Taktstock vor sich her schwenkte, zwei Großtanten, Zwillingsschwestern übrigens, die von den Ohrringen bis zu den Schuhen stets identisch daherkamen und sogar an denselben Stellen meines Vortrags lächelten oder sich bei einem Schreck synchron die Hand vor den Mund hielten. Dazu kamen noch weitere Besucher, die ich hier nicht alle im einzelnen vorstellen möchte, außer vielleicht noch den Verwalter meiner Güter, einen kleinen gedrungenen Mann mit Adlernase und stechendem Blick, der zufällig gerade in Moskau weilte und mich wegen irgendwelcher Unregelmäßigkeiten dringend zu sprechen wünschte. Insgesamt gehören meinen Gütern keine dreihundert Seelen an, die längst aus der Leibeigenschaft entlassen sind und einen Großteil der Ernten für sich selbst erwirtschaften. Entsprechend gering sind meine Jahreseinkünfte, die zudem noch von einem durchtriebenen Gutsverwalter, der meine häufige Abwesenheit nutzt, um in die eigene Tasche zu wirtschaften, weiter geschmälert werden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die Besucher waren längst im Salon des Hauses eingetroffen, hatten eine Zeitlang die übliche leichte Konversation gepflegt, die unumgänglich zu sein scheint, und die nur manchmal von empörten Ausrufen Maxima Feodoras wie »Incroyablement!3« unterbrochen wurde, sich darüber hinaus an einigen aufgetragenen Speisen gütig getan und warteten darauf, dass man den Tee servierte, als ich mit einem kleinen Silberlöffelchen an mein Weinglas schlug.
»Meine lieben und getreuen Freunde«, sagte ich, stand auf und schob meinen Stuhl bis zur Rückenlehne unter den Tisch, um bei meiner Rede im engen Salon ungehindert auf und ab gehen zu können. »Mir scheint, dass es erst einige Tage her ist, als ich Ihnen an dieser Stelle von meiner Reise an die Grenzen des chinesischen Reichs berichtet habe«, sagte ich mit leise näselnder Stimme, die sich aber kurz darauf zu einem klaren Tenor wandelte. »Und doch, darauf machte mich gerade mein geliebtes Tantchen aufmerksam, liegt dieses unser Treffen schon drei Jahre zurück.«
»Le temps file à toute allure4«, wandte Maxima Feodora ein und bewegte dazu die behandschuhten Händchen auf und ab, als ob sie sich anschickte, ein kleines Ründchen um den Tisch fliegen zu wollen.
»Wie wahr, wie wahr«, sagte ich, obwohl ich den Einwurf meiner Tante in Wahrheit gar nicht verstanden hatte und in meinem Herzen ohnehin eine abgrundtiefe Abneigung gegen alles Französische hegte, das mir aufgesetzt und albern vorkam, ganz besonders, wenn meine russischen Landsleute es nachzuäffen versuchten.
»Diesmal nun trieb es mich an die nordwestliche Grenze unseres herrlichen Reichs«, berichtete ich und sah dabei für einen Moment zum Fenster hinaus, wobei ich bemerkte, dass die weiße Farbe des Fensterkreuzes an vielen Stellen abblätterte und somit dringend ein neuer Anstrich vonnöten war. Doch ich wusste, dass ich dafür zurzeit keinen Rubel erübrigen konnte.
»Mein Ziel war ein besonderes Volk der Samojeden«, sagte ich.
Im Salon brandete Gelächter auf. Die beiden alten Großtanten ließen synchron ihre schadhaften Zähne sehen und schlugen, ebenfalls synchron, ihre linke Hand vor den Mund.
»Oh, ich sehe schon, Sie alle sind Opfer unserer Volksetymologie und glauben, ich sei zu Menschen gereist, die sich selbst verzehren. Aber nein, so ist der Name keinesfalls zu deuten. Er geht vielmehr auf suomi, der Eigenbezeichnungen der Finnen und sami, der Bezeichnung der Samen zurück. Ich bin also keinesfalls zu Kannibalen gereist, wie man durch die Verballhornung ihres Namens in der russischen Sprache glauben könnte, sondern zu einem ehrenwerten Nomadenvolk, das mit seinen Rentieren wie mit gehörnten Familienangehörigen zusammenlebt. – So wie ja auch einige von uns«, fügte ich aus einer plötzlichen Eingebung scherzend hinzu und blickte dabei meinen Oheim an, der gerade noch am lautesten gelacht hatte, und dem jetzt vor Schreck das eingeklemmte Monokel vom Auge fiel. »Die Menschen dieses Volkes ziehen auf der Suche nach Weideland ihren Tieren mit Sack und Pack hinterher.«
»C’est fou, c’est fou5«, tremolierte meine Tante.
»Um es genauer zu sagen, ich war ich bei den Jurak-Samojeden. Das sind nicht nur Rentierhalter, sondern auch ausgezeichnete Jäger und Fischfänger«, setzte ich meinen Vortrag weiter fort, wobei ich gemächlich bis hinter den Stuhl meiner Tante schritt und mich dort an den kunstvoll geschnitzten Aufbauten der Rückenlehne festklammerte. Ich konnte meiner Tante auf den Kopf sehen, auf ihren weißen Hut mit den blauen Schleifen, die wie drei zusammengerollte Schlangen in einem Nest lagen.
»Doch bin ich ihnen nicht auf die schwer erreichbare westsibirische Jamal-Halbinsel gefolgt, um von ihnen Jagdtechniken zu erlernen«, sagte ich und lächelte überlegen, wobei ich den Blick nicht von den blauen Schlangen ließ, als ob sie jeden Moment in die Höhe schnellen und zubeißen könnten, »sondern um etwas mehr von einer ganz besonderen Form ihrer traditionellen Erzählweisen zu begreifen, nämlich von ihren Gigantenepen.«
Ich machte eine kleine Pause, um abzuwarten, bis das Wort »Gigantenepen« von allen am Tisch verstanden und in seiner ganzen Tragweite erkannt worden war. »La taille n’est pas tout6«, mahnte mein Tantchen und schwenkte dazu den Zeigefinger.
»In diesen Epen, so teilte mir der Begründer der Samojedologie, Matthias Alexander Castrén, mit – ich habe die Ehre, mit ihm in einem regen Briefverkehr zu stehen – wird von Kämpfen mit bösen Geistern und menschenfressenden Riesen berichtet, die manchmal von einem heroischen Helden besiegt werden. Doch es gibt auch Riesen, die – liebe Tante halten sie sich für einen Moment bitte die hübschen kleinen Öhrchen zu – die Frauen überfallen, vergewaltigen und töten. Und das alles, während die Männer auf der Jagd sind. Manchmal aber lassen diese fürchterlichen Ungeheuer die geschändeten Frauen am Leben und diese sollen dann übermenschliche Wesen gebären.«
»C’est tiré par les cheveux7«, sagte meine Tante energisch und wollte damit wohl keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie diesem Unsinn auch nur im Entferntesten Glauben schenkte.
»Als aufgeklärter Zeitgenosse mag man in der Tat diese Geschichten einfach nur primitiv und barbarisch und für den Ausdruck eines noch unzivilisierten Geistes halten, man kann sich aber auch die Frage stellen, warum es zu diesen Epen kam, welche Grundvoraussetzungen für ihr Entstehen vorhanden gewesen sein müssen. Ja, gab es vielleicht Vorkommnisse in der Geschichte dieses Volkes, die ein Glauben an Riesen geradezu zwingend notwendig machten? Oder gar: Gibt es diese Voraussetzungen vielleicht noch immer? Denn warum sonst sollte nach wie vor mit solcher Hingabe am abendlichen Feuer von den Riesen erzählt werden, wenn doch niemand mehr diesen Ammenmärchen aus alter Zeit Glauben schenken mag?
Wie Sie alle wissen, bin ich ein Freund der wissenschaftlichen Deduktion. Meines Dafürhaltens hat alles seinen Grund, den aufzudecken und erkennbar zu machen das höchste Ziel von Wissenschaft und Forschung sein muss. Wie leicht ist es, von oberster Stelle aus Dinge mit einem Handstreich für erledigt zu erklären und sie auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern? Aber wie schnell haben wir damit etwas weggeworfen, was doch von seinem einstigen Besitzer nach wie vor für brauchbar erachtet wird, so dass er es sich in einem unbeobachteten Augenblick aus dem Dreck zurückholt und wieder an die alte Stelle setzt. Nein, meine Lieben, Aufklärung heißt auch, eine Erklärung für etwas bislang Unerklärliches zu finden, die von jedermann, insofern er über einigermaßen Verstand verfügt, eingesehen werden kann, so dass die Menschen es schließlich selber sind, die ihre überkommenen Vorstellungen kraft eigenen Nachdenkens für überflüssig halten und sich ihrer entledigen.
Aber genug! Es hat mich viele Tage geduldigen Zuhörens und noch geduldigeren Nachfragens gekostet, bis ich das Vertrauen dieser Menschen gewann und sie mir – freilich hinter vorgehaltener Hand und nicht im Beisein der Stammesältesten – verrieten, dass es die von Riesen gezeugten übermenschlichen Wesen noch immer gibt. Sancta simplicitas! oder besser Sainte simplicité wird Tantchen ausrufen wollen, in welcher geistigen Umnachtung lebt mancher Zeitgenosse doch noch immer inmitten unseres aufgeklärten russischen Vaterlands. Doch warten Sie ab, was ich weiter zu erzählen habe.«
Ich machte eine einstudierte Pause, beugte mich über den Tisch, ergriff mein Weinglas, nippte einmal daran, räusperte mich sodann ein wenig aufgesetzt und fuhr in meiner Rede ohne weitere Unterbrechung fort.
1 Wo ist mein schreckliches Kind?
2 Das ist total verrückt!
3 Unglaublich!
4 Die Zeit vergeht wie im Fluge
5 Das ist verrückt, das ist verrückt.
6 Größe ist nicht alles.
7 Das ist an den Haaren herbeigezogen.
10
Anna nimmt einen Schluck Kaffee und bemerkt, dass dieser inzwischen kalt geworden ist. Ein Blick auf die Uhr lässt sie erschrecken. »Meine Güte, es ist schon später Nachmittag. Du hättest mich ruhig unterbrechen dürfen.«
»Aber warum denn«, sagt Manu, die das letzte Blatt behutsam auf den Stapel zu den anderen legt, »es ist doch höchst interessant, wenn man sich einmal an die altmodische Sprache gewöhnt hat. Also dieses Tantchen mit seinen überflüssigen Einwürfen … aber was zum Teufel sind Gojin? Soll ich das Wort mal im Internet nachschauen?«
»Habe ich schon gemacht«, sagt Anna. »Es kommen nur ein paar alberne japanische Bildchen dabei heraus. Und ein Wörterbuch behauptet, dass Gojin japanisch sei und soviel wie wir bedeutet.«
»Das kann es nicht sein«, sagt Manu.
»Ich glaube, ich habe den Text etwas zu leger und modern übersetzt«, übt sich Anna in Selbstkritik. »Im Russischen ist einiges weitaus kunstvoller formuliert, aber das kann ich nicht so rasch übersetzen.«
»Für mich ist es kunstvoll genug. Kannst du bitte weiterlesen?«
»Ich brauche eine Pause«, sagt Anna, »ich muss noch einiges für die Uni erledigen, und du solltest besser noch deine Unterlagen fürs Arbeitsamt ausfüllen, sonst bekommst du am Ende kein Geld.«
»Ja, wahrscheinlich wäre das besser. Ich geh dann mal nach nebenan. Du weißt ja, wo du mich findest. Und danke für den Kaffee und das Gespräch.«
Manu gibt Anna die Hand, drückt sich übertrieben langsam an der Garderobe vorbei zur Wohnungstür, öffnet diese und verschwindet.
Anna bringt die Tassen in die Spüle, heftet die Kopien wieder zusammen, setzt sich ans Telefon und wählt eine lange Nummer. Am anderen Ende nimmt Maria Melnikowa den Hörer ab, die Sprechstundenhilfe, Zahnarzthelferin und Haushälterin von Annas Vater. Anna erkundigt sich, ob es schon etwas Neues gibt.
»Gar nichts, rein gar nichts«, klagt Maria Melnikowa, »Pawlow Iwanowitsch ist wie vom Erdboden verschluckt. Man möchte ihn für diese Frechheit beschimpfen, aber er entzieht sich ja leider einer Ansprache durch Abwesenheit. Eine Dreistigkeit. Alle zehn Minuten laufe ich ans Fenster, schaue auf die Straße, aber nichts. Und dann kommen die Patienten und stehen vor der verschlossenen Tür. Das geht doch nicht. Kleinere Sachen kann ich ja rasch selber erledigen, da öffne ich dann heimlich und lasse die Leute hinein. Ein wenig Prophylaxe, hier und da ein kleines Löchelchen, ist ja nicht der Rede wert, aber Zähne kann ich keine ziehen ohne Pawlow Iwanowitsch, und gar Zahnersatz anfertigen, bitte, das geht zu weit. Nun gut, das Röntgengerät wird ohnehin nur von mir bedient, da hat Pawlow Iwanowitsch rein gar nichts dran verloren, er bringt nur alles durcheinander, und die ein oder andere Diagnose habe ich schon fertig, bevor er die Bilder in seinen Beleuchter eingespannt hat, aber dennoch, das geht doch nicht, ich meine auf Dauer ist das doch kein Zustand. Ich bin nur Zahnarzthelferin, ich habe gar nicht das Recht … Ich meine, wenn etwas passiert … Na gut, man darf sich auch nicht verrückt machen lassen. Zahnärzte sind ja eigentlich nur Handwerker, ein Handwerk lässt sich erlernen, rein durch Beobachtung eines Ausübenden und dann natürlich durch die praktische Erfahrung. Ein Studium, ach nun ja. Der eine lernt es so, der andere so. Und dennoch. Wenn mal was schiefläuft, dann haben sie den Schuldigen schnell gefunden. Aber das ist ja wieder typisch, lässt alles stehen und liegen und verlässt sich darauf, dass Maria Melnikowa den Laden schon am Laufen hält. Die weiß doch, wie es geht, der hab ich doch alles beigebracht. Und für eine