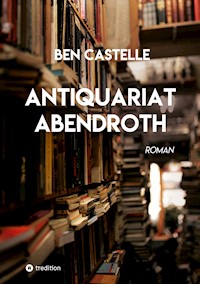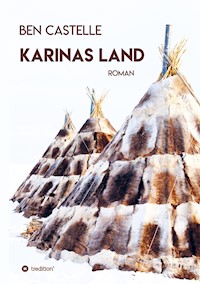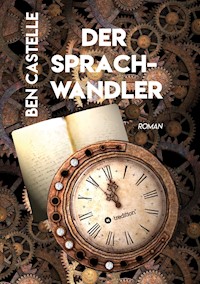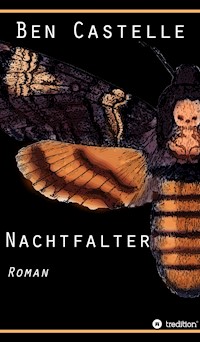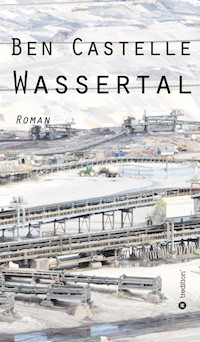9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Florian Fechtner ist ein junger Rockmusiker, der kurz vor dem Abitur steht und in die junge Violinistin Sophie verliebt ist. Die jedoch will von ihm und seiner Musik nichts wissen. Als neben dem Proberaum seiner Band eine suspendierte Hochschulprofessorin und Expertin für Quantenphysik einzieht, ändert sich Florians Leben schlagartig. Durch ein Versehen gerät er mit in die Raummaschine der Professorin, eine Erfindung zum Nachweis ihrer Theorie der "inkorporierenden Räume", und wird mit ihr zusammen in einen neuen Realitätsraum transponiert. Hier ist Florian ein berühmter Rockstar und Sophie ist seine Freundin. Aber das Glück währt nicht lang. Um ihn herum zieht ein Überwachungsstaat seine Netze, und die Professorin wird als Staatsfeind verhaftet. Nach einer gelungenen Flucht transponiert die Raummaschine die beiden jedoch nicht zurück in ihre alte Realität, sondern vielmehr auf die nächste Raumebene, in der die Regierung mit ihrem Projekt "Romantik 2.0" alle Problembereiche im Staat unter gigantischen Holografien verbirgt und an einem Verfahren arbeitet, den Menschen eine totale Existenzsimulation anzubieten. Dazu jedoch benötigt man die Raummaschine. Erneut bleibt den beiden nur die Flucht, auf der ihnen langsam klar wird, dass sie die Bedeutung der Sprache für die Wirklichkeit unterschätzt haben. Ihnen bleibt nur noch eine Chance, dem Zerfall der Wirklichkeit zu entfliehen: Sie müssen ihre Geschichte erzählen. »Eine verrückte Mischung aus Jugendroman, Science-Fiction, Physik, Sprachphilosophie und satirischer Dystopie, die zuweilen beängstigend nah an einigen Entwicklungen der Gegenwart dran ist und in der nicht zuletzt die einzigartige Bedeutung der Sprache für die Konstitution von Wirklichkeit thematisiert wird.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ben Castelle
Florian
und
Die Raummaschine
Roman
Über dieses Buch:
Florian Fechtner ist ein junger Rockmusiker, der kurz vor dem Abitur steht und in die junge Violinistin Sophie verliebt ist. Die jedoch will von ihm und seiner Musik nichts wissen. Als neben dem Proberaum seiner Band eine suspendierte Hochschulprofessorin und Expertin für Quantenphysik einzieht, ändert sich Florians Leben schlagartig. Durch ein Versehen gerät er mit in die Raummaschine der Professorin, eine Erfindung zum Nachweis ihrer Theorie der „inkorporierenden Räume“, und wird mit ihr zusammen in einen neuen Realitätsraum transponiert. Hier ist Florian ein berühmter Rockstar und Sophie ist seine Freundin. Aber das Glück währt nicht lang. Um ihn herum zieht ein Überwachungsstaat seine Netze, und die Professorin wird als Staatsfeind verhaftet. Nach einer gelungenen Flucht transponiert die Raummaschine die beiden jedoch nicht zurück in ihre alte Realität, sondern vielmehr auf die nächste Raumebene, in der die Regierung mit ihrem Projekt „Romantik 2.0“ alle Problembereiche im Staat unter gigantischen Holografien verbirgt und an einem Verfahren arbeitet, den Menschen eine totale Existenzsimulation anzubieten. Dazu jedoch benötigt man die Raummaschine. Erneut bleibt den beiden nur die Flucht, auf der ihnen langsam klar wird, dass sie die Bedeutung der Sprache für die Wirklichkeit unterschätzt haben. Ihnen bleibt nur noch eine Chance, dem Zerfall der Wirklichkeit zu entfliehen: Sie müssen ihre Geschichte erzählen.
»Eine verrückte Mischung aus Jugendroman, Science-Fiction, Physik, Sprachphilosophie und satirischer Dystopie, die zuweilen beängstigend nah an einigen Entwicklungen der Gegenwart dran ist und in der nicht zuletzt die einzigartige Bedeutung der Sprache für die Konstitution von Wirklichkeit thematisiert wird.«
Impressum
© 2023 Ben Castelle
Umschlag, Illustration unter Verwendung einer Grafik von Camille Kuo unter der Lizenz von iStock.com, einem Bild von Pexels/Pixabay und einem Bild von Cottonbro-Studio/Pexels
ISBN
978-3-347-93740-6
(Softcover)
978-3-347-93741-3
(Hardcover)
978-3-347-93742-0
(E-Book)
Druck und Distribution im Auftrag:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Für Anna und Martina
Ohne Sprache gäbe es alles und weiter nichts
(Elazar Benyöetz)
Die Sprache ist die einzige Chimäre, deren Trugkraft ohne Ende ist.
(Karl Kraus)
Fortschritt misst sich nicht an der Industrie, sondern am Wert, dem man einem Leben beimisst.
Einem unwichtigen Leben. (…)
Das definiert ein Zeitalter. Das definiert eine Spezies.
(Der zwölfte Doktor)
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
EINS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
ZWEI
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
DREI
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Nachwort der Herausgeberin
Florian und die Raummaschine
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Kapitel 1
Florian und die Raummaschine
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
EINS
ICH SAGE ES LIEBER GLEICH zu Beginn: Ich bin für diesen Bericht nicht sehr geeignet, leider jedoch der einzige Mensch auf der Welt, der ihn erstellen kann. Mein Name ist Florian Fechtner, ich bin siebzehn Jahre alt, stehe zwar kurz vor dem Abitur, verfüge aber weder über die nötigen sprachlichen Ausdrucksformen, noch über die wissenschaftliche Expertise, die man wohl benötigte, um diese Geschichte in ihrer ganzen Tragweite zu erzählen. Aber leider gibt es, wie gesagt, außer mir niemanden, der sonst noch von den Geschehnissen berichten könnte. Außer natürlich Professor Leonard, genauer Professorin Leonard. Aber die muss die Geschichte auf ihre Weise erzählen. So haben wir es abgemacht. Weil dies die einzige Chance für uns ist, in gewisser Weise am Leben zu bleiben. Aber darüber zu reden, ist an dieser Stelle noch zu früh, viel zu früh.
Wenn ich still für mich rekapituliere, was alles Berichtenswertes geschehen ist, beschleicht mich immer sogleich die Sorge, dass man mir eventuell nichts davon auch nur ansatzweise glauben wird. Dennoch muss ich es zu Papier bringen. Ja, ihr hört richtig: zu Papier. Mit dem Laptop würde es nicht funktionieren, behauptet die Professorin. Dort, wo ich mich jetzt befinde, gibt es allerdings auch gar keinen Laptop, so dass diese Möglichkeit ohnehin nicht in Frage käme. Das Risiko, dass mein Bericht als nicht glaubwürdig eingestuft wird, muss ich eingehen. Eigentlich macht es mir nicht einmal mehr etwas aus. Ich weiß, was ich erlebt habe. Wer es bezweifelt, der kann mir gestohlen bleiben.
Bevor ich jetzt aber alles durcheinanderbringe und kreuz und quer erzähle, was mir meine Lehrer schon seit der Grundschule übelnehmen, und am Ende gar noch mit irgendwelchen philosophischen Exkursionen jedermann auf die Nerven falle, will ich mich lieber zwingen, der Reihe nach zu berichten, auch wenn dies, wie mein Deutschlehrer Herr Mickel meint, aus einer literaturgeschichtlichen Perspektive heraus betrachtet sehr altmodisch wirkt. Aber mit Literatur hat das alles hier rein gar nichts zu tun, oder sagen wir besser, es hat doch damit zu tun, aber auf eine Art und Weise, die man sich schwer vorstellen kann. Also mögen die Lesenden (ich sage hier ganz bewusst Lesende, weil ich diejenigen ansprechen möchte, die jetzt gerade diese Zeilen lesen und nicht etwa, weil ich versuche, Pluspunkte bei irgendwelchen genderberauschten Zeitgenossen zu erheischen), mögen die Lesenden mich also nicht bezüglich meiner nicht vorhandenen stilistischen Künste beurteilen. Puh! Und damit genug der Captatio Benevolentiae, oder wie immer der Lateiner dieses Werben um die Gunst des Publikums bezeichnet, und medias in res hinein ins Geschehen.
Ich bin Keyboarder in der Band Hugs or Bugs. Ich weiß, das klingt eigentlich mehr nach einem Hackerkollektiv, und für ein solches war der Name auch ursprünglich gedacht, aber da meine Mitstreiter Philipp, Tom und der schöne Gilbert über noch weniger Computerkenntnisse verfügten als ich, hatten wir schon nach drei Sitzungen aufgegeben, uns ins Pentagon einschleusen zu wollen, um in den Privatmails des Präsidenten herumzustöbern, und wieder das gemacht, von dem wir glaubten, das wir es am besten könnten: Rock ’n’ Roll.
Der Name Hugs or Bugs ist dann irgendwie geblieben. Denn jeder, der mal einen Namen für eine Band gesucht hat, weiß, dass so eine Namenssuche die größte hirnzerfressende Gedankengymnastik ist, die man in diesem Leben betreiben kann. Der zerebrale Muskelkater ist höllisch, denn die anvisierten Namen weiten ihre Vieldeutigkeit, je näher man sie betrachtet, immer mehr ins Unendliche oder ins Banale aus. Ganz zu schweigen davon, dass man musikalisch tagelang nichts mehr auf die Reihe bekommt und sich irgendwann fragt, wofür man also noch einen Namen benötigt. Es ist halt ein Riesenfehler, dass man unbedingt etwas Bedeutendes oder Tiefsinniges mit dem Bandnamen ausdrücken möchte. Denn ist man erst einmal berühmt, interessiert sich kein Mensch mehr für das, was der Name bedeutet. Man erinnere sich an eine solche Megaband wie Pink Floyd, da denkt doch auch niemand mehr daran, dass Syd Barrett, der erste Sänger und Gitarrist der Band, die beiden Vornamen seiner Lieblingsbluesmusiker Pink Anderson und Floyd Council im Bandnamen verewigt hat. Und bei den Rolling Stones imaginiert man auch keine zu Tale donnernden Steine, sondern eher ein paar verlebte Faltengesichter mit gefärbten Haaren. Aber gut, ich hatte versprochen, keine Abschweifungen zu unternehmen. Also weiter mit meiner Geschichte.
Die Band Hugs or Bugs hatte sich seit einem Jahr einen Proberaum in der alten Ziegelfabrik gemietet, wo an jedem Freitagabend die musikalische Revolution der Neuzeit vorbereitet wurde. Wir waren keine von diesen Coverbands, die versuchen, so zu klingen wie ihre verehrten Vorbilder, sondern bei uns war alles original. Ich meine, wir klangen einzig und allein wie Hugs or Bugs. Den Musikern, die uns später einmal, wenn wir schon längst selbstzufrieden in der Hall of Fame in unseren Schaukelstühlen wippen und Cocktails schlürfen, covern wollen, sei schon jetzt gesagt, dass sie besser die Finger davon lassen. Denn ab und an gelingt es uns selbst nicht, so zu klingen, wie wir normalerweise klingen. Offensichtlich sind wir, wenn wir in Höchstform sind, so gut, dass wir an normalen Tagen selbst nicht an uns heranreichen.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle ein paar Sätze zu der alten Ziegelei sagen. Ja? Macht man das so? Oder muss ich hier bereits etwas über mein Äußeres zum Besten geben? Ach was, ich erzähle zunächst etwas über die Fabrik. Früher arbeiteten dort Hunderte von Menschen. In riesigen Öfen wurden hier Ziegel aus Ton gebrannt, weshalb die Fabrik im Volksmund auch Tonfabrik genannt wurde, was uns, wer den kleinen Witz versteht, als Rockband geradezu prädestinierte, hier unsere Proben abzuhalten. Vier große, aus roten Ziegeln gebaute Schornsteine kündeten noch aus alter Zeit und hatten schon seit über fünfzig Jahren nicht mehr gequalmt, wenn man mal von dem Abend absieht, als unser Schlagzeuger Tom nach zu viel Bier seine nicht abgesendeten Liebesbriefe an unsere Referendarin Frau Schneider darin verbrannte, indem er sie einfach anzündete, die Briefe meine ich, und in ein Loch des Kamins steckte, dort, wo ein paar Steine fehlten. Wenig später gerieten daraufhin ein paar alte Polstermöbel in Brand, die eine Etage tiefer von einem der dort hausenden Künstler im saalgroßen Brennofen entsorgt worden waren. Glücklicherweise war der Brand so stark, dass beim Eintreffen der Feuerwehr kein einziger Liebesbrief mehr in einem lesbaren Zustand überlebt und Toms größte Sorge sich damit in Rauch und Wohlgefallen aufgelöst hatte.
Jeden Freitag also traf man uns in der alten Tonfabrik an. Ich war meistens der Erste, weil ich im Besitz des Schlüssels war. Dann kam Tom, der Schlagzeuger, weil er immer solange fürs Aufbauen seines Sets benötigte, später Philipp, der Gitarrist, und ganz zum Schluss, wenn wir schon nicht mehr damit rechneten, kam der schöne Gilbert, der von uns auch gern, übrigens zu Unrecht, bei seinem ornithologischen Namen genannt wurde: Basstölpel.
Wir spielten immer dasselbe Programm. Erst sämtliche alten Stücke, die uns wenig Mühe machten, und dann die neuen, an denen wir uns solange abmühten, bis auch sie zum Kernbestand gehörten. Einige Meisterwerke schafften diese Metamorphose leider nie und blieben auf ewig unvollendet. Unsere Musik war simpel, aber druckvoll, um nicht zu sagen eindrucksvoll. Wir legten auf einen tanzbaren Groove wert, über dem Philipp meist seine begnadeten Girtarrensoli tanzen ließ. Es gab aber auch ein paar melancholische Stücke aus meiner Feder, bei denen das Keyboard dominierte, Stücke, zu denen ich auch Texte geschrieben hatte, die sich aber, mich eingeschlossen, keiner zu singen traute.
Tom, unser etwas übergewichtiger Schlagzeuger, und der schöne Gilbert am Bass waren wie ein präzises quarzgesteuertes Uhrwerk. Sie waren das rhythmische Herz der Band und machten kaum Fehler. Wenn Fehler geschahen, dann waren es fast immer Philipp oder ich, die sich im Eifer des Spiels verhaspelten und dann stets einen strengen Blick von den beiden Unfehlbaren einstecken mussten.
So ging es ein ganzes Jahr. Außer uns beanspruchte keine andere Band die Räumlichkeiten in der alten Ziegelei. Es gab, wie gesagt, nur ein paar Künstler, die hier ihr Atelier hatten, die man aber fast nie zu Gesicht bekam, weil sie entweder erst weit nach Mitternacht arbeiteten, wenn wir schon wieder fort waren, oder grundsätzlich niemals am Freitagabend von der Muse geküsst wurden. Wir konnten also so laut sein, wie wir wollten. Hier draußen störte das niemanden.
Ein paar Mal sind wir, zugegeben, in der alten Fabrik rein aus Spaß auf Entdeckertour gegangen. Es gab gespenstische, mit großen verstaubten Spinnennetzen verhängte Ecken, in die man sich nicht hineintraute. Die alten Ofenräume waren mit schweren, mehrfach verriegelten Eisentüren verschlossen, ließen sich aber mit etwas Gewaltanwendung öffnen. Allerdings fand man dahinter nur Sperrmüll, den man im Laufe der Jahrzehnte entsorgt hatte. Einmal entdeckten wir jedoch ein riesengroßes Acrylgemälde, das einer der Künstler dort abgestellt hatte, weil es offensichtlich misslungen war, es war nämlich nur zur Hälfte ausgeführt und zeigte eine nackte Frau mit drei Brüsten, die irgendeinem grünen Tümpel entstieg und Seerosentang in den Haaren kleben hatte. Wir schleppten die genmanipulierte Undine in unseren Proberaum, wo sie hinter Toms Schlagzeug einen durchaus schrägen Eindruck machte. Doch irgendwann kam mein Vater, der mich mit dem schweren Keyboard freitags immer mit seinem Wagen zur Tonfabrik kutschierte und wieder abholte, auf die Idee, sich unseren Proberaum einmal aus der Nähe anzusehen. Na ja, die Conclusio: Er bestand darauf, dass wir das Bild wieder dahin bringen sollten, wo wir es hergeholt hatten. Nicht etwa, weil er etwas gegen drei Möpse einzuwenden hatte, sondern weil er vermutete, das Werk könne sich am Ende als kostbar herausstellen und wir wegen Kunstraubs angezeigt werden. In Sachen Kunst war mein Vater noch nie sehr helle. Er war halt nur ein einfacher Postbeamter.
An manchen Stellen der alten Fabrik lag noch zentimeterdick der Tonstaub aus einem anderen Jahrhundert. Manchmal hörte man seltsame Kratzgeräusche. Wir nahmen an, es seien Ratten. Hier und da standen sogar noch Türme mit gestapelten Ziegelsteinen, so wie man sie vor über fünfzig Jahren aus dem Ofen gezogen und dort stehen gelassen hatte, und zwar an dem Tag, da die Fabrik für immer schloss. Jetzt war selbst schon die Zeit dieser Ziegel abgelaufen, und sie begannen bereits zu zerbröseln. Wir stießen auch auf eine Vielzahl von gebrannten Tonröhren, mit denen sich die Fabrik bis Mitte des 20. Jahrhunderts in ganz Europa einen Namen gemacht hatte. Dann wurden die Abwasserrohre in den Häusern aus günstigerem PVC hergestellt und mit der Tonfabrik ging es rapide bergab.
Manchmal hatte man das Gefühl, die Arbeiter könnten jeden Moment an ihre Wirkstätte zurückkehren und ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Je weniger Licht es gab, desto mehr Streiche spielte uns unsere Phantasie. Wenn Tom noch dazu unterzuckert war, dann sah er schon mal riesige Echsen, die mit blitzenden Augen in den Ecken hockten, oder saurierartige Vögel, die wie Fledermäuse in sich selbst eingepackt von der Decke hingen, und er hörte Geflüster und Gewimmer, das er so genau zu imitieren wusste, dass einem, zugegeben, der kalte Schauer über den Rücken lief.
Zu dieser Zeit wusste noch niemand, außer unseren Eltern, dass es die Band namens Hugs or Bugs überhaupt gab. Das sollte sich jedoch, so hatten wir beschlossen, schlagartig ändern. Für das nächste Schulfest planten wir unser musikalisches Comingout. Unser Konzert sollte am vorgerückten Abend eine furiose Überraschung werden und unseren Mitschülern und vor allem unseren Mitschülerinnen klar machen, dass sie uns völlig unterschätzt hatten. Wir redeten permanent von diesem Konzert und malten uns bis ins kleinste Detail aus, was an diesem Abend alles geschehen könnte. – Ich sollte das vielleicht besser nicht erzählen, es klingt reichlich kindisch, aber so war es nun einmal, und es ist wichtig zu wissen, in welcher gewissermaßen präadoleszenten Gemütsphase – so nennt man das doch wohl? – ich mich befand, als die Professorin eines Tages auftauchte.
An einem der Freitagabende, wir machten gerade eine kleine Pause, rumpelten gleich drei große Lieferwagen auf den gepflasterten Hof der alten Ziegelei. Mehrere polnisch sprechende Männer sprangen aus den Fahrzeugen und schleppten kurz darauf allerhand wissenschaftliches Gerät an unserem Proberaum vorbei in die hinterste Ecke der Tonfabrik, und zwar in einen riesigen Raum, der direkt neben den ehemaligen Brennöfen lag und der, so verriet uns der Hausmeister, nachdem wir ihm ein Bier spendiert hatten, früher einmal der Auskühlraum der Fabrik gewesen war. Ein paar Stunden lang herrschte reger Betrieb, und wir hörten, wie die Männer, die schwere Kisten voller Elektronik schleppten, laut fluchten. »Kurwa mać!« riefen sie immer wieder, und es war aufgrund der Betonung nicht schwer zu erkennen, dass dies so viel heißen musste wie »Verfluchte Scheiße«. Wir versuchten, unser Programm durchzuspielen, aber immer wieder klopfte jemand an die Tür und bat um einen Schraubenzieher, eine Zange oder einfach nur um Klebeband. Mit Klebeband konnten wir selbstverständlich dienen, denn mal ehrlich, was wäre ein Musiker ohne Gaffer Tape?
Dann plötzlich waren die drei Lieferwagen wieder weg, und es tat sich einige Wochen lang gar nichts. Einmal nach der Probe warfen wir einen Blick in den hinteren Teil der Fabrik. Der Auskühlraum war abgesperrt, doch an der Tür prangte ein Schild mit der Aufschrift: Institut für angewandte Quantenphysik. Prof. Dr. Helena Leonard.
Von heute aus betrachtet war das der Tag, an dem die Katastrophe ihren Lauf nahm, auch wenn zunächst nichts darauf hindeutete. Aber so ist es ja immer mit Katastrophen, sie beginnen, still und leise ihre Löcher in die Zeit zu fressen, so wie die Holzwürmer Löcher in die Dachbalken bohren, und in dem Moment, da man sie bemerkt, ist es bereits zu spät, um sie noch aufzuhalten, und das, was man für sicher hielt, bricht krachend über einem zusammen.
Na, der Satz ist mir doch jetzt mal gelungen, oder? Da hätte selbst mein Deutschlehrer nicht meckern können. Aber der hat mir in der letzten Klausur ein mangelhaft attestiert, weil ich nicht wusste und bis heute nicht weiß, was Romantische Ironie sein soll. Ich kann mich nicht erinnern, dass er uns das jemals erklärt hätte, aber in der Deutschklausur wollte er es plötzlich wissen. Und das Dumme: Ich war so ziemlich – nein, ich war der Einzige, der es nicht wusste. Aber egal.
Es dauerte ziemlich lange, bis wir unsere neue Nachbarin mal zu Gesicht bekamen. Zunächst nahmen wir sie nur als akustisches Phänomen wahr. Wir hatten eine alte Verstärkeranlage von Glockenklang, ein echtes Schätzchen, unverwüstlich und klar im Sound. Doch eines Abends brummte das gute Stück, nicht sehr laut zwar, aber bei den wenigen leisen Passagen unserer Songs war das Brummgeräusch doch gut zu vernehmen. Nun bin ich extrem empfindlich bei zwei Dingen im Leben, zum einen ertrage ich es nicht, wenn irgendetwas komisch riecht, und zum anderen nicht, wenn ein Brummton brummt, wo er nicht hingehört. Beides verschafft mit gleichermaßen Ekelgefühle.
Ich brach also mitten im Stück ab und sagte: »Leute, hört ihr das nicht, da brummt was in den Boxen. Ist ja nicht zum Aushalten.«
Tom verzog das Gesicht und legte seinen Kopf schräg wie der Pudel von unserem Nachbarn, wenn man ihn freundlich anspricht. »Stimmt«, sagte er, »eindeutige Brummgeräusche.«
Der schöne Gilbert stellte seinen Bass beiseite und legte ein Ohr auf eine der Boxen, als ob er feststellen wollte, ob ein Zug zu erwarten wäre. »Hier brummt rein gar nix!« stellte er im Anwaltston fest und fühlte sich wohl insgeheim in seiner stets kundgetanen Äußerung bestätigt, dass Glockenklang das Beste sei, was man sich als E-Bassist wünschen könne. »Das Geräusch kommt woanders her.«
Schließlich legten auch Philipp und ich unsere Ohren an die Boxen und konnten Gilberts fachkundige Analyse nur bestätigen. »Da brummt wirklich nichts«, sagten wir wie aus einem Munde, »alles sauber.« Währenddessen hatte Tom den Ursprung des Brummtons als außerhalb von unserem Proberaum liegend lokalisiert. Er öffnete die Tür zum Flur und sagte: »Ich glaube, das Gebrumm kommt aus dem Abkühlraum, vielleicht hat Frau Professorin ihren Kühlschrank in Betrieb genommen.«
Wir machten uns auf den Weg zu der mit »Institut« gekennzeichneten Tür. In der Tat brummte es hinter dieser Tür ganz außerordentlich. Philipp klopfte und rief: »Hallo, alles in Ordnung bei Ihnen?« Aber niemand gab eine Antwort. Wahrscheinlich konnte man drinnen auch gar nicht hören, dass draußen geklopft und gesprochen wurde, so laut brummte es dort. Also versuchte Philipp mutig, die Tür zu öffnen. Aber die Tür war abgesperrt. Wir klopften daraufhin noch ein paar Mal und riefen, aber nichts tat sich. Also zogen wir unverrichteter Dinge wieder ab.
»Und wenn da jetzt was passiert ist?« fragte Philipp und konnte sich von da an nicht mehr auf seine Gitarrensoli konzentrieren. Wir brachen die Probe also ab, drucksten ein wenig herum, dann griff ich zum Smartphone und rief den Hausmeister an. Der beruhigte uns, es sei alles in bester Ordnung. Das gehe schon die ganze Woche so. Die Frau Professorin kalibriere da irgendetwas und wünsche keinerlei Störung. Ich merkte an, dass wir eigentlich auch keinerlei Störung wünschten, aber da hatte der Hausmeister bereits wieder aufgelegt.
Irgendwann hörte das Gebrumm wieder auf. Zu der Zeit hatten wir jedoch schon zu viel Bier getrunken, um uns noch auf unsere Musik konzentrieren zu können. Stattdessen alberten wir herum und versuchten, Kronkorken in einen fünf Meter entfernten Eimer flitschen zu lassen. Tom war darin ein wahrer Meister. Offensichtlich hatte er als Schlagzeuger das beste Gespür für Entfernungen, da er ja stets seine Becken und Trommeln treffen musste. Als er fünf Kronenkorken nacheinander im Eimer versenkt hatte – Proberaumrekord! – , flog plötzlich die Tür auf und eine sehr sportliche Frau Anfang vierzig sprang gelenkig wie eine Katze zu uns herein. Sie trug eine schwarze Buggyhose, aus deren Seitentaschen ein ganzes Arsenal von Schraubenziehern, Zangen, Messern und digitalen Messgeräten herausschaute. Dazu steckte sie in einem ebenso schwarzen T-Shirt, auf dem weiße Strichmännlein mit den Armen mathematische Kurven zeigten. Bei y=x2 beispielsweise reckte das Männlein beide Arme in die Luft wie bei einem Rockkonzert, bei a2=x2+y2 beschrieb es mit den Armen einen Kreis.
»Hallo Männer«, sagte die Frau und warf ihren Pferdeschwanz, der ihr vor der Brust baumelte, mit Schwung zurück über die rechte Schulter, »hat jemand von euch mal ein Stimmgerät? Ich stecke mitten in der Kalibrierung eines Energieableiters und komme einfach nicht weiter.«
Philipp war so baff, dass er das kleine digitale Stimmgerät, das am Hals seiner Gitarre steckte, wie hypnotisiert abzog und es der Frau reichte. »Wiedersehen macht Freude«, sagte er, und die Frau sagte nur: »Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder«, nahm das Gerät und verschwand so schnell, wie sie gekommen war.
»War das die … die …?« stotterte Tom und legte den Kopf erneut schräg.
»Völlig durchgeknallt«, bemerkte der schöne Gilbert.
»Das wäre mal ne Frontfrau für unsere Band« sagte ich, und die anderen sahen mich entgeistert an.
»Gib ihr doch mal einen deiner Texte!« forderte Philipp mich auf, »vielleicht ist sie ja ein echtes Gesangstalent.«
»Eines ist klar«, scherzte Tom, »sie ist auf jeden Fall ein echter Brummer.«
ICH HOFFE NUR, DASS DER Junge ahnt, dass er schreiben muss, dass er alles aufschreiben muss, mit seinen eigenen Worten. Ansonsten weiß ich nicht, wie es mit uns weitergehen soll. Das trifft auch auf mich zu. Ich muss ebenfalls alles aufschreiben, aus meiner Perspektive, in meinen Worten. Und ich bin verdammt schlecht in diesen Dingen. Wenn ich das Problem mathematisch angehen könnte, wenn ich dafür nur eine Gleichung, egal wie komplex sie auch wäre, zu lösen hätte, aber so? Ich muss mich also zusammenreißen, muss mich konzentrieren. Und wo, bitteschön, fange ich an? Mit dem Moment, da ich Florian das erste Mal sah? Nein, das ist viel zu spät. Ich muss früher beginnen. Denn eigentlich fing es damit an, dass ich vom Dienst suspendiert wurde und mir der Dekan und der Verwaltungsrat untersagten, noch weiterhin Vorlesungen und Seminare für meine Studenten zu halten.
Das Ganze war eine Farce und hatte einzig und allein einen politischen Hintergrund. Ich hatte es einmal mehr gewagt, öffentlich darzulegen, dass das, was eine Ministerin neuerdings als Wissenschaft ausgab, um damit ihre krude Politik einer zunehmenden Überwachung der Bürger zu rechtfertigen, mit Wissenschaft rein gar nichts zu tun hatte, sondern weit mehr mit kirchlichen Dogmen aus dem Mittelalter. Das nahm sie mir übel. Sehr übel sogar. Und weil sie wusste, dass sie mir auf dem Gebiet der Wissenschaft nicht das Wasser reichen konnte, schüttete sie es der Einfachheit halber einfach über mich aus, einen ganzen Kübel voll, eine schöne braune Dreckbrühe. Sie hatte ein paar halbseidene Wissenschaftler gefunden, die sich dazu hergaben, meiner Inkorporationstheorie rechtsaffines Gedankengut zu unterstellen, da man sie interpretierte als eine Einverleibung und Überwältigung von allem, was anders und gewissermaßen kleiner sei als man selbst. Und die Frau Ministerin wurde nicht müde, diese von ihr persönlich angestifteten Erkenntnisse solange in den Sozialen Netzwerken zu verbreiten, bis auch die Medien sich der Angelegenheit annahmen und in dieselbe Kerbe schlugen. Da fühlte sich der Dekan schließlich genötigt, zu handeln, um, wie es in solchen Fällen immer so schön heißt, Schaden von der Universität abzuwenden.
Dass meine Theorie rein gar nichts mit einer solchen unsinnigen Unterstellung zu tun hatte, ließ sich leider der Öffentlichkeit nicht vermitteln. Das Problem war, man nahm meine Theorie nicht als mathematisches Modell, sondern als metaphorisches. Nur, weil ich es ja irgendwie anschaulich erklären musste, schauten sie sich meine wortreiche Erklärung an und fragten sich, woran sie die Metaphorik erinnerte. Und da sie bei bestimmten Worten ja immer gleich wie der Pawlowsche Hund reagierten, hatten sie schnell etwas entdeckt, was für sie kritikwürdig war.
Zwar hätte ich mein Büro im Institut behalten und auch meine Experimente dort weiter fortsetzen können, doch verzichtete ich darauf und suchte mir abseits der Stadt eine neue Unterkunft. Da ich viel Platz benötigte, erwies sich die stillgelegte Ziegelei als ein idealer neuer Forschungsort für mich, zumal die Miete sich in den Grenzen des Erträglichen hielt. Mit drei Lieferwagen voller Equipment verließ ich also eines Tages das Physikalische Institut und zog in die sogenannte Tonfabrik.
In den ersten Wochen arbeitete ich an der Wiederherstellung meines experimentellen Versuchsaufbaus, den ich zunächst wieder so zusammenzusetzen gedachte, wie ich ihn jahrelang an der Universität betrieben hatte. Aber es ist eine merkwürdige Angelegenheit: Technische Geräte, die einmal miteinander verkabelt waren und jahrelang ohne größere Probleme miteinander kommunizierten, stellen komplett ihren Dienst ein, wenn man sie ab- und danach genau so wieder aufbaut und vernetzt. Obwohl sich nichts an der Verkabelung geändert hat, funktioniert plötzlich nichts mehr so, wie es sollte. Ein Gerät bekommt keine Impulse mehr, ein anderes weigert sich, Impulse abzugeben, ein drittes springt alle zehn Minuten auf »Error«, die Sicherung knallt durch und selbst so einfache Geräte wie ein Drucker oder ein Plotter drucken plötzlich nur noch interne Protokolldaten, statt den an sie gesendeten Druckauftrag zu erfüllen. Es ist zum Verzweifeln, und wieder und wieder fängt man ganz von vorne an, hangelt sich an den Schaltplänen entlang, ist guten Mutes, dass jetzt alles richtig miteinander verknüpft ist, und dann – wieder nichts.
In solchen Momenten fragt man sich, ob Technik, die man miteinander verbunden hat, sich eigenständig weiterentwickelt, ob sie eine Art von Kommunikation ausbildet, die sich nach einiger Zeit von selber einstellt, und ob das System dann fähig wird, einen neuen autonomen Prozessablauf zu generieren, der erst wieder unterbrochen wird, sobald man die Verbindungen einmal kappt und neu zusammensetzt.
Ich zumindest war in den ersten Wochen, in denen ich in der alten Ziegelei arbeitete, fest davon überzeugt, dass die Technik sich gegen mich verschworen hatte und sich weigerte, meinen Befehlen zu gehorchen. Und entsprechend diskutierte ich mit ihr, nannte sie ein verdammtes Biest, einen störrischen Esel oder sogar einen Schrotthaufen, trat mit den Füßen in ihre Kabelschächte, schlug mit Fäusten auf ihre Anzeigeinstrumente und hätte sie am liebsten sogar bespuckt, wenn ich mich nicht jedes Mal wieder blitzartig daran erinnerte, dass sich Elektronik und Feuchtigkeit auf keinen Fall gut vertragen.
So ist der Mensch, er baut eine simple Apparatur und zeigt sich sodann größenwahnsinnig, indem er mit ihr spricht, als ob er etwas Lebendiges erschaffen hätte, dabei gelingt es ihm nicht einmal mehr, einen toten Floh wieder zum Leben zu erwecken.
Fast unnötig zu sagen, dass es mir irgendwann doch gelang, den Versuchsaufbau wieder in Funktion zu bringen. Woran es gehapert hatte, wurde mir allerdings nicht klar. Plötzlich gingen die Lichter an, die Instrumente zeigten akzeptable Werte, und ich musste die gesamte Anlage nur noch einmal vollständig von Hand neu kalibrieren, was mich eine weitere Woche kostete.
Ich glaube, am Ende dieser Woche nahm ich zum ersten Mal Notiz davon, dass ich in der Ziegelei nicht allein war. Ich hörte Musik, rhythmische und durchaus ansprechende Musik, die aus einem der Räume drang, in denen, so hatte mir der Hausmeister gesagt, einige bedeutende zeitgenössische Künstler ihr Atelier eingerichtet hatten. Nun, nach bedeutender zeitgenössischer Kunst klang die Musik Gott sei Dank nicht. Aber da ich gerade ein Stimmgerät sehr gut gebrauchen konnte, das dort bestimmt zu haben war, beschloss ich, der Band einen Besuch abzustatten. Ich benötigte nur wenige Sekunden, um zu erkennen, dass es sich um eine Schülerband handelte, und war auch sogleich wieder verschwunden, allerdings nicht ohne, dass man mir tatsächlich ein Stimmgerät lieh, mit dem ich augenblicklich einige letzte Kalibrierungen in meinem Labor vornahm. Danach hatte ich die Musikanten wieder vergessen, und auch, dass ich noch im Besitz ihres Stimmgerätes war.
Eine Woche später wurde ich jedoch an meine Vergesslichkeit erinnert. Abends gegen acht Uhr klopfte es an meiner Tür. Es war der Keyboarder, den man geschickt hatte, um mich an die Rückgabe des Stimmgeräts zu erinnern. Wahrscheinlich hatte er beim Loseziehen verloren. Er war etwas schüchtern, druckste herum und warf ein paar Mal an mir vorbei einen Blick in mein Labor.
»Komm rein!« sagte ich. »Ich muss das Gerät erst suchen und hoffe, dass ich es nicht irgendwo mit eingebaut habe.«
Er sah sich mit offenem Mund in meinem Labor um und sagte schließlich: »Mein Gott, was ist das, eine Zeitmaschine?«
»Wie bitte?« fragte ich. »Nein, ehrlich, hat man schon mal so etwas Bescheuertes gehört, eine Zeitmaschine?« Und dann polterte ich los: »Zeit, mein Lieber, ist ein irreversibles Kontinuum, sie existiert im Grunde genommen gar nicht. Es erscheint uns nur so, weil wir uns an Gestern erinnern können und ein Morgen zu imaginieren in der Lage sind. Aber in Wahrheit gibt es nur Gegenwart. Nun kannst du die Gegenwart immer enger eingrenzen. Ist die Gegenwart eine Sekunde lang oder eine halbe, eine viertel, oder eine tausendstel Sekunde? Was du auch wählst, es gibt theoretisch immer noch eine kleinere Zeiteinheit, bis gar nichts mehr da ist. Du siehst, du imaginierst Zeit nur aufgrund deiner individuellen Latenz. In Wahrheit gibt es sie nicht. Und folglich kann es daher auch keine Zeitmaschine geben.«
»Und was ist das hier für ein Gerät?«
»Bestenfalls eine Raummaschine, ja, so könnte man die Apparatur vielleicht benennen, eine Raummaschine.«
Florian zog die Augenbrauen hoch. »Und was macht man mit einer Raummaschine? Kann man damit ganz schnell zwischen Deutschland und Australien hin und her switchen?«
»Ganz gewiss nicht. Das wäre ja nichts weiter als ein extrem schnelles Gefährt. Theoretisch durchaus möglich, aber sehr schwer zu bauen. Da wäre uns nicht nur die Physik im Weg, sondern auch der Magen- und Darmtrakt.«
»Mir wird schon in der Achterbahn schlecht«, gab der junge Mann zu.
»Das kann man sich abtrainieren«, erwiderte ich.
»Mag sein«, sagte er, »das Problem ist nur, dass man immer gleich die ganze Runde drehen muss und nicht mit kleinen Teilstücken beginnen darf.«
Diese Art zu denken gefiel mir. »Richtig«, sagte ich, »Unsere schönen Theorien lassen sich manchmal in der Praxis nur schwer umsetzen.«
»Und was ist jetzt mit Ihrer Raummaschine?«
»Erkläre ich dir ein anderes Mal, dann, wenn sie endlich funktioniert.«
In der Zwischenzeit hatte ich das Stimmgerät wiedergefunden und händigte es ihm aus. »Sag dem Besitzer, herzlichen Dank, er hat mir sehr geholfen.«
»Ja, gern«, sagte Florian, von dem ich zu dieser Zeit noch gar nicht wusste, dass er Florian hieß, und verließ, nicht ohne sich noch einmal in meinen vier Wänden umgesehen zu haben und den Kopf zu schütteln, mein Labor.
Eine Woche später traf ich ihn, als er gerade die Tür aufschloss und ich auf dem Weg zu den Müllcontainern war. Seine Musikerkollegen waren noch nicht eingetroffen, und er fragte mich, ob ich mit meiner Maschine schon Fortschritte erzielt hätte.
»Ich verrate dir mal etwas«, sagte ich, »ich habe da eine Theorie, ich nenne sie Inkorporationstheorie und meine quantenphysikalischen Experimente sind kurz davor, diese Theorie zu bestätigen, freilich nur auf atomarer Ebene. Zweimal ist es mir bereits gelungen, ein Elektron auf eine andere energetische Ebene zu schießen, so dass es für die Messapparaturen nicht mehr da war, obwohl es eindeutig noch da sein musste. Verstehst du, was das heißt?«
Der junge Mann zuckte mit den Achseln und sagte: »Keine Ahnung.«
»Es heißt oder könnte heißen, dass das Elektron in einen übergeordneten Raum transponiert wurde. Einen Raum, der den Raum, in dem es sich zuvor aufhielt, wie eine Schale umschließt.«
»Physik war noch nie so mein Ding«, gab er daraufhin zu. »Wir haben uns in der Oberstufe ein wenig mit Atomphysik beschäftigt, aber viel hängengeblieben ist da nicht. Ihr Elektron ist wahrscheinlich auf eine andere energetische Ebene gehüpft.«
»Sehr richtig, genau das hat es gemacht, nur dabei hat es einen gänzlich neuen Raum real eröffnet, der vorher nur als theoretische Möglichkeit da war.«
»Ich heiße übrigens Florian«, unterbrach mich der junge Mann und brachte mich damit aus dem Konzept.
»Und ich Helena.«
»Professorin Helena?«
»Vergiss das mit der Professorin, wir sind schließlich Nachbarn, und du bist nicht mein Student.«
»Gott sei Dank«, erwiderte er, »Sie hätten wenig Freude an mir. Mein Abstraktionsvermögen reicht kaum aus, um mir den Quintenzirkel vorzustellen, da kommt es bei mir nämlich immer rasch zu enharmonischen Verwechslungen.«
Offensichtlich hatte der junge Mann Humor. Das gefiel mir. »Komm mit«, sagte ich daher, »ich möchte dir etwas zeigen.«
»Was denn?« fragte Florian etwas verschüchtert und sah mich verängstigt an.
»Etwas zum Anfassen«, antwortete ich, »damit du es schneller kapierst.«
»Meine Kollegen kommen bestimmt gleich«, wandte er ein, und ich bemerkte, dass er einen Grund suchte, nicht mit mir kommen zu müssen.
»Na, warte, dann hole ich es dir her«, sagte ich und ging in mein Labor. Kurze Zeit später kam ich zurück und drückte ihm eine Matrjoschka in die Hand.
»Weißt du, was das ist?«
»Das ist so eine russische Puppe, in der eine andere, kleinere Puppe steckt und in der wiederum eine weitere und so weiter«, antwortete er und wunderte sich, warum ich ihm die buntbemalte Puppe in die Hand gegeben hatte.