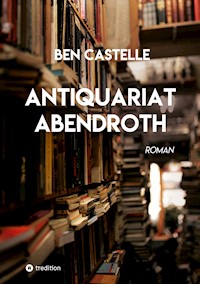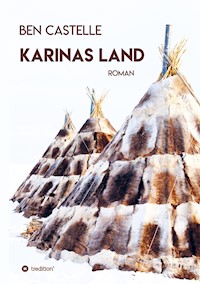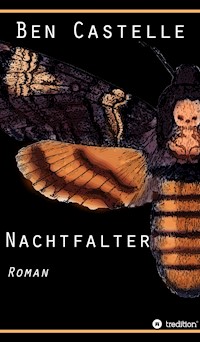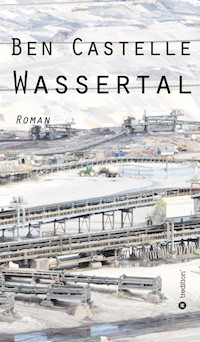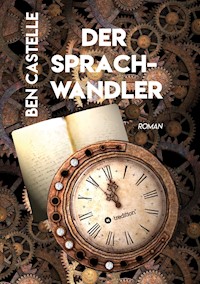
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod seiner Eltern und dem Fall der Mauer zieht der kleine Maxim mit seiner Tante Henriette, die eine Volksbibliothek in der DDR leitete, aus Ostdeutschland in den Westen. Unter ihrem Einfluss wächst Maxim überwiegend mit deutschen Übersetzungen russischer Bücher auf und gilt in der Schule als Sonderling. Nur seine Mitschülerin Annieke kommt an ihn heran und weiß, dass Maxim die wahren Umstände rund um den Tod seiner Eltern - sein Vater war Lehrer, seine Mutter Russischübersetzerin - längst enträtselt hat. Jahre später studiert Maxim in Moskau russische Literatur und arbeitet nebenher in einem kleinen Dorf außerhalb der Stadt an seiner ersten Übersetzung, die er gemeinsam mit einem russischen Autor anfertigt, der von seiner deutschen Kriegsgefangenschaft erzählt. Als Annieke Maxim in der Provinz besucht, ist sie jedoch enttäuscht von seinem neuen Leben in der Fremde. Ein Buch, das aus lauter sich erinnernden Einzelstimmen komponiert ist. Neben den zeitgenössischen Akteuren blickt darüber hinaus eine alte Fabergé-Kaminuhr zurück auf ihre Zeit mit Tolstoi und erinnert die Wirren der russischen Revolution und die Blockade Leningrads durch die deutschen Truppen. »Ein Buch, das die wechselvolle deutsch-russische Geschichte wieder in den Blick bringt. Völkerverständigung wird hier nicht der Politik überlassen, sondern der Literatur und ihrer Vermittlung.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ben Castelle
Der Sprachwandler
Roman
Über dieses Buch:
Nach dem Tod seiner Eltern und dem Fall der Mauer zieht der kleine Maxim mit seiner Tante Henriette, die eine Volksbibliothek in der DDR leitete, aus Ostdeutschland in den Westen. Unter ihrem Einfluss wächst Maxim überwiegend mit deutschen Übersetzungen russischer Bücher auf und gilt in der Schule als Sonderling. Nur seine Mitschülerin Annieke kommt an ihn heran und weiß, dass Maxim die wahren Umstände rund um den Tod seiner Eltern – sein Vater war Lehrer, seine Mutter Russischübersetzerin – längst enträtselt hat.
Jahre später studiert Maxim in Moskau russische Literatur und arbeitet nebenher in einem kleinen Dorf außerhalb der Stadt an seiner ersten Übersetzung, die er gemeinsam mit einem russischen Autor anfertigt, der von seiner deutschen Kriegsgefangenschaft erzählt. Als Annieke Maxim in der Provinz besucht, ist sie jedoch enttäuscht von seinem neuen Leben in der Fremde.
»Ein Buch, das aus lauter Einzelstimmen komponiert ist, die an die wechselvolle deutsch-russische Geschichte erinnern. Völkerverständigung wird hier nicht der Politik überlassen, sondern der Literatur und ihrer Vermittlung.«
Impressum
© 2022 Ben Castelle
Umschlag, Illustration: Ben Castelle unter Verwendung zweier Bilder von Susann Mielke, Pixabay.
ISBN
Softcover: 978-3-347-53734-7
Hardcover: 978-3-347-53740-8
E-Book: 978-3-347-53760-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Übersetzen ist die Sehnsucht nach etwas, was sich immer wieder entzieht, nach dem unerreichten Original, nach dem Letzten, dem Eigentlichen.
Swetlana Geier
Ein Polizist
Wir trafen im strömenden Regen gegen drei Uhr nachts am Unfallort ein und konnten uns den Hergang des Geschehens zunächst nicht erklären. Mittig aus einem ausgebrannten und noch rauchenden Autowrack ragte ein verkohlter Baum in den Himmel, der ebenfalls gebrannt haben, dann aber vom Regen wieder gelöscht worden sein musste. Im Fahrzeug befanden sich keinerlei Insassen. Sämtliche Glasscheiben des Wagens fehlten, die Sicherheitsgurte waren abgerissen. Von den ausgelösten Airbags erkannte man nur noch ein paar schwarze Fetzen. Wir machten uns sogleich auf die Suche nach dem oder den Verunfallten. Mehrere Meter vom Autowrack entfernt fanden wir drei bewusstlose Personen vor. Bei einer davon kam jede Hilfe zu spät. Die beiden anderen konnten vom eintreffenden Notarztteam stabilisiert und ins Krankenhaus zur intensivmedizinischen Behandlung gebracht werden.
Nach Auskunft der Sachverständigen musste der Wagen mit großer Wucht gegen den Baum gefahren sein, es gab so gut wie keine Bremsspuren auf der Straße. Als Halterin des Fahrzeugs ermittelten wir eine Annieke van Dooren. Wir nahmen zunächst an, dass sie das Fahrzeug auch gelenkt hatte. Der zweite Überlebende war Maxim Malcher. Bei dem Toten handelte es sich um Peter Stenkwitz. Die drei hatten gemeinsam an einem Klassentreffen ihres Abiturjahrgangs teilgenommen.
Weder Frau van Dooren, noch Herr Malcher konnten sich, nachdem sie wieder zu Bewusstsein gekommen waren, an den Unfallhergang erinnern. Von den anderen Gästen des Klassentreffens erfuhren wir, dass die drei Verunfallten weit nach Mitternacht gemeinsam das Fest verlassen hatten. Herr Malcher und Frau van Dooren hätten den ganzen Abend Alkohol getrunken, hieß es. Herr Stenkwitz hingegen nur Kaffee und Wasser. Unsere Gerichtsmedizin bestätigte, dass Herr Stenkwitz zur Zeit des Unfallgeschehens keinerlei Alkohol im Blut gehabt hatte. Wir hielten es daher für sehr wahrscheinlich, dass Herr Stenkwitz als Lenker des Fahrzeugs in Frage kam, konnten in dem ausgebrannten Wrack aber keinerlei bestätigende Indizien finden. Auf dem Fahrersitz fanden sich nur einige Haare und winzige Kleiderpartikel einer Fleecejacke, die zu Frau van Dooren gehörten, was aber nicht weiter verwunderte, da sie ja, wie gesagt, die Halterin des Wagens war.
Im Rahmen unserer Routineüberprüfungen stellten wir dann jedoch fest, dass Herr Stenkwitz über keinen Führerschein verfügte. Nach Auskunft seiner Familie soll er Autos gemieden haben. Er sei ein überzeugter Fahrradfahrer gewesen sowie Ortsverbandsvorsitzender einer ökologischen Partei. In dieser Eigenschaft sei er seit Jahren Verfechter einer autofreien Gesellschaft.
Unsere Ermittlungen konzentrierten sich daher erneut auf die Halterin des Fahrzeugs, zumal Frau van Dooren sich als bereits aktenkundig erwies. Sie war erst vor einem halben Jahr wegen eines Drogendelikts aufgefallen. Eine Polizeistreife hatte damals bemerkt, wie sie im Schneckentempo mehrere Runden durch einen Kreisverkehr drehte. Eine Überprüfung ergab, dass sie zuvor Cannabis konsumiert hatte.
Wir luden Frau van Dooren, die bei dem Unfall mehrere Brüche und Prellungen erlitt, nach ihrer Genesung noch einmal vor und fragten sie, ob sie sich erinnern könne, das Fahrzeug gefahren zu haben. Sie hielt das selbst für sehr wahrscheinlich, da sie grundsätzlich nicht gern andere Menschen an das Steuerrad ihres Wagens lasse. Dennoch könne sie sich nach wie vor an nichts erinnern. Auch sei sie noch niemals nach der Einnahme von Alkohol mit dem Auto gefahren.
Wir setzten ihr auseinander, dass sie mit einem Strafverfahren rechnen müsse, da der Verdacht bestehe, sie könne sich durch ihr unachtsames Verhalten schuldig gemacht haben. Frau van Dooren war entsetzt, als sie begriff, dass sie vielleicht für den Tod von Peter Stenkwitz verantwortlich war. Darüber hinaus sorgte sie sich, dass man ihr den Führerschein abnehmen könnte, denn sie arbeitete an ihrer Abschlussarbeit in Sozialwissenschaften und war, so gab sie an, aufgrund ihres Themas auf die Fahrlizenz dringend angewiesen. Uns kam dies, zugegeben, etwas merkwürdig vor. Auf der einen Seite der Schrecken, für den Tod eines Menschen verantwortlich sein zu können, auf der anderen Seite diese dagegen doch recht banale Sorge um einen möglichen Führerscheinverlust. Gleichzeitig weigerte sie sich aber nach wie vor, zu glauben, dass sie wirklich so leichtsinnig gewesen und mit dem Wagen gefahren sein sollte, und sie vermochte sich ihr Verhalten selbst nicht zu erklären.
Alles in allem sah es für Frau van Dooren nicht sehr gut aus. Die Tatsache, dass sie schon einmal mit Drogen am Steuer erwischt worden war und dass sie es selber für am wahrscheinlichsten hielt, das Auto trotz Alkoholeinflusses gefahren zu sein, hätten den Richter sicherlich nicht sehr gewogen gegen sie gemacht. Das Verfahren war jedoch noch nicht eröffnet, da erschien auf der Wache eines Morgens an zwei Gehstützen geklammert der dritte am Unfall Beteiligte: Maxim Malcher. Er gab zu Protokoll, dass er sich plötzlich wieder an alles erinnern könne: Er sei es gewesen, der den Wagen gefahren und den Unfall verursacht habe.
Ein Nachbar
Zwei Jahre lang stand die alte Nagelschmidt-Villa leer. Es schien sich niemand für die in die Jahre gekommene Immobilie zu interessieren. Eine Zeitlang hing in einem der unteren Fenster ein Schild »Zu verkaufen«, dazu nur eine Telefonnummer. Irgendwann war das Schild wieder fort. Unter den Bäumen im Garten waren die jungen Pflaumen- und Kirschtriebe längst hüfthoch gewachsen, auf der einstigen Grünfläche wucherten Karden und Disteln, und durch den Staketenzaun aus Kastanienholz drangen die Schneebeeren Meter um Meter auf mein Grundstück vor.
Bis Anfang der achtziger Jahre hatte die alte Frau Nagelschmidt in dem Haus gelebt. Danach gaben sich fast alle zwei Jahre neue Mieter die Klinke in die Hand. Die ehemalige Villa verwahrloste zusehends. Pfannen fielen vom Dach und wurden nicht wieder aufgelegt. In den verschlammten Dachrinnen wuchsen Brennnesseln und Gräser. Efeu kletterte die Fassaden hinauf und drohte, das Haus unter sich zu ersticken.
Die Nagelschmidts waren im Krieg reich geworden. Ihnen gehörten damals große Waldgebiete oberhalb der Stadt. Jahrelang konnten sie mit den Bäumen nicht viel anfangen und verfluchten ihre Erbschaft. Denn die Holzwirtschaft war ein zähes Geschäft. Doch eines Tages interessierte sich der Staat für den Wald. Man benötigte Holz für den Bau des Westwalls. Da die Nagelschmidts nicht genügend Waldarbeiter für die Rodung auftreiben konnten – die meisten Männer waren ja im Krieg – bekamen sie Zwangsarbeiter zugewiesen. Es waren fast ausschließlich Russen, die schon halbtot hier vor Ort eintrafen. Man hielt sie wie Tiere in Baracken außerhalb der Stadt. Sie mussten arbeiten bis zum Umfallen. Und wenn sie umfielen, dann wurden sie nicht selten an Ort und Stelle verscharrt.
Ich war damals noch ein Kind, habe es jedoch mit eigenen Augen gesehen, wie sie einen von den Arbeitern auf einer Lichtung verbuddelt haben. Und oben am Stadtrand, wo heute das Fitnesscenter steht, da war ein großer Russenfriedhof mit Dutzenden und Aberdutzenden kleiner Holzkreuze, auf denen kein Name, sondern immer nur »Russe« stand. Russe, Russe, Russe, als ob alle Zwangsarbeiter nur diesen einen Namen getragen hätten. Die Toten sind dann nach dem Krieg umgebettet worden auf irgendeinen Zentralfriedhof im Nachbarkreis. Es hat hier vor Ort niemanden interessiert, weil niemand sich mehr an die Zwangsarbeiter erinnern wollte und alle froh waren, dass der Friedhof wieder aus ihrem Ort und ihrer Erinnerung verschwand.
Aber ich erinnere mich noch gut: Wenn die Russen aus den Baracken in den Wald marschierten, dann legten wir manchmal ein paar Kartoffelschalen auf ihren Weg und versteckten uns hinter den Bäumen. Die Russen hoben jede kleine Schale wie eine edle Kostbarkeit vom Boden auf und ließen sie hastig in ihre Taschen verschwinden, um daraus in der Baracke eine dünne Suppe zu kochen. Wir lachten und hielten das für ein Spiel, ein Spiel mit wilden Tieren. Im Gegenzug hatten die Russen manchmal etwas für uns gebastelt, das sie rasch hinter den Bäumen versteckten. Sie waren exzellente Handwerker müssen Sie wissen. Schauen Sie, dies habe ich aufbewahrt. Es ist ein kleiner Hund aus Holz, alles an ihm lässt sich bewegen, die Ohren, der Kopf, die Beine, der Schwanz. Früher stand er noch auf vier Rollen, so dass man ihn an einem Band durchs ganze Haus ziehen konnte, doch die Rollen sind irgendwann verlorengegangen. Hier am Hals steht der Name des Hundes Mumu, und hier unter dem Bauch hat der Künstler selbst seinen Namen und Vatersnamen in kyrillischen Buchstaben eingebrannt: Nikolenka Nikolajewitsch.
– Aber Entschuldigung, das ist lange her, und Sie wollten etwas ganz anderes erfahren. Also, eines Tages stand vor dem Nachbarhaus ein großer Möbeltransporter. Ich setzte mich ans Fenster und wartete, ob ich jemanden zu sehen bekäme. Doch ich sah nur die Möbelpacker, die jede Menge altes Zeug ins Haus schleppten. Dann kamen lauter Kartons. In den Kartons waren Bücher. Ich weiß das, weil einer der Kartons entzweiging und die Bücher auf die Straße fielen. Der Möbelpacker fluchte und hob die Bücher einzeln vom Boden auf, stapelte sie in seiner linken Hand zu einem enormen Turm, den er mit seinem Kinn zu stabilisieren versuchte, was aber misslang, so dass ein Großteil der Bücher erneut zu Boden ging.
Als der Möbelwagen wieder fort war, geschah tagelang gar nichts. Nur abends sah ich, dass unten in der Küche und in den Wohnräumen Licht brannte. Aber wer dort eingezogen war, blieb mir vorerst verborgen.
Eines Tages, ich glaube, es war schon im Frühling des darauf folgenden Jahres, erblickte ich eine Frau, die im Garten mit dicken Lederhandschuhen die vertrockneten Karden und Disteln herauszureißen versuchte. Sie trug eine Reiterhose und eine weiße Bluse, und sie erinnerte mich ein wenig an die alte Frau Nagelschmidt, als diese noch jung war meine ich, also kurz nachdem sie sich mit ihrem Mann von dem neu erworbenen Reichtum aus dem Holzeinschlag dieses Haus hatte erbauen lassen. Ich glaube, auch die Nagelschmidts gingen damals reiten und besaßen Pferde, aber genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wie dem auch sei, als ich der Frau ein Weilchen bei ihrer Arbeit zugesehen hatte, hörte ich plötzlich das Wimmern eines kleinen Kindes. Und jetzt erst erkannte ich, dass auf dem Gartentisch unterm Pflaumenbaum ein Körbchen stand. Die Frau zog ihre Handschuhe aus, beugte sich über das Körbchen und hob einen Säugling empor, den sie sogleich auf und ab zu wiegen begann, bis er wieder eingeschlafen war.
Ich begab mich in den Garten und wünschte der neuen Nachbarin lautstark einen guten Tag. Sie erschrak, kam dann aber mit dem Kind zu mir an den Zaun, dorthin, wo die Schneebeeren aus unerfindlichen Gründen eine kleine Lücke bei ihrer Invasion gelassen hatten, und stellte sich mir vor. So lernte ich Frau Malcher und den kleinen Maxim kennen.
Es verging ein Monat, bis ich die beiden erneut zu Gesicht bekam. Frau Malcher klingelte eines Abends an meiner Haustür und bat mich um Hilfe. Ihr Elektroherd funktionierte nicht mehr, und sie fragte, ob ich ihr helfen könne, nach dem Fehler zu suchen. Ich ging mit ihr und erkannte rasch, dass die Sicherung durchgebrannt war. Es war noch eine von den alten Porzellansicherungen und glücklicherweise lag neben dem Zähler ein Päckchen mit Ersatz. Als ich die neue Sicherung eingeschraubt hatte, funktionierte der Herd wieder einwandfrei.
Ich kam mit Frau Malcher ein wenig ins Gespräch. Dass sie nicht Maxims Mutter, sondern seine Tante war, hatte sie mir bereits bei unserer ersten Begegnung verraten. Auch dass die Eltern des Kleinen bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Jetzt erfuhr ich, dass Frau Malcher in Ostdeutschland eine kleine Volksbibliothek geleitet hatte. Kurz darauf zeigte sie mir ihre geretteten Schätze, bei denen es sich überwiegend um russische Bücher in deutscher Übersetzung handelte. Ich zeigte mich begeistert von ihrer Bibliothek, und wir unterhielten uns sehr lange. Es stellte sich heraus, dass wir beide ein Faible für Literatur besaßen. Mit russischen Schriftstellern war ich allerdings nicht vertraut. Ich kannte zwar einige Namen, hatte aber wenig gelesen. Frau Malcher packte mir einen Gedichtband von Puschkin, einen Erzählband von Tschechow, Gontscharows Oblomow und Gorkis Kindheitserinnerungen auf. Ich nahm die Bücher mit nach Hause und las sie. Sie gefielen mir sehr gut, und von da an war ich regelmäßig bei Frau Malcher zu Gast, um mir Nachschub aus ihrer Bibliothek zu holen und dafür im Gegenzug die kleinen und größeren Schäden im und am Haus zu reparieren.
Als Maxim etwas älter geworden war, bekam er seinen eigenen Platz in der Bibliothek. Es handelte sich um eine Art Bodenlager aus roten Kissen, die auf einem türkischen Teppich ausgelegt worden waren. Dort saß er und spielte mit seinen Stofftieren oder blätterte in Kinderbüchern, die vom russischen Illustrator Iwan Bilibin bebildert worden waren. Bilibin, so verriet Frau Malcher mir, habe um die Jahrhundertwende in München studiert, bevor er dann an der Kunstakademie in Sankt Petersburg vom berühmten Ilja Repin unterrichtet worden sei. Er starb, so berichtete mir Frau Malcher, im Februar 1942, nachdem die deutsche Heeresgruppe Nord fast zweieinhalb Jahre lang Leningrad belagert hatte. Über eine Million Zivilisten seien dabei ums Leben gekommen, die meisten seien verhungert.
So kamen wir oft ins Plaudern und gerieten dabei, wie in diesem Fall, von einem harmlosen Kinderbuch zu einem der größten Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht. Meistens jedoch kreisten unsere Gespräche um die Literatur. Auf diesem Gebiet war Frau Malcher sehr beschlagen, und ich habe ihr die Kenntnis einer ganzen Reihe von Werken zu verdanken, die mein Leben bereichert und meine Wahrnehmung erweitert haben.
Annieke
Ich kannte Maxim seit der fünften Klasse. Wir haben uns gemeinsam bis zum Abitur durchgeschlagen. Maxim war immer schon anders als die anderen. Auf den ersten Blick wirkte er oft gelangweilt und arrogant. Er war zwar ein guter Schüler, rückte aber mit seinem Wissen nie von allein heraus. Immerzu musste er persönlich gefragt werden, wenn man von ihm eine Antwort haben wollte. Fragen an die Klasse ignorierte er. Schon in der Unterstufe kam man nur schwer an ihn heran. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet mir vertraute. Vielleicht, weil ich nichts von ihm wollte, weil ich ihm keine Fragen stellte und mich auch nicht für sein Urteil interessierte. Wir saßen in allen Fächern nebeneinander, aber wir sprachen nur selten zusammen und wenn, dann unterhielten wir uns über belanglose Dinge.
Man sah Maxim weder auf dem Fußballplatz, noch im Musikverein. Größeren Feierlichkeiten an der Schule entzog er sich stets durch eine vorgetäuschte Krankheit. Ich erfuhr irgendwann, dass er bei seiner Tante aufwuchs, die ihm alle Entschuldigungsformulare unterschrieb, die er ihr auf den Tisch legte. Dabei gab sich Maxim nie mit einer einfachen Erkrankung wie einem grippalen Infekt, Husten oder Fieber zufrieden, nein, er liebte die ausgefallenen Krankheiten, die er dazu noch gern in lateinischer Sprache auf dem Formular vermerkte. Ich erinnere mich, dass er mir einmal, nachdem er tagelang nicht in der Schule war, verriet, dass er an einer Trichodynie gelitten habe. Ich fragte ihn, was das für eine Krankheit sein sollte, und er sagte, »trichos«, sei griechisch und bedeute Haar, und der Rest des Wortes bedeute Schmerzen. Offensichtlich handelte es sich also um einen »Haarspitzenkatarrh«.
Bis zur Oberstufe hatte ich zu Maxim einzig und allein in der Schule Kontakt. In der zwölften Klasse änderte sich das. Ich erzählte ihm eines Tages, dass ich Probleme mit meinem Computer hatte. Ich glaubte, mir einen Virus eingefangen zu haben, und fragte ihn, ob er eine Ahnung habe, was man dagegen machen könne.
»Kann ich so nicht sagen«, antwortete Maxim. »Das müsste ich mir mal etwas genauer anschauen. Wo wohnst du?«
Nachmittags um fünf Uhr klingelte es an unserer Haustür und Maxim stand tatsächlich kurz darauf in meinem Zimmer und betrachtete sich meinen Computer. Er spielte auf die Festplatte irgendeine Software auf, ich sah nur viele weiße Zahlen und Buchstabenreihen auf schwarzem Grund. Dann sagte er irgendwann »Ui, ein ganz fetter Trojaner, wird ein bisschen brauchen, bis ich den wieder eliminiert habe. Auf welchen Seiten bist du denn gewesen? Musiktauschbörse?«
Ich stotterte verlegen herum, und Maxim grinste nur und sagte: »Erwischt!«
Ich bot Maxim Kaffee an, aber er wollte lieber einen Tee. Es dauerte fast zwei Stunden, bevor er meinen Computer für »clean« erklärte. In all der Zeit sprach er nicht viel. Es kam mir vor, als sei er zum einen etwas schüchtern, zum anderen, als ob er die Arbeit am Computer länger ausdehnte als nötig.
»Schönes Bild«, sagte er, als auf dem Desktop wieder mein gewohnter Standardbildschirm erschien, auf dem ich ein Foto meiner ganzen Familie mit Vater, Mutter, Oma, Opa und meinem Bruder Niko als Hintergrundbild eingerichtet hatte. Alle saßen sie gemeinsam an einer langen weißen Tafel mitten im Garten unter einem Apfelbaum.
»Was ist mit deiner Familie?« fragte ich.
»Auf meinem Desktop winkt mir nur Tante Henni zu«, sagte Maxim.
»Und deine Eltern?«
»Die habe ich nie gekannt.«
»Tot?«
»Ja, Verkehrsunfall.«
Ein Lehrer
Um es gleich vorwegzusagen: Maxim Malcher war alles in allem kein guter Schüler. Zwar war er intelligent, wusste auf fast jede Frage eine Antwort, die mich und meinen Kollegenkreis zuweilen in Verblüffung versetzen konnte, doch was ihm letztlich fehlte, um als guter Schüler bezeichnet werden zu dürfen, waren Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft. Maxim hatte keinerlei eigenen Antrieb, er folgte zwar dem Unterrichtsgeschehen, fiel nicht durch Störungen oder vorlaute Sprüche auf, aber er war extrem passiv, so als ob ihn das, was in der Klasse vor sich ging, nicht im Geringsten interessierte.
Einmal schickten wir Maxim zu einem IQ-Test, weil mein Kollege Herr Heimpel glaubte, Maxim sei vielleicht hochbegabt und langweile sich an unserer Schule. Aber das Ergebnis fiel enttäuschend aus, vor allem für Kollege Heimpel, der ein paar Tage lang im Lehrerzimmer eine Miene machte, als ob man ihn persönlich in aller Öffentlichkeit einen Dummkopf gescholten hätte. Aber ich muss zugeben, dass ich mir bis heute nicht sicher bin, ob Maxim einige der Testfragen nicht absichtlich falsch beantwortet hatte, nur um in Ruhe gelassen zu werden.
Womit er uns manchmal in Erstaunen versetzte, das war seine ungeheure Allgemeinbildung, oder sagen wir besser seine sehr spezielle Allgemeinbildung, auch wenn das eine contradictio in adiecto zu sein scheint. Ich erinnere mich an einen Vorfall, der sich in der Mittelstufe zutrug. Auf dem Lehrplan stand die napoleonische Zeit, und wir streiften kurz den Russlandfeldzug Bonapartes. Eigentlich nur, um ihn in Verlegenheit zu bringen, wollte ich von Maxim wissen, ob er davon schon mal gehört habe. Er nannte mir daraufhin den Tag, an dem Napoleon die Memel überschritt, benannte die Heeresstärke der Grande Armée, berichtete von der russischen Politik der verbrannten Erde, die – obwohl man das nicht genau wisse – Moskau in Flammen habe aufgehen lassen, und sprach von der Schlacht bei Borodino, fast so, als ob er dabei gewesen wäre. Und schließlich beschrieb er anschaulich die Zerschlagung der französischen Truppen, wie sie abgeschnitten vom Nachschub und von Hunger und Krankheit gezeichnet den Rückweg antraten. Ich muss gestehen, das hat mich beeindruckt, obwohl ich mich die ganze Zeit über fragte, ob Maxims Erzählung historisch stichhaltig war oder ob die Phantasie mit ihm durchging. Als ich mich zu Hause noch einmal selbst über den Russlandfeldzug informierte, musste ich mir aber eingestehen, dass Maxim alles in allem Recht hatte. Aber wie konnte es sein, dass ein deutscher Mittelstufenschüler den russischen Feldherrn Michail Illarionowitsch Kutusow kannte und ihm sogar eine gewisse Sympathie entgegenbrachte, während ihm Napoleon offensichtlich missfiel?
Auch in der Oberstufe änderte sich an Maxims Zurückhaltung und Passivität im Unterricht nicht das Geringste. Ich glaube, er hatte keine Freunde, wenn man von diesem Mädchen Annieke van Dooren einmal absieht, die ebenso auffällig unauffällig war wie Maxim. Ich weiß nicht, ob die beiden ein Paar waren. Ich glaube, sie waren es nicht. Dennoch saßen sie in fast jeder Schulstunde zusammen. Annieke war allerdings nicht ganz so schweigsam, sie nahm zumindest zuweilen am Unterricht teil und war alles in allem eine Dreiminuskandidatin, wenn ich das einmal so sagen darf. Sie schien keine Gemeinsamkeiten mit den anderen Mädchen der Klasse zu haben. Sie schminkte sich nicht, interessierte sich nicht für Mode und hatte auch sonst keinerlei typisch mädchenhafte Attitüden. Ich hielt sie immer für langweilig, aber da kann ich mich auch täuschen.
Die schriftlichen Leistungen von Maxim waren stets tadellos. Er konnte gut formulieren. Man bemerkte, dass er die Themenstellungen der Klausuren erst durchdachte, bevor er mit dem Schreiben begann. Er schrieb zwar nie viel, aber was er schrieb, das hatte Hand und Fuß. Nur in seinen kritischen Schlussbetrachtungen legte er manchmal eine eigenartige Perspektive an den Tag und benutzte Vokabeln, als ob er noch in der DDR aufgewachsen wäre.
Das hing vielleicht damit zusammen, dass er bei seiner Tante lebte, die sich um seine Erziehung kümmerte, nachdem seine Eltern kurz vor dem Mauerfall bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. So wurde es zumindest kolportiert. Zusammen mit seiner Tante war Maxim demzufolge Ende 1989 in den Westen gezogen, da war er nicht einmal mehr ein Jahr alt gewesen. Seine Tante haben wir hier an der Schule selten gesehen. Bei der Einschulung war sie einmal da und hinterließ einen eher zwiespältigen Eindruck auf uns. Sie wirkte sehr dominant, obwohl sie eher zierlich gebaut war. In der Unter- und Mittelstufe hab ich sie dann noch einmal bei einem Elternsprechtag erlebt. Sie hörte sich alle meine Bedenken und guten Ratschläge, die ich bezüglich Maxim vorbrachte, in Ruhe an und erwiderte dann, dass es der Junge nicht leicht habe, sie könne ihm weder die Mutter noch den Vater ersetzen. Wahrscheinlich mache sie daher vieles falsch. Aber andererseits müsste ich akzeptieren, dass es nicht jedem Kind gegeben sei, immerzu auf sich aufmerksam zu machen und jedermann auf die Nase zu binden, was es alles könne und wisse. Ich versuchte, ihr klar zu machen, dass es darum nicht gehe, sondern dass es einzig und allein entscheidend sei, ob man als Lehrer zumindest so etwas wie Leistungsbereitschaft und Teilnahmewillen bei den Schülern erkenne. Darauf sagte sie: »Es ist ihm halt peinlich, auf Fragen zu antworten, deren Antworten Sie ja bereits kennen. Er mag dieses Spielchen nicht.« Ich sagte, dass man dieses »Spielchen« Unterricht nenne, und sie sagte: »Eben, Unterricht mag er nicht.«
Wie gesagt, Maxims Tante war etwas merkwürdig. Vielleicht hatte dieser Eindruck auch mit ihrer Kleidung zu tun. Sie trug stets enge Reiterhosen, lange schwarze Stiefel und ein ebenso schwarzes Halstuch. Nicht, dass ich empfänglich für so etwas wäre, nein, bestimmt nicht, aber es fiel mir halt auf. Übrigens nicht nur mir, auch einige meiner Kollegen machten bisweilen so ihre Anspielungen über Maxims Tante.
Das Abitur hat Maxim dann glanzvoll hinbekommen, besser als einige andere, die sich im Unterricht stets als zuverlässig und aufmerksam erwiesen oder zumindest große Energien darauf verwendeten, diesen Anschein zu erwecken. Ob das am Ende gerecht ist, weiß ich nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, dass er den Abschluss rein gar nicht verdient hätte. Maxim war halt irgendwie besonders, kein Dutzendmensch. Er war keinesfalls dumm, das auf keinen Fall, nur etwas weniger begeisterungsfähig. Manchmal kam er mir geradezu alt vor. Ja, das ist komisch, aber wenn ich ihn während des Unterrichts betrachtete, wie er meinen Ausführungen ohne jegliche Mimik folgte, dann dachte ich oft an einen alten Mann, dem man nichts mehr erzählen kann, der schon sehr viel erlebt hat, und der das Geschwätz um ihn her nur erträgt, weil er … ja … weil er zu freundlich ist, um einfach aufzustehen und wegzugehen.
Eine Kaminuhr
Die schon sehr oft an mich herangetragene Frage, ob mich die genialen Hände des Meisters Michael Perchin oder vielmehr die des ebenso kunstfertigen Meisters Henrik Wigström geschaffen haben, kann ich nicht beantworten. Vielleicht war es keiner dieser beiden sagenumwobenen Goldschmiede der Zarenzeit, die mich Ende des 19. Jahrhunderts in der Werkstatt von Peter Carl Fabergé inmitten des vornehmen Sankt Petersburg anfertigten. Vielleicht war es ein heute längst Vergessener, ein einfacher Mitarbeiter, dem es aber, so viel darf ich beim Blick auf mein Äußeres und mehr noch auf mein Inneres mit Gewissheit behaupten, keinesfalls weniger an Ideenreichtum und Geschick mangelte als den namhaften Meistern, die über ihm gestanden haben mögen. Ich weiß nur, dass meine Anfertigung auf Wunsch eines reichen Unternehmers aus Moskau geschah, der eigens den langen Weg bis nach Sankt Petersburg auf sich genommen hatte, um mich beim berühmten Fabergé – noch bevor er den Titel des kaiserlichen Hofjuweliers tragen durfte und auch glücklicherweise, bevor die Oktoberrevolution ihn zwang, über Finnland nach Wiesbaden zu fliehen – in Auftrag zu geben. Ich weiß dies, weil er es war, der mich nach meiner Fertigstellung, die knapp zwei Monate in Anspruch genommen hatte – zwei Monate höchster Konzentration und präzisester Feinarbeit – in Empfang nahm und eine astronomische Summe für mich zahlte. Gleich mehrere hundert Rubel breitete er an einem freundlichen Augusttag im Kontor der Werkstatt auf einem der mit grünem Filz bespannten Präsentationstische aus.
Ich spüre deutlich, wie mancher jetzt die Stirn runzelt und sich fragt, was zum Teufel eine geschwätzige Kaminuhr aus dem 19. Jahrhundert mit der hier erzählten Geschichte zu tun haben soll und warum diese auch noch so spricht, als ob ihre Zeit in der Werkstatt Farbergés stehengeblieben wäre. Ich bitte um Geduld, es wird sich alles aufklären. Ansonsten hätte man mich ja nicht eingeladen, ja mehrfach freundlichst gebeten, meine Sicht auf die Dinge kundzutun.
Ich war damals keinesfalls für den reichen Herrn selbst bestimmt, der mich in Auftrag gegeben hatte und der übrigens in Moskau eine Maschinenbaufabrik unterhielt und zu einem der Gründungsväter der russischen Industrialisierung zählte – seinen Namen möchte ich aus Rücksicht auf einige seiner heute noch lebenden Nachfahren nicht nennen, nur anmerken, dass es sich um den Sohn eines deutschen Attachés aus Sankt Petersburg und einer russischen Adeligen aus Simbirsk handelte – und auch keinesfalls galt meine Bestimmung einer Dame, um deren Hand der reiche Fabrikbesitzer anzuhalten gedachte, sondern ich war einzig und allein für einen Schriftsteller gedacht, welchen unser Maschinenbauer über alles schätzte. Zumindest gab er dies vor, und es ist ja kein Geheimnis, dass reiche Männer, die, wenn sie sich denn schon mit den Federn der Kunst zu schmücken belieben, besonders gern zu den schillerndsten Federn greifen. Kurz: Mein Geburtshelfer hatte mich niemand anderem zugedacht als dem damals bereits weltberühmten Dichter Lew Nikolajewitsch Tolstoi.
So brachen wir an einem der milden Augusttage des ausgehenden 19. Jahrhunderts – ich in einem mit dickem Samt ausgeschlagenen, eigens für mich angefertigten Kästchen, mein Begleiter auf dem Lederpolster eines formidablen Zweispänners – von Moskau nach Jasnaja Poljana auf, wo der berühmte Dichter geboren worden war und wo er inmitten seiner Güter noch immer lebte, dichtete und wirtschaftete.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle ein wenig von meinem damaligen Aussehen berichten, da die Zeit nicht spurlos an mir vorübergegangen ist und man bei meinem heutigen glanzlosen Anblick noch bis vor kurzem glaubte, ich sei eine ganz normale, wenngleich auch in der Formgebung reichlich verspielte Kaminuhr aus alter Zeit, wie man sie mit etwas Glück für wenig Geld auf Flohmärkten erwerben kann. Nein, als ich die Werkstatt von Fabergé verließ, da war ich ein wahres Schmuckstück: Drei goldpolierte Messingringe jeweils vom Umfang eines Armreifens waren so stabil ineinander gesetzt und verschweißt worden, dass sie zusammen mit einem ebenso goldenen und mit filigranen Efeu-Lianen umwickelten Zylinder eine Art Postament bildeten. Der erste Ring trug hebräische Schriftzeichen, der zweite lateinische und der dritte arabische. Zusammen schufen sie den Unterbau für ein aufgeschlagenes Buch, das darauf wie auf einem Pult ruhte. Die linke Seite des Buches war mit kyrillischen Schriftzeichen bedeckt, und auf der rechten Seite war die eigentliche Uhr mit einem Ziffernblatt aus Emaille eingelassen, umrahmt von zwölf Diamanten, für jede Stunde des Tages einen. Das Ziffernblatt selbst steckte unter einem gewölbten Glasdeckel, den man öffnen musste, um mich vermittels eines kleinen Schlüsselchens, das unter dem Buch hinter einem Türchen aufbewahrt wurde, aufzuziehen. Außer mit einigen Efeugirlanden und den erwähnten Edelsteinen hatte mein Meister mich mit keinerlei überflüssigem Zierrat oder überraschenden Eigenschaften ausgestattet. Man konnte mich also nicht, wie die berühmten Farbergé-Eier, an geheimer Stelle öffnen, auf dass irgendetwas Absonderliches wie ein krähender Hahn oder ein goldenes herumhopsendes Insekt zum Vorschein kam. Der Auftraggeber hatte darauf bestanden, auf jeden diesbezüglichen Firlefanz zu verzichten, um denjenigen, dem ich zugedacht war, nicht durch solcherlei nutzlose Spielereien zu verärgern.
Wir trafen Ende August in Jasnaja Poljana ein. Man wies uns einen Platz auf der hölzernen Veranda an und servierte meinem Begleiter Tee. Ich selbst steckte nach wie vor in der Holzkiste, doch hatte mein Begleiter diese auf den Tisch gelegt und den Deckel des Kästchens ein wenig geöffnet, wahrscheinlich, um mich, sollte der berühmte Dichter auftauchen, schneller aus meinem Gefängnis befreien und mich ohne viel Umstände überreichen zu können. Wir mussten jedoch über eine Stunde warten, da der Hausherr überraschenderweise zu einem Spaziergang aufgebrochen war, obwohl man ihn von unserer Ankunft, wie man glaubhaft versicherte, rechtzeitig in Kenntnis gesetzt hatte. Mein Begleiter, soviel konnte ich erkennen, war etwas unleidlich, zumal er es nicht gewohnt war, dass man ihn warten ließ. Er hatte offensichtlich mit mehr Respekt gerechnet, schließlich war er ein reicher Mann mit großem politischen Einfluss. Sein Name wurde fast jeden dritten Tag in irgendeiner Zeitung genannt, sobald dort – und das geschah in diesen Tagen sehr häufig – das Thema Fortschritt abgehandelt wurde. So ging also die Zeit dahin, wir hörten die Spatzen in den Bäumen zwitschern und in der Ferne eine Kuh nach ihrem Kälbchen rufen.
Plötzlich polterte ein Bauer in dreckigen Stiefeln zu uns auf die Veranda. Sein Gesicht mit hoher Stirn, dicker Nase und verfilzten Augenbrauen sah finster aus, ein langer Bart wehte ihm bis auf den Rücken und seine Fingerkuppen waren dunkelrot, anscheinend hatte er kurz zuvor von irgendwelchen Früchten genascht oder gar Schlimmeres angestellt. Er hustete einmal laut, wischte sich dann die rechte Hand an seinem Bauernkittel ab und streckte sie meinem Begleiter schwungvoll entgegen, der wie vom Schreck getroffen in die Höhe schoss und zu stottern begann. Dann jedoch begrüßte er sein Gegenüber mit einer zuvor einstudierten Rede, und mir wurde langsam klar, dass es sich bei dem Wilden um den berühmten Dichter selber handeln musste.
»Ich wusste, Sie würden mich mit meinem Problem nicht im Stich lassen«, trompetete Graf Tolstoi sogleich los. »Aus diesem Grund habe ich Ihnen geschrieben, weil ich weiß, dass Sie ein guter Mensch sind, der ein Unrecht nicht einfach auf sich beruhen lassen kann.«
Mein Begleiter stimmte dem zaghaft zu und gab sich bescheiden, jedoch nicht aus wahrer Bescheidenheit, sondern, wie mir erst später klar wurde, um nicht zu sehr in des Grafen Geschichte involviert zu werden. Er sagte denn auch mehrfach nur »nun ja« und »ach«, bis Tolstoi seine Einsilbigkeit unterbrach:
»Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, ist es mein Ziel, zweitausend armen Menschen die Schiffspassage nach Amerika zu ermöglichen, da sie hier doch nur die Wahl zwischen Diskriminierung und Vertreibung haben.«
»Das ist sehr großherzig von Ihnen gehandelt«, sagte mein Begleiter, der seine Sprache wiedergefunden zu haben schien, »wirklich sehr großherzig, und ich freue mich, wenn ich Ihnen bei Ihrem Vorhaben ein wenig behilflich sein kann. Es ist nur so, wie drücke ich es aus, ohne Sie zu verletzen, also es wäre mir sehr lieb, wenn Sie meine Hilfe nicht öffentlich machten und meinen Namen diesbezüglich nicht nennen würden.«
»Ja, verstehe schon«, brummte Tolstoi, und es klang ein wenig unwirsch, »als Geschäftsmann möchten Sie nicht, dass man Sie mit den Duchoborzen in Verbindung bringt.«
»Sie haben es erfasst«, fiel meinem Begleiter ein Stein vom Herzen, »so ist es, so ist es.«
»Sie meinen«, hakte Tolstoi nach, »es wäre schlecht für Ihr Geschäft, wenn der Staat erführe, dass Sie strengen Pazifisten, die den Kriegsdienst verweigern, tatkräftig unter die Arme greifen, um ihnen die Ausreise aus diesem Land zu ermöglichen, während Sie in Ihrer Fabrik allerhand Kriegsgerät für eben diesen Staat produzieren, so dass am Ende also der Staat mit seinem Geld über Umwege es ja selbst wäre, der den Pazifisten unter die Arme griffe?«
»Gewitzt. Ja, so ähnlich. Und bedenken Sie, ich kenne diese Menschen überhaupt nicht, habe nur dieses und jenes von ihnen gehört, das mich, ehrlich gesagt, eher verwirrt, anstatt dass es mich in irgendeiner Form für sie einzunehmen imstande wäre.«
»Was haben Sie denn gehört?«
»Nun ja, dass sie sich bei Protesten gegen die Obrigkeit gerne ihre Kleider vom Leibe reißen und dann splitternackt durch die Gegend marschieren.«
»Da haben Sie Recht. Aber was stört Sie daran?«
»Nun, das gehört sich doch nicht.«
»Aber diese Menschen nach Ostsibirien zu deportieren und ihre Schulen niederzubrennen, das gehört sich, ja?«
»Wie gesagt, ich weiß von alldem nichts und möchte es auch gar nicht wissen. Sie hingegen genießen mein volles Vertrauen, deshalb möchte ich Ihnen helfen.«
Mein Begleiter nestelte in diesem Moment in seiner Jackentasche herum, zog seine Brieftasche hervor, öffnete sie und überreichte Tolstoi einen Scheck. Tolstoi betrachtet das graue, etwas knittrige Papier und sagte: »Oh, das ist überaus freundlich von Ihnen und wird ganz gewiss eine Hilfe sein. Ich werde Sie in meine Gebete einschließen.«
»Ich danke«, sagte mein Begleiter. »Gestatten Sie aber, dass ich Ihnen auch noch ein persönliches Geschenk übergebe, das allein für Sie bestimmt ist und mit dem ich meine Zuneigung zu Ihnen und Ihrem großen Werk unter Beweis stellen möchte«, fügte er umständlich hinzu und langte nach dem Kästchen, um mich endlich ans Tageslicht zu befördern. »Empfangen Sie von mir diese Kaminuhr, deren Symbolik sich Ihnen wohl von selbst erschließen dürfte.«
Mit diesen Worten stellte mein Begleiter mich in all meiner Pracht vor Tolstois Augen auf den Tisch. Der griff sogleich mit seinen rauen Bauershänden nach mir und betrachtete mich wie einen Hammer oder eine Zange von allen Seiten, so dass ich mehr als einmal befürchtete, zu Boden zu stürzen und mein junges Leben frühzeitig beenden zu müssen.
»Überaus reizend, überaus reizend«, flüsterte Tolstoi, »aha, verstehe, Lessing, nicht wahr, die Ringparabel, und, ach Gott, ist das eine Seite aus Krieg und Frieden? Sie beschämen mich, das ist zu viel der Ehre. Fabergé? Sie haben also ein Vermögen ausgegeben für diese Uhr, die übrigens ein klein wenig vor zu gehen scheint, nicht wahr? Ein Vermögen, für das man … Arabisch, Lateinisch, Hebräisch … verstehe … Literatur und Zeit … sehr symbolisch … ein kleines Meisterwerk der Goldschmiedekunst … wo dreht man das Uhrwerk denn auf? … Aha, hier ist der Schlüssel.«