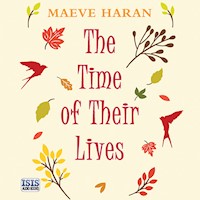6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Auch hinter der größten Regenwolke ist der Himmel noch hoffnungsblau …
Angela, Claire, Sylvia und Monica könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch haben sie einiges gemeinsam – angefangen mit einem Freund, der sie alle nach Italien einlädt. Doch vor allem eint sie eins: gute Gründe, ihrer Heimat London für einige Zeit den Rücken zu kehren. Und wo könnte man besser auf andere Gedanken kommen, als in einer Villa am Mittelmeer? Die erste Begegnung fällt etwas angespannt aus, da jede dachte, sie wäre dort allein, nach einigen Tagen – und Turbulenzen – und diversen Limoncelli, wird aber klar: Das hier kann eine Freundschaft fürs Leben werden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 662
Ähnliche
Buch
Angela, Claire, Sylvie und Monica kennen sich nicht und könnten unterschiedlicher auch fast nicht sein – doch zwei Dinge verbinden sie: Zum einen hat jede einen guten Grund, England für eine Weile den Rücken zu kehren: Sie flüchten vor einem dominanten Ehemann, vor dem peinlichen öffentlichen Verlust der eigenen Firma, einer Mutter, die sich immer wieder einmischt, und vor dem Schmerz, den man empfindet, wenn der eigene Mann eine Affäre mit einer wesentlich jüngeren Frau hat. Die zweite Gemeinsamkeit ist ein Freund, der alle vier unabhängig voneinander einlädt, in seiner Villa in Süditalien, an der Amalfiküste, den Kopf wieder freizubekommen. Jede der vier dachte, sie sei dort allein, und somit ist es nicht verwunderlich, dass das erste Zusammentreffen sehr angespannt verläuft. Doch während die italienische Sonne die Zitronen in ihrem Hain reifen lässt und das Mittelmeer unter ihnen funkelt, erblüht eine Freundschaft, mit der niemand gerechnet hätte – und die umso schöner ist.
Autor
Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. »Alles ist nicht genug« wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in London.
Von Maeve Haran bei Blanvalet lieferbar:
Die beste Zeit unseres Lebens ∙ Das größte Glück meines Lebens
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
MAEVE HARAN
ROMAN
Deutsch von Karin Dufner
Für Vicky Barrass
zum Dank für dreißig Jahre Spaß und Freundschaft – ganz zu schweigen von ihren Ratschlägen, was die italienische Sprache, die dortigen Sitten und Gebräuche sowie die Kunst des Flirtens angeht
Eins
»Du meine Güte, Claire!«
Wie Martin so auf einem Fuß herumhüpfte, erinnerte er Claire an einen Reiher in der Mauser. »Musst du die Kisten dort herumstehen lassen, wo man über sie stolpert? Fast hätte ich mir das Bein gebrochen, verdammt!«
»In fünf Minuten muss ich nach Mayfair fahren und das Essen für den Lunch ausliefern.« Es kostete Claire alle Beherrschung, ihm nicht die Kiste mit den Thunfisch-Ceviche, die sie als Vorspeise eingeplant hatte, über den Schädel zu ziehen. Sie hatte sich heute Morgen schon mit einem gekränkten männlichen Ego herumschlagen müssen, denn sie hatte Harry, den Fischhändler, zu fragen gewagt, ob der Thunfisch auch frisch sei, worauf dieser einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte. Da ihr Harry beruflich gesehen ziemlich nützlich war, hatte sie sein zerzaustes Gefieder gestreichelt und sich entschuldigt. Mit ihrem Ehemann war es hingegen eine andere Sache. Immerhin verdiente sie bereits seit Jahren die Brötchen. Aber ging er ihr dafür zur Hand? Erbot er sich etwa, die Kisten mit den Speisen zum Auto zu tragen? Fehlanzeige. Claire kam zu dem Schluss, dass sie sich entweder zur Menschenfeindin entwickelt hatte oder einfach eine eingefleischte Feministin war. Erschrocken hielt sie damit inne, Plastikkisten im Kofferraum ihres altersschwachen Panda zu verstauen. Eigentlich hatte sie sich nie als Frauenrechtlerin betrachtet. Wenn man sie vor dreißig Jahren gefragt hätte, hätte sie sich eher einen hausfraulichen Typ genannt – vergesst das Verbrennen von BHs, mir ist der heimische Herd lieber. Vielleicht war es ja das Leben, das eine Frau in eine Feministin verwandelte. Oder die Ehe.
Denn wenn man die Angelegenheit richtig tranchierte – und als Inhaberin eines Partyservice konnte Claire im Tranchieren niemand etwas vormachen –, hatte sie zuweilen den Eindruck, dass Männer nichts weiter als verzichtbarer Luxus waren. Eine ihrer Lieblingskarikaturen fiel ihr ein. Die Frau sagt zu ihrem Mann: »Wenn einer von uns stirbt, ziehe ich nach Südfrankreich.« Recht hatte sie.
»Mach dich nicht lächerlich, Claire«, erwiderte ihre Freundin Jan stets, wenn sie derartige subversive Gedanken äußerte. »Du könntest ohne einen Kerl nicht überleben!«
Vermutlich war Martin derselben Ansicht.
Allerdings wollte sie sich im Moment weder mit Martin noch mit ihrem Sohn Evan und ihrer Schwiegertochter Belinda befassen. Die beiden wohnten nun schon seit einem halben Jahr »vorübergehend« bei ihnen, weil es mit ihrer Wohnung nicht geklappt hatte. Sie erschwerten Claire zusätzlich das Leben, weil sie nun ihre Aufträge vorbereiten musste, während ihr zwei weitere Menschen im Weg herumstanden. Ganz zu schweigen davon, dass der Kühlschrank von merkwürdigen Gemüsen und widerlichen Grünkohlsmoothies überquoll. Evan und Belinda ernährten sich aus Prinzip von Rohkost. Ergebnis war, dass in Claires kostbarem Entsafter ständig irgendwelches grüne Zeug klebte.
Claire, schalt sie sich, du klingst ja fast wie deine Mutter. Diese Erkenntnis war derart beängstigend, dass sie sich gedanklich sofort dem bevorstehenden Vormittag zuwandte. Sie hatte noch nie für diese Kunden gekocht. Doch die Inhaberin eines anderen Partyservice, die sie kannte, hatte festgestellt, dass sie überbucht war, und Claire gebeten, den Auftrag zu übernehmen. Die Kunden waren offenbar erfolgreiche Investoren und residierten in einem großen Haus in der Brook Street in Mayfair. Claire wusste eigentlich nicht so genau, was Investoren so trieben, und fragte sich, ob sie sich von den Bankern unterschieden, für die sie in der guten alten Zeit Arbeitsessen ausgerichtet hatte. Bei den meisten hatte es sich um aufgeblasene alte Wichtigtuer gehandelt. Allerdings war hin und wieder auch ein Gefährlicher dabei gewesen, der geglaubt hatte, die Köchin gehöre zum Menü wie die Crème brûlée. Erstaunlich, wie hartnäckig dieser Männertyp sein konnte. Die Generation ihrer Mutter hatte solche Kerle als GIT – Grapscher im Taxi – bezeichnet.
Claire gab die Adresse der Firma in ihr altes, an der Windschutzscheibe befestigtes TomTom ein und winkte ihrer lästigen Familie zum Abschied zu. Das war ihr liebster Moment des Tages. Sie fuhr stets früh genug los, damit sie genug Spielraum für Autopannen, Staus, Parkplatzprobleme oder andere vorhersehbare Katastrophen hatte. Ein Desaster, das sie nicht hatte einplanen können, war der Autofahrer gewesen, der das Heck des alten Transporters gerammt hatte, den sie sich für größere Veranstaltungen lieh. Dabei hatte er die vier ordentlich verpackten Lachse, die für eine Hochzeit bestimmt waren, heruntergestoßen. Zwei der Fische hatte sie durch geschickt platzierte Gurkenscheiben retten können, auch wenn sie entfernt an Nudisten erinnert hatten, die ihren Intimbereich mit Wasserbällen tarnten. Die anderen beiden hatte sie mithilfe eines praktischen Gefrierschranks und der stets mitgeführten Lachsform in eine Mousse verwandelt. Gott sei Dank hatten die Gäste gedacht, sie sei absichtlich so retro. Und zum Glück hatten Braut und Bräutigam zum Zeitpunkt des Servierens schon so viel Champagner intus gehabt, dass ihnen die geänderte Menüfolge nicht aufgefallen war.
Als sie anderthalb Stunden später an der georgianischen Prunkvilla in der Brook Street eintraf, war direkt vor dem Haus ein Parkplatz frei. Claire dachte an den Film Der Schläfer von Woody Allen, in dem der Protagonist gewusst hatte, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn er einen Parkplatz vor einem Krankenhaus bekam. Deshalb war sie zwar erleichtert, aber auch argwöhnisch.
Sie bezahlte die Parkgebühr mit ihrem Handy und trug die Kisten vorsichtig ins Haus. Margie, die sonst hier kochte, hatte ihr den Tipp gegeben, die Kunden seien die übliche Hausmannskost leid und bevorzugten etwas schärfer Gewürztes. Deshalb die Thunfisch-Ceviche, gefolgt von Hühnchen Piri Piri und dem allseits beliebten süßen Brotauflauf, gemacht aus italienischer Panettone und nicht aus abgepacktem Toastbrot.
Sie war gerade damit beschäftigt, in der winzigen Teeküche die Ceviche auf Teller zu verteilen und dabei über Kopfhörer Radio Four zu hören, als die Büroleiterin den Kopf zur Tür hereinsteckte.
»Schön, dass Sie schon so weit sind«, sagte die Frau. »Die letzte Köchin war so schlampig, dass wir sie rausschmeißen mussten.«
»Oh.« Nachdenklich presste Claire die letzte Limette aus. Margie hatte gar nicht erwähnt, dass sie gefeuert worden war. Wie seltsam. Vielleicht war es ihr ja peinlich. In der Welt des Catering sprachen sich Gerüchte schnell herum. Meistens ging es um unerträgliche Kunden, die entweder schlecht bezahlten oder einen behandelten, als wären sie Heinrich der Achte und man selbst ein niederer Dienstbote.
Claire wandte sich wieder der BBC-Sendung You and Yours und dem Thema zu, ob man auch richtig für das Alter vorgesorgt habe. In ihrem Fall überhaupt nicht, denn sie hatte dafür nie genug verdient. Deshalb war es besser, sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie würde eben einfach weiterarbeiten müssen, bis sie hundert war.
Als sie hörte, dass allmählich die Gäste eintrudelten, überprüfte sie alles noch ein letztes Mal. Mineralwasser, still und mit Kohlensäure, auf Eis. Weißwein, obwohl vermutlich nicht viel davon getrunken werden würde. Die Thunfisch-Ceviche auf Tellern. Wie ein ungezogenes Kind tunkte sie den Finger in das würzige Dressing – genau die richtige Mischung aus Chili und Limette. Dann stellte sie das Hühnchen Piri Piri ins Warmhaltegerät und setzte die Brotaufläufe im Miniaturformat zusammen, sodass sie später nur noch einmal Hand anlegen musste, damit sie flockig und unwiderstehlich wurden.
Die letzte Aktion bestand darin, die Speisekarten mit der Hand zu schreiben. In vierzehn Jahren Privatschule hatte sie zwar keine großen Bildungserfolge errungen, doch zumindest eine makellose Schreibschrift gelernt.
Claire förderte ihren altbewährten Füllhalter zutage und machte sich ans Werk.
Zufrieden blickte Angela sich im Laden um. Die Atmosphäre war genau so, wie es sich vorgestellt hatte, als ihr die Idee gekommen war, eine Boutique zu eröffnen.
Das Ambiente war einladend, fast als träte man in ein Wohnzimmer. Perserteppiche, Bücherregale mit Dekoobjekten, Tische, auf denen Töpfe mit ihren geliebten leuchtend roten Nachtfalterorchideen standen, und vor allem lächelnde Verkäuferinnen, die sich eindeutig über jeden Kunden zu freuen schienen.
Wenn Angela eines verabscheute, dann waren es Läden mit Schwellenangst auslösenden weißen Flächen und einschüchterndem Verkaufspersonal, das einen herablassend musterte, als müsste es sich erst mal überlegen, ob man es wert sei, die geheiligte Schwelle zu übertreten. Außerdem war die Lage ein Traum. Der St. Christopher’s Place lag nah genug an der Oxford Street, war jedoch ein wenig ausgeflippt und gemütlich. Es wimmelte hier von gut gelaunten Büroangestellten, die mittags die Straßencafés bevölkerten und ihre Pause vom Schreibtisch genossen. Eigentlich war es fast wie in Paris.
Angela lächelte. Sie erinnerte sich noch deutlich an den Tag in Hongkong, als sie in einem kleinen Laden in einer Seitengasse ein Kleid anprobiert hatte und nicht aufhören konnte, es zu streicheln. Ziemlich peinlich, weil der Inhaber dabei zusah …
»Schöner Stoff«, beteuerte der zierliche Mann und streichelte das Kleid ebenfalls. »Gemacht aus Bambus. Sehr weich. Sogar weicher als Seide.«
Das Kleid war geschnitten wie ein sehr langer Pullover mit einem weiten Ausschnitt und engen Ärmeln. Angela wusste, dass sie es nie wieder würde ausziehen wollen.
So lächerlich es auch sein mochte, fühlte sie sich in seine Weichheit eingehüllt, fast als wäre es eine Liebkosung. Die seltsamen Worte »wie eine Umarmung in einem Kleid« kamen ihr in den Sinn. Angela ahnte in dem Moment nicht, dass ihr gerade der Slogan eingefallen war, der sie berühmt machen sollte.
Damals arbeitete sie in einer Bank, trug nichts als Bürokostüme und ganz sicher nichts, was auch nur den Hauch einer Umarmung verhieß. Nach ihrer dramatischen Bekehrung in Hongkong hatte sie sich gründlich auf dem Modemarkt umgesehen und beschlossen, dass genug Nachfrage nach tragbarer Kleidung bestand, sodass es einen Versuch wert war. Also kündigte sie und gründete Fabric. Ihre Kollegen erklärten sie für verrückt.
Natürlich war das umarmende Kleid nur der Beginn ihrer Kollektion. Es folgten lange, schmeichelhafte Tops, die den Po bedeckten, leichte Strickjacken und Ensembles, die sowohl luxuriös und bequem als auch modisch waren und sich für Frauen über vierzig eigneten. Das Glück wollte es, dass die Fitnesswelle kam. Ihre Mode entsprach dem Bedürfnis der Frauen nach einer lässigeren Lebensweise. Angelas neunzigjährige Mutter hätte so etwas niemals angezogen. Doch genau darum ging es ja. Der Alltag der Frauen hatte sich geändert. Angela startete eine Kollektion Wickelkleider. Obwohl diese laut Auffassung der Modewelt so ausgestorben waren wie der Dodo, verkauften sie sich wie die Taschenbuchausgaben von »Harry Potter«. Ebenso wie die bunten Pashminas – von den Modegurus gleichermaßen verachtet wie von den Kundinnen geliebt. Hinzu kamen hübsche exotische Seidenschals, was Angela einen Vorwand lieferte, immer wieder nach Indien und Marokko zu reisen.
Angela betrachtete sich in einem der großen Spiegel, die auf ihren Wunsch hin überall hingen. Sie hasste Läden, wo man stundenlang herumirren musste, bis man einen fand.
Das Gesicht, das ihr entgegenblickte, erschreckte sie. Trotz ihres makellos gepflegten blonden Bobs, der geschickt ausgewählten Kleidung und der bronzefarbenen Perlenkette, dazu gedacht, die Falten an ihrem Hals zu tarnen, sah sie alt aus. Und was noch schlimmer war, sie wirkte hart. Wider Willen erinnerte sie sich an eine Zeile aus Nora Ephrons wundervollem Essay über das Altern, in der es hieß, man brauche jeden Tag länger, um auszusehen wie man selbst.
Tja, vielleicht war es ja ein Vorteil, dass sie hart war. Das würde sie nötig haben. Vor drei Jahren hatte sie einen großen Anteil von Fabric an einen Investor verkauft, um Geld für die Eröffnung neuer Läden und den Onlinehandel aufzutreiben. Die Expansion war ein großer Erfolg geworden: sechs Filialen und ein florierender Shop im Internet. Fabric machte so gute Umsätze und wurde zudem ständig in der Presse erwähnt, dass die beliebte Fernsehshow Der Handel gilt auf sie aufmerksam geworden war und ihr einen Moderatorenposten angeboten hatte.
Angela sah auf die teure Uhr, die sie sich dank ihrer hohen Umsätze hatte leisten können. Es war halb eins. Um eins wurden sie und ihr Assistent Drew in dem eleganten Büro von Woodley Investment in der Brook Street zum Lunch erwartet.
Mayfair war der Tummelplatz der Investoren, die sich von den Bankern alter Schule abgrenzen wollten.
»Bist du so weit?«, fragte Drew, der gerade oben aus dem Büro kam.
»Was, glaubst du, könnten die wollen?«, erwiderte Angela. Sie und Drew waren von ihren Investoren sehr kurzfristig zu diesem Lunch geladen worden.
»Los, Angie.« Drew verzog das Gesicht. »Du musst doch irgendeinen Verdacht haben. Mir schwant nichts Gutes. Wer mit dem Teufel ins Bett geht, muss wohl damit rechnen, Blessuren davonzutragen.«
»Blessuren wären ja okay. Ich habe nur Probleme damit, wenn man mich bei lebendigem Leibe auffressen will.«
Nachdem Angela sich von den lächelnden Verkäuferinnen verabschiedet hatte, machten sie und Drew sich draußen auf die Suche nach einem Taxi. Um die Ecke vor Selfridges warteten sie immer hordenweise. Eigentlich gab es seit der Invasion der billigen Minicabs von Uber überall Massen von Taxis. Angela warf im Gehen einen Blick zurück auf den Laden. »Gut besucht von Leuten, die ihre Mittagspause zum Shoppen nutzen«, stellte sie zufrieden fest.
»Kannst du denn nie lockerlassen, Angie?« In Drews Tonfall schwang ein kaum merklicher Hauch von Kritik mit.
»Nein. Nie. Das ist mein Geschäft.« Sie musterte ihn, überlegte, ob sie sich gekränkt fühlen sollte, und entschied sich dagegen. »Ich habe alles in Fabric investiert. Der Laden bedeutet mir sehr viel. Und bis jetzt hat er mich nicht im Stich gelassen.«
Spontan ignorierte Angela die Reihe hoffnungsfroher schwarzer Taxis und winkte eine Fahrradrikscha heran, eines von vielen windschiefen Gefährten mit kitschigen Polstern aus künstlichem Samt und undichten Plastikdächern.
»Was soll das?«, protestierte Drew. »Die Dinger sind überteuerte Touristenfallen. Denkst du nicht, es wäre besser, wenn du die erfolgreiche Chefin spielst? Den berühmten Fernsehstar?«
»Zum Teufel damit.« Manchmal bereute sie es, sich für die Show verpflichtet zu haben. Insbesondere deshalb, weil man ihr die Rolle des blonden, männermordenden Vamps gegeben hatte.
Sie musste selbst über ihre verrückte Entscheidung grinsen, als sie hinten einstieg.
»Sind Sie nicht die Dame aus dem Fernsehen?« Der Rikschafahrer betrachtete sie. »Die Gefährliche, die fies zu allen ist und niemandem etwas leiht?«
»Genau.« Angel lachte. »Warum? Sie wollen doch nicht etwa expandieren?«
»Ich nicht. Ich bin Student.«
»Was studieren Sie denn?«
»Betriebswirtschaft.«
Angela lachte wieder. »Viel Glück. Ich bin nicht immer so gefährlich. Eigentlich entscheide ich aus dem Instinkt heraus.«
»Da müssen Sie ja knallharte Instinkte haben.« Der junge Mann sagte das mit einem so breiten Grinsen, dass Angie ihm einfach nicht böse sein konnte.
»Sogar die Rikschafahrer haben Angst vor dir«, raunte Drew. »Also entscheidest du nach Instinkt.« In einem für eine Fahrradrikscha erschreckenden Tempo bretterten sie die Oxford Street hinunter. Mutig versuchte Drew, nach ihrer Hand zu greifen. »Zum Beispiel, dass du dich mit deinem Stellvertreter einlässt?« Er und Angela waren – in Angelas Augen eine ziemlich schlechte Idee – einige Male miteinander ins Bett gegangen. Offen gestanden war sie überrascht gewesen, dass in ihrem Alter überhaupt noch jemand mit ihr schlafen wollte.
»Ach, Drew, das haben wir doch schon hinter uns. Wir waren eben unvernünftig. Es ist nicht ratsam, Geschäft und Gefühl zu vermischen. Außerdem bist du zu jung für mich. Erinnerst du dich an Sie von Rider Haggard?«
»War vor meiner Zeit.«
»Vor meiner auch. Er war Zeitgenosse von Königin Viktoria«, erklärte sie spöttisch. »Er hat die erste Domina erfunden, gespielt von Ursula Andress in der Verfilmung des Romans. Eigentlich hieß sie Ayesha und war unsterblich. Ein netter junger Mann verliebt sich in sie, und sie will ihn auch unsterblich machen. Nur dass die Angelegenheit schiefgeht und sie vor den Augen des armen Jungen zweitausend Jahre alt wird.«
»Ich bin kein Junge, sondern fünfundvierzig.«
»Wenn man in meinem Alter ist, ist das ein Junge.«
»Und war es die Sache wirklich wert?« Sie hörte ihm an, dass er gekränkt war, als sie in die Bond Street einbogen.
»Was meinst du?«
»Dein Leben, Angela. Kein Mann. Keine Kinder. Nicht einmal ein Hund.«
Angela musste sich beherrschen, um ihm keine runterzuhauen. So eine Unverschämtheit!
In ihrer Wut bemerkte sie nicht einmal, dass sie an ihrem liebsten Jo-Malone-Laden und den blauen Gedenkplaketten für Jimi Hendrix und Händel vorbeifuhren.
»Nach dem heutigen Tag könntest du meinen Trost brauchen«, stellte Drew unheilverkündend fest. Sie hielten vor einem georgianischen Schmuckstück, einige Türen vom Claridge’s entfernt. Wie immer drängten sich die Paparazzi vor dem Lieblingshotel der Queen, nicht etwa, um Ihre Majestät zu fotografieren, sondern Alexa Chung, Daisy Lowe oder Karlie Kloss, wenn sie von einem der üblichen Promi-Lunchs kamen.
Drew half Angela aus der Rikscha und musterte die prächtige Fassade des Gebäudes vor ihnen. »Diese Investoren-Bubis machen gern einen auf alte Schule, damit niemand merkt, dass sie in Wirklichkeit eine Gaunerbande sind«, verkündete er.
»Sei nicht so streng mit ihnen. Schließlich haben sie mir für ihre Anteile ein hübsches Sümmchen bezahlt und mich danach in Ruhe gelassen.«
»Bis jetzt«, lautete seine düstere Antwort. »Man nennt sie nicht umsonst Geier. Es interessiert sie nicht, worin sie investieren. Sie sind nur auf ihren Profit aus. Sieh dir doch die Leute an, die dieser Schuhdiva etwas geliehen haben. Sie meinte, die konnten einen Stiletto nicht von einem Cornetto unterscheiden. Aber lass uns gehen, sie können ja nichts weiter tun, als uns zu vierteilen.«
Das Innere der Firmenzentrale von Woodley Investment war noch prunkvoller als das Äußere, falls das überhaupt möglich war. Ein dienstbarer Geist nahm Angela den Mantel ab und führte sie durch eine riesige, mit beeindruckenden schwarz-weißen Kacheln geflieste Vorhalle. Dahinter schwang sich eine noch gewaltigere Treppe empor, so eine wie jene, die Scarlett O’Hara hinuntergeschritten war. Sie war mit einem tiefroten Teppich ausgelegt und hatte ein verschnörkeltes Geländer aus schwarzem Metall. Das Blumenarrangement auf dem Flurtisch war so groß, dass sicher zwei Männer nötig gewesen waren, um es ins Haus zu schleppen. Erhellt wurde das Ganze von Kronleuchtern aus Kristall.
»Der Sonnenkönig persönlich hätte diese Burschen angepumpt«, flüsterte Drew.
Eine schlanke junge Frau im schwarzen Businesskostüm und mit glattem dunklem Haar erschien, fast als wäre sie aus der Wandvertäfelung getreten. »Guten Morgen, Miss Williams. Mr. Northcott und Mr. Fisher sind gleich bei Ihnen. Wenn Sie mir bitte folgen würden.«
Plötzlich wurde sich Angela ihres von der Rikschafahrt zerzausten Haars bewusst. »Könnte ich zuerst auf die Toilette?«
»Die nächste befindet sich im Untergeschoss.«
Erleichtert eilte Angela die mit einem teuren Teppich versehenen Stufen hinunter. Es war die Art von Damentoilette, wie man sie in einem Herrenclub antraf – groß, nicht modernisiert und Zeugin eines altväterlichen Elitedenkens, das keine albernen italienischen Wasserhähne oder kitschig geformten Waschbecken nötig hatte, um Statusbewusstsein auszustrahlen.
Angela frischte ihren Lippenstift auf und bürstete sich die Haare. Zehn Minuten an der frischen Luft hatten ihre Wangen rosig gefärbt. Sie beugte sich zu ihrem Spiegelbild vor und sprach die allseits bekannten Worte aus der Fernsehsendung: »Los, Angela. Der Handel gilt.«
Am anderen Ende des Raums sprang eine zierliche philipinische Hausangestellte hervor, die sich vermutlich in einer der Kabinen versteckt hatte. »Ich wusste, dass Sie es sind, als Sie mir Ihren Mantel gegeben haben!«, rief sie begeistert. »Sie sind wundervoll! Sie lassen sich von niemandem was gefallen!« Die Hausangestellte sah sich rasch um, als befürchtete sie, eine Grenze überschritten zu haben. »Könnten Sie mir ein Autogramm geben?« Sie zog ein Stück Papierhandtuch aus dem Spender und reichte es Angela.
»Wie heißen Sie?«
»Nina.« Die kleine Frau lächelte verzückt.
»Für Nina, die auch wundervoll ist. Beste Wünsche, Angela.«
Nina drückte das Papierhandtuch an ihre magere Brust.
Angela wusch sich die Hände. »Okay, Angela«, sagte sie sich. »Du lässt dir von niemandem was gefallen!«
Angela richtete sich zu ihren vollen eins fünfundsiebzig auf und marschierte ins Speisezimmer. Nicht die prunkvolle Ausstattung mit einem gewaltigen Konferenztisch, luxuriösen Vorhängen an den Fenstern und noch mehr Blumen war es, was sie erschreckte. Nein, es war die Tatsache, dass fünf Personen an diesem Tisch saßen. Nicht nur die beiden jungen Männer – verwöhnte Privatschulbübchen, deren Namen sie bereits vergessen hatte. Eddie? Nein, Jamie. Hieß der andere vielleicht Adam? -, sondern drei weitere Leute, zwei Männer und eine Frau, die man auf den ersten Blick als Anwälte erkannte.
Drew sah sie an. Offenbar teilte er ihre Bedenken.
»Miss Williams, hallo.« Jamie hielt ihr die Hand hin. »Sehr erfreut, Sie leibhaftig kennenzulernen, um es einmal so auszudrücken. Ich bin ein großer Bewunderer von Der Handel gilt.« Er lächelte einnehmend. »Ich bin erleichtert, dass Woodley keinem Ihrer Kandidaten etwas leihen muss.«
»Es sind keine Kandidaten«, entgegnete Angela streng. »Sondern echte Geschäftsleute, die eine Investition brauchen.« Sie ließ den Blick über die Runde schweifen. »So wie ich damals von Ihnen.«
»Fabric hatte deutlich mehr Potenzial als Strampelanzüge für Hunde.« Jamie lächelte seinen Kollegen herablassend zu.
»Offen gestanden war es sehr klug von mir, in Poochy Protectors zu investieren. Sie waren ausgesprochen erfolgreich.«
»Schön und gut«, fuhr Jamie rasch fort. »Adam Northcott kennen Sie ja schon. Mary, Tim und Seb sind von unserer Rechtsabteilung.«
»Wie reizend von Ihnen, mich im Voraus zu informieren, dass Anwälte anwesend sein würden.« Ihr leicht stählerner Unterton sorgte dafür, dass alle plötzlich ihre Servietten ausschüttelten.
»Bitte nehmen Sie Platz.«
Angela bemerkte die Frau vom Partyservice, die an der Tür darauf wartete, die Vorspeise servieren zu können. Sie stellte einen Teller vor jeden hin und verteilte Brot, das in Angelas Augen sehr lecker aussah. Dann fing sie an, die Gläser zu füllen. »Stilles Wasser oder mit Kohlensäure?«
»Für mich mit Kohlensäure.« Angela hielt der Frau ihr Glas hin.
»Verzeihung«, unterbrach Jamie und schwenkte Claires sorgfältig mit der Hand geschriebene Speisekarte. »Was soll das hier sein?« Schmollend wies er auf die Vorspeise.
»Thunfisch-Ceviche«, antwortete Claire bemüht höflich. »Ein Gericht aus Peru. Thunfisch, mariniert in Chili und Limetten.«
»Wenn ich Chili will, gehe ich zum Mexikaner. Was ist aus der Tomaten-Basilikum-Suppe geworden, die wir bestellt haben?«
Claire wurde von Panik ergriffen. Sie dachte an die Piri-Piri-Salsa, die es zum nächsten Gang geben sollte. Offenbar war ihm das noch nicht aufgefallen. Was hatte Margie da angestellt? Hatte sie ihr absichtlich falsche Informationen gegeben? Falls das die Rache für ihre Kündigung gewesen sein sollte, würde sie Margie bei ihrer nächsten Begegnung ermorden. Es war schon an sich schlimm genug, so gedemütigt zu werden. Und dann auch noch in Gegenwart der Frau mit dem harten Blick aus dem Fernsehen. Hinzu kam, dass sie sich von diesem überbezahlten Schnösel gönnerhaft behandeln lassen musste …
»Nun, ich liebe Thunfisch-Ceviche«, mischte sich Drew ein. »Frisch, elegant und groß im Kommen.«
Jamie beäugte ihn, als wäre er gerade unter einem Stein hervorgekrochen.
Kurz darauf sammelte Claire die Teller ein – alle bis auf Jamie hatten aufgegessen – und hastete, so schnell sie konnte, in die Küche, um das Piri Piri von den Hühnerbrüsten abzukratzen. Hektisch hackte sie einige Pilze, die sie eigentlich als Dekoration hatte verwenden wollen, und schmorte sie auf dem Herd. Dann würde sie eben die fürs Dessert bestimmte Sahne benutzen müssen.
Sobald die Pilze sich erwärmten und dunkle Flüssigkeit austrat, rührte Claire die Sahne unter. Einen Teil behielt sie zurück, um sie für den Nachtisch mit Milch zu verdünnen.
Zu ihrer Erleichterung sah das Gericht gar nicht so schlecht aus, als sie es mit dem Reis, der eigentlich zum Piri Piri gehörte, und grünem Salat auf Tellern verteilte.
Während sie das von Chili befreite Huhn vor Angela hinstellte, fing sie deren Blick auf. Angela lächelte fast unmerklich und schaffte es, ihr zu vermitteln, wie sehr sie diesen Privatschulschnösel verabscheute.
Angela wusste von früheren Treffen, dass sie erst beim Kaffee zum eigentlichen Geschäft kommen würden. Deshalb tat sie ihr Bestes, um das alberne Geschwätz über Kinder, Börsenkurse und wer wohl die nächste Vorrunde gewinnen würde, zu erdulden.
Schließlich wurde das köstlich duftende Dessert serviert. »Von wem ist das Rezept?«, erkundigte sich Angela, ehe Jamie oder Adam Gelegenheit zu einer Beschwerde hatten.
»Nigella Lawson.« Die Frau lächelte. Sie hatte ein sehr hübsches Lächeln, das ihr ziemlich rundliches Gesicht erhellte. Herrje, Angela konnte nicht anders, als einen professionellen Blick über sie schweifen zu lassen, diese schrecklichen Klamotten.
»Meinen Löffel kann sie meinetwegen täglich ablecken«, verkündete der Schmierlappen, den Angela als Adam identifiziert hatte.
Die Anwältin verdrehte die Augen himmelwärts.
Die Frau räumte das Geschirr ab. Offenbar hatte sie beschlossen, dass diese Bemerkung keine Antwort wert war.
Sobald die Teller in der Küche waren, kehrte sie mit einer Kaffeekanne und Pfefferminzplätzchen zurück.
»Wenigstens die Plätzchen sind in Ordnung«, witzelte Jamie. Er beugte sich zu Angela hinüber und raunte: »Ich wette, dieser Frau würden Sie bei Der Handel gilt nichts leihen. Kein Darlehen für die muffige Kuh vom Partyservice.«
»Ich fand sie offen gestanden sehr nett«, meinte Angela. »Außerdem sind bei Caterern, im Gegensatz zu Investoren, die Gewinnspannen sehr gering. Also bezweifle ich, dass sie sich bei Der Handel gilt bewerben würde.«
In der Küche schmunzelte Claire in sich hinein. Angela wusste, wie man diese arroganten feinen Pinkel zurechtstutzte.
Als sie sich umdrehte, stellte sie überrascht fest, dass Angela ihren schmutzigen Teller selbst in die Küche gebracht hatte.
»Das wäre nicht nötig gewesen.« Claire bedankte sich.
»Gern geschehen. Entschuldigen Sie das Theater von vorhin. Das Essen war lecker – insbesondere der Nachtisch. Ich liebe italienische Panettone.«
»Ich liebe die italienische Küche überhaupt«, antwortete Claire angesichts dieser freundlichen Geste. »Es ist mein Traum, mich darauf zu verlegen und ein Restaurant mit Räumlichkeiten zu betreiben.« Sie lächelte Angela an. »Doch das kann ich wohl vergessen. Übrigens heiße ich Claire.«
»Verzeihung, meine Damen«, rief einer der lästigen Unsympathlinge. »Das ist hier kein Mütterkränzchen. Zeit fürs Geschäftliche.«
Mit zornig funkelnden Augen drehte Angela sich um. Sie hatte Gönnerhaftigkeit schon immer gehasst. Außerdem war sie ja nicht einmal Mutter.
»Richtig.« Offenbar hielt es der Quälgeist namens Adam für an der Zeit, auch seinen Senf dazuzugeben. »Zum Geschäftlichen.« Er beugte sich vor und legte die Fingerspitzen aneinander, als wäre er Henry Kissinger und im Begriff, den Weltfrieden auszurufen. »Wir haben von einem sehr solventen Interessenten ein ausgesprochen attraktives Angebot für Fabric erhalten, von dem sowohl Sie als auch wir beträchtlich profitieren werden. Genau genommen ist dieses Angebot so vorteilhaft, dass wir am liebsten sofort anfangen und das Geschäft in zwei Wochen abschließen würden.«
Fast wäre Angela an ihrem Minzplätzchen erstickt. »Aber Fabric steht nicht zum Verkauf!«
Sie wusste, dass es Investoren mehr um schnelle Gewinne als um Verkäufe ging und dass sie vor drei Jahren in Fabric investiert hatten. Doch sie konnten sie doch schlecht zwingen zu verkaufen, oder? Außerdem tätigte man auf diese Hauruck-Methode keine wichtigen Transaktionen. Offenbar hatten sie schon seit Wochen oder gar Monaten hinter den Kulissen daran gearbeitet. Und zwar ohne Absprache mit ihr. Sie sollte hinausgedrängt werden! Die wollten die Firma über ihren Kopf hinweg verkaufen!
»Und wer ist dieser solvente Interessent?«
»Die Tuan Corporatio aus Singapur. Sie haben bereits einige Modeketten erworben und finden, dass Fabric perfekt in ihr Portfolio passen würde.«
»Sind das nicht die Leute, die Material Girl gekauft haben?«
»Ja, ich glaube schon.«
»Sie haben eine ausgezeichnete Kollektion übernommen und kaputtgemacht! Schlichte, elegante Kleidungsstücke haben sie mit Perlen und Pailletten bestickt und sie so verdorben!«
»Soweit ich informiert bin, sind die Verkäufe in Asien seitdem in die Höhe geschnellt.«
»Wenn die in Peking Glitzerkram wollen, sollen sie ihn in ihren eigenen Firmen herstellen, aber gewiss nicht in meiner.«
»Miss Williams, Sie würden dabei eine beträchtliche Summe verdienen.«
»Sie auch!«
»Das ist Ziel und Zweck unserer Investition.«
»Und außerdem dürfte ich zusehen, wie meine Marke zerstört wird! Die Marke, die ich am Küchentisch entwickelt und in die ich unbezahlt all meine Zeit gesteckt habe, bis Fabric auf eigenen Füßen stand. Ich weigere mich.«
»Miss Williams«, meldete sich die Anwältin zum ersten Mal zu Wort. »Darf ich Sie an die Mitveräußerungsvereinbarung im Gesellschaftsvertrag erinnern?«
Angela wurde klar, dass sie diesen Kram nie so richtig verstanden hatte. Zum Teil auch deshalb, weil sie nicht im Traum daran gedacht hatte, dass es je so weit kommen könnte. »Wie lange planen Sie dieses Geschäft schon hinter meinem Rücken?«
»Natürlich recherchieren wir diese Möglichkeit bereits seit einer Weile, das ist übliche Geschäftspraxis.«
»Und was wäre dann meine Rolle in meinem eigenen Unternehmen?«
»Mr. Tuan könnte Sie als Symbolfigur von Fabric an Bord behalten, und auch einige der Anteile blieben in Ihren Händen. Aber soweit ich gehört habe, regelt er die Dinge lieber selbst.«
»Die Symbolfigur von Fabric …«, wiederholte sie zornig. »Ich werde zu nichts meine Zustimmung geben, ehe ich nicht mit meiner Anwältin gesprochen habe. Und falls ich sie nicht erreiche, läuft überhaupt nichts, ganz gleich wie solvent der Interessent auch sein mag.«
Sie stand auf und marschierte, gefolgt von Drew, hinaus.
»Ich fasse es nicht, dass die so was versuchen!«, zischte sie, als sie außer Hörweite waren.
»Du könntest ziemlich absahnen«, wandte Drew ein.
Fest entschlossen, sich nicht belauschen zu lassen, schleppte sie Drew in die Damentoilette im Untergeschoss, ohne auf die piepsigen Proteste der Hausangestellten gegen die Anwesenheit eines Menschen männlichen Geschlechts zu achten. Nach einigen Versuchen hatte sie ihre Anwältin am Apparat und schilderte ihr die Situation.
»Lassen Sie mich kurz zusammenfassen«, erwiderte die Anwältin. »Die behaupten, dass Sie nicht in der Lage sind, das Angebot abzulehnen, wenn sie beschließen zu verkaufen.«
»Genau. Das kann doch nicht wahr sein, oder?«
Am anderen Ende der Leitung herrschte unheilverkündendes Schweigen.
»Ich fürchte, das ist es. Sie haben sich im Austausch gegen eine sehr großzügige Summe dazu bereit erklärt, als Sie einen großen Teil des Werts von Fabric abgestoßen haben.«
Obwohl Angela sich für eine gute Geschäftsfrau hielt, trieb sie dieses Juristenchinesisch in den Wahnsinn. Sie war sicher, dass die Anwältin ihr das damals nicht so erklärt hatte. War sie womöglich falsch beraten worden? Wenn ja, würde sie klagen – aber das könnte womöglich nicht verhindern, dass sie ihre Firma verlor.
»Das war vor drei Jahren«, beharrte sie ärgerlich. »Seitdem haben meine harte Arbeit und meine Kreativität den Wert des Unternehmens beträchtlich erhöht. Des Unternehmens, das Mr. Tuan aus Singapur mir wegnehmen und zerstören will.«
»Sie könnten jederzeit ein neues gründen. Sie hätten ja dann mehr als genug Geld, Angela.«
»Ach, Sie können mich mal kreuzweise!«
Die zierliche Angestellte saß offenbar dem Trugschluss auf, dass Angela sich gerade erfolgreich zur Wehr setzte, und lächelte aufmunternd.
Als sie in den Speisesaal zurückkehrten, herrschte aufgeregtes Getuschel, das bei Angelas Eintreten schlagartig verstummte.
»Gut, meine Damen und Herren«, verkündete Angela in eisigem Tonfall. »Anscheinend haben Sie recht.«
Claire, die in der Teeküche lauschte, war entsetzt darüber, wie man eine kluge Frau wie Angela so schäbig behandeln konnte. Ihr fiel nichts Besseres ein, als mehr Kaffee und ein paar von ihren hausgemachten Schokokeksen anzubieten.
»Ganz gleich was auch geschieht« – Angela schleuderte ihr Haar zurück, was Drew als Anzeichen von Stress deutete –, »heute werden keine Beschlüsse gefasst.«
»Natürlich.« Jamie nickte anteilnehmend. Er ahnte, dass sie bekommen würden, was sie wollten. »Aber ist Ihnen klar, dass es letztlich Ihre einzige Option ist?«
Angela stand auf und ging zu dem großen, geschwungenen Fenster. Claire spürte – offenbar als Einzige im Raum –, wie sehr sie litt. Sie bemerkte, dass Jamie unter dem Tisch eine anzügliche Siegesgeste machte. Jetzt war es endgültig genug. Erst ihr Mann Martin, dann Harry, der Fischhändler, und nun dieser geistige Vorgartenzwerg.
Als Claire Jamies Tasse nachfüllte, zuckte plötzlich ihr Arm, sodass die kochend heiße Flüssigkeit mit der tödlichen Präzision einer Drohne auf seinem Schoß landete. Jamie sprang mit einem Schrei auf.
»Sie dämlicher Trampel!«, tobte er. »Erst kriegen Sie das Menü nicht hin, und dann fügen Sie mir einen bleibenden Schaden zu. Hier werden Sie jedenfalls nicht mehr arbeiten.« Er wandte sich an sein Team von Anwälten. »Können Sie die nicht verklagen oder so?«
Das Meeting glitt ins Chaos ab.
Gerade wollte Drew Angela diskret seine Unterstützung anbieten, als in seiner Tasche das Telefon vibrierte.
Es war sein alter Freund und Mentor Stephen Charlesworth, der wegen seiner legendären Geschäftstüchtigkeit den Spitznamen »der Seher von Southwark« trug. Stephen war nicht nur berühmtermaßen erfolgreich, sondern außerdem ein berüchtigter Eigenbrötler, weshalb Drew einen Anruf von ihm unmöglich ignorieren konnte, ganz gleich wie ungünstig die Umstände auch sein mochten. Deshalb zog er sich in die Teeküche zurück, wo Claire beim Aufräumen jedes Wort des Telefonats mitbekam.
»Stephen«, flüsterte Drew. »Ich kann jetzt nicht reden. Bin in einem ziemlich scheußlichen Meeting.«
»Ich weiß«, lautete die überraschende Antwort.
»Woher?« Stephen konnte doch unmöglich über derart ausgeprägte hellseherische Kräfte verfügen.
»Jemand hat es getwittert. ›Aus und vorbei für die männermordende Angela‹, zitierte er. ›Der Fernsehqueen wird der eigene Laden über dem Kopf wegverkauft.‹ Drew, du solltest sie warnen. Die Presse wird sich auf sie stürzen wie die Maden auf ein Stück Aas.«
»Eine reizende Metapher.«
»Wie geht es ihr? Pass auf, Drew, falls sie eine Auszeit braucht, ich besitze eine Villa in Italien. Und wenn sie eine Erklärung verlangt, sagst du ihr, der Eigentümer habe ein Angebot erhalten, das Anwesen zu verkaufen und ein Hotel daraus zu machen, und er würde sich über ihren Rat freuen.«
»Einverstanden. Du kennst sie ja von früher.«
»Das ist schon lange her. Erwähn es um Himmels willen nicht, sonst fährt sie nie hin.«
»Stephen, was führst du im Schilde?«
»Ich habe eben ein gutes Herz.«
»Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt ein Herz hast.«
»Aber, aber, Drew. Durch Erfolg wird man doch nicht gleich herzlos.«
»Meiner Erfahrung nach passiert das öfter.«
Claire versteckte sich in der Küche, bis alle weg waren, damit sie die Spülmaschine einräumen und das Gehörte Revue passieren lassen konnte. Würde Angela wirklich die Flucht ergreifen? Auf Claire machte sie einen ziemlich robusten Eindruck. Allerdings konnte sie sich gut vorstellen, dass die Zeitungen auf die harte Geschäftsfrau aus dem Fernsehen, die im wirklichen Leben ihre Firma verlor, die Jagdsaison eröffnen würden.
Sie stapelte die Teller in ordentlichen Reihen, füllte den Besteckkorb und stellte die Gläser in die oberste Schublade, bevor sie ihre eigenen Sachen in einer großen orangefarbenen Tasche von Sainsbury verstaute, auf der ein Elefant abgebildet war.
Nachdem sie den Konferenztisch mit einem Schwammtuch abgewischt und dieses ins Spülbecken gelegt hatte, sah sie jemanden in der Tür stehen. Claire erkannte die Personalchefin, die ihr erzählt hatte, sie habe Margie feuern müssen.
Seufzend machte sich Claire auf das Jüngste Gericht gefasst.
»Ich habe gerade mit Mr. Fisher gesprochen. Offenbar glaubt er, Sie hätten ihn absichtlich verletzt.«
»Unsinn«, protestierte Claire. »Es war schlicht und ergreifend ein Missgeschick.«
»Und was ist mit dem geänderten Menü?«
Claire kam zu dem Schluss, dass man sie für eine Spinnerin halten würde, wenn sie Margies Sabotageakt breitträte. »Es tut mir sehr leid, aber ich hatte keine Ahnung, dass das Menü bereits festgelegt war.«
»Aha«, entgegnete die Frau streng. »Tja, ich bin der Ansicht, dass Ihre Fähigkeiten vielleicht nicht unseren Anforderungen genügen könnten. Schicken Sie mir Ihre Rechnung, ich kümmere mich darum.« Claire schulterte ihre schwere Tasche und stieg die mit einem dicken Teppich belegte Treppe hinunter.
»Claire!«, zischte plötzlich eine Stimme.
Es war Angela, einen nervös wirkenden Drew im Schlepptau.
»Könnten Sie nachsehen, ob die beiden Reporter noch vor der Haustür stehen? Offenbar sind mir die Mistkerle schon auf den Fersen.«
Claire spähte hinaus. Auf der anderen Straßenseite lauerte tatsächlich eine kleine Gruppe von Journalisten auf eine Gelegenheit zuzuschlagen.
»Ja«, teilte sie Angela mit. »Sind Sie sicher, dass die nicht auf jemandem aus dem Claridge’s warten?«
»Das will ich nicht riskieren. Ob dieses Haus wohl einen Hintereingang hat?«
»Mein Auto steht gleich vorne. Es ist ein blauer Panda. Hier sind die Schlüssel. Steigen Sie ein. Ich lenke den Feind mit der übrig gebliebenen Panettone ab. Besser, als wenn mein Mann sie kriegt.«
Ehe Angela ablehnen konnte, hatte Claire ihr schon die Schlüssel zugeworfen und marschierte über die Straße auf die Reportermeute zu. »Hallo, Jungs, ihr seht ja halb verhungert aus. Am besten verteile ich jetzt diesen köstlichen Brotauflauf, bevor er noch schlecht wird.« Sie überreichte der Meute das Dessert.
Die drei Reporter stürzten sich darauf wie Löwen auf ein Gnu. Claire machte auf dem Absatz kehrt und überquerte rasch die Brook Street, wobei sie mit einer nachdrücklichen Handbewegung den Verkehr anhielt. Als sie auf den Fahrersitz ihres Panda sprang, stellte sie erleichtert fest, dass Angela hinten und Drew auf dem Beifahrersitz saßen. Sie brauste davon, ehe die Schreiberlinge ihren Trick durchschaut hatten.
»Mein Gott.« Angela blickte aus dem Heckfenster. »Das war brillant. Vielen, vielen Dank.«
»Keine Ursache.« Claire grinste. »Hat mir Spaß gemacht. Wohin?«
»Ich wohne in Marylebone, aber irgendeine U-Bahnstation wäre in Ordnung.«
»Unsinn. Ich setze Sie zu Hause ab und fahre auf der Hochstraße zurück zur A40. Fast kein Umweg.«
»Wenn Sie sicher sind.«
»Offenbar hatten Sie ein scheußliches Treffen.«
»Ja. Doch wenn Sie die Presse nicht abgelenkt hätten, hätte es noch viel schlimmer ausgehen können.«
»Ich muss zugeben, dass es eine Abwechslung war. Offen gestanden ist mein Arbeitsalltag normalerweise ein bisschen langweilig.«
»Deshalb die Idee mit dem Restaurant mit Räumen.«
»Italien ist meine Leidenschaft. Vielleicht hatte meine Ururgroßmutter ja eine Affäre mit einem neapolitanischen Seemann.« Sie lächelte Angela im Rückspiegel an. »Wenn man sich ihr Foto ansieht, war es vermutlich eher ein Eisverkäufer. Jedenfalls hatte ich schon immer eine Schwäche für dieses Land.«
»Wenn dein geheimnisvoller Freund es ernst meint«, wandte sich Angela an Drew, »könnte Claire vielleicht mitkommen. Ich hatte gerade ein großzügiges Angebot von einem Freund von Drew«, erklärte sie Claire. »Ich könnte für eine Weile nach Italien verschwinden.«
»Ich wäre sofort dabei«, verkündete Claire. »Egal ob es meinem Mann passt oder nicht.« Da sie plötzlich befürchtete, zu aufdringlich gewesen zu sein, konzentrierte sie sich aufs Fahren.
Sie waren bereits am Marble Arch.
»Könnten Sie nach Selfridges vielleicht links abbiegen?«, sagte Angela zu Claire und wies auf die Zufahrt zur Duke Street. Einen knappen Kilometer später kamen sie an dem wunderschönen Gebäude aus dem achtzehnten Jahrhundert vorbei, das die Wallace Collection beherbergte. Als sie sich dem St. James’s Spanish Place näherten, deutete Angela auf eine schmale Zufahrt zu einer Siedlung. »Hier wohne ich. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Sie haben mir den Hals gerettet.« Sie und Drew stiegen aus und winkten Claire zum Abschied zu.
Sie beobachtete, wie die beiden die belebte Straße überquerten. Es musste wirklich seltsam sein, wenn man derart berühmt war. Obwohl Angela so viele Vorteile auf ihrer Seite hatte, wurde sie gejagt und schwebte in Gefahr, ihre Firma zu verlieren.
In diesem Moment bemerkte sie den Strafzettel unter ihrem Scheibenwischer. Sie war so sehr mit dem Gespräch mit Angela beschäftigt gewesen, dass er ihr bis jetzt gar nicht aufgefallen war. Spitze.
Alles in allem hatte sie heute etwa vierzig Pfund Verlust gemacht. Sie unterdrückte den Drang, in Tränen auszubrechen, und dachte an den geheimnisvollen Anrufer und sein Angebot an Angela. Hatte Angela ihren Vorschlag, sie mitzunehmen, wirklich ernst gemeint?
Zwei
Sylvie Sutton schob sich in ihr chaotisch zugestelltes Büro, das sich in einem umgebauten Pub am weniger angesagten Ende der King’s Road befand. Mit Mühe gelang es ihr, sich hinter ihren Schreibtisch zu setzen.
Es amüsierte sie stets, dass diese Straße einst ein Privatweg im Besitz von King Charles II. gewesen war, weil sie diesen Monarchen besonders verehrte. Sie bewunderte den Übergang vom Puritanismus zu der Lebenslust, die unter seiner Regentschaft ausgebrochen war – ganz zu schweigen von den wundervollen schulterfreien Kleidern seiner Epoche. Wenn sie sich hätte aussuchen können, in welcher Zeit außer der heutigen sie am liebsten gelebt hätte, so wäre es diese gewesen.
Interessanterweise hatte der Pub früher King’s Arms geheißen. Allerdings war es das Einzige, was die baufällige, nach Bier riechende, feuchte Bruchbude mit Großbritanniens genussfreudigstem König gemeinsam hatte.
Die King’s Road selbst hatte sich seit der Hippiezeit stark verändert. Damals war sie das Epizentrum des Swinging London gewesen. Angefangen beim Chelsea Drugstore, unsterblich gemacht von den Rolling Stones in »You Can’t Always Get What You Want«, bis hin zum Nachtclub The Pheasantry mit seinen sieben Meter hohen griechischen Säulen und den ausgeflippten Gästen. Bei dem Gedanken, dass nun ausgerechnet eine Filiale von Pizza Express darin untergebracht war, musste Sylvie ein Schaudern unterdrücken.
Sie bevorzugte die gemütliche Boheme-Atmosphäre des Chelsea Arts Club ein Stück die Straße hinunter, der einen geheimen Garten aufwies. Auch den inzwischen geschlossenen Queen’s Elm Pub ganz in der Nähe hatte sie geliebt. Literaturschaffende wie Laurie Lee, die Autorin von Cider mit Rosie, hatten dort verkehrt, regelmäßig am Tresen gelehnt und kostenlose Seminare in moderner Literatur gegeben.
Sylvie zog den Bauch ein, um sich besser bewegen zu können. Der Raum, ja das gesamte Gebäude diente zum Teil als Büro und zum Teil als Lagerfläche für ihre Antiquitätenhandlung und beherbergte außerdem ihre Sammlung exotischer Stoffe, die ihren innenarchitektonischen Stil prägten. Exotik und Extravaganz betrachtete Sylvie nämlich als ihr Markenzeichen. Zum Teil lag es an ihrer Kindheit, in der sie ihrem Vater, einem Diplomaten, in ferne Länder wie Syrien, Ägypten und den Iran gefolgt war. Allerdings hatte es auch geschäftliche Gründe. Der Markt für den englischen Landhausstil war übersättigt, obwohl einige Kunden – für gewöhnlich Ausländer – ganz verrückt danach waren. Sylvies dramatischer, üppiger und überladener Look zog Menschen an, die das Theatralische liebten, geradeso als wäre ihr Zuhause eine Bühne, wo jeden Moment etwas Aufregendes geschehen konnte. Sylvie verabscheute die tausendundein Schattierungen von Beige, die Londons Wände marterten, fast ebenso sehr wie den angesagten Shabby-Chic, in ihren Augen nichts weiter als Massen zerschrammter Möbel und alberner Ballettröckchen aus rosafarbener Spitze, überall drapiert, als wollte die Bewohnerin gleich in Schwanensee auftreten.
Die Wände von Sylvies Büro waren in der Farbe gestrichen, die ebenfalls ihr Markenzeichen war – in einem strahlenden Kobaltblau. Allerdings war das nur schwer festzustellen, da sie fast vollständig mit Fotos bedeckt waren, denn Sylvie knipste mit ihrem geliebten Smartphone alles, was ihr vor die Linse kam. Die Bilder stellten silberne marokkanische Teekannen, bunte Seilenden auf Stränden, Goldfinken im Garten des Pub, orangefarbene Taschenbücher von Penguin aus dem Sozialkaufhaus nebenan, einen beeindruckenden scharlachroten chinesischen Wandschirm und ein makellos blaues Entenei dar.
Traurig blieb ihr Blick an dem Foto ihrer Tochter Salome – inzwischen nannte sie sich beharrlich Sal – und ihren beiden Enkelkindern hängen, die Sylvie nur selten sah. Ihre Tochter konnte eine überkandidelte Mutter wie Sylvie nicht ertragen und gab ihrer spießigen und deshalb weniger bedrohlichen Schwiegermutter den Vorzug.
Und dennoch wusste Sylvie, dass ihre Exaltiertheit ihre Einzigartigkeit ausmachte und gut fürs Geschäft war. Außerdem war sie eine wunderbare Tarnung, wann immer sie richtig in Sorge war. So wie jetzt gerade.
Wenn sie ihre langen roten Locken zurückschleuderte und in die Hände klatschte wie eine strenge Ballettlehrerin, bemerkten die Menschen die Panik hinter den grün geschminkten Augenlidern nicht. Ihr derzeitiges Zwei-Millionen-Pfund-Projekt war eine Sechszimmerwohnung in Belgravia. Die Besitzer kamen aus Moskau und wollten in drei Tagen eintreffen. Und dann würden sie erwarten, dass die Wohnung mehr als perfekt eingerichtet war.
Wie Sylvie festgestellt hatte, musste für ihre russischen Auftraggeber alles bis ins letzte Detail fertig sein. Bis hin zu gemachten Betten, als befänden sie sich in einem Hotel und nicht in den eigenen vier Wänden. Oft fragte sie sich, warum diese Leute nicht einfach ins Savoy oder ins Ritz zogen. Doch sie genossen es, sich wie in einem Hotel oder einer Musterwohnung zu fühlen, wo jede Vase gefüllt, jeder Gegenstand ausgewählt und jedes Kaminsims mit Fotos in silbernen Rahmen geschmückt war. Einmal hatte sie einen Klienten ein halbes Jahr nach seinem Einzug besucht und die Fotos von seiner reizenden Familie bewundert. Nur um kurz darauf festzustellen, dass es sich bei den Aufnahmen um Platzhalter handelte, die mit den Rahmen geliefert wurden. Seitdem hütete sie sich, voreilige Bemerkungen zu Fotos zu machen.
»Amelia!«, rief sie ihrer Assistentin zu, die mit den drei Designern und Frank, dem wundervollen Möbelpacker, im Erdgeschoss logierte. »Wo, zum Teufel, steckt Tony?« Tony war Sylvies Mann und, wenn es ihm gerade in den Kram passte, ihr Geschäftspartner.
»Ich glaube, er ist mit Kimberley nach Belgravia gefahren, um etwas auszumessen«, schrie Amelia die Treppe hinauf. »Möchtest du eine Tasse Pfefferminztee?«
Frischer Pfefferminztee gehörte zu Sylvies kleinen Lastern, was allerdings verglichen mit Champagner zu vernachlässigen war. An den meisten Tagen gönnte sie sich Punkt mittags um zwölf ein Glas, frei nach dem Motto, dass nichts die Kreativität so beflügelte wie Laurent Perrier.
»Was, um alles in der Welt, will er in dieser späten Phase noch ausmessen?«, fragte Sylvie gereizt, griff nach ihrer Tasche und tastete sich die Wendeltreppe hinunter ins Erdgeschoss.
»Kimberley hat etwas von einer Badematte im Elternbad gesagt.«
»Ach herrje, wahrscheinlich kauft sie die bei Primark!« Ärgerlich fuhr Sylvie sich mit der Hand durch die Locken. »Und Tony hätte sich besser nützlich gemacht, indem er sich vergewissert hätte, ob die roten Vorhänge im Esszimmer schon hängen. Frank, kannst du gleich mitkommen? Ich erledige das selbst.«
Sylvie konnte Kimberley nicht leiden. Sie war die verwöhnte Tochter eines ihrer Lieferanten in Basildon, die sich in einer seichten Reality-Serie wohl eher zu Hause gefühlt hätte als im eleganten Chelsea. Nur der Himmel wusste, warum Tony bereit gewesen war, sie als Praktikantin einzustellen. Offenbar glaubte sie, Innenarchitektur bestünde aus glitzernden Kissenbezügen und Spitzendeckchen auf jedem Tisch, den sie in die Finger bekam. Sylvie hatte den Verdacht, dass Kimberleys Bettüberwurf zu Hause von einem Haufen Stofftiere geziert wurde. Wahrscheinlich stand sogar ihr Name an der Zimmertür.
Sie bemerkte, dass Frank einen raschen Blick mit Amelia wechselte. »Du brauchst nicht mitzukommen, Sylvie. Ich mach das schon. Hast du nicht erwähnt, die rote Samtchaiselongue müsste vom Polsterer abgeholt werden?«
»Ja«, erwiderte Sylvie und musterte ihn zweifelnd. »Aber die ist erst morgen fertig. Außerdem haben sie zugesagt zu liefern. Und das sollten sie bei dem Preis, verdammt noch mal, auch tun.« Die Chaiselongue, ein Empire-Fundstück von der Antiquitätenmesse, hatte trotz Kollegenrabatt so viel gekostet wie eine gesamte Sitzgarnitur von Ikea. Doch sie würde dem recht seltsam geschnittenen Ankleidezimmer die von den Auftraggebern gewünschte dramatische Note verleihen. Plötzlich fiel ihr das berühmte Zitat von der edwardianischen Schauspielerin Mrs. Patrick Campbell ein, sie sehne sich wegen der Verrenkungen auf der Chaiselongue nach dem tiefen Frieden des Ehebettes. Hatten sich die Edwardianer tatsächlich auf Chaiselongues vergnügt? Die sahen doch viel zu ungemütlich aus.
Und was den Frieden im Ehebett betraf, hatte Mrs. Campbell sicher nie einen Gatten wie Tony kennengelernt, der die Bettdecke als sein alleiniges Eigentum betrachtete.
Frank holte den Pick-up, der gegenüber dem World’s End Pub – inzwischen Filiale einer Imbisskette – parkte, und fing an, seine Gerätschaften einzuladen. »Du siehst ganz schön erledigt aus«, meinte er plötzlich, als Sylvie die Beifahrertür öffnete. »Wäre besser, wenn du rübergehst und dir ein Gläschen Schampus genehmigst.« Er wies auf den Pub auf der anderen Straßenseite.
Sylvie starrte ihn entgeistert an. Wenn sie Lust auf Champagner hatte, würde sie sich eine Flasche aufmachen. Außerdem war sie viel zu angespannt für eine Pause. Möglicherweise spürte Frank das ja, was sein doch recht eigenartiges Verhalten erklärte. »Vielleicht später. Diesen Auftraggebern ist Perfektion nicht gut genug. Wenn auf der Fensterscheibe auch nur ein Schmierer ist, verschwinden sie und verlangen ihr Geld zurück.«
Frank zuckte die Achseln. »Okay, dann also auf nach Belgravia.«
Die Fahrt dauerte nicht lang. Es war die ruhige Zeit am Nachmittag, wenn die mittäglichen Pubgäste schon wieder im Büro saßen und die Luxusmamis noch nicht wieder in ihren Range Rover oder den aufgemotzten Lexus stiegen, um den Nachwuchs von der Schule abzuholen. Oder das Kindermädchen damit beauftragten, während sie im Harbour Club trainierten.
Die Wohnung der Riskovs befand sich im ersten Stock, den man früher als die Beletage bezeichnet hatte. Durch eine Reihe prachtvoller bodentiefer Fenster strömte die Nachmittagssonne herein.
Während Frank seine Sachen auspackte, suchte Sylvie den Schlüssel. Im Parterre nickte der livrierte Concierge ihnen zu und wandte sich dann wieder der Racing Post zu.
Der Aufzug war sofort da. Zu der Wohnungstür gehörte einer dieser schicken Schlüssel der Firma Banham-Sicherheitssysteme, die man angeblich nicht nachmachen konnte, ausgestattet mit einer Fernbedienung, um die Alarmanlage auszuschalten, indem man sie an den Mechanismus hielt. Die Polizei in dieser Gegend bestand auf Fernbedienungen, weil zu viele reiche Leute nicht in der Lage waren, sich ihren sechsstelligen PIN-Code zu merken, und deshalb immer wieder den Alarm versehentlich selbst auslösten. Seltsamerweise war die Alarmanlage zur Wohnung der Riskovs nicht aktiviert. Dafür würden sich Sylvies Mitarbeiter eine Rüge einhandeln.
Zu ihrer großen Erleichterung sah das Innere traumhaft aus. Es fehlten nur noch die roten Samtvorhänge, die Chaiselongue fürs Ankleidezimmer und frische Blumen aus dem Laden in Bluebird. Wenn die Zeit reichte, würde sie sich vielleicht selbst darum kümmern. Gerade hatte sie ihr Telefon zutage gefördert, um die Stellen zu knipsen, wo die Blumenvasen hinsollten, und um die genaue Farbgebung des Hintergrunds festzuhalten – so arbeitete Sylvie nämlich, für sie war alles ein Schnappschuss –, als sie aus dem Schlafzimmer ein eigenartiges Geräusch hörte.
In dem riesigen Wohnzimmer stand Frank bereits auf der Leiter. Sylvie schritt über den Teppich, in dessen Flor man fast bis zu den Knöcheln versank, und öffnete die Schlafzimmertür.
An den Anblick, der sich ihr bot, würde sie sich ihr Leben lang erinnern.
Unter dem gewaltigen vergoldeten Baldachin des Bettes lag Kimberley, noch immer in ihrem aufreizenden Teeniekleidchen von Boohoo, breitbeinig unter Sylvies Mann.
Kimberley glotzte sie an wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht.
Schlagartig wurde Sylvie klar, warum Amelia und Frank sich so seltsam benommen hatten. Sie wussten wohl, was sich da tat, und hatten sie schützen wollen.
Gefühle und Wut würden sich später melden. Im Moment ließ sie die Winkel, das Licht und die dramatische Wirkung der Szene mit dem Auge einer Innenarchitektin auf sich wirken.
Im nächsten Moment begann Kimberley zu kreischen, und Tony drehte sich um. Entsetzen malte sich in seinem Gesicht ab, während Sylvie weiter mit ihrem Telefon fotografierte.
»Weißt du was, Tony?«, meinte sie, um einen letzten Rest von Würde bemüht. »Abgesehen von mir hattest du schon immer einen schauderhaften Frauengeschmack.«
Gwen Charlesworth setzte sich mit ihrem üblichen Teller mit Speck, Eiern und dick gebuttertem Toast an den Tisch und schaltete ihr geliebtes iPad ein. Auch wenn sie schon weit über achtzig war, hatte sie nie etwas von diesem Müsli-Unsinn gehalten. Ihr Mann Neville hatte das Zeug jahrelang gegessen, und man brauchte sich ihn nur anzusehen. Ständig jammerte er wegen irgendwelcher Zipperlein, während sie den ganzen Tag im Garten arbeiten konnte. Und dann noch dieses dämliche Vorurteil, ältere Menschen seien von der modernen Technik überfordert. Eine Welt ohne Mr. Google war für sie unvorstellbar.
Sie scrollte sich durch die langweiligen Aufforderungen für Senioren, doch in Privatrenten zu investieren, grässliche Gesundheitsschuhe zu kaufen, die dem alternden Fuß Bequemlichkeit versprachen, und ihre Bestellbestätigungen von Amazon. Amazon war ihre geheime Leidenschaft. Jeden Tag brachte der Paketbote etwas Neues – ihre Lieblingsstifte, neue Gartenhandschuhe oder unanständige Romane. Jede Lieferung war für sie wie ein Geschenk. »Was haben wir denn heute, Mrs. Charlesworth?«, pflegte der Paketbote zu witzeln. »Fifty Shades of Grey?«
Es machte Gwen einen Heidenspaß, ihn zu schockieren, indem sie antwortete: »Keine Chance. Ich bin zu alt für diese Fesselspielchen. Wahrscheinlich würde ich sterben, bevor dieser Christian Soundso mich losbindet.«
Eigentlich wartete sie auf eine Nachricht von ihrem Sohn Stephen. Er rief sie brav einmal in der Woche an. Doch manchmal scannte er eine lustige Karikatur oder einen Zeitungsartikel ein, von dem er glaubte, dass er sie zum Lachen bringen würde.
Unwillkürlich dachte sie über Stephen nach. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann wie dieser Christian Grey. Sie hoffte nur, dass er, anders als der Romanheld, keine merkwürdigen Dinge trieb. Er hatte eine eindeutig glückliche Kindheit gehabt. Aber nun war er, mit Ausnahme einer kurzen Ehe mit Mitte zwanzig, noch immer Single. Gwen verstand das einfach nicht. Er war charmant, humorvoll und wohlhabend. Was war denn bloß mit den Frauen los?
»Könntest du mir bitte Kaffee nachschenken, Gwen, mein Schatz?«, fragte Neville.
Gwen ignorierte ihn, da sie es hasste, Schatz genannt zu werden. Das erinnerte sie an den Ausdruck »alte Schätzchen«, eine Personengruppe, der sie sich auf gar keinen Fall zugehörig fühlte. Neville wiederholte seine Bitte, wobei er klugerweise das Kosewort wegließ. Sie füllte seine Tasse.
Ah, da war eine Nachricht von Sylvie Sutton. Gwen hatte Sylvie immer gemocht, seit diese ab ihrem zwölften Lebensjahr jede Schulferien bei ihrer Tante und ihrem Onkel verbracht hatte, die einen Katzensprung entfernt von den Charlesworths wohnten. Das Mädchen hatte wirklich eine sonderbare Kindheit hinter sich und war von zwei egoistischen Elternteilen, die ein Kind anscheinend als Folge einer momentanen Konzentrationsschwäche betrachteten, kreuz und quer durch den Mittleren Osten geschleppt worden. Offenbar kam keiner der beiden je auf den Gedanken, dass Sylvies ständiges Davonlaufen aus dem Internat und ihre skandalöse Art, sich zu kleiden – ganz klar, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen –, etwas war, worum man sich kümmern müsste.
Vor Kurzem hatte Gwen Sylvie damit beauftragt, ihr Wohnzimmer umzugestalten, das seitdem ihr liebster Raum im Haus war. Auffälliger Samt und üppige Sofas. Ein bisschen wie in einem Beiruter Bordell, hatte ihr Sohn angemerkt. Gwens konventionelle Freundinnen, die es eher mit geblümten Überwürfen hielten, waren samt und sonders schockiert gewesen.
»Wehe, wenn du in meiner Gegenwart das C-Wort aussprichst«, hatte Sylvie gefleht, als sie sich gemeinsam die Stoffmuster angesehen hatten. Als Gwen sie verdattert angestarrt hatte, hatte Sylvie die Stimme gesenkt und »Chintz« geflüstert.
Gwen fragte sich, was die liebe Sylvie wohl von ihr wollte. Vielleicht plante sie ja, sie zu besuchen. Dann konnte Gwen sie um ihren Rat in Sachen Blumenrabatte im Vorgarten bitten. Gwen hatte an das Rubinrot von Rococo-Tulpen und das exotische Violett der Sorte Arabian Mystery in einem Meer aus Vergissmeinnicht gedacht, die jedes Jahr wie blaue Wolkenbäusche in ihrem Garten blühten. Auch wenn der Sex aus Gwens langem Leben verschwunden war, hatte sie wenigstens noch ihren Garten. Und angesichts des Zustandes von Nevilles Knien war das vermutlich auch gut so.
Die E-Mail schien an alle in Sylvies Kontaktliste verschickt worden zu sein und lautete nur: »Liebe alle, ich dachte, das würde euch zum Lachen bringen.«
Gwen lächelte schon voller Vorfreude, als sie den Anhang öffnete. Doch obwohl sie glaubte, dass sie nichts mehr schockieren konnte, fiel ihr dennoch vor Schreck die Kinnlade herunter, als sie Sylvies Mann in einer kompromittierenden Stellung mit einer jungen Frau vor sich sah.
Kurz darauf läutete ihr Telefon. Sofort erkannte sie die Nummer ihres Sohnes Stephen. Er meldete sich per Skype, eine weitere Suchtdroge von Gwen.
»Hast du den Anhang schon geöffnet?«, fragte er ohne Einleitung.
»Ich habe ihn gerade vor mir … Ach herrje. Was hältst du denn davon?«, erkundigte sie sich. Gwen hatte Tony Sutton, Sylvies Mann, immer gemocht. Er hatte etwas beruhigend Männliches an sich. Sie hatte ihn sich stets mit Schnurrbart vorgestellt, obwohl er nie einen getragen hatte. Außerdem war er nett zu Tieren und Kindern und gewiss nicht eitel genug, um ein Schürzenjäger zu sein. Das hatte Gwen wenigstens gedacht.
Und dennoch hatte sie den Gegenbeweis direkt vor Augen.
»Vermutlich hat Sylvie ihren Mann in flagranti erwischt«, schlug Stephen vor.
»Gütiger Himmel!« Gwen musterte noch einmal das Foto. »Das sieht ja aus wie einer dieser grässlichen arrangierten Scheidungsgründe aus dem Brighton der Fünfziger. Aber warum schickt Sylvie es überall herum?«
»Wahrscheinlich, um es ihm heimzuzahlen. Sie war schon immer ein bisschen impulsiv. Ich hoffe nur, dass der Schuss für sie nicht nach hinten losgeht. Wie ich annehme, werden ihre russischen und arabischen Kunden das nicht gerade witzig finden.«
»Ach, die arme, kleine Sylvie!« Das Bild, wie ein einsames kleines Mädchen vor den entgeisterten Gästen ihrer Tante und ihres Onkels herumstolzierte, stand Gwen noch deutlich vor Augen.
»Arm« und »klein« war nicht unbedingt der Eindruck, den Stephen von Sylvie Sutton hatte. Erstens war sie eins fünfundsiebzig, und zweitens hatte sie ihn in ihrer Kindheit als Waschlappen bezeichnet, weil er sich geweigert hatte, Strumpfhosen und ein Ballettröckchen anzuziehen. Auch als Erwachsene war Sylvie sehr wohl in der Lage gewesen, sich durchzusetzen.
Bis jetzt.
»Stephen, du musst sie anrufen. Sie steckt offenbar in Schwierigkeiten, und wie du schon sagtest, könnte es in einer geschäftlichen Katastrophe für sie enden. Was, wenn sie behauptet, sie wäre – wie heißt das noch mal? – gehackt worden oder so?«
»Wäre möglich. Allerdings könnten einige Leute auf die Idee kommen, dass das genau Sylvies Stil ist, falls sie sich an Tony rächen will.«
Gwen hielt inne und grübelte über einer Lösung nach. Es war nicht ihre Art, die Hände in den Schoß zu legen, wenn Menschen, die sie liebte, litten. »Was ist denn mit dieser traumhaften Villa Le Sirenuse? Die wäre doch optimal geeignet, um sie zu einem Urlaub am Mittelmeer zu verführen. Ihren Kunden kann sie ja sagen, sie würde sich eine kleine Auszeit nehmen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Schließlich ist es nicht so, als ob du eine Familie zu versorgen hättest.«
Sie fuhr fort, bevor Stephen Gelegenheit hatte, gegen diese Spitze wegen seines Junggesellendaseins zu protestieren. »Es ist sowieso keine Saison. Die Italiener verlassen vor Ende Mai das Haus nicht. Sie halten uns für verrückt, weil wir uns schon vorher ausziehen und denken, dass Sommer ist. Ich erinnere mich an die Zeit, die wir auf Capri verbracht haben …«
Stephen wusste, dass das Thema Capri zu Reminiszenzen über E. F. Benson und Somerset Maugham führen würde. Dann würde seine Mutter das Bonmot des Letzteren zitieren, die Riviera sei ein sonniger Ort für zwielichtige Gestalten. Denn ihrer Ansicht nach traf das auch voll und ganz auf Capri zu.
»Offen gestanden habe ich das Haus gerade einer Frau namens Angela Williams angeboten, Ma. Ich bin nicht sicher, ob du dich noch an sie erinnerst. Ich kannte sie vor vielen Jahren in Oxford.«
»Doch nicht etwa diese grässliche Person aus Der Handel gilt? Dein Vater liebt diese Sendung. Warum, um Himmels willen, hast du das getan?«
»Sie ahnt nicht, dass die Villa etwas mit mir zu tun hat.«
»Welche Rolle spielt das?«
»Das ist eine lange Geschichte. Sie hat gerade ihre Firma verloren. Wahrscheinlich hast du es in der Zeitung gelesen.«
»Gütiger Gott, eröffnest du jetzt ein Stift für mittellose Damen?«
»Eigentlich hoffe ich, dass sie mich geschäftlich beraten kann. Man hat mir ziemlich viel für das Haus geboten.«
»Stephen, nicht Le Sirenuse!«, rief seine Mutter entsetzt aus. »Du darfst dieses wundervolle Haus nicht verkaufen wie eine Einliegerwohnung in Shoreditch! Es ist einzigartig! Was haben die Käufer damit vor? Oligarchen und Scheichs aus Katar darin unterbringen?«
Stephen hatte mitbekommen, dass die zwielichtigen Gestalten nicht mehr lange im Schatten bleiben würden. »Sie wollen es in ein Luxushotel verwandeln.«
»In Lanzarella! Gibt es dort nicht schon genug Luxushotels? Als dein Vater und ich es zum ersten Mal von Capri aus besucht haben, war es nur ein kleines Dorf, wo die Leute Zitronen anbauten. Weil es nicht am Meer liegt, ist es von diesem grässlichen Tourismus verschont geblieben. Stephen, das darfst du nicht tun!«
Allmählich wünschte sich Stephen, Sylvies Mann hätte seine Hose anbehalten. Das hätte allen eine Menge Ärger erspart.
»Ich überlege es mir, Ma.«