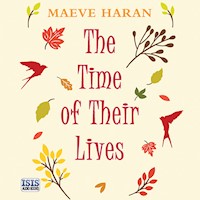4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine charmante, kluge Komödie über Familie in all ihren Facetten!
Molly Meredith, hübsch, energisch und glücklich verheiratet, ist erleichtert: Ihre Ehe befindet sich keineswegs in einer Krise! Ihr Mann Joe ist deswegen so bedrückt, weil er sich seit der Geburt des gemeinsamen Sohnes nichts sehnlicher wünscht, als seine leibliche Mutter kennenzulernen. Also macht Molly sich kurzerhand auf die Suche nach der Unbekannten – ein fataler Fehlentschluss! Denn sie tritt damit eine Lawine von ungeahnter Tragweite los ...
Mit ihren turbulent-witzigen Geschichten über die Liebe, Freundschaft, Familie und die kleinen Tücken des Alltags erobert SPIEGEL-Bestsellerautorin Maeve Haran die Herzen ihrer Leser im Sturm!
»Maeve Haran erweist sich immer wieder als Spezialistin für locker-amüsante Geschichten mit Tiefgang!« Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Buch
Molly Meredith, hübsch, energisch und glücklich verheiratet, ist erleichtert: Ihre Ehe befindet sich keineswegs in einer Krise! Ihr Mann Joe ist deswegen so bedrückt, weil er sich seit der Geburt des gemeinsamen Sohnes nichts sehnlicher wünscht, als seine leibliche Mutter kennenzulernen. Also macht Molly sich kurzerhand auf die Suche nach der Unbekannten – ein fataler Fehlentschluss! Denn sie tritt damit eine Lawine von ungeahnter Tragweite los …
Autorin
Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. »Alles ist nicht genug« wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in London.
Von Maeve Haran bereits erschienen
Liebling, vergiss die Socken nicht · Alles ist nicht genug · Wenn zwei sich streiten · Ich fang noch mal von vorne an · Schwanger macht lustig · Und sonntags aufs Land · Scheidungsdiät · Zwei Schwiegermütter und ein Baby · Ein Mann im Heuhaufen · Der Stoff, aus dem die Männer sind · Schokoladenküsse · Mein Mann ist eine Sünde wert · Die beste Zeit unseres Lebens · Das größte Glück meines Lebens · Der schönste Sommer unseres Lebens
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Maeve Haran
Zwei Schwiegermütter und ein Baby
Roman
Deutsch von Ariane Böckler
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Baby Come Back« bei Little, Brown and Company, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Copyright dieser Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2000 by Maeve Haran
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2000 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Buchgewand Coverdesign | www.buch-gewand.de unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © flas100,
© Liddiebug, © Marina_Mandarina
LA · Herstellung: sam
ISBN978-3-641-26302-7V001
www.blanvalet.de
1. Kapitel
»Ach herrje!«
Der Knopf, der vergeblich versucht hatte, Molly Merediths neuerdings üppige Brüste im Zaum zu halten, flog in hohem Bogen durchs Zimmer und landete in der halb leer gegessenen Schachtel Thorntons Pralinen vor dem Fernseher. Molly schüttelte ihre ebenso ungebändigten roten Haare, die – wie ihre Großmutter stets zu sagen pflegte – die Farbe polierten Messings hatten, obwohl Molly selbst eher fand, dass der Farbton verrosteten Sprungfedern ähnelte, und machte sich auf die Suche nach ihm, indem sie ihren Tacker beiseite legte und von der Leiter stieg.
Bevor sie vor sechs Monaten ein Baby bekommen hatte, waren ihre Brüste wie zwei kleine Mandarinen gewesen, aber nach der Geburt hatten sie melonenhafte Ausmaße angenommen und ein regelrechtes Eigenleben entwickelt. Von einer übermütigen Freundin aus dem Geburtsvorbereitungskurs angestachelt, hatte sich Molly gar zu einem ausgesprochen unziemlichen Spritzwettbewerb herausfordern lassen, schlimmer als jeder Wettstreit zwischen kleinen Jungen darum, wie weit sie pinkeln konnten. Molly hatte um Busenlänge gewonnen.
Die Zeit reichte nicht, um den abtrünnigen Knopf wieder anzunähen, wenn sie die Vorhänge rechtzeitig fertig haben wollte, um Joe zu überraschen. Also nahm Molly, einfallsreich wie immer, den Tacker zur Hand und verschloss damit ihre Bluse, bevor sie die Leiter wieder hinaufstieg, um den Querbehang an der Gardinenstange anzubringen. Sie hatte gerade die letzte Klammer hineingeschossen und war ein paar Schritte zurückgetreten, um ihr Werk zu bewundern, als sich Joes Schlüssel im Schloss drehte.
Sie wünschte sich so sehr, dass Joe die Vorhänge gefielen – ebenso wie ihre kleine Wohnung und jeder Aspekt ihres gemeinsamen Lebens.
»Was meinst du?« Molly zeigte mit großer Geste auf die auffälligen Vorhänge in exotischem Violett und Jadegrün, die sie aus billigem Stoff vom Markt genäht und dabei die kühne Hoffnung gehegt hatte, die Aussicht auf einen Parkplatz und zwei Hochhäuser verbergen zu können.
Ihr Mann Joe schenkte dem Fenster seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Die extravaganten Vorhänge waren typisch Molly. Bunt, völlig schrill und absolut unpassend für eine Schuhschachtel-Wohnung mit zwei kleinen Schlafzimmern und einer winzigen Küche. Und doch wirkten sie phänomenal und verwandelten irgendwie den ganzen Raum.
»Herrlich«, lobte er. »Genau wie du. Wie hast du meinen geheimen Wunsch erraten, in einem Bordell in Louisiana zu wohnen?«
»Es sieht nicht die Bohne aus wie in einem Bordell in Louisiana«, korrigierte ihn Molly streng. »Vielleicht wie in einem türkischen Harem …«
»Ich glaube nicht, dass es in Peckham besonders viele türkische Harems gibt. Du solltest eines Tages Bühnenbildnerin werden. Das Talent dazu hast du jedenfalls.«
»Es ist ein bisschen gewagt, oder?«, pflichtete Molly ihm fröhlich bei. »Den restlichen Stoff hab ich übers Sofa drapiert, damit ich hier liegen und Pralinen essen kann, während ich Eddie stille.« Sie lehnte sich zurück und räkelte sich genüsslich.
»Pass auf«, sagte Joe und ging mit vielsagender Miene auf sie zu. »Wenn du deine Trümpfe richtig spielst, könntest du meine Lieblingsfrau werden. Dann kriegst du mich jede Nacht.«
Molly lachte und tat so, als liefe sie davon, doch er fing sie und stieß sie auf das frisch dekorierte Sofa. »Und zwar ab sofort.«
In diesem Moment fing Eddie, das Baby, im anderen Zimmer an zu weinen.
»Die Freuden des Elternseins«, witzelte Joe trocken. »Ganz schön schlau, dass sie einem im Geburtsvorbereitungskurs nicht sagen, dass man nie wieder Sex haben wird. Sonst könnte man es sich noch anders überlegen.«
»Dann ist es schon ein bisschen zu spät«, meinte Molly.
»Soll ich ihn holen?«
Molly nickte. Sie liebte ihr Baby heiß und innig, war aber immer froh über fünf Minuten Ruhe. »Und ich hole uns einen Drink.«
Sie summte vor sich hin, während sie sich in der kleinen Küche zu schaffen machte und eine Flasche billigen Weißwein entkorkte. Noch immer konnte sie kaum glauben, dass sie und Joe tatsächlich verheiratet waren.
Joe war der attraktivste und schickste Student ihres Jahrgangs gewesen – oder vielmehr sämtlicher Jahrgänge. Mit seinem hübschen, grüblerischen Gesicht, den dunklen Haaren und den erstaunlich hellen blauen Augen hatte er im Vergleich zu den anderen wie ein Angehöriger einer anderen Spezies gewirkt. Das und seine zeitweiligen Anfälle Byronscher Trübsal und Geistesabwesenheit hatten dazu geführt, dass ihn manche Kommilitonen hochnäsig fanden. Einmal, auf einem Besäufnis in der Studentenkneipe, hatte er ihr gestanden, dass er noch nie das Gefühl gehabt hatte, irgendwo dazuzugehören, weder im College noch im Leben. »Vielleicht liegt das daran, dass ich adoptiert bin«, hatte er mit nervösem Lachen gesagt, da er Angst hatte, sie könnte ihn des Selbstmitleids beschuldigen und ablehnen, aber sie hatte den Schmerz in seinen Augen gesehen, und er war ihr zu Herzen gegangen. Danach erschienen ihr all die anderen Studenten langweilig unkompliziert.
Molly war von Natur aus Optimistin, bodenständig und praktisch. Molly glaubte daran, dass sie alles Mögliche reparieren konnte, und dazu gehörte auch Joe.
Doch die Stimmungsschwankungen hatten nicht aufgehört – im Gegenteil, sie hatten sich verstärkt. Manchmal verschwand Joe einfach. Er hatte mit Joggen angefangen, und das hatte anscheinend geholfen, ihm ein Ziel und ein Ventil für seine ruhelose Energie zu geben.
Und dann war Molly schwanger geworden. Zuerst hatte der Gedanke sie entsetzt. Joe würde sich doch bestimmt in eine Ehe gedrängt fühlen, die er nicht wollte? Aber die Neuigkeit hatte eine wunderbare Wirkung gehabt. Joe war begeistert gewesen und hatte darauf bestanden, dass sie auf der Stelle heirateten. Während all ihre Freunde sich immer noch fragten, was sie mit ihrem Leben anstellen sollten, hatte Joe seinen Beruf gefunden, indem er Handbücher für Autobastler verfasste.
Sie seufzte, als sie den Korken herauszog. Er schien mit ihrem gemeinsamen Leben recht zufrieden zu sein, aber es war Molly bisher nicht gelungen, seine plötzlichen Anfälle von Trübsinn zu kurieren.
Sie nahm die Weingläser und tappte hinüber in das kleine Schlafzimmer. Joe hatte Eddie aus seinem Bettchen genommen und aufs Ehebett gelegt. Als er nun auf ihn herabblickte, leuchteten seine Augen vor Zärtlichkeit.
Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war dermaßen frappierend, dass es ihr regelmäßig den Atem raubte. Vater und Sohn besaßen das gleiche dunkle Haar in einer glänzenden, fast pflaumenblauen Schattierung, die gleiche blasse Haut und diese erstaunlichen Augen, so strahlend blau wie die Flügel eines Eichelhähers. Sogar ihre Hände waren gleich, bis hin zu den quadratisch zulaufenden Fingernägeln und den breiten Nagelhäutchen.
»Er sieht dir ja so ähnlich«, flüsterte sie voller Lebensfreude.
»Ich weiß.«
Unvermittelt wandte Joe sich ab, als wären seine Gefühle zu tief für Worte. Über sein Gesicht schien sich ein Vorhang herabzusenken.
»Ich gehe joggen.«
Molly wollte schon protestieren und erklären, dass das Abendessen fertig sei, aber sie kannte die Anzeichen für einen von Joes Stimmungsumschwüngen und beschloss, es ihn auf seine Weise ausleben zu lassen. Er fing ihren Blick auf und rang sich ein entschuldigendes Lächeln ab, doch der Schmerz, den sie inzwischen kannte, war wieder da. »Tut mir leid.«
Als er gegangen war, legte sie sich neben das Baby aufs Bett und starrte ihm in die Augen, als läge in ihnen die Lösung. »Warum ist dein Dad so unglücklich? Er liebt dich, aber nicht einmal das scheint zu genügen.« Molly lehnte sich wieder zurück und kämpfte mit den Tränen. Warum hatte sie sich eingebildet, dass sie, Molly Meredith, die Macht besaß, Joes Wunden zu heilen, nachdem alles andere versagt hatte?
Sie nippte ein Schlückchen Wein, stillte das Baby und schlief ein, ohne sich auch nur ausgezogen zu haben.
Es war dunkel, als sie wieder aufwachte. Eddie lag friedlich schlafend in ihrer Armbeuge neben ihr. Joe war nirgends zu sehen.
Auf einmal krampfte sich Mollys Magen vor Panik zusammen. War ihm etwas passiert? Und doch wusste sie im selben Augenblick, dass dies nicht der Fall war. Aber vielleicht war mit ihnen etwas passiert. Vielleicht würde es ihr doch nicht gelingen, in Joes Abgründe vorzudringen. Und vielleicht hatte Joe das auch erkannt.
Als sie sich aufsetzte, kalt, steif und unglücklich, ging die Wohnungstür. Vorsichtig, um ihn nicht aufzuwecken, legte sie Eddie wieder in sein Bettchen.
Sie hörte Joe in der Küche herumwerkeln, war aber zu müde, um auch nur das Schlafzimmer zu verlassen und zu ihm zu gehen. Kurz darauf kam er herein, in den Händen ein Tablett mit Tee und Keksen und mit einem Lächeln, das derart ehrlich um Verzeihung bat, dass es wirkte wie ein Sonnenaufgang.
»Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Ich habe nachgedacht.«
Mollys Herz hämmerte. Worüber hatte er nachgedacht? Dass ihre Ehe trotz Eddie nicht funktionierte? Dass er allein sein musste?
»Ich habe einen Entschluss gefasst.«
Wieder spürte sie ein Pochen, durchdringend und schmerzhaft.
»Diese verfluchten Depressionen, die ich immer wieder habe – ich bin mir sicher, dass sie etwas damit zu tun haben, dass ich adoptiert bin. Deshalb habe ich beschlossen, meine leibliche Mutter zu suchen. Meinst du, du könntest mir dabei helfen?«
2. Kapitel
Mollys Erleichterung war so massiv, dass es fast schmerzte.
Er dachte nicht daran, sie zu verlassen – er wollte ihre Hilfe. Und der Grund war wirklich einleuchtend. Das Bedürfnis, zu wissen, woher man stammte, war so übermächtig, dass sie sich fragte, warum er nicht schon früher daran gedacht hatte.
Joe erriet ihre Gedanken. »Ich habe schon mal überlegt, sie zu suchen, als ich achtzehn war, aber du weißt ja, wie Pat ist.«
Molly wusste allerdings, wie Joes Adoptivmutter war. Pat hatte ihr ganzes Leben um Joe herum aufgebaut und wäre am Boden zerstört, wenn sie erfahren müsste, dass er vorhatte, seine leibliche Mutter zu suchen. Das Wort »Verrat« wäre dafür in Pats Augen noch untertrieben gewesen.
»An meinem achtzehnten Geburtstag habe ich mir ein Buch über das Aufspüren von Verwandten aus der Bücherei geholt und es unterm Bett versteckt wie ein Pornoheft.«
»Ein Pornoheft wäre Pat lieber gewesen.«
»Ja. Nur hat sie dann kurz darauf befürchtet, sie könnte Brustkrebs haben, und da habe ich es nicht über mich gebracht, ihr das anzutun. Also habe ich das Buch wieder in der Bücherei abgegeben und die Sache vergessen.«
»Nur dass du sie nicht wirklich vergessen hast.«
»Genau.« Er kuschelte sich auf dem Bett an sie. »Ich dachte, dass sich vielleicht alles lösen würde, wenn wir ein Baby hätten, aber irgendwie hat es das noch schlimmer gemacht. Eddie und ich sind uns dermaßen ähnlich, dass ich mich frage, ob diese Gene von meiner Mutter stammen. Ich überlege die ganze Zeit, wo sie wohl ist.«
»Und jetzt möchtest du versuchen, sie zu finden?«
»Ja.« Er richtete den eindringlichen Blick seiner blauen Augen auf sie, voll von anrührender Hoffnung. »Hältst du mich jetzt für komplett verrückt?«
Molly wandte sich zu ihm um und verlor sich in den blauen Tiefen seiner Augen. »Nein, es leuchtet mir vollkommen ein.«
»Du hast doch ein Händchen für solche Dinge. Ich weiß noch, wie du dem Jungen von nebenan bei seiner Geschichtsarbeit geholfen hast.«
»Daten über die normannische Eroberung auszugraben ist etwas anderes, als deine Mutter zu finden«, entgegnete Molly.
»Aber du bist so praktisch und gründlich und entschlossen.«
»Das hört sich an, als wäre ich Bibliothekarin.«
»Aber eine charmante, überzeugende und unwiderstehliche. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der es geschafft hat, sich vor einem Strafzettel herauszureden, nachdem er schon ausgedruckt war.«
»Da hab ich gelogen. Ich habe behauptet, ich hätte Wehen.«
»Genau. Skrupellos bist du auch. Eine ideale Mischung. Und noch dazu unheimlich sexy.« Er zog sie sanft, aber fest an sich. »Ich liebe dich, Molly. Bitte hilf mir.«
Molly wusste, dass sie im Grunde keine Wahl hatte. »Natürlich helfe ich dir. Und jetzt komm her, mein süßer, hinreißender, toller Mann …«
Am nächsten Morgen erwachte Joe als Erster. Nackt sprang er aus dem Bett und trottete pfeifend in die Küche. Molly staunte über die Veränderung an ihm.
»Pass auf!«, warnte sie ihn. »Die alte Mrs Jenkins von nebenan hält immer Ausschau nach dem Milchmann.«
Joe stand am Küchenfenster, lehnte sich hinaus und schenkte der Nachbarin sein strahlendstes Lächeln. »Hallo, Mrs Jenkins. Was macht der Hexenschuss von Ihrem Bert?«
»Besser, vielen Dank, Joseph«, kam die fröhliche Antwort der Achtzigjährigen. »Aber Sie sollten sich lieber was anziehen«, fügte sie verschmitzt hinzu, »sonst holen Sie sich noch den Tod.«
Molly versteckte den Kopf unterm Kissen. »Deinetwegen bekommt sie noch einen Herzinfarkt, das liebe, alte Schätzchen.«
»Unsinn«, lachte Joe und ging ins Nebenzimmer, um Eddie aus seinem Bettchen zu holen. »Das kennt sie doch alles schon seit Urzeiten, was, Eds?«
Voller Liebe beobachtete Molly ihre beiden Männer und glaubte, ihr müsse vor Glück das Herz platzen. Alles würde gut werden. Molly hatte seit jeher instinktiv gehandelt, und diesmal war sie sich ihrer Sache besonders sicher.
Immer noch im Morgenmantel winkte sie Joe nach, als er zur Arbeit fuhr, und überlegte, was sie anziehen sollte. Das Leben wurde ständig besser. Abgesehen davon, dass sie und Joe eine gewichtige Entscheidung gefällt hatten, war sie heute Mittag mit Claire zum Essen verabredet und konnte ihre Begeisterung mit ihr teilen.
Claire war Mollys engste Freundin, ihre Verbündete und Vertraute, wenn es um Männer, Unglücksfälle und Schwiegermütter ging, und ihre Leidensgenossin im Weinlokal um die Ecke, wenn Worte nicht mehr ausreichten.
Molly hatte schon oft gedacht, dass sie sich nach dem Grundsatz »Gegensätze ziehen sich an« gefunden hatten. Während Molly groß und gertenschlank war – abgesehen von den jüngsten Entwicklungen an ihrem Oberkörper – und wilde, rote Haare hatte, die so widerspenstig waren, dass sie sie mit drei Spangen bändigen musste, war Claire knabenhaft und kurzhaarig und gerade mal einsfünfzig. Was ihr an Körpergröße fehlte, machte sie durch Ehrgeiz wett. War Molly mit Mann, Heim und Kind vollauf zufrieden, wollte Claire die Welt erobern.
Als Claire, die gespürt hatte, dass bei ihrer Freundin nicht alles im Lot war, das Essen vorgeschlagen hatte, hatte Molly erwogen, Eddie mitzunehmen, aber Claire meinte, das Restaurant ließe keine Babys zu, nicht einmal welche mit goldenen Kreditkarten. Glücklicherweise hatte sich Joes Adoptivmutter Pat erboten, von Essex herzukommen und auf ihn aufzupassen.
Es wäre Mollys erstes Mittagessen ohne Kind, und sie musste gestehen, dass sie ihm entgegenfieberte.
»Molly, Liebes«, wollte Pat als Erstes wissen, sobald sie ihren Mantel ausgezogen hatte, »wo steht denn bei dir das Sagrotan?« Pat zog eine Schürze aus ihrer Tasche und legte sie an wie ein Soldat, der gleich zum Sturmangriff antritt.
Sie fand es beunruhigend, dass Molly auf ziemlich unsystematische Art einkaufte und dazu neigte, Eis mit Schokosplittern und Mandelplätzchen zu kaufen anstelle vernünftiger Dinge wie Ajax und Waschmittel. Molly hasste Großmärkte und ging lieber täglich – manchmal auch zweimal täglich – im Laden an der Ecke einkaufen. Sie hatte eine für beide Seiten erfreuliche Beziehung mit dem Ladeninhaber Mr Sawalha und dessen weitläufiger Familie entwickelt, die ihre unerschütterliche Heiterkeit trotz des englischen Wetters, rassistischer Bosheiten und dem Entstehen von Großmärkten auf der grünen Wiese nicht verloren hatte. Mr Sawalha erkundigte sich stets ausführlich nach Eddie und gab Molly irgendeine Süßigkeit für ihn mit. Hinten im Laden schmunzelte dann seine Frau und wandte angesichts der unwissenden Männer, die nicht begriffen, dass Säuglinge keine Kaubonbons, Fondant-Spiegeleier oder eine Art länglichen Fruchtgummis mit dem schönen Namen Astro-Belt aßen, den Blick zum Himmel.
»Tut mir leid, Pat, aber ich habe kein Sagrotan«, erklärte Molly. »Ich nehme immer Spülmittel und einen alten Lumpen.«
»Meine Güte«, stöhnte Pat aus vollem Herzen, »bei dir müssen ja sämtliche Oberflächen das reinste Bazillenparadies sein.«
Molly sann über diese treffende Beschreibung nach. Das Wort klang eher nach einem tropischen Feriendorf für Bakterien.
Pat machte sich auf den Weg in den Laden und kehrte bis an die Zähne bewaffnet mit Sprays, Topfkratzern und einem Mittel zurück, das versprach, kurzen Prozess zu machen, was Molly auch gleich tun würde, wenn sie nicht ganz schnell aus der Wohnung verschwand. Jeden Moment mussten die Bazillen mit erhobenen Händen herauskommen. Der Gedanke an Claire und das schicke Restaurant wurde von Minute zu Minute verlockender.
Molly wusste, wenn sie zurückkehrte, hätte die gesamte Wohnung, von den Fußleisten bis zur Decke (und sogar hinter dem Schrank, den nur drei starke Männer vom Fleck bewegen konnten) einen Frühjahrsputz hinter sich, und sie müsste unendlich dankbar sein. Nur wäre es ihr lieber gewesen, wenn sie vorher gefragt worden wäre. So musste sie nämlich den wenig taktvollen Wink mit dem Zaunpfahl schlucken, dass ihre Wohnung zuvor wie ein Schweinestall ausgesehen hatte.
»Eddie wacht schätzungsweise in einer halben Stunde auf«, erklärte Molly. »Im Kühlschrank steht abgepumpte Milch.«
Pat schürzte missbilligend die Lippen. Ob nun deshalb, weil Joe als Adoptivkind mit Flaschennahrung aufgezogen worden war, oder weil Pat den Vorgang an sich ekelerregend fand, wusste Molly nicht. Sie vermutete, wenn sie je versuchen sollte, ihr Baby in Gegenwart ihrer Adoptiv-Schwiegermutter zu stillen, würde Pat ihr zuerst die Brust mit Sagrotan einsprühen.
»Ich habe auch ein Baby aufgezogen, weißt du«, bemerkte Pat säuerlich. »Ich nehme an, Eddie wird einen Tag mit seiner Großmutter überleben. Willst du so ausgehen?« Pats Tonfall legte nahe, dass selbst die kaum verhüllte Lady Godiva besser gekleidet war.
Aber Molly hatte sogar sehr genau über ihre Kombination aus einer weißen Cargohose und einem schlichten T-Shirt nachgedacht. Sie wollte nicht so tun, als versuchte sie mit den Yuppie-Frauen im Karriere-Kostüm mitzuhalten, und so war ihr diese Aufmachung ideal erschienen.
»Dann bis später, Pat. Und danke, dass du auf Eddie aufpasst.«
Die Bakterien in ihrer Wohnung mochten anderer Meinung sein, aber Molly war froh, dass Pat den weiten Weg auf sich genommen hatte, um Molly das Mittagessen mit ihrer Freundin zu ermöglichen. Molly konnte sich zwar nicht vorstellen, dass Pat jemals mit einer Freundin Mittagessen gegangen war, aber vielleicht trafen ihre Freundinnen und sie sich, um einander zu gestehen, dass sie die Mülltonnen nicht ausgewaschen und hin und wieder den Staub unterm Couchtisch ignoriert hatten.
»Amüsier dich gut«, wünschte Pat und winkte ihr zum Abschied. »Und mach dir keine Sorgen wegen Eddie. Dem fehlt’s an nichts.«
Spontan schloss Molly sie in die Arme. Joes plötzlicher Entschluss, sich auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter zu machen, würde für Pat am schwersten zu verkraften sein. Sie würden ungemein vorsichtig sein müssen, wie sie ihr das beibrachten.
Als sie in dem schicken Restaurant ankam, war Claire nirgends zu sehen. Molly hatte keine Lust, sich zwischen all die schicken Karrierefrauen, die über andere schicke Karrierefrauen lästerten, an die Bar zu setzen, und ging auf die Toilette. Sie war vollauf damit zufrieden, zu Hause zu sein, und es wäre ihr ein Gräuel gewesen, Eddie einer Tagesmutter zu übergeben, aber in dieser von Ehrgeiz geprägten Atmosphäre fühlte sie sich kaum besser als eine Aussätzige. Ja, eventuell hätte sie ganz gut verdient, wenn sie sich mit einer Sammelbüchse und einem Schild mit der Aufschrift »Vollzeit-Mutter – bitte spenden Sie großzügig, damit wir diese heilbare Krankheit ausrotten können« draußen aufgestellt hätte.
Bis sie sich die Haare gebürstet und ihr Make-up aufgefrischt hatte, war Claire eingetroffen und hatte bereits eine Flasche Wein bestellt.
Molly musste zugeben, dass sie das erwachsene, komplett kinderfreie Ambiente genoss. In letzter Zeit waren die einzigen Speisekarten, die sie zu Gesicht bekommen hatte, die von McDonald’s gewesen, wo sie andere Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern traf. Einen Augenblick lang musterte sie ihre Freundin. Claire war seit jeher klein und zierlich mit einem Hauch von Wildfang gewesen, aber seit sie diesen Job hatte, war etwas von dem Glanz, bei einer großen Zeitung zu arbeiten, auf sie übergegangen, und sie strahlte die reichlich einschüchternde Aura des Erfolgs aus.
»Na, was gibt’s Neues an der Heimatfront? Langweilst du dich noch nicht zu Tode?« Claire schenkte Wein ein.
»Du bist doch nur eifersüchtig, weil dein Leben eine leere Wüstenei ist, abgesteckt von den bedeutungslosen Meilensteinen aus Ehrgeiz und Enttäuschung«, spöttelte Molly.
Beide prusteten vor Lachen. Dieses Spielchen trieben sie jedes Mal. In Wirklichkeit gab es zwar Dinge im Leben der anderen, um die sie einander beneideten, aber trotzdem war jede von ihnen froh, ihr eigenes zu führen. Eine höchst erfreuliche Grundlage für eine Freundschaft.
»Irgendwie reden wir dauernd nur über mich. Aber was ist mit dir?«, hakte Molly nach. »Was tut sich in der mörderischen Welt von Amalgamated Newspapers?«
Claire sah einen Moment lang betroffen drein. »Also, offen gestanden läuft es nicht so großartig. Man munkelt von Entlassungen.«
»Aber das trifft bestimmt nicht dich. Du bist doch so gut.« Molly stupste ihre Freundin vielsagend an. »Außerdem – bist du nicht, ähm … mit deinem Chef?«
»Emotional verbunden?«, ergänzte Claire hilfsbereit. »Das ist echt ein Witz. Ich habe noch nie begriffen, weshalb ›emotional verbunden‹ bedeutet, dass man mit jemandem ins Bett geht. ›Körperlich verbunden‹ träfe es wesentlich genauer.«
»Egal, wie du es nennst – nützt das denn nichts?«
Claire sah ernüchtert drein. »Ich weiß nicht einmal, ob es diesmal etwas nützen würde, wenn ich die Künste einer Thai-Prostituierten beherrschte. Ich wurde als Letzte eingestellt, und das heißt, dass ich als Erste rausfliege, es sei denn, ich liefere ihnen einen wirklich gigantischen Knüller. Aber genug von mir und meinen egoistischen, oberflächlichen Interessen. Wie bekommt dir die Mutterschaft? Du wirkst anders, irgendwie fröhlicher. So wie du aussiehst, wenn du zu einem deiner Kreuzzüge wie »Haltet Peckhams Straßen sauber« oder »Adoptiert eine Oma« aufbrichst.«
»Tja, das tue ich auch – gewissermaßen. Joe hat mich um Hilfe bei etwas gebeten, das ihm wirklich am Herzen liegt, und ich bin so wahnsinnig erleichtert. Er war in letzter Zeit dermaßen trübsinnig, dass ich schon dachte, er stünde kurz davor, mich zu verlassen, oder er hätte zumindest eine heimliche Affäre.«
»Joe würde dich nie verlassen. Ich kann mich noch an euren Hochzeitstag erinnern. Er hat ausgesehen, als hätte er das große Los gezogen. Das hat mich schwer für ihn eingenommen.«
Der Neid hatte jede Einzelheit in Claires Gedächtnis geätzt. Molly in einem elfenbeinfarbenen Belle Èpoque-Kleid, das sie selbst geschneidert hatte (zum Teil mit Heftklammern, wie sie hinterher gestand) und dessen seidene Falten die sanfte Schwellung ihres bereits schwangeren Bauches verbargen, und Joe in einer bestickten Weste, die ihn mitsamt seinem attraktiven Gesicht und den dunklen Haaren Zoll für Zoll zu einem modernen Mr Darcy machte. Und Claire zu der Überzeugung brachte, dass sie auf ewig ledig bleiben würde.
»Und was ist diese große Sache, um die er dich gebeten hat? Doch wohl kein flotter Dreier mit einem Bernhardiner oder so?«
Der Kellner suchte sich genau diesen Moment aus, um diskret an ihrem Tisch zu erscheinen. Er zuckte nicht mit der Wimper.
»Moment bitte, wir sind noch unentschlossen«, erklärte Claire.
»Offen gestanden hat er mich gebeten, ihm dabei zu helfen, seine leibliche Mutter zu finden.«
»Ach herrje. Wann ist er denn auf die Idee verfallen?«
»Gestern. Nachdem er zwei Stunden lang verschwunden war und ich schon kurz davor stand, die Polizei zu alarmieren, kam er zurück und hat es verkündet. Ehrlich gesagt freut es mich. Ich war schon immer der Meinung, dass es ihm massiv helfen würde, vor allem, seit wir Eddie haben. Es liegt einfach in der Natur des Menschen, wissen zu wollen, wo seine unschönen kleinen Macken herkommen. Heutzutage wird doch alles auf die Gene zurückgeführt.«
Trotz allem war Claire von der Waghalsigkeit des Vorhabens beeindruckt.
Molly war erstaunlich. Sie glaubte daran, alles reparieren zu können – von einem zerbrochenen Spielzeug bis zu einem zerbrochenen Traum. Das war es, was sie so einnehmend – oder nervig – machte, je nachdem, ob es das eigene Leben war oder das von jemand anderem, das sie in Ordnung brachte.
»Joe hatte doch schon immer Stimmungsschwankungen. Manchmal taucht er in seine eigene Welt ab, und man hat das Gefühl, als seien die Mauern meterdick. Man dringt einfach nicht zu ihm durch. Und doch kann man nicht sagen, dass er depressiv wäre oder so. Für mich ist es einfach furchtbar. Früher habe ich mir immer gesagt, dass es nur sein Bedürfnis nach Raum ist.«
»Schwer sechzigerjahremäßig.«
»Aber manchmal fühlt es sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Sonst ist er stets so liebevoll, und das macht es nur noch schlimmer. Ich weiß, dass es einen Grund dafür gibt. Deshalb fand ich es ja so verblüffend, als er mich um Hilfe gebeten hat.« Molly begann sich für ihr Thema zu erhitzen wie ein früher Heiliger, der sich an einer Feuersbrunst berauscht, und übersah die neugierigen Blicke der Gäste an den umliegenden Tischen. »Ich habe einiges über das Thema gelesen, Claire. Vielen Adoptierten geht es wie Joe. Wenn er seine Mutter finden und sie Joe davon überzeugen kann, dass er ihr etwas bedeutet und sie ihn geliebt hat, könnte das unheimlich viel bewirken. Ich meine, womöglich war sie ein mittelloser Teenager und wurde von ihren Eltern unter Druck gesetzt. Es gibt da schreckliche Geschichten …«
»Molly, halt mal die Luft an«, warf Claire ein, besorgt darüber, wie schnell das alles ging. »Was, wenn dem nicht so war? Was, wenn sie ihn wirklich nicht wollte, wenn es eine Vergewaltigung oder eine Affäre war? Nicht jede wünscht sich, dass ihr verschollener Sohn oder – nebenbei bemerkt – dessen Frau auf einmal in ihr Leben platzt. Was, wenn sie ihn gar nicht kennenlernen will? Es könnte eine Million Gründe dafür geben, dass sie ihn weggegeben hat. Womöglich lehnt sie ihn erneut ab, und wie fühlt er sich dann? Hör mal, wir schreiben über solche Geschichten. Da gibt’s nicht nur glückliche Gesichter und tränenreiche Wiederbegegnungen.«
Aber der Versuch, Molly aufhalten zu wollen, wenn sie erst einmal in Fahrt war, ähnelte dem Versuch, einen Wirbelwind in einer Flasche zu fangen. »Wenn sie ihn nicht kennenlernen will«, beharrte Molly, als gäbe es nichts Einleuchtenderes auf der Welt, »dann muss ich sie eben dazu überreden. Schließlich würde es ihr auch guttun. Es sei denn, sie ist eine völlig herzlose Kuh.«
Claire empfand vorübergehend Mitleid mit der herzlosen Kuh, falls Molly sie je aufspürte. Molly neigte dazu, die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen.
»Wenn ich sie finde und sie ihn wirklich nicht sehen will, könnte ich ja eventuell so tun, als hätte ich sie nie gefunden.«
Claire fasste mit einer Hand über den Tisch. »Ich hab dich unheimlich gern, Molly. Aber meinst du nicht, dass du in diesem Fall ein bisschen Gott spielst?«
»Clairey, ich glaube, dass das wirklich gut für unsere Ehe ist.«
»Na, dann trinke ich darauf.«
Molly stieß mit ihr an und sah sich im Raum um. »Pass auf, wahrscheinlich erreiche ich ohnehin nichts. Du wirfst mir doch ständig vor, ich sei hirntot und säße nur mit dem Baby zu Hause, während du dich draußen in der Welt durchboxt. Damit hätte ich endlich eine sinnvolle Aufgabe.« Mit hörbarem Zungenschnalzen, das keine weitere Diskussion gestattete, wechselte sie das Thema. »So, was wollen wir essen? Ach, und was noch wichtiger ist: Claire, lädst du mich ein? Schließlich hast du dieses Lokal vorgeschlagen. Ich könnte mir nicht mal die Oliven an der Bar leisten.«
»Natürlich lade ich dich ein«, versicherte ihr Claire. »Ich kann zwar Pizza Express nicht auf meine Spesenabrechnung setzen, aber diesen Schuppen hier akzeptieren sie. Also, wen soll ich heute als meinen Gast eintragen?« Sie zwinkerte ihrer Freundin zu. »In diesem Licht würde ich sagen, siehst du Kate Winslet sehr ähnlich oder vielleicht auch Minnie Driver.« Molly warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Nein, wenn schon, dann die gute Kate.« Claire hob ihr Glas. »Viel Glück bei deiner Suche. Auf Molly, die Mutterfinderin!«
Damit stellte sie ihr Glas ab und wirbelte abrupt herum, um die Schritte einer hinreißenden dunkelhaarigen Frau zu verfolgen.
Die Leute in der kleinen Bar neben dem Restaurant schienen angesichts der neu Eingetroffenen zurückzuweichen wie das Rote Meer.
»He, ist das nicht Stella Milton?«, flüsterte Claire laut. Ihr journalistischer Instinkt meldete sich sofort zur Stelle. »Mein Gott, im wirklichen Leben ist sie sogar noch aufregender. Tony, mein Chef, kriegt jedes Mal fast einen Orgasmus, wenn er sie in diesem Werbespot für das Auto mit der vielen Beinfreiheit sieht.«
Molly reckte den Hals und versuchte so zu tun, als versteckte sie sich hinter der riesigen Speisekarte, als Stella an ihnen vorbeirauschte, die Verkörperung weiblicher Eleganz, das dunkle Haar so geschnitten, dass es ihr Kinn umspielte und die gemeißelten Mulden unter ihren Wangenknochen betonte. Ihre Oberlippe schwang sich über die untere und wirkte wie eine dezente sexuelle Einladung.
Andere Schauspielerinnen waren schöner, doch es gab nur eine Stella Milton, die shakespearesche Sexgöttin. Ihre gesamte Erscheinung ließ einen an zerwühlte weiße Bettlaken und heiße, erotische Nachmittage denken.
»Woher hat sie nur diese Wangenknochen?«, fragte Molly und tastete ihr Gesicht nach ihren eigenen ab. »Meinst du, sie hält die ganze Zeit den Atem an?«
»Lass das, Moll. Du siehst aus wie eine Zwetschge mit Verstopfung, nicht wie ein Sexsymbol.«
»Ich habe sie neulich im Nachmittagsprogramm gesehen«, gestand Molly. »In dieser Sendung, wo sie zusammen essen und plaudern. Weißt du, dass sie Spaghetti um die Gabel rollen und gleichzeitig witzige Anekdoten erzählen kann?«
»Das ist nicht das einzige Kunststück, das man ihr nachsagt.« Claire kramte in ihrer Handtasche und überließ es Molly, die trüben Gewässer sexueller Handreichungen selbst zu ergründen, auf die ihre Freundin angespielt hatte. Manchmal war Molly froh, dass sie zu Hause saß.
»Es könnte aber auch sein«, murmelte Molly vor sich hin, »dass sie eine verdammt gute Schauspielerin ist und die anderen neidisch sind.«
»Soll ich mich trauen, zu ihr zu gehen und sie um ein Interview zu bitten?« Claire war schon halb aufgestanden. »Pass auf, sie hat garantiert eine kosmetische Operation hinter sich. Niemand sieht in ihrem Alter dermaßen gut aus, es sei denn man ist Tina Turner oder hat seine Seele dem Teufel verkauft.«
»Warum gehst du nicht hin und fragst sie?«
Doch es war schon zu spät. Stella Milton war verschwunden, und eine Wand anderer Speisegäste, allesamt zu vornehm, um zu starren, stand zwischen Claire und ihrer Beute.
3. Kapitel
Auf der anderen Seite des Restaurants zog Stellas Agent Bob Kramer, mit dem sie zum Mittagessen verabredet war, eine Augenbraue hoch und wartete, bis seine Klientin bei ihm angelangt war. Im Lauf der Jahre hatte Stella die Fähigkeit entwickelt, sich ihrer Wirkung genau bewusst zu sein, ohne es zu zeigen. Sie konnte in Restaurants schlendern, den Blick auf den Rücken des Oberkellners geheftet, als wäre er der wichtigste, faszinierendste Mann des Universums, und dabei die Aufmerksamkeit aller Gäste an den umstehenden Tischen ignorieren, ohne snobistisch oder hochnäsig zu wirken. Es war Teil ihrer Kunst, einen Mythos unnahbarer Sexualität um sich herum zu erzeugen, ohne je mit jemandem sprechen zu müssen. Doch selbst Stellas mächtiger Zauber konnte nicht ewig anhalten. In Wirklichkeit näherte sie sich dem Ende ihrer Lebensspanne als Sirene, und Bob wäre froh gewesen, wenn sie sich dazu hätte überwinden können, das einzusehen.
Er fragte sich, was hinter der heutigen Einladung eigentlich steckte. Dieses Mittagessen war eine äußerst kurzfristig anberaumte königliche Vorladung gewesen. Sie hatte darauf bestanden, dass er sämtliche anderen Termine absagte. Bob war sich nicht sicher, ob seine Klientin noch gefragt genug war, um ein derart herrisches Wesen zu rechtfertigen. Katharina die Große hatte das Russische Reich unter sich gehabt und konnte damit ihre Haltung begründen, doch Stella besaß lediglich ihre Schönheit, ihre Sinnlichkeit und ihre beträchtlichen schauspielerischen Fähigkeiten. Bis jetzt hatte das gereicht. Aber konnte eine Frau über vierzig ein solches Entgegenkommen verlangen?
Der Strahler über seinem Kopf spiegelte sich in seinem kahlen Schädel, während Bob diese Überlegungen anstellte. »So, Stella, meine Liebe, welchem Anlass verdanke ich denn die überraschende und erfreuliche Tatsache, dir so kurzfristig gegenübersitzen zu dürfen?«
Stella gewährte ihm ein ironisches Kräuseln ihrer vollen Lippen. Bob war einer der wenigen Männer, die sie nie zu bezirzen versucht hatte. Ein Agent war von wesentlich dauerhafterem Wert als ein Liebhaber, doch ihr Zauber war nützlich als Trumpf in der Hinterhand. Stellas gesamtes Leben setzte sich daraus zusammen, dass sie immer noch Trümpfe im Ärmel hatte. Manchmal war sie geradezu enttäuscht, wenn sie sie nicht einsetzen musste.
»Es gibt da eine Rolle, die ich haben will.«
»Mhm. Natürlich. Und wer hat sie im Moment, das arme, arglose Lämmchen?«
»Ich glaube nicht, dass sie schon besetzt worden ist. In New York wird sie von Suzi May gespielt.«
»Ah. Dunkle Nacht und Verlangen. Aber Stella, die Hauptfigur in dem Stück ist blond.«
»Ich kann blond sein.«
»Herzchen, sie ist unter dreißig.«
»Ich kann auch unter dreißig sein. Ich habe gesehen, wie sie das in Italien machen. Herr Ober, könnten Sie mir einen Gummiring bringen?«
Der Kellner, der gerade mit einem Tablett voller Drinks vorbeikam, sah drein, als würde er bis ans Ende der Welt gehen, um einen für sie aufzutreiben. Zum Glück lag der Kassenschrank etwas näher.
Die Gäste an den Nebentischen bemühten sich, nicht zu glotzen, als Stella an beiden Schläfen eine Haarsträhne fasste und daran zog, was eine sofortige Straffung ihres Gesichts zur Folge hatte. »Die Schauspielerinnen dort machen es alle, und keine davon erinnert einen an wiederbelebte Leichen, wie es in den Staaten nach chirurgischen Eingriffen der Fall ist.«
»Das Problem ist, Stella, meine Liebe, dass ich gerüchteweise gehört habe, die Rolle sei schon vergeben.«
»Dann stimm sie um. Sag ihnen, ich spreche für die Rolle vor. Sag ihnen, die Gage ist mir egal.«
»Moment mal, Stella.« Bob hatte sie noch nie so entschlossen gesehen. »Manche Dinge sind heilig. Um diese Rolle tobt der Konkurrenzkampf. Altmodischer Glamour ist wieder in Mode, und viele von diesen jungen Schauspielerinnen haben dafür ein Händchen.«
»Die tun doch nur so«, behauptete Stella und griff nach ihrem Mantel, den sie über die Stuhllehne drapiert hatte. »Ich bin das Original. Besorg mir die Rolle.«
»Willst du denn nichts essen?« Bob war beim Studieren der Speisekarte schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. »Es sollte doch ein Mittagessen werden.«
»Für die Rolle muss ich schlank bleiben.« Stella strahlte ihn mit ihrem Tausend-Watt-Lächeln an, aber als Agent einiger der schönsten Schauspielerinnen Londons war Bob dagegen immun. Essen war ihm lieber als Frauen. Davon bekam man zwar mitunter Verdauungsstörungen, aber zumindest weckte es einen nicht mitten in der Nacht und verlangte nach Sex.
»Mal sehen, was ich tun kann.« Er stand auf, um sie zur Tür zu begleiten.
»Aber sicher. Dann bis bald.« Wie gewohnt schien Stella die Blicke gar nicht zu bemerken, die ihr auf ihrem Weg durchs Lokal gefolgt waren, aber sie hätte einen Plan davon zeichnen können, wer starrte und wer nicht.
Draußen winkte Bob ihr ein Taxi herbei – leicht zu finden, da die meisten schicken Mittagsgäste sich gerade erst hingesetzt hatten – und schloss galant die Tür. »Meinst du nicht, Stella, meine Liebe«, begann er, lehnte sich zum Fenster herein und senkte die Stimme, »dass du aufhören solltest, auf Rollen aus zu sein, die für Achtundzwanzigjährige gedacht sind?«
Stella tat so, als hätte sie nichts gehört, und winkte ihm zum Abschied. Sie hatte eigentlich in ihre Wohnung zurückfahren und sich mit Richard, ihrem geduldigen und großzügigen Liebhaber treffen wollen, doch eine Art Impuls trieb sie in Richtung Victoria Station. Es war eine Reaktion auf Bobs negative Einstellung. Was sie brauchte, war eine Dosis ihrer erfrischenden Mutter Beatrice. Bea war schon achtzig und immer noch unverwüstlich.
Sie war zwar vielleicht nicht die zugänglichste aller Mütter gewesen, sinnierte Stella – Bea war ebenfalls Schauspielerin und hatte einen großen Teil von Stellas Kindheit damit verbracht, auf Tourneen mit Musikkomödien um den Globus zu reisen –, doch sie hatte eine nüchterne Direktheit an sich, die Stella tröstlich fand. Ihre Mutter sah die Welt immer noch als einen Ort, der schlicht und einfach aus Gut und Böse und Schwarz und Weiß bestand und hielt nichts von Nabelschau. Sich selbst zu analysieren, hatte Bea stets gesagt, sei der Fluch von Stellas Generation.
»Entschuldigung«, unterbrach der Taxifahrer Stellas Tagträume, »aber sind Sie nicht die Dame, die diesen Werbespot für das Auto macht?«
Stella empfand einen Anflug von Ärger darüber, dass man sich nach einundzwanzig Filmen, zahllosen Shakespeare-Aufführungen und einem frühen »Kunst«-Film, in dem sie sich splitternackt ausgezogen hatte, nur aufgrund dieses Werbespots an sie erinnerte. »Ja«, antwortete sie markig, »die bin ich.«
»Hoffentlich haben Sie in meinem Taxi genug«, gluckste er amüsiert.
Stella sah verständnislos drein.
»Beinfreiheit, meine ich.«
Stella lächelte matt und rief sich in Erinnerung, wie viel sie für den Spot bezahlt bekommen hatte. Genug, um sich für Dunkle Nacht und Verlangen mit einem Hungerlohn zufrieden zu geben. Wenn sie die Rolle überhaupt bekam.
Stella reiste gern. Es hatte etwas Sicheres, Heimeliges an sich, zwischen zwei Orten zu sein. Nichts wurde von einem erwartet. Wenn ein Wagen geschickt wurde, um sie zu einem Drehort oder der Aufzeichnung für eine Fernsehsendung zu bringen, wünschte sie oft, sie könnte darin sitzen bleiben, statt anzukommen und ihren Glamour anzuknipsen. Es war harte Arbeit, eine Legende zu sein.
Den ersten Teil der Reise bildete der Zug nach Brighton. Auf dieser Strecke war man dermaßen an Prominente gewohnt, dass einem der Mann am Imbisstresen schon fast ein Autogramm von sich gab. Trotzdem behielt Stella ihre Sonnenbrille auf und versteckte sich hinter einer Ausgabe des scharfsinnigen Guardian. In Brighton stieg sie um und fuhr die paar Haltestellen bis Ovington, wo sie für die letzten Meilen nach Lower Ditchwell, wo ihre Mutter wohnte, ein Taxi nahm.
Lower Ditchwell war ein Dorf im Hügelland mit nicht einmal vierzig Häusern und so bilderbuchhübsch, dass es bereits Platzdeckchen, Spielkarten und hin und wieder eine Pralinenschachtel geziert hatte. So weit Stella wusste, hatte es nie ein Upper Ditchwell gegeben, das den ersten Teil des Namens erklärt hätte.
Es war bereits Juni, doch sie hatte so viel gearbeitet, dass sie es gar nicht bemerkt hatte. In Lower Ditchwell war es unmöglich, die Jahreszeit nicht zu bemerken. Früher war das Dorf für sein Überleben vollkommen von den Launen des Wetters abhängig gewesen. Seine Häuschen mochten ja mit ihren Rosenbogen über den Türen und den Mauern aus rohem Feuerstein dekorativ aussehen, aber vor hundert Jahren war jedes davon mit Arbeit im Herrenhaus, bei der Kirche oder auf einem Bauernhof verbunden gewesen. Die meisten von ihnen waren innen feucht und ließen die Landarbeiter unter ständigem Husten leiden. Es gab fast gar keine Möbel, abgesehen vielleicht von einem harten Stuhl und einem rohen Holztisch, und die Häuschen waren mit so vielen Kindern angefüllt, dass nur das Hausschwein, das besser genährt wurde als der Nachwuchs der Landarbeiter, die Familien vorm Verhungern bewahrte.
Die ursprünglichen Bewohner der Häuschen wären beim jetzigen Anblick ihrer früheren Behausungen in Ohnmacht gefallen. Jeder versuchte die anderen mit einer Masse an Hängekörben, Zier-Schubkarren voller Fleißiger Lieschen, angebauten Wintergärten und weißen Gartenmöbeln zu übertrumpfen.
Heute hatte kein einziger Hausbesitzer mehr einen Bezug zum Land – abgesehen vielleicht von dem schwulen Gartenarchitekten im umgebauten Schulhaus, der davon lebte, dass er Gärten nach den Prinzipien des Feng Shui anlegte.
Allein ein Häuschen leistete all dieser Verstädterung Widerstand, obwohl »Häuschen« vielleicht ein zu simples Wort war, um das elegant proportionierte Haus aus goldgelbem Stein mit seiner weißen, von einem fein geschnitzten Türsturz überwölbten Haustür zu beschreiben. Dies war Beas Haus, die Frucht eines Lebens, das sie damit verbracht hatte, mit Noel-Coward-Retrospektiven und Dauerbrennern der Musikkomödie wie The Boyfriend durch die ehemaligen Kolonien zu touren. Wenn ihre Mutter Schuldgefühle hatte, weil sie während Stellas gesamter Kindheit im Ausland gewesen war und ihre Tochter auf Gedeih und Verderb den Nonnen im Internat ausgeliefert hatte, so zeigte sie es jedenfalls nie. Die Nonnen hatten gut für Stella gesorgt und waren ganz außer sich vor Begeisterung, als Stella nach drei Tagen stiller Einkehr glaubte, den Ruf Gottes vernommen zu haben und sich womöglich dem Orden verschreiben zu wollen. Als das mulmige Gefühl in ihrem Bauch, das Stella mit ihren dreizehn Jahren als die Stimme Gottes interpretiert hatte, sich als ihre erste Periode entpuppte, verloren die Nonnen das Interesse an ihr.
Stella schmunzelte vor sich hin. Seitdem war sie dem Nonnendasein nur noch einmal nahegekommen, und zwar als sie die durchgedrehte, sexbesessene Mutter Oberin in einem Film von Ken Russell gespielt hatte. Sie hoffte nur, dass die Nonnen ihn nie gesehen hatten.
»Stella, Liebes, das ist aber eine nette Überraschung! Warum hast du denn nicht vom Bahnhof aus angerufen? Ich hätte dich doch abgeholt.«
Bea setzte den breitkrempigen Schlapphut ab, den sie stets bei der Gartenarbeit trug, und umarmte ihre Tochter. Ihre Kluft bestand aus ausgebleichten Reithosen, uralten Reitstiefeln und einer weißen Rüschenbluse. Nach wie vor trug sie die auffälligen falschen Wimpern aus ihrer Bühnenzeit und sah aus wie eine verwirrende Mischung aus Vita Sackville-West und Barbara Cartland.
Stella hoffte, dass ihre Mutter – im Gegensatz zu Vita – keine Affäre mit einer verheirateten Frau hatte. Vermutlich nicht, wenn sie es sich genauer überlegte. Das ganze Dorf wüsste Bescheid, und außerdem liebte Bea trotz ihres fortgeschrittenen Alters die Gesellschaft von Männern.
»Hallo, Beatrice, du alte Schachtel.« Stella und ihre Mutter hatten sich nie mit mütterlichen Kosenamen aufgehalten. »Schön, dich zu sehen.«
»Das finde ich auch. Du kommst gerade rechtzeitig, um mir dabei zu helfen, vierundzwanzig Gläser Orangensaft zu machen.«
Verständnislos folgte Stella ihrer Mutter aus dem grellen Sonnenlicht in das kühle, blumengeschmückte Wohnzimmer mit seinen niedrigen Balken und den blassgelben Wänden. Ihre Mutter, die nie eine vornehme Dame vom Land gewesen war, hatte in den letzten Jahren ein außergewöhnliches Gespür dafür entwickelt, wie eine solche zu wirken. Vielleicht war es die jüngste in einer Reihe zahlreicher Rollen, und Bea spielte sie genau wie die anderen brillant.
»Wozu brauchst du denn vierundzwanzig Gläser Saft, um Gottes willen?«, wollte Stella wissen. »Du erwartest doch wohl keinen Männerchor?«
»Nur ein Ausflug der Dorfschule. Sie dürfen mich besuchen, meine alten Kostüme anziehen und mir ein kleines Stück vorführen. Sie werden begeistert sein, wenn du mit mir als Jury fungierst. Obwohl ich bezweifle, dass auch nur ein paar von ihnen alt genug sind, um deine Filme zu kennen.« Sie machte eine Kunstpause. »Zum Glück.«
»Glaub das nicht. Das Poster von diesem dämlichen Film über die Motorradfahrerin hängt in den besten Jungeninternaten an jeder Zimmerwand. Das hat man mir zumindest berichtet.«
»Nur, weil du unter deiner Lederkluft nichts anhast«, kommentierte Bea eine Spur zu bissig. »Red dir bloß nicht ein, es hätte etwas mit deinen schauspielerischen Fähigkeiten zu tun.«
»Das ist mir klar.«
Jegliche weitere Unterhaltung wurde von der Ankunft einer lärmenden Horde Kinder übertönt, die johlend und hüpfend aus Kleinbussen stiegen und Beas friedliches Häuschen stürmten. Ein Stück weit die Straße hinunter wackelten mehrere Vorhänge aus Liberty-Stoffen vor Missbilligung. Bea schien es nicht zu bemerken. Es war typisch für ihre Mutter, so sinnierte Stella, dass sie ihre Tochter nicht einmal gefragt hatte, warum sie so unvermittelt an einem Donnerstagnachmittag aufgetaucht war, ohne auch nur vorher kurz anzurufen.
Aber warum, so fragte sich Stella, war sie eigentlich gekommen? Falls sie die Versicherung brauchte, dass sie für die Rolle in Dunkle Nacht und Verlangen, die sie haben wollte, nicht zu alt war, so war sie bei Bea eher an der falschen Adresse.
Die Schulkinder, die sich mittlerweile als viktorianische Damen und bunte Zwanziger-Jahre-Schönheiten – dazu eine kleine Rothaarige mit elizabethanischer Halskrause und Wams – verkleidet hatten, kamen wieder ins Zimmer marschiert, um eine verworrene Darbietung aufzuführen, in der Elizabeth I. Mrs Bridges aus Das Haus am Eaton Place Befehle erteilt.
»Herrlich, Kinder«, gratulierte Bea. »Ihr seid alle wunderbar.«
»Diese Kostüme müssen ein Vermögen wert sein«, bemerkte Stella, als eine zehnjährige Julia auf einen Charleston-Steppschuh aus pinkfarbener Seide stieg und einen breiten Abdruck hinterließ. »Du solltest sie versteigern lassen, anstatt diese Horde Kinder auf sie loszulassen.«
»Mir ist es lieber, wenn sie benutzt werden«, entgegnete Bea. »Und jetzt zieht bitte meine feinen Sachen aus, bevor ihr euren Saft trinkt«, wies Bea die Kinder mit der ganzen Autorität einer geborenen Lehrerin an. »Und vergesst nicht, sie aufzuhängen, damit sie fürs nächste Mal bereit sind!« Sie wandte sich wieder an ihre Tochter. »Du hast im Grunde nie etwas an Kindern finden können, oder, Liebes?«
»Soll heißen?«, fragte Stella gereizt zurück.
»Soll heißen, dass du zu dem Schluss gekommen bist, dich nicht für die Mutterschaft zu eignen. Das war wahrscheinlich sehr vernünftig von dir.« Beas Ton legte nahe, dass sie kein Wort davon meinte.
Stella spürte eine Feuerwand aus Wut um sich herum auflodern. Ihre Mutter konnte sich keine Spitze verkneifen. »Du hast mir nie verziehen, dass ich ihn zur Adoption freigegeben habe, was?«
»Natürlich fand ich deine Handlungsweise egoistisch. Es hätte weniger drastische Alternativen zu einer Adoption gegeben. Wir hätten dir helfen können, wenn du nur darum gebeten hättest.«
»Egoistisch!« Stella hörte, wie ihre Stimme schrill wurde und all die wohlklingenden Vokale verlor, an denen sie in ihrer Ausbildung so lange gefeilt hatte. »Ich war egoistisch? Das ist aus deinem Mund ein starkes Stück!«
All ihre Erinnerungen an die Einsamkeit und Verlassenheit in diesem verdammten Kloster, in dem sie sogar während der Ferien festsaß, wallten trotz der vielen Jahre dazwischen in ihr auf und befeuerten ihre Wut auf die Heuchelei ihrer Mutter. »Du hast dich nicht ein einziges Mal um mich gekümmert! Du bist einfach mit Vater nach Woolloomooloo, Sarawak oder Larnaka abgereist und davon ausgegangen, dass mir nichts fehlt.«
Auf einmal wirkte Bea schwer getroffen. Die Falten ihres dünnen Halses schienen sich plötzlich übereinanderzustapeln wie Hula-Hoop-Reifen. »Ich musste. Dein Vater hat hier keine Arbeit gefunden. Die einzigen Stücke, für die wir gemeinsam engagiert wurden, wurden im Ausland produziert.«
Stella gestattete sich einen Moment der Bitterkeit für den Vater, den sie eigentlich nie richtig kennengelernt hatte. Doch jetzt war es zu spät. Er war gestorben, als sie Mitte zwanzig war.
»Er hätte ja fahren und du dableiben können.«
»Das wäre das Ende unserer Ehe gewesen. Dein Vater hat sich seit jeher gern nach anderen Frauen umgesehen. Damals herrschte die allgemeine Meinung, dass man seine Ehe über seine Kinder stellen muss.«
»Damit hattest du jedenfalls keine Probleme.« Stella hatte gar nicht so verbittert klingen wollen, aber es fiel ihr schwer, jetzt aufzuhören, wo sie schon angefangen hatte.
Bea war genauso reizbar. »War es das alles wert, Stella? Für deine sagenhafte Karriere als Schauspielerin, die sich auszieht? Wie oft hast du es inzwischen schon gemacht? Zehn-, zwölfmal? Und lass uns die nackte Julia nicht vergessen, mit der alles angefangen hat.« Sie nahm die Hand ihrer Tochter und drückte sie fest. »Überlegst du eigentlich manchmal, was aus dem Baby geworden ist? Was für eine Art Leben dein Sohn führt?«
Stellas Gesichtsausdruck ging Bea zu Herzen. Sie sah aus wie ein teures, verhätscheltes Tier, das vom einzigen Menschen, auf den es sich verlassen konnte, getreten worden ist. »Hör mal, Stella, Liebes – ich hätte das alles nicht sagen sollen. Du hast recht. Ich habe mich egoistisch benommen, als du klein warst. Die Tatsache, dass sich die allgemeine Einstellung geändert hat, ist keine Entschuldigung. Ich habe nicht das Recht, dir Herzlosigkeit vorzuwerfen.«
»Zerbrich dir darüber nicht den Kopf.« Stellas Ton war so eisig, dass er einem die Fingerspitzen hätte gefrieren lassen können. »Ich nehme an, du erkennst das Gefühl wieder.«
Es war nicht Beas geliebte Tochter, die mit übertriebener Lässigkeit nach ihrer Jacke griff und das Haus verließ, sondern die weithin bekannte, glamouröse Schauspielerin.
Bea sah Stella nach, wie sie in stillem Schmerz davonstolzierte, und wünschte, sie könnte einige ihrer Vorhaltungen zurücknehmen und die scharfkantige Wunde zwischen ihnen heilen. Doch ihr mangelte es an Worten. Alles, was sie gesagt hatte, war wahr gewesen, und das wussten sie beide. Manchmal war das Schlimmste am Mutterdasein, dass man der einzige Mensch war, der die Wahrheit aussprechen konnte.
4. Kapitel
Später, in ihrer kleinen, aber heiß geliebten Wohnung, die nur wenige Ausgewählte betreten durften, sinnierte Stella über das Leben nach, das sie sich selbst aufgebaut hatte. Die Wohnung war winzig, lag jedoch ausgesprochen günstig mitten in Covent Garden, sodass sie zu jedem Theater, in dem sie spielte, zu Fuß gehen konnte. Es gab einen Dachgarten mit einem kleinen Gewächshaus, das sie mit Jasmin bepflanzt hatte. Hier konnte sie sitzen, den schweren Duft einatmen und die Sterne betrachten, während sie den Geräuschen der geliebten Stadt tief unten lauschte. Es war nicht die Art von Wohnung, in der man Kinder aufziehen würde, genau wie Stellas zwei zinnoberrote Art déco-Sofas nicht die Art von Farbe hatten, die man wählen würde, wenn klebrige Finger in der Nähe waren.
Warum, so fragte sich Stella wütend, sollte Erfolg nur danach definiert werden, ob man Kinder hatte? Zählten denn Talent, harte Arbeit und ein instinktives Verständnis dafür, worauf ein Dramatiker hinauswollte, gar nichts? Konnte der Wert eines Lebens lediglich danach bemessen werden, ob man der bereits überzähligen Bevölkerung noch eine Seele hinzufügte?
Wie konnte ihre Mutter die Andeutung wagen, dass ihr Leben sinnlos gewesen sei? Ihre Mutter mit ihren peinlichen falschen Wimpern, ihrer Stimme, die wie Sandpapier klang, das durch Honig kratzt, und die ihre gesamte schauspielerische Laufbahn auf abgelegenen Provinzbühnen verbracht hatte, eine lächerliche Figur, die stets versuchte, ihre Unbekanntheit durch schrille Kleidung zu kompensieren, die Parodie einer Schauspielerin. Stella wusste noch, wie sie jedes Mal versucht hatte, sich vor Verlegenheit zu einer Kugel zusammenzurollen wie ein Igel, der Gefahr wittert, wenn Bea in einem neuen und schauderhaften Gewand, das aussah, als wäre es bei einer Produktion von Der Mikado übrig geblieben, an die Schule kam, um sie abzuholen. Ihre Mutter hatte es entweder nicht bemerkt, oder es war ihr egal gewesen.
Tja, Stella war es auch egal. Warum sollte es sie kümmern, was irgendjemand anders dachte, insbesondere ihre Mutter?
Sie wählte die Nummer ihres Agenten. Bob blieb oft lange im Büro, was bei einem Agenten beruhigend war. Und wenn er nicht im Büro war, dann saß er in irgendeinem Stück, bei dem ein Klient mitspielte, oder tat jemandem schön, der einem anderen nützen könnte. Bob schien überhaupt kein Privatleben zu haben und dies auch gar nicht zu vermissen. Während manche Leute die Midlife-Crisis bekamen und beschlossen, ihren Job hinzuwerfen, um sich dem Buddhismus oder dem Landleben zu widmen, kaufte sich Bob lediglich eine neuere und noch leistungsfähigere Errungenschaft der Technik, um seine Kontaktadressen auf den letzten Stand zu bringen.
Heute Abend war er in seinem Büro. »Bob. Hier Stella. Hast du etwas über Dunkle Nacht in Erfahrung gebracht?« Stella verschwendete nie Zeit mit Freundlichkeiten, wie etwa andere nach ihrem Befinden zu fragen.
»Mhm. Tut mir leid, meine Liebe, aber die Rolle ist felsenfest vergeben. Roxanne Wood hat sie bekommen.« Roxanne Wood war nicht nur eine der neuen, begehrten Schauspielerinnen, sondern auch der junge und schöne Spross einer Bühnendynastie.
»Aber sie ist noch ein Kind! Sie hat noch gar nicht gelebt. Sie werden sie zehn Jahre älter machen müssen.«
Er hätte entgegnen können: »Immer noch leichter als zehn jünger.« Doch das tat er nicht. Der Gedanke schwebte trotzdem irgendwo zwischen ihnen. »Sie wollten allerdings wissen«, fuhr er fort und hielt gleich wieder inne, um auf die Explosion zu warten, und ohne sich sicher zu sein, ob er weitersprechen sollte, »ob du eventuell daran interessiert wärst, ihre Mutter zu spielen.«
»Ich hoffe, du hast ihnen gesagt, dass sie sich ins Knie ficken können.« Wütend knallte Stella den Hörer auf.
»Ja«, gestand Bob der toten Leitung, »hab ich. Nur dass ich es nicht so höflich ausgedrückt habe.«
Stella zitterte noch vor Zorn, als es an der Tür klingelte. Richard, der geduldigste und genügsamste aller Liebhaber, stand mit einem riesigen Strauß weißer Lilien vor der Tür.
»Exotisch und wohlriechend«, sagte er lächelnd, »wie du.«
Die Ironie bestand darin, dass Richard zwar ruhig und unauffällig wirkte, aber Tiefen besaß, die für den durchschnittlichen Betrachter unsichtbar waren. Nur wenige Männer, wie machohaft sie auch auf den Rest der Welt wirken mochten, waren stark genug, um es mit Stella aufzunehmen. Männer gingen – nicht ganz zutreffenderweise – davon aus, dass sie sexuell so erfahren war, wie sie im Film oder auf der Bühne wirkte. Ganz egal, wie abgebrüht sie auch sein mochten, sie glaubten allen Ernstes, dass Stella Milton ihre Brustwarzen hart machte, indem sie sie mit Eiswürfeln einrieb, die sie dann aufaß, wie sie es in Einsame Nächte und wie man sie übersteht getan hatte, oder dass sie tatsächlich eine Affäre mit ihrem eigenen Vater gehabt hatte wie in Daddy, oder noch gewagter, dass sie der etwas ausgefallenen Gewohnheit frönte, den Liebhaber, der sie betrogen hatte, eigenhändig einzubalsamieren wie in der schwarzen Komödie Rat mal, wer zum Essen blieb.
Es hätte ja einfach sein können, dass es Richard an Fantasie mangelte, aber er war der einzige Mann, der begriffen hatte, dass sie lieber im Bett Pizza aß, anstatt kopfüber von der Lampe hängend zu vögeln, und sich gern ab und zu am Samstagabend einen Videofilm anschaute, genau wie der Rest der Bevölkerung. Vor allem wenn Stella Milton nicht mitspielte.
Stella machte eine Flasche Wein auf, und sie setzten sich zusammen auf die Terrasse. »Ich liebe London«, sinnierte Stella. »Wie irgendjemand im hintersten Winkel auf dem Land leben kann, ohne jede geistige Anregung, die über Klatsch und Gärtnern hinausgeht, ist mir ein Rätsel.«
»Du hast deine Mutter besucht, was?«, riet Richard. »Wie war Dame Beatrice?« Das war Richards Kosename für Bea, die er sehr gern hatte.
»Herrisch. Durchgeknallt. Sie hatte das Haus voller kreischender Kinder, die in ihren wertvollen Bühnenkostümen herumgehüpft sind, obwohl sie sie doch für einen Haufen Geld versteigern lassen könnte.« Das Bild erinnerte sie schmerzlich an die Vorwürfe ihrer Mutter.
»War das alles, was dich verärgert hat?« Richard kannte sie gut genug, um zu spüren, dass noch mehr dahintersteckte.
»Nein. Gehen wir ins Bett.« Diese Ankündigung überraschte Richard, da normalerweise er es war, der den Anstoß zum Liebesspiel gab.
Ohne eine Antwort abzuwarten, verschwand Stella in dem kleinen Badezimmer, das über die hellste Beleuchtung verfügte, die Richard außerhalb des London Palladium je gesehen hatte.
Er begann sich rasch auszuziehen, bevor Stella es sich anders überlegte. Die Badezimmertür stand offen, und kurz darauf lehnte Stella, beleuchtet von etwa fünfhundert Watt, am Türpfosten. »Richard, sag mir die Wahrheit. Wenn ich mich ausziehe, sehe ich dann akzeptabel aus, oder denken die Leute: ›O Gott, nicht schon wieder diese schlaffen, alten Brüste‹?«
»Jedenfalls nicht, wenn sie wie ich empfinden.« Richard hob die Bettdecke und zeigte ihr den Beweis.
Es war nicht ganz die Antwort, die Stella sich erhofft hatte, aber sie würde genügen müssen.
»Richard«, sagte sie unvermittelt und mit einer Stimme, die so untypisch für sie war, dass er sich zu ihr umwandte, »glaubst du, dass wir für ein Baby zu alt sind?«
Er zog ihren Kopf an seine Schulter herab. »Zu alt vielleicht nicht, aber garantiert zu egoistisch.«
Stella vergrub das Gesicht in der Decke. Warum benutzte jeder in Bezug auf sie immer wieder dieses Wort?
Ein bisschen früher am selben Nachmittag hatten Molly und Claire ihren Salat mit Büffelmozzarella und gebratenen Paprika verspeist, und Molly hatte der Verlockung eines Tiramisu-Eises nachgegeben. Claire hatte aus figürlichen Gründen abgelehnt, war aber begeistert gewesen, als Molly sich hinreißen ließ. Wenigstens würde jetzt der Kellner nicht verächtlich den Mund verziehen und sie für Geizkragen halten, wie es so oft in noblen Restaurants der Fall war, wenn man nur Kaffee bestellte.
Zu Mollys Erstaunen wartete Joe am Straßenrand, als sie das Lokal verließen. Eddie stand in seinem Buggy daneben.
»Was macht ihr beiden denn hier?«, fragte sie hocherfreut.
»Ich hatte einen Termin in der Stadt, also bin ich nach Hause gefahren und habe Mum abgelöst. Wir wollten dich überraschen. Hast du dich gut amüsiert?«
»Wir haben Stella Milton gesehen. Sie sieht umwerfend gut aus«, erzählte Molly begeistert.
»Ihr bewegt euch ja in vornehmen Kreisen.«
Eine Zigeunerin mit einem jämmerlich aussehenden Strauß folienverpackter Trockenblumen kam vorüber. »Weißes Heidekraut als Glücksbringer, Schätzchen?« Sie hielt Molly die Blumen hin.
Claire hatte schon den Mund geöffnet, um abzulehnen, doch Molly reichte ihr ein Pfund und nahm die Blumen. Sie hielt sie sich unter die Nase, um daran zu riechen. Es war überhaupt kein Heidekraut, sondern weiß gefärbte Stranddisteln ohne jeglichen Duft.
Als sie Mollys enttäuschten Blick sah, nahm ihr die Zigeunerin das armselige Büschel wieder weg und besprühte es mit einem billigen Parfüm. »Alles wird gut«, flüsterte die zahnlose Frau in Mollys Ohr, als sie ihr den Strauß wieder reichte. Ihr Atem war so widerwärtig, dass Molly fast das Gesicht abgewandt hätte. »Sie tun das Richtige.«
Mit offenem Mund sah Molly der Frau nach, als sie ohne einen weiteren Blick zurück in Richtung Oxford Street davonging, um weitere Leute auf Einkaufsbummel anzusprechen. Was die Zigeunerin gesagt hatte, war so allgemein, dass es alles Mögliche bedeuten konnte, aber da Molly eben Molly war, beschloss sie, es als wundersames Omen zu verstehen, und fühlte sich in absoluter Hochstimmung.