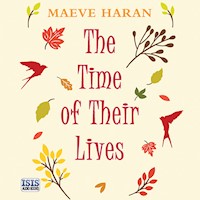4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Mit starken Frauen an deiner Seite kannst du auch die schwersten Zeiten des Lebens meistern!
Gerade als Lily Brandon kurz vor dem ersehnten Durchbruch als Theater-Schauspielerin steht, erkrankt ihre Mutter Charlotte lebensgefährlich. Sie bittet Lily inständig, ihre florierende Modefirma, die sie aus dem Nichts aufgebaut hat, weiterzuführen. Lily ist ratlos: Soll sie alle Zelte in London abbrechen und auf ihre Karriere verzichten? Das wäre ein Opfer, zu dem ihre erfolgreiche Mutter selbst nie bereit gewesen wäre. Als dann auch noch Lilys exzentrische Tante Evie aus Australien hereinplatzt, ist das Durcheinander perfekt. Doch schnell zeigt sich, dass drei Frauen gemeinsam – fast – alles meistern können: die Liebe, den Beruf und das Leben ...
Mit ihren turbulent-witzigen Geschichten über die Liebe, Freundschaft, Familie und die kleinen Tücken des Alltags erobert SPIEGEL-Bestsellerautorin Maeve Haran die Herzen ihrer Leser im Sturm!
»Maeve Haran erweist sich immer wieder als Spezialistin für locker-amüsante Geschichten mit Tiefgang!« Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Ähnliche
Buch
Gerade als Lily Brandon kurz vor dem ersehnten Durchbruch als Theater-Schauspielerin steht, erkrankt ihre Mutter Charlotte lebensgefährlich. Sie bittet Lily inständig, ihre florierende Modefirma, die sie aus dem Nichts aufgebaut hat, weiterzuführen. Lily ist ratlos: Soll sie alle Zelte in London abbrechen und auf ihre Karriere verzichten? Das wäre ein Opfer, zu dem ihre erfolgreiche Mutter selbst nie bereit gewesen wäre. Als dann auch noch Lilys exzentrische Tante Evie aus Australien hereinplatzt, ist das Durcheinander perfekt. Doch schnell zeigt sich, dass drei Frauen gemeinsam – fast – alles meistern können: die Liebe, den Beruf und das Leben …
Autorin
Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. »Alles ist nicht genug« wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in London.
Von Maeve Haran bereits erschienen
Liebling, vergiss die Socken nicht · Alles ist nicht genug · Wenn zwei sich streiten · Ich fang noch mal von vorne an · Schwanger macht lustig · Und sonntags aufs Land · Scheidungsdiät · Zwei Schwiegermütter und ein Baby · Ein Mann im Heuhaufen · Der Stoff, aus dem die Männer sind · Schokoladenküsse · Mein Mann ist eine Sünde wert · Die beste Zeit unseres Lebens · Das größte Glück meines Lebens · Der schönste Sommer unseres Lebens
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Maeve Haran
Ich fang noch mal von vorne an
Roman
Deutsch von Ariane Böckler
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel »A Family Affair« bei Michael Joseph, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright dieser Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © 1996 by Maeve Haran
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1999 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Buchgewand Coverdesign | www.buch-gewand.de unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © Liddiebug, © HS-Photos, © Dolly-s
DN · Herstellung: sam
ISBN978-3-641-26297-6V001
www.blanvalet.de
Für A. G.
in Liebe, wie immer
1. Kapitel
Lily Brandon ließ sich vom Beifall überfluten, der süß wie Honig war und für den sie hart gearbeitet hatte. Das Ensemble wurde fünfmal zurück auf die Bühne gerufen, und das Klatschen schien nicht abnehmen zu wollen. Hier war nichts von jener halbherzigen Anerkennung zu spüren, die alle Schauspieler fürchten, da sie wissen, dass während der letzten fünfzehn Minuten die Gedanken des Publikums nicht beim Höhepunkt des Stückes sind, sondern beim Abendessen und wie man auf schnellstem Weg dazu kommt. Dieses Publikum war wie Wachs in ihren Händen gewesen. Und das Herrlichste, so musste Lily zugeben, war, dass der lauteste Beifall ihr gegolten hatte.
Sie winkte dem Publikum zu und verbeugte sich tief. Alle Wesenszüge der ernsthaften und nüchternen Figur, die sie soeben gespielt hatte, waren verschwunden. Sie hatte ihr Herz und ihre Seele in diese Rolle gelegt, und es hatte sich ausgezahlt.
»Wenn das nicht im West End gespielt wird«, zischte Ray, der männliche Hauptdarsteller, als das Klatschen allmählich nachließ und die Zuschauer nach ihren Mänteln zu greifen begannen, »mache ich einen Antiquitätenstand in Brighton auf.«
Lily drückte seine Hand. Es ging das Gerücht um, dass Londons einflussreichster Theaterkritiker in der dritten Reihe gesessen und wie ein Irrer geklatscht hatte.
Wie sie alle wussten, konnte das Stück eventuell, nur eventuell – wenn die Kritiken gut und die Kartennachfrage heftig genug war –, nach der Spielzeit hier ins West End aufsteigen. Lily gestattete sich nicht, daran zu denken. Was auch immer geschehen mochte, heute war der beste Abend ihrer Laufbahn. Wenn auch noch Ben hätte hier sein können, wäre alles perfekt gewesen.
Aber Ben hatte sich schon vor Monaten zur Preisverleihung in einer Schauspielschule verpflichtet und konnte dort nicht mehr absagen. Ben Winter war der faszinierendste Schauspieler auf Londons Bühnen, der bereits Fernsehangebote hatte und kurz vor Beginn einer Filmkarriere stand. Aber wenigstens würde er zu ihrer Premierenfeier in das italienische Restaurant um die Ecke kommen. Wie jedes Mal durchzuckte Lily beim Gedanken daran, Ben zu sehen, ein Anflug von Erregung, den auch die sechs Monate ihrer Bekanntschaft nicht im Geringsten dämpfen konnten. Sie fühlte sich immer noch wie das dicke Mädchen auf der Party, verblüfft, dass der Herzensbrecher es zum Tanzen auffordert.
Zurück in ihrer Garderobe – Kabuff wäre eine treffendere Bezeichnung gewesen –, kostete Lily ihre Freude ganz für sich allein aus. Wenn sie in diesem winzigen Kämmerchen hätte herumtanzen können, hätte sie es getan, aber hier war nicht einmal Platz genug für ein paar Schritte, geschweige denn einen Freudentanz, und die ohnehin geringe Fläche wurde durch die riesigen Blumensträuße und Glückwunschkarten noch weiter eingeengt.
Ray steckte den Kopf zur Tür herein. »Wir sehen uns in zehn Minuten drüben. Wenn du zu spät kommst, esse ich dein Antipasto auf. Kommt unser Goldjunge auch?«
Alle wussten von Ben. Sie nickte.
»Das wird den Regisseur auf die Palme bringen. Er hasst es, wenn ihm jemand die Schau stiehlt. Spitze. Übrigens, Herzchen, du warst phantastisch.«
Lily schlüpfte aus ihrem Kostüm und hängte es sorgfältig auf, während sich ihre Gefühle in die Lüfte schwangen wie eine Lerche an einem Sommermorgen. Sie wusste, dass sie gut gewesen war, das hatte sie im Innersten gespürt. Vor dem heutigen Abend hatte sie nicht gewagt, über ihren Auftritt nachzudenken, es wäre ihr wie eine Herausforderung des Schicksals vorgekommen, aber jetzt hatten alle gesehen, wie großartig sie war.
Es war ein herrliches, schamlos wundervolles Gefühl.
Na komm, warnte sie ihr nacktes Spiegelbild, verwandle dich bloß nicht nach einem einzigen guten Auftritt in eine selbstgefällige alte Kuh. In sechs Wochen kannst du arbeitslos sein.
Sie schob die Realität, mit der jeder Schauspieler leben musste, beiseite und griff nach einem herrlichen schwarzen Kleid, kurz und enganliegend, das sie gewählt hatte, da es ihr üppiges Dekolleté, in das sich Männer gern vertieften, gut zur Geltung brachte und die Aufmerksamkeit von ihren etwas schweren Beinen ablenkte, auf die Frauen sich gern gegenseitig hinwiesen. Es hatte sie die gesamte Gage der ersten Woche gekostet, aber ein Premierenabend schrie einfach nach etwas Aufsehenerregendem. Vielleicht würde sie es in ein paar Monaten, wenn sie ins West End umzogen, wieder tragen, dann aber im Ivy, wo die oberste Schauspielergarde Premieren feierte. Doch für den heutigen Abend war Romeo und Giulio’s in der High Street von Wingfield unübertrefflich.
Sie zog das Kleid an und befreite ihr langes rotes Haar aus der komplizierten Vierziger-Jahre-Frisur, die das Stück verlangt hatte. Es fiel ihr in ungezähmten Wellen über die cremeweißen Schultern. Das blasse Bühnen-Make-up stand ihr, und so entfernte sie lediglich einen Teil der dick aufgetragenen Schicht mit einem weichen Papiertüchlein. Vielleicht sah sie ein wenig übertrieben aufgemacht aus, aber das war ihr Abend, und sie wollte ihn genießen. Das Tüpfelchen auf dem i waren ein paar bronzene Ohrringe, die perfekt zu ihren Augen passten.
Ihr Blick fiel auf das Foto von Ben, das neben ihren Schminksachen stand, und sie drückte einen Kuss darauf. Es zeigte ihn in der Rolle, in der er berühmt geworden war; er spielte einen Politiker, der versucht, undurchsichtige Nukleargeschäfte aufzudecken. Der Film hatte dermaßen eingeschlagen, dass realpolitische Parteien sich bemüht hatten, Ben als Mitglied zu gewinnen, da sie hofften, sein erstaunliches Charisma ausschlachten zu können. Ben hatte gelacht und darauf hingewiesen, dass es nur eine Rolle war, doch Lily wusste es besser. Eines der Dinge, das sie an Ben liebte, war sein Engagement für andere, insbesondere junge Schauspieler, die um ihre ersten Erfolge kämpften. Deshalb, so rief sie sich ins Gedächtnis und trat das Fünkchen Ärger aus, das sich an die Oberfläche drängen wollte, war er heute Abend auch in der Sanders School of Dramatic Art, anstatt hier zu sein und ihren Triumph mitzuerleben. Sie zwang sich dazu, ihre überschäumende Freude wieder aufleben zu lassen, und machte sich auf den Weg in das Restaurant.
Romeo, der den passenden Namen für seinen extravaganten Stil hatte, stand in der Tür der freundlichen, einladenden Trattoria und erwartete sie mit einer roten Rose zwischen den Zähnen. Romeo spielte den Clown des Etablissements, schwenkte schüchternen weiblichen Gästen stets vielsagend eine riesige Pfeffermühle entgegen und überredete sie dazu, eine »Spezialität« zu bestellen, die sich als ein Dessert aus zwei Kugeln Eis entpuppte, zwischen denen eine riesige Banane wie ein erigierter Penis aufragte.
Er reichte Lily die Rose. »Per la diva«, verkündete er, als sei sie Kiri Te Kanawa vom Covent Garden, und nicht Lily Brandon vom Wingfield Theatre. Lily nahm die Rose entgegen, als wäre sie Erstere, und hoffte, er würde sie nicht über die Schwelle tragen.
Glücklicherweise kannte Romeo seine Grenzen und machte lediglich einen Kratzfuß. »Ihre Freunde sind schon da.«
Als Lily das Restaurant betrat, ertönte Applaus, diesmal vom Rest des Ensembles, der auch die anderen Gäste veranlasste, in ihre Richtung zu sehen. Lily straffte sich und schwebte mit vorgerecktem Busen an den vollbesetzten Tischen vorüber.
Einer der Kellner zückte eine Kamera und verewigte sie, je mit einem Arm von Romeo und Giulio um die Schultern, während ihr Giulio in den Ausschnitt starrte. Mit ihrer Unterschrift versehen, würde das Foto mit den anderen »Berühmtheiten« an eine Wand des Restaurants gehängt werden, damit zukünftige Essensgäste sie beäugen und sich fragen konnten, wer um alles in der Welt sie waren.
Schließlich schaffte sie es bis an ihren reservierten Tisch, wo sie sogleich von alten Freunden umringt wurde, die ihr gratulierten, bis sie von den Lobeshymnen beinahe berauscht war. Als sie die letzte Umarmung hinter sich gebracht hatte, suchte sie den Tisch mit Blicken nach Ben ab und musste ihre Enttäuschung hinunterschlucken, als keine Spur von ihm zu sehen war. Lily nahm Platz und sagte sich, dass er bei der Preisverleihung aufgehalten worden sein musste. Sie bestellte sich ihren geliebten Tomaten-Mozzarella-Salat und – wobei sie mit ihrem Gewissen rang, die Bestellung aber trotzdem aufgab – eine Portion butterzarte Kalbsleber.
Als ihr Hauptgericht kam, war er immer noch nicht eingetroffen. Wie lang konnte denn eine Preisverleihung dauern? Für Liebeskranke gibt es immer eine Million Entschuldigungen, und Lily ging sie auf der Suche nach der passenden allesamt durch. Vielleicht hatten ihn die Organisatoren bestürmt, hinterher noch kurz etwas trinken zu gehen, und er war zu höflich gewesen, um Nein zu sagen. Mechanisch verspeiste sie das wunderbare, von Giulio mit Liebe zubereitete Essen und ging anschließend auf die Toilette, um über mögliche Erklärungen nachzudenken und die Lippen nachzuziehen. Er konnte das Datum nicht verwechselt haben, da sie erst am selben Morgen noch mit ihm telefoniert hatte.
Lily schloss sich in ein Toilettenabteil ein und zwang sich, nicht zu weinen. Vor der Tür hörte sie zwei der anderen Schauspielerinnen, beide in kleineren Rollen, reden. Keine von beiden hatte sich den warmen Lobesworten angeschlossen, die über Lily gesagt worden waren. Sie überlegte, ob sie sie auf sich aufmerksam machen sollte, doch ihre Worte unterbrachen diese Überlegung.
»Er ist also nicht da?«
»Wer?«
»Wer wohl? Der Olivier unserer Generation.«
»Vermutlich weiß er nicht, wo Wingfield ist. Oder vielleicht ist er wie ein Taxifahrer. Bewegt sich nicht über die Sechs-Meilen-Zone hinaus.« Beide lachten.
»Ich wette, sie hat die Rolle nur seinetwegen bekommen. Ich meine, was hat Lily Brandon denn schon jemals gemacht?«
Das war zu viel für Lily. Sie hatte lang und hart gearbeitet, um diese Rolle zu bekommen und ihr aufsässiges Wesen unterdrückt, dessentwegen ihr manchmal Engagements entgingen. Sie warf ihr langes Haar zurück und stieß die Tür auf. »Eine ganze Menge«, fauchte sie. »Ich werde meine Agentin bitten, deiner Agentin meinen Lebenslauf zu schicken! Das heißt, falls du überhaupt eine Agentin hast.«
Sie wartete die Antwort nicht ab, genoss aber den Blick, den der überraschte Gesichtsausdruck der Frau bot.
Als sie ins Restaurant zurückkam, trat ein unerwartetes Schweigen ein. Es dauerte nicht lange, bis sie sah, weshalb. Ben Winter war endlich eingetroffen – aber nicht allein. Er saß am anderen Ende des langen Tischs, und neben ihm, auf dem gerade erst von Lily verlassenen Platz, der Grund, aus dem er sie so lange hatte warten lassen. Sie war etwa neunzehn, von fohlenhafter Schönheit und hing an seinen Lippen.
Ben erhob sich, die dunklen, feuchten Augen erfüllt von aufrichtigstem Bedauern. »Lily, Liebes, tut mir leid, dass ich so spät gekommen bin. Es war mir unmöglich, mich früher freizumachen.« Kokett fuhr er sich durch sein schwarzes Haar. Lily, die normalerweise weder eifersüchtig noch misstrauisch war, konnte sehen, von wem. Ben bemerkte ihren skeptischen Blick. »Das ist übrigens Lara. Ich habe ihr gerade ein paar Tipps gegeben, wie man ins Geschäft kommt.«
Lara starrte ihn bewundernd an, wobei sie Lily an ein Reh mit Lernschwäche erinnerte. Lily setzte sich auf den Platz, den Ray für sie freigemacht hatte, und versuchte, heiter mit ihm zu plaudern. Drei Plätze weiter hob sich für einen Augenblick die rosafarbene Tischdecke, als sich jemand nach einer heruntergefallenen Serviette bückte, und enthüllte dabei Bens Hand auf Laras Jungmädchenknie.
Die Wut rang mit einem Übelkeit erregenden Gefühl der Erschütterung, das noch heftiger war als ihre Empfindungen, bevor sie heute Abend auf die Bühne gegangen war. Wie konnte er ihr das antun? Er wusste doch, dass alle zusahen. Wenn er sie fallen lassen wollte, hätte er ihr das unter vier Augen sagen können, nicht wenn zwei Dutzend der schlimmsten Londoner Klatschmäuler dabeisaßen. Er bewies nicht einmal ein Mindestmaß an Anstand, von Liebe ganz zu schweigen. Lily sehnte das Ende des Abendessens herbei, damit sie sich in ihre Wohnung und ihr privates Unglück zurückziehen konnte.
Schließlich erschien Romeo, grinsend wie ein Wasserspeier, mit einem Tablett voller Kaffeetassen, und verteilte Amaretti in Seidenpapier an jeden. Mit Ausrufen kindlichen Entzückens, rollte das gesamte Ensemble die Papierchen zu zylinderförmigen Röhrchen und zündete sie an, begeistert darüber, dass sie fast vollständig verbrannten und dann, anstatt die Tischdecke in Brand zu stecken, plötzlich in Richtung Decke davonschwebten und ihre spinnwebartige Asche über die Tischgesellschaft verteilten.
Lily wusste, dass sie handeln musste. Sie konnte sich nicht vor all ihren Kollegen derartig vorführen lassen.
»Wünscht der Signore einen Cappuccino?«, fragte Romeo sie und wies auf Ben.
Lily nahm die Tasse mit dem schaumigen Getränk und kippte es mit einem hinreißenden Lächeln in Bens treulosen Schoß. Sie verabschiedete sich just in dem Moment, als in der anderen Ecke des Lokals das Blitzlicht aufleuchtete und Bens ungläubige Empörung für die Nachwelt festhielt.
Als sie am nächsten Morgen aufwachte und sich daran erinnerte, was geschehen war, fing sie an zu weinen. Sie hatte alle Brücken hinter sich abgebrochen und darüber hinaus auch noch einen wertvollen Teil von Bens Anatomie versengt. Anderen mochte ihre Tat vielleicht unangebracht, ja sogar verrückt erscheinen, doch Lily wusste, warum sie es getan hatte. Wenn sie nicht zu dieser drastischen Maßnahme gegriffen hätte, hätte sie ihm vielleicht verziehen und seine Lügen geglaubt. Durch diese Handlung hatte sie ebenso für sich selbst wie für alle anderen klargestellt, dass sie sich von niemandem zum Narren machen ließ, nicht einmal von Ben.
Das Problem war nur, dass es sie nicht davon abhielt, ihn weiterhin zu lieben.
Da sie sich dem Elend, das sie überflutete, nicht entziehen konnte, tat sie das, was sie in solchen Fällen immer tat; sie griff nach dem Telefon, um ihre Schwester Connie anzurufen. Während sie darauf wartete, die warmen und mitfühlenden Worte ihrer Schwester durch die Leitung zu hören, überlegte Lily, wie es wohl wäre, einen liebenden Ehemann, Kinder, ein ordentliches, gepflegtes Heim und eine Vorstellung davon zu haben, was man übernächste Woche machen würde – wie Connie. Allerdings waren die Ordnung und Ruhe in Connies Leben von ihrer eigenen unberechenbaren Existenz dermaßen weit entfernt, dass sie sich genauso gut hätte vorstellen können, E. T. zu sein.
Mehr als hundert Meilen entfernt, im tiefsten Dorset, bog Connie Brandon von der Hauptstraße in Richtung Supermarkt ab. Sie war schon so oft im Safeway’s von Bidchester gewesen und mit dessen Anlage so vertraut, dass sie den Einkauf buchstäblich blind hätte erledigen können und trotzdem all die richtigen Waren im Korb gehabt hätte. Vielleicht sollte sie das als Idee bei einer Spielshow einreichen: Blindeinkauf im Supermarkt.
Neben der Verkehrsampel forderte sie ein Schwarzweiß-Plakat zweier umwerfend attraktiver, offenbar nackter Menschen, die Eis von einem Löffel leckten, dazu auf, Häagen-Dazs Eis zu kaufen. Warum hatten anscheinend alle anderen exotischen Sex, während sie mehr Erregung dabei empfand, ihre Spülmaschine ordentlich einzuräumen? Sie beschloss, aus Protest Ben und Jerry’s Eis zu kaufen. Allerdings würde das ihrem Sexualleben nicht weiterhelfen, es sei denn, sie aß es wie die beiden auf dem Plakat zusammen mit ihrem Ehemann, aber danach stand ihr wirklich nicht der Sinn. Gavin wäre vermutlich begeistert gewesen, aber Connie hielt nichts davon, sich wie ein französisches Stubenmädchen herauszuputzen oder einen flotten Dreier mit dem Brausekopf hinzulegen. Wenn man sich dermaßen anstrengen musste, um seine Ehe aufzupeppen, dann pfiff sie darauf. Sex würde dadurch zu einer weiteren unangenehmen Pflichtübung, noch weniger amüsant, als die Flusen aus dem Wäschetrockner zu klauben, und dazu wesentlich zeitaufwendiger.
Und wie sie es schon unzählige Male getan hatte, schärfte sie sich erneut ein, dass es die Vertrautheit war, die sie an der Ehe schätzte, ihre Berechenbarkeit, das Gefühl, ein normales und geordnetes Leben zu führen. Wenn der Preis dafür ein Mangel an Aufregung war, dann sei’s drum. Trotzdem wunderte sie sich, wie andere Leute die Leidenschaft in ihrer Beziehung aufrechterhielten. Vielleicht taten sie das ja auch gar nicht. Vielleicht fingen sie an zu gärtnern und verlagerten ihre Lust und Libido darauf, Pflanzen zu züchten. Es musste doch eine Erklärung für die britische Besessenheit geben, übergroße Kürbisse zu erzeugen.
Sie wollte gerade auf ihren gewohnten Parkplatz einbiegen, den sie als günstigsten zwischen dem Standplatz der Einkaufswagen und dem Eingang zum Supermarkt berechnet hatte, als ihr plötzlich ein Bild ihrer Schwester Lily in den Sinn kam, wie sie, alleinstehend, glamourös und unbelastet von Kindern oder Einkaufslisten, von einem namenlosen Mann mit einem phänomenalen Oberkörper und ohne jedes unnütze Geplauder an ein Bett gefesselt wurde.
Und sie wünschte, sie wäre sie.
»Hier ist der geänderte Schnitt für das Ballkleid, um den Sie gebeten hatten, Mrs. Brandon.«
Charlotte Brandon, Lilys und Connies Mutter, zuckte angesichts der Unterbrechung zusammen und fuhr sich mit der Hand durch ihr adrettes graues Haar, beides für sie untypische Gesten. Die junge Nachwuchs-Modezeichnerin wartete nervös darauf, angeschnauzt zu werden, weil sie den Gedankenfluss der großen Frau gestört hatte. Sie hatte von Charlotte Brandons herrischer Art gehört und wusste, dass sie Unterbrechungen nicht einfach hinnahm.
Charlotte jedoch dankte dem Mädchen lediglich huldvoll. Sie saß an ihrem Schreibtisch im Büro von Victoriana, in einer umgebauten Wassermühle hoch über der Landschaft von Dorset, die sie so liebte, nahm aber nichts von deren vertrauter Schönheit wahr. Sie dachte über ihre Töchter nach und fragte sich, warum keine von ihnen auch nur das leiseste Interesse an der Firma zeigte. Bei Lily war es vielleicht nicht weiter verwunderlich. Sie war seit jeher aufsässig gewesen und hatte sich, obwohl sie einen ausgeprägten, eigenen Stil besaß, nie auch nur im Geringsten für Mode interessiert. Doch einst hatte sie große Hoffnungen auf Connie gesetzt. Dann hatte Connie plötzlich eine Familie gegründet und sich mit übertriebener Leidenschaft, die Charlotte als Vorwurf gegenüber ihren eigenen unklaren Vorstellungen von Kindererziehung empfand, auf Haushalt und Mutterschaft verlegt. Mutter zu sein, so hatte Charlotte es erlebt, war ja ganz nett, aber uferlos langweilig. Sie hatte kein Verständnis für Connies kindernärrische Generation, deren Vertreterinnen sich offenbar bereitwillig auf dem Altar der Mutterschaft opferten und ihren Nachwuchs zu unzähligen Kursen und Hobbies begleiteten, ein Zwischending aus Gouvernante und Chauffeur. Von Charlottes Kindern war erwartet worden, dass sie sich Victorianas wachsenden Erfordernissen anpassten.
Anfangs hatte Charlotte Kleider entworfen, weil sie sich über den Terror der Modediktate ärgerte, die Frauen glauben machten, dass sie ihre liebsten Kleidungsstücke nicht mehr tragen konnten, wenn der Saum plötzlich zwei Zentimeter zu lang war oder der Farbton nicht dem entsprach, was irgendein männlicher Modezar ihnen dieses Jahr zu tragen vorschreiben wollte. Sie hatte einfach romantische, nostalgische Kleider entwerfen wollen, die eine seit Langem vergangene, friedlichere Zeit widerspiegelten und jahrelang hielten. Der rasche Erfolg der Firma, die binnen weniger Jahre von einem winzigen Betrieb, den sie von ihrem Esstisch aus führten, zu einem Unternehmen mit hundertfünfzig Angestellten expandiert war, hatte alle verblüfft. Die Presse war von ihnen begeistert gewesen, und Charlotte Brandon war zu einer Legende in der Bekleidungsbranche geworden. Aber wofür, wenn nun, dreißig Jahre später, keines ihrer drei Kinder die Firma übernehmen wollte?
Erst gestern Abend hatte sie Edward, ihren Mann, gefragt, ob er glaube, dass ihr Sohn Jonathan oder dessen Frau es in Erwägung ziehen könnten. Edward hätte beinahe gelacht. »Jonathan fährt ja nicht einmal ans andere Themse-Ufer«, hatte er entgegnet, »und für Judith ist Erde ein Schimpfwort. Sie wird sich nie mit dem Landleben anfreunden.« Charlotte musste zugeben, dass Edward nicht ganz unrecht hatte. Jonathan und Judith waren überzeugte Großstadtmenschen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass einer von ihnen hierherzöge, wo Seele und Inspiration von Victoriana lagen.
Die Schmerzen in der Brust, die sie schon länger plagten, wurden vor Sorge schlagartig schlimmer. Wenn keines ihrer Kinder die Firma übernehmen wollte, was in aller Welt sollten sie dann tun? Die Vorstellung, dass Victoriana in fremde Hände überginge, entsetzte Charlotte. Es wäre, wie wenn Einbrecher in ihr Haus eindrängen und alles zerstörten, weil sie kein Gefühl dafür hatten, was wertvoll war und was nicht.
Verrückterweise hatte Edward vorgeschlagen, Lily noch einmal zu fragen, und als Charlotte protestierte, hatte er ihr vorgeworfen, Lily nie gemocht zu haben, da sie als Kind schwierig und reizlos gewesen war. Er hatte sogar diesen lächerlichen Vorfall erwähnt, als sie Lily im Alter von zehn Jahren als Modell für den Katalog abgelehnt hatte. Edward behauptete immer noch, es habe daran gelegen, weil Lily – im Gegensatz zu der blonden zierlichen Connie – nicht der Vorstellung ihrer Mutter vom Victoriana-Ideal entsprochen habe.
Charlotte seufzte. Es hatte absolut keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob Lily Victoriana leiten könnte. Sie wäre der Aufgabe nicht gewachsen.
2. Kapitel
Sie würde nicht mehr an ihn denken.
Lily trat mit der Spitze ihres karierten Doc Martens in einen Haufen Laub und sah mit Befriedigung, wie die Blätter durch die Luft des Hyde Parks wirbelten, als wären sie Stücke von Ben Winters aufgeblasenem Ego. Das Problem war nur, dass er sich immer wieder in ihre Gedanken einschlich. Woran lag es, dass man sich, wenn eine Beziehung beendet war, ausschließlich an deren schöne Seiten erinnerte? Die spontanen Mittagessen in dunklen Bistros, die den ganzen Nachmittag dauerten, weil Schauspieler – im Gegensatz zu Menschen in der realen Welt – sich ihre Tage frei einteilen können. Der herrliche Klatsch. Das Mitgefühl, wenn man neurotisch wurde. Das Teetrinken im Bett. Jemanden zu haben, der vor einem selbst die Kritiken las und einem das Schlimmste vorenthielt – zumindest bis nach dem Mittagessen. Seine wundervollen dunklen, grüblerischen Augen, die aber auch vor Vergnügen aufleuchten konnten, auch wenn dies meist auf Kosten anderer geschah.
Du wolltest doch nicht an ihn denken, nahm sie sich noch einmal scharf ins Gebet. Und weshalb war sie überhaupt hier? Der Hyde Park lag meilenweit von ihrer Wohnung entfernt. Als ob sie es nicht wüsste. Er lag ganz in der Nähe von Bens Wohnung, und vielleicht machte er ja gerade einen Spaziergang. Lily war sich der Abwegigkeit ihrer Logik bewusst. Wenn sie ihn sehen wollte, konnte sie ihn doch einfach anrufen. Vielleicht würde er gleich wieder auflegen, vielleicht auch nicht. Ben liebte Dramen, vor allem wenn er selbst die Hauptrolle spielte. Doch das konnte sie nicht tun. Irgendwie war es akzeptabel, in der vagen Hoffnung, ihm zu begegnen, hier spazieren zu gehen, während es nicht akzeptabel war, ihn anzurufen. Sie würde nicht klein beigeben.
Die Sonne ging bereits unter, und der Nachmittag wurde kühler. Überall schienen Liebespaare zu sein: Sie hielten auf Bänken Händchen, wärmten sich gegenseitig, tollten herum und lachten, als wäre der Zutritt zum Park nur Menschen in Paaren gestattet.
Lily machte sich auf den Nachhauseweg und kaufte sich eine Abendzeitung und einen extragroßen Marsriegel für die U-Bahn-Fahrt. Vielleicht wartete auf ihrem Anrufbeantworter eine Nachricht auf sie; vielleicht hatte er inzwischen angerufen, um sich zu entschuldigen. Du wolltest doch nicht an ihn denken, wiederholte sie das Mantra, dankbar dafür, dass der Rest des Tages hektisch verlaufen würde: Nach Hause kommen, ein Sandwich verschlingen, sich umziehen und ins Theater fahren.
In der U-Bahn war es voll und warm. Lily war dankbar für die Menschenmassen, vor allem, da sie einen Sitzplatz ergattert hatte. Sie wickelte ihr Mars aus und machte es sich bequem, um die Zeitung zu lesen.
Es stand auf Seite 18. Unter der Überschrift »Eine Portion oder zwei?«, folgte die Geschichte, wie die aufstrebende Schauspielerin Lily Brandon ihrem Liebhaber Ben Winter einen Cappuccino auf die Hose gekippt hatte, weil er zu ihrer Premierenfeier mit einer Zwanzigjährigen erschienen war. Es war sogar ein Foto dabei.
Er sah dermaßen lächerlich aus, dass Lily ein Kichern nicht unterdrücken konnte. Ja, er sah dermaßen lächerlich aus, dass er nie wieder mit ihr sprechen würde.
Als sie ihre Wohnung betrat, klingelte das Telefon. Lily war überzeugt davon, dass es Ben wäre – und dass er nicht unbedingt anrief, um sich zu entschuldigen. Aber es war Mo, ihre Agentin.
»Hey«, sagte Mo herausfordernd. Bestimmt hatte sie den Artikel gelesen. »Wie sind sie an das Foto gekommen? Hast du ihnen vorher geflüstert, dass du das machen würdest?«
Lily war entsetzt. »Natürlich nicht. Es war eine absolut spontane Geste.«
»Jede Frau über dreißig wird auf deiner Seite stehen. Du könntest eine Galionsfigur der Frauenbewegung werden.«
»Pass mal auf, Mo«, sagte Lily erschrocken. »Ich möchte die ganze Geschichte einfach vergessen.« Sie wechselte das Thema. »Gibt’s irgendwas Neues darüber, ob das Stück im West End gespielt wird? Sie müssen sich doch bald entscheiden.«
»Noch nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich sitze ihnen im Nacken.«
Lily konnte es sich vorstellen. Mo war wie eine britische Bulldogge, wenn es um ihre Klienten ging.
»Auf jeden Fall hast du großartige Kritiken bekommen.«
Lily warf einen weiteren Blick auf den peinlichen Artikel. Einen Trost gab es wenigstens. Es war die London-Ausgabe des Evening Express. Zumindest würde ihre Mutter sie nicht zu Gesicht bekommen. Ihre Meinung von Lily war auch so schlecht genug.
»Troy! Troy! Komm her, du böser Hund!« Charlotte Brandon schaute verärgert ihrem roten Setter nach, der die steile Anhöhe hinaufrannte und hinter der Kuppe verschwand. Es war ein herrlicher Morgen. Der Nebel hatte sich noch nicht von den Baumwipfeln gelöst, und das Licht war von milchiger Färbung. Die Sonne schien zwar, jedoch nur blass, als dränge sie durch ganz dünnen Musselin. Das Gras unter ihren Füßen knirschte und brach unter dem frühen Frost. Charlotte setzte ihren Spaziergang durch die Talsohle fort. Troy, benannt nach dem berüchtigten Sergeant Troy, und zwar aufgrund der schändlichen Neigung des Hundes, alles zu jagen, was weiblich war, und, wie man zugeben musste, sogar alles, was männlich war, falls sich nichts Interessanteres bot, würde bald wieder auftauchen, wenn er keine Kaninchen aufstöbern würde.
Charlotte holte beim Gehen tief Luft. Es war so friedlich hier unten, wo nur gelegentlich ein landwirtschaftliches Fahrzeug durchkam. Man konnte das Meer bereits riechen, das knapp außer Sichtweite am Ende ihres Grundstücks lag. Über ihr zogen die Möwen ihre Kreise und hofften auf einen Traktor, der den Boden umpflügte und frische Würmer an die Oberfläche holte. Aber es war zu spät. Das Umpflügen war bereits beendet, und nun mussten sie auf den Frühling warten.
Auf der anderen Seite des Tals sah sie eine Hütte auf Rädern, die mittlerweile dazu genutzt wurde, Futter für die Schafe zu lagern, anstatt wie früher als Behausung für den Schafhirten zu dienen, während er seine Herde von einer Weide zur nächsten führte. Noch zu Beginn ihrer Ehe hatte ein Hirte darin gewohnt, dessen Weg vom Tal auf die Anhöhe man verfolgen konnte, wenn man Ausschau nach dem Rauchkringel hielt, den der kleine Ofen in seiner Hütte verursachte. Er hatte einen Kittel getragen, der Charlotte zu einem ihrer ersten Entwürfe inspiriert hatte. Heutzutage fütterte ein einziger Mann – ein Landarbeiter, kein Hirte – die Schafe, indem er Heuballen aus seinem Land Rover warf.
Sie mochte eine dumme, romantische alte Närrin sein, wenn sie das Verschwinden des alten Lebens in Dorset bedauerte, aber andere Menschen empfanden offensichtlich genauso, denn sie kauften ja ihre Kleider. Charlotte hüllte zwar niemanden mehr in Hirtenkittel aus Baumwolle, aber sie setzte viktorianische Petticoats und Nachthemden zu Tausenden ab.
Sie pfiff nach Troy. Sie wusste durchaus um das Ironische an der Nostalgie, das darin bestand, dass die Vergangenheit nicht immer sanft und freundlich gewesen war, sondern für viele einen harten Kampf bedeutet hatte, in dem der Tod häufig siegte. Trotzdem hatten die Menschen oft Sehnsucht nach einem einfacheren Leben, und Charlotte hatte von diesem Gefühl profitiert.
Aber was hatte es letztlich für einen Sinn gehabt, dass sie die Firma aufgebaut hatte, wenn es nun in der Familie niemanden gab, der in ihre Fußstapfen trat? Erneut ergriff sie die alte Angst, die ihre Brust einengte, und ließ sie um Luft ringen. Verdammt noch mal, sie hatte die Pillen vergessen, die sie nehmen musste. Vor ihrem geistigen Auge sah sie das Fläschchen höhnisch auf dem Küchentisch stehen. Es war Zeit, zurückzugehen und eine zu nehmen, aber Troy hatte die Witterung eines Kaninchens aufgenommen und überhörte ihre Rufe. Charlotte verwünschte ihn und erklomm die steile Anhöhe. Oben angekommen, sah sie ihn, nur wenige Meter entfernt, wie er kokett mit dem Schwanz wedelte, er war begeistert von dem neuen Spiel. Plötzlich konnte sie sich zu ihrem Entsetzen nicht mehr bewegen. Der Schmerz hielt sie wie ein Schraubstock umklammert und drückte ihr die Luft ab. Charlotte ließ sich schwer zu Boden sinken. Ihr war schwindlig. Sie musste zu rasch hier heraufgestiegen sein.
Als er sein Frauchen so unvermittelt zu Boden sinken sah, begann Troy wie verrückt zu jaulen. Obwohl Charlotte ihn völlig klar sah, konnte sie ihm nicht einmal die Hand hinstrecken. Er rannte zu ihr und ließ sich zu ihren Füßen nieder.
Doch es war zwecklos. Sein Frauchen spielte nicht mehr mit.
3. Kapitel
In dem kleinen, stillen Raum streckte Edward Brandon die Hand aus und berührte das Gesicht seiner Frau. Bis zu diesem Moment hatte er noch nicht über ein Leben ohne Charlotte nachgedacht. Im Alter von vierundsechzig Jahren hatte man genug Freunde und Zeitgenossen verloren, um einzusehen, dass das Leben brüchig war. Man hatte sogar erlebt, dass Freunde ihre Kinder verloren, und diese Freunde sich schuldig fühlten, weil sie als Erste hätten gehen sollen. Aber nichts davon bereitete einen auf die eigenen persönlichen Tragödien vor. Charlotte war der Mittelpunkt seiner Welt. Fast vierzig Jahre lang hatten sie sich gemeinsam um ihre Familie gekümmert und Victoriana von einer Winzlingsfirma zu einem florierenden Unternehmen heranwachsen sehen. Sie hatten beinahe jede wache Minute zusammen verbracht. Manchmal hatten sie sich übereinander geärgert, sich sogar angeschrien, doch meist hatten sie Kraft und Freude aus der Anwesenheit des anderen geschöpft. Mittlerweile bestand eine Bindung zwischen ihnen, die nichts ernsthaft bedrohen konnte. Nichts – außer dem Tod. Er schloss die Augen.
Leise klopfte Lily gegen die Glastür des kleinen Raumes. Auf einem roten Plastikstuhl, der dicht neben dem Bett stand, schlief ihr Vater, den Kopf auf die zerschlissene Tagesdecke gelegt. Als sie die beiden so sah, sehnte sie sich danach, für jemanden das Gleiche zu empfinden, was sie offenbar füreinander empfanden. Und doch – je stärker die Liebe war, umso schwerer würde es für jeden von beiden werden, ohne den anderen auszukommen. Was würde Edward tun, wenn Charlotte sich nicht erholte? Sie waren wie Fäden, die ein Leben lang miteinander zu einem einzigen Stück Stoff verwoben worden waren.
Angst durchzuckte Lily, die in ihrer Intensität beinahe körperlich spürbar war. Was würde sie tun, wenn ihre Mutter starb? Zwischen ihnen standen so viele unbeantwortete Fragen. Sie liebte ihre Mutter tief und innig, obwohl sie wusste, dass Charlotte sich ihr in einer Weise entzogen hatte, die auf ihre anderen Kinder nicht zutraf. Sie war so angsteinflößend gewesen, dass Lily nie gewagt hatte, zu ergründen, warum. Stattdessen hatte sie das Gefühl, dass mit ihr etwas nicht stimmte, dass sie nicht so liebenswert war wie die anderen. Ich bin Schauspielerin geworden, Ma, damit ich die Anerkennung Tausender bekomme, wo ich doch im Grunde nur die Anerkennung eines einzigen Menschen wollte. Warum konntest du mir die nie geben?
Als hätte er ihren Blick auf sich gespürt, schlug Edward die Augen auf. »Wie lange war ich außer Gefecht?«
Lily reichte ihm eine Tasse Tee, die sie in der Kantine geholt hatte. »Nicht lange. Soll ich dich vielleicht ablösen, damit du dir die Beine vertreten kannst? Connie ist mit den Kindern draußen, und Jonathan hat vom Auto aus angerufen. Sie sind schon am Ortsrand von Bidchester. Sie werden gleich da sein.«
Edward nahm dankbar den Tee entgegen. Er erhob sich steif, wobei er verletzlich und alt aussah, und Lily sah mit Schrecken, wie eine Krise die Rollen vertauschte. Sie war jetzt der Elternteil und ihre Mutter und ihr Vater die abhängigen Kinder.
Als sie die blasse, von blauen Adern durchzogene Hand ihrer Mutter hielt, bemerkte Lily, dass sie feucht von ihren eigenen Tränen war. »Ich liebe dich, Ma«, sagte sie leise, »selbst wenn du mich anscheinend nicht liebst. Verlass mich nicht. Wenn du stirbst, werde ich es nie verstehen.«
Charlotte regte sich nicht. Trotz der störenden Technik wirkte sie erstaunlich ruhig und friedlich, und nur ein schwacher, blauer Schatten um ihren Mund herum wies auf ihren Zustand hin. Und dann, ganz langsam, begannen ihre Augenlider zu zittern und öffneten sich. Eine Sekunde lang fixierten ihre Augen Lily mit beinahe flehentlichem Ausdruck, wie jemand, der um Vergebung bittet, doch Lily war zu aufgeregt, um es zu registrieren. »Pa!«, rief sie überschwänglich. »Pa, komm. Sie wacht auf.«
Edward kam hereingelaufen, sein Gesicht leuchtend vor plötzlicher Freude. Ihm folgten Connie und Gavin mit Tara und Jeremy im Schlepptau.
»Charlotte«, schluchzte Edward, der nun nicht mehr meinte, ihr zuliebe stark sein zu müssen, »Charlotte, mein Liebling, Gott sei Dank.«
»Was machst du denn, wenn sie stirbt?«, fragte Judith Brandon ihren Ehemann Jonathan, als sie in ihrem makellos weißen Range Rover auf das Krankenhaus von Bidchester zusteuerten.
»Was meinst du damit?«
Es sah Judith gar nicht ähnlich, ein Gespräch über sein Gefühlsleben anzufangen. Judith schien es stets lieber zu sein, wenn er stark war und schwieg. Seine Firma hatte in jüngster Zeit Schwierigkeiten gehabt, aber er war fest überzeugt, dass sie davon nichts hören wollte.
Jonathan dachte an seine Mutter und merkte, dass er die Möglichkeit ihres Todes gar nicht ernsthaft in Betracht gezogen hatte. Ma war ein Felsblock. Sie konnte überhaupt nicht sterben.
Sie war zu stark. Sie würde seinen Vater überleben, da war er sich sicher. Jonathan hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, schmerzliche Möglichkeiten auszuklammern, und das hatte sich bewährt. Er hatte nicht vor, das jetzt zu ändern.
»Wegen der Firma, meine ich«, sagte Judith, wobei ihr perfekt geschnittenes aschblondes Haar in der Sonne glänzte. »Sie verkaufen?«
Wie dumm von ihm, sich einzubilden, dass seine Frau an etwas so Triviales wie seine Gefühle denken könnte.
»Warum, du willst sie doch nicht etwa übernehmen? Meine Eltern wären begeistert, wenn du das tätest.«
Judith dachte darüber nach. Im Grunde interessierte sie sich sogar für Victoriana. Soweit sie es beurteilen konnte, betrieb Charlotte die Firma beinahe wie einen Wohltätigkeitsverein, und wenn jemand mit dem richtigen Management käme, könnte sie hohe Renditen erzielen. Aber Judith hatte Wichtigeres zu tun: sie musste Paula, ihre Chefin bei Imagemakers, dazu überreden, sie zur vollwertigen Teilhaberin zu machen, um mit der Firma in neue und lukrative Gebiete wie etwa politische Einflussnahme vorzudringen. Auf jeden Fall war die Vorstellung, sich in Dorset zu vergraben, absurd. Sie hasste das Land. Es war langweilig und schmutzig, und man aß dort immer zu viel.
Jonathan warf einen Blick auf das perfekte Profil seiner Frau, um zu sehen, ob sich wenigstens eine minimale Spur von Mitgefühl für seine Mutter auf ihrem Gesicht abzeichnete. Hinter den schwarzen Gläsern ihrer modischen Sonnenbrille blieben ihm ihre Augen verborgen, aber er konnte deren Ausdruck erraten. Sie wandte den Kopf zur Seite, um eine Schaufensterpuppe in der Auslage von Country Casuals zu betrachten, als sie durch die kleine Stadt Bryly fuhren.
Sie hielten vor einer roten Ampel. »Im Grunde ist es dir schnurzegal, ob meine Mutter lebt oder stirbt, stimmt’s?«
»Und dir?«
»Mir nicht.« Jonathan sah sich selbst gern als mitfühlendes Wesen, und außerdem war seine Mutter Teil seiner Sicherheit und seines Selbstgefühls. »Es ist mir ganz und gar nicht egal.«
Die Ampel schaltete auf Grün. »Dann beeil dich lieber mal«, sagte Judith und steckte sich die Kopfhörer ihres tragbaren CD-Players in die Ohren.
Eine halbe Stunde später erreichten sie das Krankenhaus. »Hallo, Ma.« Jonathan legte einen riesigen Blumenstrauß auf das Bett. »Was habe ich da gehört – du tust so, als wärst du krank?«
»Uns war klar, dass das nur Unsinn sein konnte«, fügte Judith hinzu. »Die Welt würde sich ja ohne Charlotte Brandon nicht mehr drehen.«
Lily sah, wie ihre Mutter schwach lächelte, und wurde von nagender Eifersucht befallen. Jetzt, wo sie sich erholte, schien Charlotte erfreuter zu sein, die verdammte Judith zu sehen als ihre eigenen Töchter. Judith hatte eine ähnliche Zähigkeit wie Charlotte, die ihr und Connie fehlte.
Der kleine Raum hatte infolge des regen Kommens und Gehens die Atmosphäre einer geschäftigen Flughafenhalle angenommen, so dass schließlich die Krankenschwester kurz angebunden auf ein Schild zeigte, das darauf hinwies, dass nur zwei Besucher zugleich gestattet waren. Mit etwas, das einem Seufzer der Erleichterung sehr nahe kam, verabschiedeten sich Judith und Jonathan und fuhren nach London zurück.
Eine Woche später wurde Charlotte zur Freude aller – außer der kleinen Schar Reporter, die im The George in Bidchester wohnten und die geschickt worden waren, um ihre Genesung zu verfolgen – nach Hause entlassen. Sie hatten wohl darauf gehofft, den Nachruf zu verfassen und vielleicht sogar über die Beerdigung berichten zu dürfen, falls sich genügend Prominenz dazu einfand.
Edwards Freude über ihre Heimkehr war rührend. Er füllte alle Vasen mit ihrem geliebten weißen Rittersporn, importiert von den Kanalinseln, und kaufte wie ein Irrer ein, um sicherzugehen, dass auch all die gesunden Nahrungsmittel im Haus waren, die die Ärzte vorgeschrieben hatten. Der andere ärztliche Ratschlag war schwerer zu befolgen. Charlotte sollte ordentlich essen und sich viel bewegen, aber alles vermeiden, was sie überanstrengte oder stressig war. Wie zum Beispiel Victoriana zu leiten. Die ganze Familie wusste, wie schwer es sein würde, Charlotte zum Ausruhen zu bringen. Wenn sie voll ausgelastet war, strahlte Charlotte immer noch genug Energie aus, um ein Kraftwerk zu betreiben, aber bei erzwungener Untätigkeit wurde sie zum Vulkan.
Edwards Einwänden zum Trotz ließ sie June, die Angestellte, der sie am meisten vertraute, täglich vor ihrer Bettkante antreten und schickte sie mit einer Liste von Aufgaben wieder davon, für die ein normaler Mensch Wochen gebraucht hätte, deren Erledigung Charlotte jedoch bis zum nächsten Tag erwartete.
Ein- oder zweimal ging Edward ins Büro, zerbrach sich aber die ganze Zeit lediglich den Kopf darüber, wie Charlotte während seiner Abwesenheit zurechtkam. An einem dieser Tage kam er nach Hause und traf sie auf einem Stuhl stehend an, strahlend in einem ihrer eigenen Victoriana-Nachthemden (das Modell aus reiner Baumwolle, das man stundenlang bügeln musste, das aber dem masochistischen Gefühl der Kundinnen entgegenkam, mit der Geschichte verbunden zu sein), wie sie sich in ihrem Arbeitszimmer nach einem Stapel Victoriana-Katalogen hoch oben in einem Regal reckte.
Edward, der meist einen beruhigenden Einfluss auf Charlottes explosives Temperament hatte, verlor die Beherrschung. »Was zum Teufel machst du da, Charlotte?«, herrschte er sie an.
»Ich kann nicht ewig im Bett liegen.«
»Pfeif auf ewig. Du hattest einen schweren Herzinfarkt.«
»Schon gut, schon gut«, gab sie ungeduldig zu. »Ich gehe ja wieder ins Bett. Aber irgendjemand muss Victoriana leiten, und du hast zu viel damit zu tun, mich zu bemuttern. Der neue Katalog muss vorbereitet werden. Wir müssen etwas tun, Edward.«
Edward wusste, dass sie recht hatte. Es war schon immer Charlottes Firma gewesen, obwohl sie sich viel stärker auf ihn verließ, als die Leute dachten. Nun, da sie so krank war, wollte er sich um sie kümmern. Was hatte es für einen Sinn, eine erfolgreiche Firma zu führen, wenn es einen den Menschen kostete, den man am meisten liebte? Er musste Charlotte irgendwohin bringen, wo sie auf andere Gedanken käme. Und das heißt, dass ein anderer bei Victoriana die Zügel in die Hand nehmen musste.
Es war Zeit, die Familie zusammenzutrommeln.
Lily hörte weit entfernt das Telefon klingeln, als stünde es in der Wohnung nebenan, bis ihr einfiel, dass sie ein Kissen über dem Kopf hatte. Sie war am Abend zuvor mit ihrer besten Freundin Maxie aus gewesen, um ihre Sorgen zu ertränken und bei einem Glas Wein nach dem anderen ihre Beziehung zu Ben Winter zu sezieren und zu ergründen, ob er eine miese Ratte war oder ein überaus kreativer Mensch, dem man mehr Freiraum für schlechtes Benehmen zugestehen musste als gewöhnlichen Sterblichen. Ärgerlicherweise hatte Maxie an Ersterem festgehalten und noch ein paar alternative Bezeichnungen hinzugefügt wie etwa Dreckskerl, Schweinepriester oder Windhund und behauptet, dass er seitdem jeden Abend mit der zwanzigjährigen Bambi-Doppelgängerin gesehen worden war. Lily, die auf ihren unmissverständlichen Akt stolz war, Ben aber schrecklich vermisste, neigte eher dazu, von ihrer harten Haltung abzuweichen.
Der Abend hatte damit geendet, dass Maxie ihrer Freundin lautstark verkündet hatte, sie würde nie mehr mit ihr sprechen, wenn sie sich wieder mit Ben Winter versöhnte.
Sie nahm an, dass Maxie am Telefon wäre, um sich zu entschuldigen.
»Spreche ich mit Lily Brandon?« Lily kannte die Stimme nicht.
»Ja.«
»Hier ist Miles Langdon. Ich bin Nachrichtenredakteur beim Sunday Special.«
Lily wurde übel bei dem Gedanken, dass Englands berüchtigtste Dreckschleuder ihre Telefonnummer besaß.
»Wir wollten Ihnen ein äußerst lukratives Angebot machen, wenn Sie uns ein Exklusiv-Interview über Ihre Beziehung zu Ben Winter geben. Es wäre Ihrer Karriere sehr förderlich«, sagte Miles Langdon.
Lily fühlte die Schmierigkeit des Mannes fast körperlich.
Sein Tonfall ging vom Schmeichlerischen zum süßlich Drohenden über. »Wir können es natürlich auch so bringen, wissen Sie. Sie könnten einfach nur wesentlich besser dastehen als er, wenn Sie die Initiative ergriffen. Als eine Art Heldin. Ich wette, hinter seiner liberalen Fassade ist er ein ebensolcher Chauvi wie wir alle, oder?«
Lily konnte sich gut vorstellen, was für ein Chauvi Mr. Miles Langdon war. Vermutlich wies er seine weiblichen Reporter an, Miniröcke zu tragen und sich für eine gute Story flachzulegen und an England zu denken.
»Mr. Langdon.« Lily wünschte, sie stünde neben ihm, um ihm mit ihren Doc Martens auf die Füße zu treten. »Das Interview können Sie sich abschminken. Ich denke nicht im Traum daran, Ihrem Blatt ein Interview zu geben. Ja, ich würde nicht einmal mein Katzenklo damit auslegen.« Die Tatsache, dass sie überhaupt keine Katze besaß, spielte keine Rolle.
Als sie den Hörer aufknallte, durchzuckte sie der schreckliche Gedanke, dass sie offensichtlich für die Presse interessant war, wenn bereits der Sunday Special hinter ihr her war, und das bedeutete, dass ihr auch andere auf den Fersen sein konnten. Panisch verkroch sie sich unter der Decke. Wohin konnte sie gehen? Vielleicht könnte sie bei Maxie unterschlüpfen. Maxie lebte in einer riesigen, heruntergekommenen Wohnung in Finsbury Park, die sie mit drei anderen Schauspielern und einem armen Menschen mit Festanstellung teilte, der sämtliche Rechnungen bezahlen musste.
Jemand nahm den Hörer ab. Gott sei Dank war es Maxie.
»Max, kann ich ein paar Tage bei dir wohnen? Eine grässliche Zeitung ist hinter mir her.«
»Die möchten wohl, dass du ihnen verrätst, wie sich Ben Winter aufführt, wenn er nicht auf der Bühne steht, was?«
»Maxie, hör bloß auf.«
»Okay, Schätzchen, es tut mir wirklich furchtbar leid, aber wie du weißt, gehe ich auf Tournee, und ich habe mein Zimmer bereits einem anderen Schauspieler vermietet. Übrigens, ich verspreche dir, dass ich es nicht dem Sunday Special verrate, aber wie ist der schöne Ben eigentlich im Bett?«
Maxi sollte es nie erfahren, denn in diesem Moment sah Lily aus dem Fenster und stieß einen Schrei aus. Sie war mit dem Telefon ins Badezimmer gegangen, um sich ein Bad einlaufen zu lassen. Oben in der Linde, kaum einen Meter von ihr entfernt, hockte ein Fotograf, der soeben sein Teleobjektiv auf ihr Badezimmerfenster richtete.
Mindestens eine Sekunde lang starrten sie einander an. Er war dicklich und hatte schon fast eine Glatze; man sah ihm an, dass er sich extrem unwohl fühlte – wie ein Wellensittich, der versucht, auf einem Zahnstocher zu balancieren. Lily hatte sogar noch Zeit, sich zu fragen, ob er wohl erfrieren würde, bevor sie sich beide wieder gefasst hatten und er nach seinem Blitzlicht griff.
»Maxie«, zischte Lily mit klopfendem Herzen, »hier im Baum sitzt ein Fotograf, der die Kamera auf mich gerichtet hat. Was zum Teufel soll ich jetzt tun?«
»Schütt ihm Wasser ins Gesicht.«
»Das kann ich nicht. Dann fotografiert er mich dabei, wie ich es tue.«
Maxie dachte einen Augenblick darüber nach. »Aber nicht, wenn du es mit der Dusche durch die Vorhänge machst.«
»Danke für den Tipp. Ich ruf dich wieder an.«
Lily zog die Vorhänge zu und kroch über den Fußboden. Sie drehte den Hahn bis zum Anschlag auf und stellte dann auf die Brause um. Das Wasser war eiskalt. Sie schob die Vorhänge drei oder vier Zentimeter auseinander, so dass sie immer noch unsichtbar war, öffnete das Fenster und zielte auf den Störenfried.
Sein Gebrüll war Musik in ihren Ohren.
Sie überlegte sich gerade, dass ihre neue Angewohnheit, Männer körperlich zu attackieren, nicht zur Gewohnheit werden durfte, als ihr Vater anrief, um sie auf das Familientreffen zu beordern.
»Es ist doch nicht wegen Ma?«, fragte sie ängstlich und fürchtete schon einen Rückfall.
»Nein, nein, ihr geht es gut. Es dreht sich um eine Familienangelegenheit.«
Lily brauchte fünf Minuten zum Packen. Bislang hatte niemand eine Verbindung zu Charlotte Brandon und Victoriana hergestellt. Dort wäre sie sicher. Es bedeutete zwar, dass sie täglich fünf Stunden pendeln musste, um zum Theater zu gelangen, aber alles war besser, als von schamlosen Mitarbeitern der Boulevardpresse abgelichtet zu werden, während man auf dem Klo saß.
Sie war schon halb zur Tür draußen, als das Telefon wieder klingelte. Lily verkrampfte sich bei dem Gedanken, dass es noch ein Journalist sein könnte, und war dankbar dafür, dass der Anrufbeantworter das Gespräch aufzeichnen würde.
Bens Stimme ging ihr durch und durch. »Lily, Liebes«, säuselte er, wobei es ihm gelang, äußerste Zerknirschtheit und tiefe Aufrichtigkeit zugleich zu vermitteln – kein Wunder, dass er beim Synchronsprechen so gut verdiente –, »ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir alles tut. Könntest du mich vielleicht zurückrufen? Es ist ziemlich dringend.«
Lily konnte der Versuchung nicht widerstehen, das Band noch einmal abzuhören, und versenkte sich in die Schönheit seiner Stimme. Entschuldigte er sich eigentlich, weil es ihm leid tat, wie er sie behandelt hatte, oder weil es ihn beunruhigte, dass sein aufrechtes Image als der gute Mensch aus der linken Szene beschmutzt würde, wenn Lily mit der Presse sprach?
Sie rief sich erneut ins Gedächtnis, dass Maxie ihn vor zwei Abenden mit Bambi in einer Diskothek gesehen hatte, und zog fest die Tür hinter sich zu.
Der Gedanke, dass Ben nun vergeblich auf ihren Anruf wartete, war überaus befriedigend.
»Was glaubst du, warum wir hinzitiert werden?«, fragte Judith ihren Ehemann gereizt, während sie das warme Wasser mit einem Stückchen Ingwer schlürfte, das sie morgens stets als Erstes zu sich nahm. Die Samstage waren kostbar, und ihrer Meinung nach war die alte Schachtel außer Gefahr.
»Da bin ich genauso überfragt wie du.« Jonathan überlegte, ob es die Mühe wert war, eine Hand zwischen die Beine seiner Frau zu schieben; sie hatten noch Zeit, miteinander zu schlafen, bevor sie sich auf den Weg machten. Ihre Blondheit, die an eine englische Rose erinnerte, die blasse Haut, durch die ihre blauen Venen schienen, ihre winzigen, zerbrechlich wirkenden Knochen erregten ihn in fast obszöner Weise. Es wirkte beinahe so, als könnte man ihre zarten Handgelenke nehmen und entzweibrechen. Aber Judith bestand, wie er aus bitterer Erfahrung wusste, unter dieser brüchigen Fassade aus reinstem Stahl. Er merkte, wie seine Erektion anschwoll, aber Judiths Miene von kühler Effizienz deutete darauf hin, dass sie in Gedanken bereits woanders war, und er hatte keine Lust, den Tag mit einer weiteren demütigenden Zurückweisung zu beginnen. Er war, das wusste er, eine kleine Enttäuschung für Judith. Sie schwärmte für Sieger, und Jonathan entsprach nicht ganz ihren Erwartungen.
»Gut.« Sie schlug die Decke zurück und ließ die brutale, kalte Luft herein. »Die Zeit reicht noch für eine halbe Stunde auf dem Stairmaster, bevor wir fahren.«
»Hast du meine Gitarrennoten gesehen, Ma?« Jeremy steckte den Kopf zur Küchentür herein.
Connie Brandon sah von ihrer Lieblingsbeschäftigung auf, dem Ausfüllen ihres Terminkalenders. Sie liebte Strukturen. All diese Schuljahre, Halbjahre und Dinnerpartys, die sich beruhigend in den Terminkalender des nächsten Jahres erstreckten, gaben ihr das Gefühl, dass das Leben Struktur und Rhythmus besaß. Wie Lily damit zurechtkam, alleinstehend zu sein, war Connie ein Rätsel. Connie hatte das Single-Dasein gehasst. Das einzige Problem war nur, dass sie manchmal, wenn sie alle Veranstaltungen eingetragen hatte, das merkwürdige Gefühl bekam, sie bereits hinter sich zu haben. »Wann hast du sie zuletzt gesehen?«
»Das war im Wohnzimmer. Tara hat sie versteckt, weil sie dachte, ich könnte ihr ein bisschen Kultur aufdrängen, als sie sich Blind Date anschauen wollte.«
Seine Schwester streckte ihm die Zunge heraus. »Seit wann ist dieser fürchterliche Scheiß, den du spielst, Kultur?«, wollte Tara wissen.
»Woher willst du überhaupt wissen, was Kultur ist, du Fernsehsüchtige? Du findest doch noch Baywatch intellektuell anregend.«
Connie schüttelte den Kopf. Sie waren siebzehn und fünfzehn Jahre alt, und sie gingen so miteinander um, seit sie vier und zwei gewesen waren. Früher hatte sie einmal davon geträumt, am Esstisch geistreiche Unterhaltungen mit ihren Kindern zu führen, aber Tara aß kaum etwas, und Jeremy schaufelte das Essen in fünf Minuten in sich hinein, egal wie lange die Zubereitung gedauert hatte, und eilte dann wieder zu seiner geliebten Gitarre.
Gavin kam herein, sah in den Spiegel neben der Spüle, rückte die witzige Krawatte gerade, die sie ihm geschenkt hatte, und beugte sich hinab, um ihr einen Kuss zu geben.
»Bist du heute Morgen im Laden? Dieser Exporteur von den Philippinen wollte mit ein paar Mustern vorbeikommen.«
Connie fluchte in ihre Cornflakes. Heute fand das Familientreffen statt, und sie würde ihn verpassen. Mit den Exporteuren zu verhandeln war der Teil ihrer Arbeit, der ihr am meisten Spaß machte, seit sie – dank der Rezession – nicht mehr selbst zu Einkaufsreisen nach Marokko oder auf die Philippinen jetten konnten. Connie schob ihre geschäftlichen Sorgen beiseite. Es war so einfach gewesen, als sie angefangen hatten. One World. Sie waren jung, idealistisch und ohne Geld, trampten mit Rucksäcken durch Nepal und kamen überladen mit herrlichen Holzschnitzereien zurück, die sie fast umsonst bekommen hatten. Leute, die sich ihre ersten Wohnungen einrichteten, hatten sie ihnen aus den Händen gerissen, und Connie und Gavin stellten fest, dass sie alles, was ihnen an Billigem und Exotischem unter die Finger kam, verkaufen konnten. Mittlerweile hatte sich entweder der Geschmack gewandelt, oder die Leute hatten weniger Geld, und One World, in seinen neuen, großzügigen Räumen, bekam die gesunkene Kaufkraft zu spüren.
»Könntest du einen anderen Termin mit ihm ausmachen? Heute ist große Familienkonferenz, du weißt schon.«
»Worum geht es denn?«
»Um die Zukunft von Victoriana, nehme ich an.«
»Vielleicht wollen sie dich fragen, ob du die Firma übernehmen willst. Mit deiner Geschäftserfahrung wärst du ideal.« Gavins Glaube an sie rührte sie. Er trieb sie ständig dazu an, etwas Neues auszuprobieren.
»Das werden sie sicher nicht«, sagte Connie rasch. Sie würden sie nicht fragen, weil sie ihnen stets erklärt hatte, dass sie ihrem Laden und ihrer Familie zu sehr verpflichtet war. Sie wusste, dass der Laden sie brauchte und Gavin es sich nicht leisten konnte, ein weiteres Gehalt zu zahlen, aber in Wirklichkeit sehnte sie sich nach einer Veränderung. Und ihre Familie, sosehr sie sie auch liebte, konnte ziemlich nervenaufreibend sein.
Sie betrachtete den Stapel schmutzigen Geschirrs auf der Spülmaschine. Dieses eine Mal könnten sie es selbst machen. Connie wollte Zeit dafür haben, sich wie eine dynamische Geschäftsfrau herauszuputzen.
Lily raste bei brüllend lauter Kassettenmusik in ihrem Käfer die Autobahn entlang. Es würde furchtbar eng werden, zur Abendvorstellung zurückzufahren, aber Familientreffen waren eine Seltenheit, und wenigstens lenkte sie dieser ganze Aufwand von Ben ab. Trotz allem fragte sie sich, was er wohl machte. Wahrscheinlich lange schlafen. Mit Bambi. Sie zwang sich, nicht mehr an Ben Winter zu denken. Es tat nur weh. Das musste ein Ende haben.
Der Anblick ihres Elternhauses erlöste sie. Das vierhundert Jahre alte Bauernhaus, halb versteckt in der Talsohle gelegen, bewegte sie jedes Mal wieder in seiner abgeschiedenen Schönheit. Errichtet von einem Bauern, der nach Höherem strebte, bestand es aus weichem gelben Stein und stand zwischen zwei sanften Anhöhen. Obwohl es schon Ende Oktober war und das Ackerland weiter oben bereits umgepflügt und kalt dalag, hatte man hier unten fast noch das Gefühl, es wäre Sommer.
Sie wusste genau, warum gerade Dorset mit seinen unveränderlichen landwirtschaftlichen Abläufen ihrer Mutter den Anstoß zur Gründung von Victoriana gegeben hatte, so dass sie an diesem geliebten Ort leben und arbeiten konnte. Heute, an diesem herrlichen Nachmittag, fühlte auch sie die Anziehungskraft.
Ihr Vater musste nach ihr Ausschau gehalten haben, da er vor der Tür stand und sie winkend willkommen hieß. Dafür besaß er offenbar einen sechsten Sinn, da er, auch wenn sie überraschend vorbeikam, dastand und sie zu erwarten schien. Sie sah ihr Zimmer vor sich, mit seiner duftigen Leinenbettwäsche und den frischen Blumen, die ihre Mutter immer arrangierte. Das Einzige, was sie sich wirklich wünschte, war eine Umarmung von Charlotte, aber die Blumen würden genügen müssen.
»Bin ich die Einzige hier?« Sie gab ihrem Vater einen Kuss. Es war ein so herrlicher Morgen gewesen, dass Lily zunächst getrödelt hatte und die letzten Meilen gerast war, damit sie nicht zu spät kam.
»Jonathan und Connie haben die Autos hinter dem Haus geparkt. Wir sind alle beim Kaffeetrinken im Esszimmer.«
Der nach Westen gelegene Raum glühte von der Wärme des Feuers, das in dem riesigen Kamin brannte, der die gesamte Breite der hinteren Wand einnahm. In einer silbernen Kaffeekanne spiegelten sich die Flammen. Lily gab allen einen Kuss und nahm schließlich mit ihrer Tasse und einem der berühmten Ingwerplätzchen ihrer Mutter Platz.
Edward warf seiner Frau mit hochgezogenen Augenbrauen einen Blick zu und erhob sich.
»Es erschien uns angebracht, dieses Treffen hier abzuhalten, da das hier der Raum, ja sogar der Tisch ist, an dem das erste Kleidungsstück von Victoriana zugeschnitten wurde.« Er lächelte Charlotte zu. »Ein Rüschennachthemd, das eure Mutter von einem Nachthemd im Landwirtschaftsmuseum von Bidchester kopiert hat und das ich anschließend Harrods anzudrehen versucht habe. Seitdem haben wir es weit gebracht.«
Das haben sie allerdings, dachte Lily. Jede Frau hatte vermutlich zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben ein Kleidungsstück von Victoriana besessen, und Charlotte selbst war im Handumdrehen berühmt geworden, ein Teil des Mythos von Swinging England. Lily bemerkte, wie Judith einen gelangweilten Blick mit Jonathan wechselte, und hätte ihr gern einen Tritt versetzt. Die beiden, so schien es Lily, hatten herzlich wenig mit der Philosophie von Victoriana gemein. Ihre Wohnung war minimalistisch und ungemütlich. Alles war in unsichtbaren Schränken verstaut. Ein versprengtes Stück Nippes würde vor Einsamkeit umkommen. Als Lily ihre Schwägerin einmal gefragt hatte, ob sie nächstes Mal irgendetwas anders – soll heißen gemütlicher – machen würde, hatte Judith gesagt, sie würde die Lichtschalter verschwinden lassen.
Charlotte blickte in ihre Richtung, und als Judith ihren Blick auf sich spürte, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck von Langeweile in äußerste Faszination. Schlange, dachte Lily. Natürlich hatten Charlotte und Edward das uneingeschränkte Recht, sich ihren Nachfolger selbst auszusuchen, aber sie hoffte stark, dass es nicht Judith sein würde. Charlotte besaß einundvierzig Prozent der Aktien, und mit Edwards zwanzig Prozent hielten sie die Mehrheit. Jedem der Kinder gehörten zehn Prozent, und die restlichen neun Prozent besaß Leo Orson, der Freund, der ihnen am Anfang finanziell unter die Arme gegriffen hatte, als sie in massiven Geldnöten steckten. Er war inzwischen nach Australien ausgewandert und zu Reichtum gekommen, aber bislang hatte er alle Angebote, seine Aktien zurückzukaufen, abgelehnt.
»Unserer Ansicht nach haben wir drei Möglichkeiten«, fuhr ihr Vater fort. »Verkaufen – aber Victoriana ist das Lebenswerk eurer Mutter, und außerdem fühlen wir uns unseren Angestellten verpflichtet, von denen einige von Anfang an bei uns sind. Wir könnten einen Geschäftsführer einstellen, was keinem von uns sonderlich behagt; oder wir könnten einen von euch fragen.« Er blickte seine Kinder der Reihe nach an. »Und für Letzteres haben wir uns schließlich entschieden.«
Im Raum war eine greifbare Spannung zu spüren, die Lily entsetzt als Geschwisterrivalität erkennen musste. Eine der Grundregeln, wenn man einen Bruder oder eine Schwester hatte, war, dass man zwar ein Spielzeug vielleicht gar nicht selbst haben wollte, aber trotzdem mit den Füßen auf den Boden stampfte, um es zu ergattern, falls auch nur die vage Aussicht bestand, dass es eines der anderen bekommen könnte.
Edward schien das vorausgesehen zu haben. »Ihr werdet vielleicht mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht einverstanden sein, aber wir bitten euch, sie trotzdem zu respektieren. Wir haben lange und intensiv darüber diskutiert, wer am besten geeignet ist. Derjenige von euch, den wir darum bitten, wird gewisse Opfer bringen müssen, aber wir glauben, dass der Betreffende davon genauso profitieren wird wie Victoriana.«
Er lächelte Connie an, deren Herz hoffnungsvoll, dass er sie zu Charlottes Nachfolgerin ernennen würde, klopfte. »Connie, du hast bereits den Laden und deine Familie.« Sein Blick wanderte weiter. »Lily hat ihre Bühnenkarriere. Jonathan und Judith haben ihre Berufe.« Edward holte tief Luft. Er war die halbe Nacht auf gewesen, um Charlotte von der Klugheit seiner nächsten Worte zu überzeugen. »Wir sind der Meinung, dass die beste Nachfolgerin für Charlotte bei Victoriana du wärst, Lily. Wir glauben, dass du mit deiner Entschlusskraft und deinem Stilgefühl genau die Richtige wärst, um Victoriana ins nächste Jahrhundert zu führen.«
Edward wartete auf Lilys Reaktion. Er hatte gewusst, dass sie überrascht sein würde; womöglich gar nicht einwilligte. Wenn sie es aber tat, so war er davon überzeugt, dass sie Victoriana nicht nur erfolgreich leiten würde, sondern dass es auch zu ihrem Vorteil sein könnte, indem es ihr die Stabilität und den Rahmen verschaffte ebenso wie den Glauben an sich selbst, der ihr seiner Meinung nach fehlte. Es war, das wusste er, ein kalkuliertes Risiko, aber eines, von dem er glaubte, dass es die Sache wert war.
»Aber ich habe keine Ahnung, wie man eine Firma leitet«, protestierte sie völlig verblüfft.
Eine Reihe unerfreulicher, prustender Lachgeräusche sagten ihr, dass Jonathan den Vorschlag seines Vaters nicht akzeptierte. »Das ist doch lächerlich, Pa. Lily hat noch nicht einmal eine Suppenküche geleitet. Mittlerweile ist sie in London zum Gespött der Leute avanciert, weil sie einen Kaffee über einen Schauspieler gekippt hat. Man wird sie nie ernst nehmen.« Lily konnte es kaum glauben, als er in seiner Jackentasche wühlte und den Artikel über Ben und den Cappuccino herauszog.
»Vielen Dank, Jonathan«, fauchte sie, »du hast sogar den Zeitungsausschnitt aufgehoben. Wie gewissenhaft. Hast du befürchtet, sie würden dir nicht glauben?«
»Mein Gott«, überging Jonathan sie, »Lily ist Schauspielerin.« Er sprach es aus, als wäre es ein Schimpfwort.
Lily merkte, dass sie langsam wütend wurde, wie immer, wenn sie gegen eine Übermacht zu kämpfen hatte. Tatsache war, dass keiner aus ihrer Familie an sie glaubte – außer Edward. Er hatte Ma vermutlich zu dieser Entscheidung überredet. Lilys Blick wanderte zum Gesicht ihrer Mutter, verzehrt von dem altbekannten Verlangen, ihre Mutter möge eine hohe Meinung von ihr haben und ihr die Anerkennung schenken, nach der sie sich immer gesehnt hatte.
Edward schien ihre Gedanken zu lesen. »Wir haben dir dieses Angebot gemacht, weil wir glauben, dass du es kannst. Wirst du es versuchen?«
Connie unterdrückte ihre bittere Enttäuschung. Sie war sich so sicher gewesen, dass sie gefragt werden würde, und ebenso sicher, dass sie angenommen hätte. »Glaubt ihr wirklich, dass Lily genug Erfahrung hat, um eine Firma zu leiten?«, fragte sie zögerlich.
»Wir hatten auch keine Erfahrung«, erinnerte sie Edward, erstaunt, dass nicht einmal Connie hinter Lily stand. »Wir waren keine Geschäftsleute.«
Nein, fühlte Jonathan sich versucht wütend hinzuzufügen, und ihr seid immer noch keine.