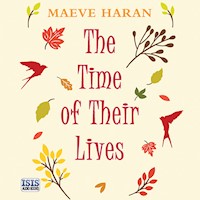4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Stoff aus dem die Männer sind? Darüber rätselt wohl jede Frau …
Nach sechzehn Ehejahren mit einem charmanten Nichtsnutz hat Amanda Wells ihre Männerlektion gelernt und kümmert sich fortan lieber um ihre zwei Kinder, die chaotischen Familienfinanzen und ihre kleine Galerie. Doch die Liebe – und ein verführerisch attraktiver Schotte – lassen sich nicht so leicht beiseiteschieben. Zum Schluss weiß Amanda Wells zumindest das eine: Aus welchem Stoff
gute Ehemänner sind!
Mit ihren turbulent-witzigen Geschichten über die Liebe, Freundschaft, Familie und die kleinen Tücken des Alltags erobert SPIEGEL-Bestsellerautorin Maeve Haran die Herzen ihrer Leser im Sturm!
»Maeve Haran erweist sich immer wieder als Spezialistin für locker-amüsante Geschichten mit Tiefgang!« Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Ähnliche
Buch
Nach sechzehn Ehejahren mit einem charmanten Nichtsnutz hat Amanda Wells ihre Männerlektion gelernt und kümmert sich fortan lieber um ihre zwei Kinder, die chaotischen Familienfinanzen und ihre kleine Galerie. Doch die Liebe – und ein verführerisch attraktiver Schotte – lassen sich nicht so leicht beiseiteschieben. Zum Schluss weiß Amanda Wells zumindest das eine: Aus welchem Stoff gute Ehemänner sind!
Autorin
Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. »Alles ist nicht genug« wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in London.
Von Maeve Haran bereits erschienen
Liebling, vergiss die Socken nicht · Alles ist nicht genug · Wenn zwei sich streiten · Ich fang noch mal von vorne an · Schwanger macht lustig · Und sonntags aufs Land · Scheidungsdiät · Zwei Schwiegermütter und ein Baby · Ein Mann im Heuhaufen · Der Stoff, aus dem die Männer sind · Schokoladenküsse · Mein Mann ist eine Sünde wert · Die beste Zeit unseres Lebens · Das größte Glück meines Lebens · Der schönste Sommer unseres Lebens
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Maeve Haran
Der Stoff, aus dem die Männer sind
Roman
Deutsch von Elfriede Peschel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Husband Material« bei Little, Brown, London.
Copyright dieser Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © 2002 by Maeve Haran
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2003 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Buchgewand Coverdesign | www.buch-gewand.de unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com:
DN · Herstellung: sam
ISBN978-3-641-26299-0V001
www.blanvalet.de
Für Alex
1. Kapitel
Klirr, klirr, rums!
Amanda Wells versuchte, sich an die Worte von »I Love the Sound of Breaking Glass« zu erinnern, als sie die nächste Weinflasche in den Glascontainer auf Tesco’s Parkplatz warf.
Ehrlich gesagt waren es ziemlich viele Weinflaschen. Gestern war sie an der Reihe gewesen, für die Räumlichkeiten und die Bewirtung der Lektüregruppe zu sorgen. Wie üblich hatten sie die erste halbe Stunde darauf verwandt, den Text des Monats zu diskutieren – einen Roman über erdrückende Beziehungen in einer Kleinstadt der amerikanischen Ostküste –, um sich dann auf den Wein zu stürzen und in ihre eigenen erdrückenden Beziehungen in einer Küstenstadt Englands zu vertiefen. Oder, in Amandas Fall, dem schmerzhaften Fehlen einer erdrückenden Beziehung seit ihr Ehemann, Giles, der Schurke, sie wegen Stephanie, der Nymphe, verlassen hatte, einem zehn Jahre jüngeren und beträchtlich schlankeren Modell.
»Mama!«, entrüstete sich ihre sechzehnjährige Tochter Clio voller Abscheu, als hätte Amanda gerade einen öffentlichen Striptease hingelegt oder sich erdreistet, vor Clios Freunden zur Musik der Rolling Stones zu tanzen. »Ihr habt doch nicht etwa das alles gestern Abend getrunken?«
»Natürlich nicht«, log Amanda und beschloss, die zweite Tragetasche voller Flaschen im Wagen zu lassen. »So!« Beim letzten Klirren überzog ein selbstgefälliges Lächeln der Befriedigung Amandas Gesicht. Wie ließ sich die Schuld, am Abend zuvor zu viel getrunken zu haben, auch besser sühnen als damit, seinen Teil, wie klein auch immer, zur Rettung des Planeten beizutragen?
»Du weißt ja, dass es wahrscheinlich mehr kostet, jede Flasche zu recyclen, als gleich eine neue herzustellen«, gab Clio gemeinerweise zu bedenken.
»Du redest wie dein Vater«, warf Amanda ihr vor und versuchte sich noch eine Weile an ihre Wunderfrau-rettet-den-Planeten-Stimmung zu klammern.
Giles, der Schurke, Clios Vater, war in der Tat so etwas wie eine gespaltene Persönlichkeit gewesen. Umwerfend gut aussehend und charmant in der Öffentlichkeit, wurde er in der Langeweile seines eigenen Zuhauses zu einem Weltmeister pingeliger Krittelei und zersetzender Kommentare. In den sechzehn Jahren ihrer Ehe hatte Giles Amanda das Gefühl vermittelt, an allem, von der globalen Erwärmung bis zu den im Toaster explodierenden Elemantarteilchen, schuld zu sein.
»Lass uns heimfahren«, schlug Amanda vor, ehe die zweite Tragetasche entdeckt wurde, »sonst verpasst du Hollyoaks.«
»Mann!«, entfuhr es Clio, und sie deutete auf den blitzenden, kobaltblauen zweisitzigen Sport-BMW, der hinter ihnen geparkt hatte. »Der hat bestimmt einige Scheine gekostet.«
Amanda sah zwar, dass das Auto schön war, las aber überall die Aufschrift »Egoistischer Kerl«. Kein Rücksitz mit Platz für Kinder, haarsträubend teuer und wahrscheinlich hübscher als die Ehefrau des Besitzers, der zweifellos ein Mann in den Wechseljahren war wie Giles mit seinem neuen Spielzeug. Oder der Wagen war der Stolz und die Freude eines verzogenen Yuppies, in dessen Hirn nur für Prämien und Stadtzulagen Platz war.
»Jetzt komm schon, Mama«, rief Clio und sprang, auf ihre Uhr zeigend, in ihren so ganz anders gearteten Wagen. »Wenn wir jetzt nicht losfahren, verpassen wir den Anfang!«
Hocherfreut über ihr gelungenes Ablenkungsmanöver lächelte Amanda liebevoll und stieg ins Auto. Noch immer lächelnd, löste sie die Handbremse, legte den Rückwärtsgang ein, vergaß dabei aber die steile Neigung des Parkplatzes und setzte den Fuß auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse.
Knirsch, knirsch, ratsch! Das Geräusch einer herabfallenden Stoßstange und eingeschlagener Plastiklichter war unverkennbar.
»Scheiße! Scheiße! Scheiße!«, kreischte Amanda und schlug ihren Kopf gegen das Steuerrad, in völliger Missachtung ihres Bemühens, Clio die Unart auszutreiben, Schimpfwörter häufiger als Kommata zu gebrauchen.
»Meine Güte, Mama«, zischte Clio und erinnerte dabei nur noch stärker an ihren Vater, »was, zum Teufel, hast du dir denn dabei gedacht?«
Amanda hätte ihr am liebsten den Hals umgedreht, warf aber einen Blick nach hinten. Der wunderbare Sportwagen hatte jetzt einen langen Riss in seiner Stoßstange, direkt unter der BMW-Ikone.
Rote Plastikscherben, gerade eben noch die Abdeckung von Amandas Rücklichtern, lagen wie Weltraumkonfetti über den Boden verstreut.
Amanda betete, der Fahrer möge nicht in der Nähe sein. Ihrer Erfahrung nach verwandelten sich Männer in geifernde Psychopathen, sobald sie sich hinter ein Steuerrad klemmten, und sei es auch nur das eines Ford Fiesta. Sie hegte die Hoffnung, er werde nicht aus dem teuren Innenleben des Wagens auftauchen und sie lautstark mit Flüchen und Beschimpfungen überschütten, wie Giles das getan hätte. In diesem Fall könnte sie wenigstens feige eine Notiz hinterlassen und ihre Versicherungsnummer angeben, obwohl die Versuchung groß wäre zu schreiben: »Die anderen Fahrer denken, ich hinterlasse meine Telefonnummer, aber das tue ich nicht.«
Zögerlich stieg sie aus ihrem Auto, um für ihr Missgeschick einzustehen.
Der BMW-Fahrer war auf jeden Fall kein Yuppie um die zwanzig. Amanda schätzte ihn auf Anfang vierzig, er war frisch rasiert, hatte dunkles, welliges Haar und Augen so grau wie die Nordsee im Winter. Und er wirkte tatsächlich sehr wütend. Er trug einen weichen Pullover mit Polokragen und darüber auch noch eine anthrazitfarbene Strickjacke – eine Aufmachung, die nur so nach Geld stank.
Hat wahrscheinlich gerade Frau und Kinder sitzen lassen und ist mit einer Wasserstoffblonden durchgebrannt, überlegte Amanda gehässig. Dieses Statussymbol eines Autos diente zum Ausgleich seiner instabilen Männlichkeit, und genau die hatte es nun ein wenig verbeult.
»Ist Ihnen eigentlich klar«, herrschte er sie wütend an, wobei sein Blick eher auf das Auto als auf sie gerichtet war, »dass ich diesen Wagen erst seit drei Tagen habe?«
Fast hätte Amanda der erbärmlichen Versuchung nachgegeben, sich an sein teuer behostes Bein zu klammern und sich zu entschuldigen, aber sein Ton bewahrte sie vor diesem Kniefall. Er erinnerte sie an Giles.
»Gut«, erwiderte sie dreist und richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. Normalerweise schüchterte das die Männer erst mal ein. »Dann ist wenigstens noch Garantie drauf.«
Seine stählernen Augen bohrten sich in ihre grünbraunen. »Dessen bin ich mir sicher. Aber die gilt nur bei technischem Versagen, nicht bei rücksichtslosem Rückwärtsfahren auf Supermarktparkplätzen.«
»Und was ist mit rücksichtslosem Parken?« Verflucht sollte Amanda sein, würde sie auch nur einen Zentimeter nachgeben. Sie machte eine weit ausholende Geste. »Hier ist alles frei, da hätten sie nicht so nah an den Glascontainern parken müssen. Es liegt doch wohl auf der Hand, dass die Autos hier auch wieder rausfahren müssen.«
Zu ihrer Verblüffung lachte er offenbar ehrlich belustigt. »Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, es sei mein Fehler?«, hakte er nach, von Amandas komischem Talent offenbar sehr angetan. Aber ehe er weiterreden konnte, mischte sich eine herrische Stimme aus dem Inneren des Autos ein.
»Wag es ja nicht, sie zu schikanieren, Angus! Die junge Frau hat doch zweifellos etwas Nützliches im Sinn gehabt.«
»Im Gegensatz zu mir, willst du wohl damit sagen, Mutter«, schnaubte der so Angesprochene kaum vernehmbar. »Ich denke doch nicht im Traum daran, sie zu schikanieren.« Ein Anflug von Ironie milderte seinen Stahlblick. »Sie hat durch und durch recht. Ich stehe viel zu dicht am Flaschencontainer.«
»Wäre es denkbar«, pirschte Amanda sich hoffnungsvoll vor, »dass wir die ganze Sache inoffiziell regeln, ohne unsere Versicherungen einzuschalten?« Tatsächlich konnte es Amanda sich nämlich als plötzlich Alleinerziehende nicht leisten, auf ihren Bonus für unfallfreies Fahren zu verzichten, wenngleich sie lieber sterben würde, als dies ihm gegenüber zuzugeben.
Sollte sie ihm ein Entschädigungsangebot machen? Sie zählte im Geist das Bargeld in ihrer Brieftasche. Sie hatte an die hundert Pfund dabei, wovon sie Clio etwas für einen Kinobesuch versprochen hatte, der Rest war für den Wocheneinkauf. Schlagartig machte sie sich klar, dass hundert Pfund wohl nicht einmal für einen Scheibenwischer dieses Wagens reichen dürften. Dazu kamen noch die eigenen Reparaturkosten.
Die Beifahrertür ging auf, und eine magere Frau, die zwischen Ende fünfzig und Anfang siebzig alles hätte sein können, stieg aus.
»Das ist doch völliger Unsinn«, beharrte sie forsch. »Angus denkt nicht im Traum daran, Geld von Ihnen anzunehmen. Er hat ohnehin schon viel zu viel davon.«
Sie machte ein Geräusch, als sei die finanzielle Situation ihres Sohnes etwas Schändliches, ein soziales Stigma irgendwo zwischen schlechtem Mundgeruch und der Pest.
»Sollen wir die ganze Angelegenheit einfach vergessen, wie meine Mutter es vorschlägt?«
Aber das ging dieser Furcht erregenden Matriarchin noch nicht weit genug. »Sei doch nicht so gemein, Angus. Du musst schon für ihren Schaden aufkommen.«
Einen Augenblick lang rechnete Amanda damit, dass er etwas höchst Unflätiges sagen würde. Er sah ganz und gar nicht danach aus, als würde er tun, was seine Mutter ihm befahl.
Doch stattdessen zückte er seine Brieftasche und zog eine Karte heraus. »Warum bringen Sie Ihr Auto nicht in meine Werkstatt?« Er kritzelte eine Nummer auf die Rückseite. »Sagen Sie einfach, Sie kommen von mir. Sie richten alle möglichen Autotypen, von BMWs bis …« Er warf einen Blick auf Amandas verwahrlostes Fahrzeug.
»Honda Civics«, kam Clio ihm zu Hilfe.
»Genau.«
»Das geht schon«, beharrte Amanda und wünschte, sie könnte sich ihren Stolz auch wirklich leisten. »Danke, ich werde es in meine Werkstatt bringen.«
»Das werden Sie nicht tun.« Die herrische ältere Dame ließ nicht locker. »Oder ich steige nicht mehr in diesen lächerlichen Wagen ein.«
Amanda zögerte.
»Sie bekommen ihn noch am selben Tag zurück«, fügte sie hinzu. »Das haben sie immer gemacht, als ich noch fuhr.«
Amanda dachte an die Probleme, tagelang, vielleicht sogar Wochen ohne Auto zu sein, wie das bei ihrer nicht gerade effizient arbeitenden Werkstatt durchaus der Fall sein könnte, und sie sah sich schon ihren zehnjährigen Sohn Sean mit dem Bus zum Fußballtraining bringen.
»Also gut«, willigte sie ein.
»Gut.« Da ihre Aufgabe erledigt war, kehrte die grauhaarige Dame ins Auto zurück, indem sie ihre baumwollbestrumpften Beine mit der Eleganz einer Debütantin eines Lucie-Claytons-Kurses hineinzog.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen«, kam es Amanda bei nur leicht zusammengebissenen Zähnen über die Lippen.
»Kein Problem. Geschieht mir recht, warum bin ich auch so ein dreckiger Kapitalist, wie meine Mutter gleich als Erstes anmerken würde. Ihr Retter des Planeten verdient das höhere moralische Niveau, selbst hier auf Tesco’s Parkplatz.« Sie spürte, dass er unter all der Höflichkeit über sie lachte, und hätte am liebsten seine Karte zerrissen und seiner abgerissenen, verbeulten Stoßstange einen Tritt verpasst, aber diese Option stand ihr aus finanziellen Gründen leider nicht offen. »Machen Sie weiter so.« Er streckte ihr seine Hand hin. »Ich heiße übrigens Angus Day.« Sein Händedruck war fest, und es war eine Schande, wie beruhigend er wirkte. Und wenn er seinem Lächeln freien Lauf ließ, war es überraschend warmherzig.
Amanda schüttelte sich. Sie würde nicht wieder auf diesen alten Quatsch hereinfallen. Wenn sie eins in den sechzehn Jahren mit Giles gelernt hatte, dann, dass Charme von höchst zweifelhafter Qualität war.
»Wie kann man nur so herablassend sein?«, flüsterte sie Clio kaum hörbar zu, als Angus und seine Mutter wegfuhren.
»Mama«, wunderte sich Clio in einem Ton, als wollte sie sagen »der Kaiser hat keine Kleider an«, »es war dein Fehler, erinnerst du dich? Nur gut, dass er nicht gesehen hat, wie viele Flaschen du gehabt hast, sonst hätte er bestimmt verlangt, dass du ins Röhrchen pustest.«
»Die waren von gestern Abend. Außerdem geschieht es ihm recht, warum fährt er so ein haarsträubendes Auto. Für das Geld, was das kostet, könnte man bestimmt ein Dreifamilienhaus bauen. Und es ist reinster Schwachsinn, damit in stark befahrenen Städten herumzukurven.«
»Oder auf einem Parkplatz«, murmelte Clio leise. Wenn ihre Mutter auf dem hohen Ross der Moral saß, war jede Diskussion sinnlos. »Ich fand ihn wirklich sehr reizend.«
»Pah!«, schnaubte Amanda.
»Sag mir bitte eines, Mama. Warum bist du der einzige Mensch auf Erden, der gutem Aussehen und Charme misstraut?«
Amanda wusste, dass sie ihrer Tochter gegenüber ihre Zunge im Zaum halten und nie gehässig, sondern immer neutral sein sollte, aber sie konnte nichts dagegen tun. »Der Grund, meine liebe Clio, warum ich gutem Aussehen und Charme misstraue, ist dein Vater, der beides hatte. Und zwar mehr als genug.«
Sie drehte die Karte um, auf deren Rückseite er die Telefonnummer der Werkstatt geschrieben hatte. Darauf stand: Angus Day, Day-Immobilien.
»Aha. Das erklärt den BMW. Er ist nichts weiter als ein verdammter Häusermakler.«
»Was genau ist ein Häusermakler?«
»Jemand, der wunderschöne, alte Gebäude niederreißt und grässliche neue dafür hochzieht. Und dabei ganz nebenbei noch das schnelle Geld macht.«
»Mama.« Clio fixierte ihre Mutter mit scharfem Blick. »Hat Papa dir jemals gesagt, dass du ein wenig zu voreingenommen urteilst?«
Amanda duckte sich und tat, als untersuche sie ihre Stoßstange. Giles hatte ihr tatsächlich vorgehalten, voreingenommen zu sein. Ihre Mutter ebenso. Und auch Louise, ihre Chefin. Amanda redete sich gern ein, dass sie alle im Irrtum waren. Sie nahm Dinge ganz einfach instinktiv wahr. Auch wenn sie damit gelegentlich baden ging.
»Also, ich fand ihn unglaublich sexy«, meinte Clio herausfordernd.
»Sexy?«, wunderte sich Amanda verblüfft. Bis dato hatte Clio höchstens Mitglieder von Boy Groups als sexy angesehen. Männer um die vierzig hatten gar nicht gezählt. Sie hoffte ernsthaft, dass dies nicht die ersten Anzeichen einer beängstigenden neuen Entwicklung waren. »Wie, um Himmels willen, kann jemand in einer Strickjacke sexy sein?«
»Ach, ich weiß nicht.« Mit halb geschlossenen Augen strich Clio über den Ärmel ihrer eigenen Jacke, als wäre diese aus dem weichsten und sinnlichsten Gewebe, das man sich nur vorstellen konnte. »Nutz doch deine Vorstellungsgabe, Mama. Man kann, wenn es Kaschmir ist.«
»Mein Ding ist es nicht, fürchte ich. Männer in Kaschmir sind für gewöhnlich Golf spielende Langweiler, vor allem die mit den kleinen Poloschlägern auf ihren Brustkörben.«
»Jetzt lass doch mal deine Vorurteile, Mama. Die Golf spielenden Langweiler hätten doch wohl Golfschläger drauf? Außerdem war er Logo-frei. Ich habe das überprüft.«
Amanda legte einen Arm um ihre Tochter. Clio war sechzehn, dürr wie eine Bohnenstange und sich der Tatsache mehr als bewusst, dass ihre Figur eigentlich eher die einer Zwölfjährigen war. Das bereitete ihr großen Kummer, den auch Amandas ständig wiederholte Versicherung, dass sich dies über Nacht ändern könne, nicht zu lindern vermochte.
»Dann kannst du ihn ja haben«, neckte Amanda sie. »Er ist nicht mein Typ.«
»Vielleicht«, forderte Clio sie heraus. »Hast du übrigens nicht noch was vergessen?«
»Was denn?«, fragte Amanda, als sie endlich äußerst erleichtert, nicht nur eine Autoreparatur, sondern gleich zwei gespart zu haben, in ihren Wagen stieg.
Clio grinste. »Die andere Tasche mit den Weinflaschen im Kofferraum.«
Zu Hause überraschte sie der unerwartete Anblick von Amandas Mutter Helen, hinter dem Rücken oft einfach GG genannt, die Kurzform für Glamouröse Großmutter, die mit Sean für eine Schulparty Törtchen backte. Helen hätte keinesfalls was dagegen gehabt, als glamourös bezeichnet zu werden, aber das Wort Großmutter hasste sie.
»Das sind Augäpfel!«, grinste ein begeisterter Sean in der Schürze, die Giles Amanda beim letzten Weihnachtsfest vor seinem Abzug geschenkt hatte und auf der der wenig schmeichelhafte Satz stand: »Vertraue nie einem dürren Koch.«
Die Küche sah so chaotisch aus wie immer. Egal, wie oft Amanda auch versuchte, die Ansammlung alter Turnschuhe, Schultaschen, Fußballstiefel, Pausenbrotdosen und Kicker-Ausgaben wegzuräumen, sie sah nie auch nur im Entferntesten ordentlich aus. Bei ihrem Einzug hatte sie in scherzhafter Anlehnung an Monets Küche Blau und Gelb zum Anstreichen gewählt und sich Familienmahlzeiten ausgemalt, bei denen im Lauf der Jahre alles, vom Impressionismus bis zur Frage, ob es Gott gab, zur Sprache kam. Na ja, falls es Gott geben sollte, hatte er wohl ganz eindeutig seine Meinung zu dem ganzen »Bis dass der Tod uns scheidet«-Quatsch geändert.
Amanda versuchte, ihre Sehnsucht nach schimmernden Oberflächen und glänzenden Arbeitsplatten oder wenigstens Lücken zwischen den diversen Sachen zu unterdrücken. Würde ein Stilmagazin über ihre Küche herfallen, würden sie alles rauswerfen, einen Fetzen roten Samt über einen Stuhl drapieren und ein paar aberwitzig teure Blumen reinstellen und das Ganze dann als »Schmuddelchic« verkaufen. Ohne diese Stilelemente war es nur schmuddelig.
Sean verpasste mit einer Tube Schreibglasur seinen Kuchen die letzten blutigen Adern und garnierte ihn mit glasierten Kirschen. Die Ähnlichkeit mit Augäpfeln war bemerkenswert, es waren rote, übernächtigte, wie Amanda sie immer bekam, wenn sie mit ihrer Lektüregruppe die Liste mit Empfehlungen für den Booker Prize heftig diskutiert hatte.
»Die sehen sehr gut aus, mein Schatz«, beglückwünschte ihn Amanda.
»Nein, tun sie nicht!«, widersprach Sean. »Sie sollten eigentlich verdreht sein. Oma sagt, da wird ihr übel.«
»Denk dran, die Schreibglasur zuzuschrauben, sonst funktioniert sie das nächste Mal nicht mehr.« Amanda hasste Schreibglasur. Es war eines dieser Nepp-Produkte, die nur funktionierten, wenn sie ganz neu waren. Später war die Tube verstopft, egal, wie oft und wie wütend man auch mit einer Stecknadel hineinbohren mochte.
»Nörgle nicht, Amanda«, fiel ihre Mutter ihr ins Wort. »Kein Wunder, dass Giles mit diesem Mädchen abgehauen ist. Ich wette, dass sie ihn nicht ständig nervt, seine Socken wegzuräumen. Wahrscheinlich hat sie ihm gesagt, wie wundervoll er ist.« Nach Helens Theorie bestand die Aufgabe der Frauen darin, ihren Männern ständig zu versichern, wie wunderbar sie waren, egal, wie groß die Verachtung insgeheim war. Amanda hatte mitbekommen, wie ihre Mutter ihrem Vater sklavisch diente, obwohl sie ihm am liebsten Rattengift verabreicht hätte. Und da hatte Amanda sich geschworen, kein solches Doppelleben führen zu wollen.
Aber wohin war Amanda mit ihrer Aufrichtigkeit gekommen? Giles hatte sich mit Stephanie aus dem Staub gemacht, einer modernen Inkarnation ihrer Mutter, die ihm zweifellos ständig versicherte, dass er der perfekte Ehemann war, von einem Gott im Bett ganz zu schweigen.
Dem immer sehr einfühlsamen Sean fiel ihr Gesichtsausdruck auf. »Hier, Mama, du bekommst das erste Törtchen. Du bist der offizielle Vorkoster.«
Fast hätte Amanda das dick verzuckerte Törtchen abgelehnt. Sie konnte glasierte Kirschen nicht ausstehen, und die Süßigkeit hatte vermutlich mehr Kalorien, als die nymphengleiche Stephanie in einer Woche zu sich nahm. Aber da sie die Ehre dieses Angebots zu schätzen wusste, biss sie hinein und fand unerwarteten Trost in dem Zuckerschock und noch mehr in der Liebe, die ihr aus Seans Augen entgegenstrahlte.
»Fabelhaft! Wenn du Frankenstein ein paar davon gibst, wird selbst er zu einem Kuschelkätzchen!«
»Du warst aber lang am Glascontainer«, bemerkte ihre Mutter, die wie immer Ton in Ton in neutralen Farben gekleidet war, von Karamell bis Cappuccino, was ihr das Aussehen eines sehr teuren Toffees verlieh. Von der Sorte, die zwar hinreißend duftet, aber an den Zähnen kleben bleibt, überlegte Amanda boshaft. »Wie viele Flaschen hast du weggebracht? Eine ganze Spirituosenhandlung?«
»Das war doch nur, weil wir einen Zusammenstoß hatten!«, berichtete Clio schadenfroh. »Oder besser, weil Mama auf dem Parkplatz in diesen Mann reingefahren ist. Du hättest sein Auto sehen sollen, Oma. Ein todschickes Ding. Na ja, bis Mama reinfuhr und seine Stoßstange verbeulte.«
»Um Himmels willen, Amanda! Du warst schon immer hoffnungslos ungeschickt. Und jetzt wird dieser Mann wohl Schadenersatz von dir verlangen. Hast du denn nicht schon genug Probleme, als allein erziehende Mutter?« Die letzten drei Wörter sprach sie aus, als wären sie in Haftfolie eingewickelt, um Verseuchungen zu vermeiden. »Lepra« oder »gemeingefährlicher Irrer« hätten sich weniger giftig angehört.
»Na ja, tatsächlich …«, begann Amanda.
»Er sagte, es sei nicht so schlimm«, unterbrach Clio sie, »und er hat sogar angeboten, Mamas Wagen in seiner Werkstatt reparieren zu lassen.«
»Du lieber Himmel.« Helen klang ein wenig enttäuscht. »Warum, zum Teufel, tut er so was?«
Amanda zuckte irritiert zusammen. »Vielleicht hat er mich ja toll gefunden«, schlug sie vor.
Ihre Mutter, Clio und Sean brachen in Gelächter aus.
»Eigentlich lag es an seiner Mutter, die bei ihm war und die gesagt hat, er solle aufhören, Mama zu schikanieren.«
»Ich hoffe, du hast eingewilligt«, sagte Helen. »Wie alt ist er übrigens, dieser Musterknabe, der noch immer tut, was seine Mutter ihm sagt? Einundzwanzig?«
»Unglaublich alt«, sprang Clio hilfsbereit ein. »Aber sehr sexy.«
»Um die vierzig«, ergänzte Amanda korrigierend.
»Und macht immer noch, was seine Mutter sagt. Wie traurig.« Wie Amanda sich im Laufe ihrer Kindheit in regelmäßigen Abständen überzeugen konnte, gab es keine angenehme Helen.
Ihre Mutter wartete einen Herzschlag lang, ehe sie ihr perfektes Platinhaar zurückwarf und hinzufügte: »Ich hoffe nur, du hast seine Telefonnummer. Selbst ein Mann, der noch am Rockzipfel seiner Mutter hängt, ist besser als gar kein Mann.«
Sean entging das Mienenspiel seiner Mutter nicht, das an einen Vulkan vor dem Ausbruch erinnerte. »Mama braucht keinen Mann. Sie hat mich.« Schützend schlang er seine Arme um sie, der Kopf gerade mal in Brusthöhe. Eine Woge der Zärtlichkeit überrollte Amanda. Er war so tapfer gewesen nach Giles’ Weggang und hatte sich aus glühender Loyalität monatelang geweigert, Stephanie zu sehen. Amanda musste zugeben, dass sie darüber wider besseres Wissen hocherfreut gewesen war. »Es gehören immer zwei dazu, wenn eine Ehe in die Brüche geht«, hatte Amanda ihm mit Mordgelüsten im Herzen pflichtschuldig zu bedenken gegeben. »Nein, das stimmt nicht«, hatte Sean erwidert. »Papa war wirklich gemein zu dir.«
Dafür liebte Amanda ihn.
Als Helen dann endlich zu ihrem Kosmetiktermin aufbrach und Clio und Sean verschwanden, um sich mit ihren Freunden zu treffen, entschied Amanda, dass nur noch ein Bad sie zu trösten vermochte. Der Unfall hatte sie doch wesentlich mehr mitgenommen, vor allem wegen ihrer eigenen Dummheit und Achtlosigkeit, als sie hätte zugeben können.
Mitten am Tag ein Bad zu nehmen hatte fast was Verruchtes. Als sie sich auszog, schauderte sie ein wenig in der kalten Luft. Doch aus Kostengründen musste die Zentralheizung tagsüber ausgeschaltet bleiben. Sie stellte sich aufrecht hin und betrachtete sich im Badezimmerspiegel. Sie war größer als die meisten Frauen – Amazone lautete die schmeichelhafte Bezeichnung dafür, aber es gab auch andere.
Grünbraune Augen starrten durch ein Gewirr goldbrauner Haare zurück, die schon seit Wochen einen Friseur brauchen würden. Ihre Nase war lang und gerade, und ihre Wangenknochen waren für eine Gestalt, die ihre Mutter immer als »groß« bezeichnet hatte, überraschend fein modelliert. Noch immer lag ein Hauch Sommerbräune auf ihrer Haut. Die Kälte ließ ihre Brustwarzen Haltung annehmen. Würde sich trotz ihrer einundvierzig Jahre und ihrer aus einem aufsässigen Teenager und einem fußballverrückten Zehnjährigen bestehenden Bürde noch einmal ein Mann für sie interessieren? Wäre einer vielleicht sogar größer als sie?
Sie hatte keinen Schimmer. Nach fast drei Jahren Alleinsein hatte sie eigentlich gehofft, ihr Selbstvertrauen wiedererlangt zu haben. Aber Selbstvertrauen war eine launische Bestie, und ihre war in der Höhle geblieben.
Sie musste ihren Frisör befragen und sich ein völlig neues Aussehen verpassen lassen, selbst wenn das für sie alle eine Woche lang gebackene Bohnen bedeutete. Sean wäre davon ohnehin begeistert. Eine Rundumerneuerung wäre zwar Luxus, aber ihr Selbstwertgefühl hatte Auftrieb bitter nötig. Eigentlich sogar einen Raketenwerfer.
Sie betrachtete sich in dem rasch Dampf ansetzenden Spiegel, zog einen Schmollmund und machte auf Kate Moss, oder besser auf anderthalb Kate Mosses. »Weil ich es mir wert bin«, hauchte sie und zwang sich, auch daran zu glauben.
Als sie in die Wanne stieg, überlegte sie kurz, ob sie sich bei Angus Day hätte bedanken sollen, weil er die Sache mit seinem Auto so locker genommen hatte. Aber wenn sie seine Situation richtig einschätzte, war das Leben mit ihm bisher immer sanft umgegangen. Also würde ihm ein bisschen Aufsässigkeit ihrerseits bestimmt nicht schaden.
2. Kapitel
Als sie nach dem Baden wieder nach unten kam, fühlte sie sich gleich besser. Vielleicht war das Leben doch noch nicht vorbei. Aber sie hatte das Durcheinander in der Küche vergessen. Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet. Das Tablett mit den Augäpfeln starrte ihr aus einem Schlachtfeld aus Mehl, Eierschalen und Zuckerguss entgegen. Der mit Kuchenmischung überzogene Rührbesen klebte auf der Arbeitsfläche. Kinky, die Katze, die man angeschafft hatte, um das Loch zu füllen, das Giles bei seinem Abgang gerissen hatte, und die sich als ähnlich nützlich erwies wie dieser, leckte seelenruhig die Butter auf.
Amanda gab der Katze einen Klaps und überlegte, ob sie die Butter wegwerfen oder die oberste Schicht abkratzen und das Beste hoffen sollte. Sie entschied sich für Letzteres. Ökonomie stand schließlich auf der Tagesordnung. Ihr Job in einer kleinen Kunstgalerie in der Stadt war zwar vergnüglich, aber nicht besonders gut bezahlt, und Giles schien vergessen zu haben, wie kostspielig es war, Kinder großzuziehen. Außerdem würde sie es genießen, ihrer Mutter diese Butter zu reichen.
Seit Giles weggegangen war, hatte Amanda einen Dienstplan für die häuslichen Aufgaben eingeführt, der aber meist zu mehr Problemen führte, als das Ganze wert war, vor allem, da Clio Schmutz als Stilelement ansah. Doch da Amanda jetzt allein verantwortlich war, musste sie für ein wenig Disziplin sorgen, wenngleich auch sie manchmal schwach wurde und überlegte, sich ein Glas Wein einzuschenken und die Arbeit selbst zu erledigen. Es ginge schneller und wäre dem Seelenfrieden zuträglicher.
Zur schwesterlichen Unterstützung beim Aufräumen legte sie Clios Shania Twain-CD auf. Begleitet von der auf volle Lautstärke gedrehten röhrenden Shania ging der Abwasch wie von selbst von der Hand. Nur Pech für Amanda, dass das erste Lied »You’re Still the One« war, eine rührende Beschwörung einer glücklichen Ehe, die trotz allem gehalten hatte.
Sie musste sich eine Träne abwischen. Was war nur in ihrer eigenen Ehe so schiefgelaufen, dass Giles sich einfach so aus dem Staub machen konnte und ihr aus heiterem Himmel erklärte, alles sei aus und er ziehe jetzt mit Stephanie zusammen? Diese Frage hatte sie sich in den letzten drei Jahren schon hundert Mal gestellt.
»Es war nicht dein Fehler«, hatte ihre Freundin Simone gemeint, als Amanda der Lektüregruppe von Giles’ Weggang erzählte. »Er war ein Scheißkerl, durchschnittlich und gewöhnlich.«
Sie hatten an diesem Abend auf ihre Lektüre verzichtet (Ian McEwan’s Liebeswahn wäre kaum passend gewesen) und die Männer nach Strich und Faden fertig gemacht, ihre Nutzlosigkeit, ihre Unverantwortlichkeit, ihre Unfähigkeit, eine Toilettenpapierrolle auszuwechseln, ihren geisttötenden Egoismus und ihre traurigen, in Schubladen aufgefächerten Seelen. Janine, ein neues Mitglied, hatte kraftlos eingewendet, dass ihr Mann ziemlich nett sei, und Ruthie, eine der treuesten und äußerst glücklich verheirateten, hatte den Mund gehalten.
»Du solltest ihn dir zurückholen«, hatte Simone geraten. »Schlitz seine Reifen auf.«
»Näh ihr einen Bückling in die Vorhänge«, lautete Dales Vorschlag. Ihr Mann hatte sie vor zwei Jahren verlassen.
»Säe ihr Senf und Kresse in ihren Bettvorleger«, kicherte Janine.
»Schlitz ihre Reifen auf«, ergänzte Dale.
»Erzähl seinem Chef, dass er Frauen schlägt«, hatte die sanfte Anne zu ihrer eigenen Überraschung gemeint.
»Hast du jemals versucht, mit ihm darüber zu reden?«, hatte Ruthie nachgehakt.
Aber Giles hatte nicht darüber reden wollen.
»Gott sei Dank war er nicht einer dieser besitzergreifenden Väter«, hatte ihre Mutter mit der ihr eigenen verdrehten Logik erklärt. »Wenn derart präsente Väter weggehen, ist das eine Katastrophe. Bei Giles wirst du das jedenfalls kaum spüren.«
Natürlich hatte sie es gespürt. Man kann sich kaum elender fühlen, als nach einer gescheiterten Ehe. Seitdem hatte sie geheult und alles Mögliche in sich hineingestopft, Giles Vorwürfe gemacht und sich selbst Vorwürfe gemacht. Zugenommen und abgenommen. Einen Kurs zum Abnehmen besucht. War zur »Kalorienzählerin der Woche« ernannt worden und hatte auf dem Heimweg eine ganze Tüte Mini-Marsriegel verdrückt. Und das geschah alles, ehe sie sich fragte, welche Auswirkung es wohl auf die Kinder haben mochte.
Jetzt endlich hatte sich ihr Leben leidlich eingespielt. Keine Diäten mehr. Kein Vollstopfen mehr. Vielleicht noch ein wenig Heulen, aber das konnte man verstehen, schließlich war sie nicht Mutter Teresa. Vielleicht kam sie ja, o Wunder über Wunder, aus dem düsteren Tal der Scheidung, wenn schon nicht auf die sonnigen Höhen des Glücks, so doch wenigstens auf die platte Ebene der Akzeptanz. Sie hatte sich in letzter Zeit sogar bereits ein, zwei Mal gefragt, ob es nicht zum Teil auch ihr Fehler gewesen war.
Mit tadellosem Timing klingelte das Telefon.
Es war Giles, der Scheißkerl.
»Hallo, Amanda, na, wie sieht’s aus im schönen Laineton?« Bei Giles’ schmeichlerischem Ton sträubte sich alles in ihr. So charmant war Giles nur, wenn er etwas von ihr wollte.
»Komm auf den Punkt, Giles.«
»Ich habe überlegt, ob wir nicht dieses Jahr unsere Vereinbarung für die Weihnachtszeit ändern könnten?« Normalerweise verbrachten Clio und Sean den ersten Weihnachtsfeiertag mit Amanda und den zweiten bei ihrem Vater. »Ich habe nämlich so ein unglaubliches Angebot bekommen, über Weihnachten nach Val d’Isère zu fahren.« Ehe sie protestieren konnte, stürmte er schon weiter. »Es ist geschenkt. Das Eröffnungsangebot von TBL’s neuem Katalog.« Giles war Reisebürokaufmann und schien immer zu irgendeinem Auslandsziel unterwegs zu sein. Schon komisch, dass keines der Freiangebote ihn je nach Middlesbrough oder Bognor Regis führte, sondern immer an irgendwelche palmengesäumten Strände oder zu üppigem Après-Ski. »Den Kindern wird’s gefallen. Sie haben sich doch immer weiße Weihnachten gewünscht.«
Amanda hatte den Mund schon offen, um zu protestieren, aber wie üblich hatte Giles das letzte Wort. Sean wünsche sich doch nichts sehnlicher als Skifahren. Und Clio wäre auch begeistert. Sie klage doch immer, sie sei von allen ihren Freundinnen die Einzige, die noch nie im Skiurlaub gewesen sei. Sie sei gerade im richtigen Alter, in dem man sich genauso gut in den Skilehrer verlieben als den Leadsänger von Westlife anhimmeln könne.
Amanda wollte gerade brüsk nachhaken, ob Stephanie auch mit von der Partie sein werde, aber Giles nahm auch das vorweg. »Steph kann nicht mitkommen. Sie findet es zu riskant.«
Amanda hatte plötzlich das Gefühl, ihr Herz würde in einen Schraubstock eingespannt. Sie hatte Sean und Clio noch immer nicht erzählt, dass Stephanie schwanger war, geschweige denn, dass sie wahrscheinlich Zwillinge erwartete. »Wenn ich zustimme«, erwiderte sie und versuchte, sich den Schmerz nicht anhören zu lassen, »versprichst du mir dann, dass du mit ihnen wirklich über Steph sprichst?«
»Absolut. Und ich werde mit ihnen wertvolle Zeit verbringen können, um den Schlag zu dämpfen.«
Wenigstens dieses eine Mal zeigte er Einsicht, dass es ein Schlag war, wenn ihr Vater Kinder mit einer anderen bekam.
»Na gut.« Das Angebot war zu gut, sie durfte es Sean und Clio zuliebe nicht ausschlagen.
»Urlaub ist großartig, aber die Unterhaltszahlungen rechtzeitig zu bekommen, wäre noch sinnvoller.« Diese Bemerkung konnte Amanda sich nicht verkneifen.
»Okay, okay, ich versprech’s.« Und Giles hörte sich dabei an, als würde er es auch ernst meinen. Aber genau dies gehörte auch zu Giles’ herausragenden Fähigkeiten.
»Und was ist mit der Skiausrüstung? Ich könnte versuchen, ob wir was leihen können«, schlug Amanda vor und dachte an die ungeheuren Ausgaben.
»Das kriegen wir schon hin. Ich kann da sicherlich verhandeln. Wir schicken genug Leute auf die Piste. Ich werde mal mit meinem Kontaktmann bei The Great Outdoors sprechen.«
Amanda zuckte mit den Schultern. Giles kannte immer eine Kontaktperson. Sie hatten nicht einmal das Ziel ihrer Flitterwochen gekannt, bevor sie zum Flughafen kamen, weil Giles billig drangekommen war.
Als sie den Hörer auflegte, wurde ihr die ganze Tragweite erst richtig bewusst. Dies bedeutete, dass sie über Weihnachten und Neujahr zwei Wochen lang allein war. Eigentlich eine fabelhafte Aussicht. Endlich Freiheit. Also, warum fühlte sie sich dabei so grässlich leer?
Als sie Clio und Sean am nächsten Morgen davon erzählte, waren beide völlig aus dem Häuschen. Sean legte sogar seinen Kicker beiseite, um durch die Küche Slalom zu fahren und der Katze einen Schrecken einzujagen. An Hindernissen, die umfahren werden mussten, mangelte es jedenfalls nicht.
Amanda schrie hoch zu Clio, die wie üblich unheimlich spät dran war und sich im Bad noch schminkte, obwohl sie sich längst die Schultasche umschnallen sollte.
»Wenn du nicht in zehn Sekunden unten bist, werfe ich deinen Nagellack weg!«, kreischte Amanda und versuchte, zwei Pausenbrote und einen Diätsalat für die Galerie fertig zu machen. Sie war davon ausgegangen, dass die weiterführende Schule das Ende der Pausenbrote bedeutete, aber ihre beiden Kinder forderten deren Wiedereinführung ein. Clio, weil sie die Schulverpflegung nicht mochte, und Sean, weil er in der Pause immer Fußball spielte und es so verpasste, sich in die Schlange vor der Essensausgabe zu stellen und seinen Hunger sonst mit einem Marsriegel und Cola Light gestillt hätte.
»Das ist cool, Mama!«, begeisterte sich Sean. »Kann ich auch Ski springen?«
»Ich würde erst mal damit anfangen, aufrecht zu stehen und keine Knochen zu brechen«, schlug Amanda vor.
Clio kam hereingerauscht, die Wangen leuchtend vor Rouge. Eigentlich war auf der Schule kein Make-up erlaubt, aber es schminkten sich ohnehin alle. »Du bist ja schon wieder angemalt, Clio!«, entrüstete sich Amanda.
»Ich versuche nur, meine Wangenknochen zu betonen«, grinste Clio. Sie versuchte immer, erwachsener auszusehen, aber es funktionierte nie. Zu Clios großem Leidwesen sah sie kaum einen Tag älter aus als zwölf, während alle ihre Freundinnen schon für achtzehn durchgingen. Ihre ungelenke Art würde eines Tages sicher sehr reizvoll sein, jetzt wirkte sie nur unbeholfen.
Die Vorstellung, in den Skiurlaub zu fahren, versetzte sie in Ekstase. »Jasmine wird total neidisch sein, wenn ich ihr das erzähle. Wird es auch Après-Ski und Glühwein und Seilbahnen geben?«
»Ich denke schon.« Amandas Erfahrung mit Wintersportorten beschränkte sich auf die Reiseprogramme im Fernsehen. »Ich bin sicher, dass es das alles gibt.«
»Stell dir vor, Mama: weiße Weihnachten!« Clios Stimme überschlug sich vor Aufregung. Dann aber platzte die Seifenblase genauso schnell wieder. »Aber was wirst du denn machen? Du kannst doch nicht ganz allein Weihnachten feiern! Warum kommst du nicht mit?«
Es ärgerte Amanda, dass Giles mühelos ein solches Geschenk präsentieren konnte, während sie gerade mal eine Fahrt an die Anlegestelle oder ins Kino zu bieten vermochte. »Und GG allein lassen? Was würde Oma denn machen, wenn wir abzögen, um über die Pisten zu wedeln?«
»Da hast du recht. Und wenn ihr beide mitkämt?«, bohrte Clio voller Hoffnung nach.
»Damit Oma dann mit einem Skilehrer durchbrennt oder sich die Hüfte bricht.«
»Auf der Piste?«
»In der Disco, wie ich Oma kenne. Egal, für euch wird es schön werden. So viel Zeit mit Papa.«
»Kommt sie mit?«
»Nein. Ihr werdet Papa ganz für euch haben.«
»Klasse. Aber so wie ich Papa kenne, wette ich, dass er krank wird und es schafft, sämtliche Zimmermädchen auf Trab zu halten, damit sie ihm heißen Grog bringen.«
Diese Wahrscheinlichkeit war groß, dachte Amanda, behielt es aber für sich. »Komm schon, Clio, es ist eine wunderbare Chance für dich. Du wolltest doch immer Skifahren gehen.«
»Ich wünschte, du kämst mit.«
Amanda umarmte sie, weil sie spürte, wie weh ihrer Tochter die Scheidung immer noch tat.
»Ich wünschte, wir wären eine richtige Familie wie bei Jasmine. Und würden was zusammen machen.«
»Wetten, dass die nicht Skifahren gehen?« Amanda bemühte sich um einen fröhlichen Ton.
»Nein. Aber wenn wir alle zusammen sein könnten, würde es mir auch nichts ausmachen, keinen Schritt aus dem Haus zu kommen. Und, Mama« – sie fing den Blick ihrer Mutter auf –, »spar mir die Lektion, dass fast die Hälfte der Ehen ohnehin mit Scheidung enden, bitte?«
Amanda versicherte sich mit einem Seitenblick, dass Sean außer Hörweite war. »Du hast recht. Und in Wahrheit ist das alles einfach nur beschissen, stimmt’s?«
Clio lachte und sah glücklich aus wie seit Tagen nicht mehr. »Ja«, grinste sie, »ja, das ist es.«
Die Lektüregruppe trat für wesentlich mehr Aktivitäten ein. »Es wird Zeit, dass du dir einen Mann suchst«, verkündete Ruthie, nachdem sie den letzten Roman von Will Self in gerade mal fünfzehn Minuten besprochen hatten. »Einen, der das genaue Gegenteil von Giles ist. Einen, der wirklich das Zeug zum guten Ehemann hat. Und jetzt hast du fast zwei Wochen freie Zeit, um dich umzusehen. Ausgezeichnet.«
Die Gruppe traf sich in Ruthies Haus, das die Atmosphäre eines Spielzimmers für Erwachsene ausstrahlte, überall helle Farben und große Kissen. Ruthie hatte früher Vorbereitungskurse für natürliche Geburt gegeben und schwor noch immer darauf, sich in Stresszeiten auf den Boden zu legen und tief durchzuatmen.
»Ja«, stimmte Simone zu, die wie in ihren Collegetagen das schwarze lange Haar offen trug und mit ihrer glutvollen Ausstrahlung Männer bevorzugte, die zwanzig Jahre jünger waren als sie. »Da sind wir uns alle einig. Aber was ist das, das Zeug zum guten Ehemann?«
»Zumindest in Amandas Fall ist das ganz einfach«, warf Louise ein. Louise war sowohl eine Freundin als auch Amandas Chefin in der Galerie. »Jemand, der sie nicht in der Öffentlichkeit heruntermacht oder jede Frau unter achtzig anbaggert, wie Giles das getan hat.«
»Louise«, fuhr Amanda auf, denn sie wollte die sechzehn Jahre ihrer Ehe nicht so brutal abgetan sehen. »So schlimm war er nun auch wieder nicht.«
»Doch, das war er«, korrigierte sie Louise. »Schlimmer sogar. Obwohl er charmant war. Aber Charme ist normalerweise eine Eigenschaft, die Ehemänner für andere Menschen aufbewahren.«
»Na gut, dann lassen wir Charme also nicht gelten, oder?«, schlug Ruthie vor. »Was macht also einen guten Ehemann aus? Wie wär’s mit Selbstlosigkeit?«
»Sachte«, schaltete Louise sich ein, »wir wollen doch nicht gleich die ganze männliche Spezies disqualifizieren.«
»Ich halte Freundlichkeit für wichtiger«, warf Janine ein, »und Rücksichtnahme.«
»Rücksichtnahme?« Dale betonte das Wort, als wäre es ihr fremd. »Soll das bedeuten, dass sie dann keinen Sex mit dir machen, wenn du nicht möchtest?«
»Und kommen, wenn du kommst«, fügte Ruthie hinzu.
»Also ich weiß, was ich an einem Mann mag.« Simone schüttelte ihr schwarzes Haar. »Einen, der Lust auf zwei Stunden oralen Sex hat und dann den Müll rausträgt.«
»Besten Dank, Simone«, widersprach ihr Ruthie, »aber wir sprechen hier über Ehe und nicht über die Pornofassung von Brief Encounter.«
»Ich weiß, was mir bei einem Ehemann wichtig wäre«, verkündete Anne ernst, die nur selten was sagte und die Bücher jedes Mal in zwei Tagen durchgelesen hatte. »Jemand, der mich zum besseren Menschen macht, bereichert und ermutigt.«
»Wovon redet sie eigentlich?«, wollte Simone wissen.
Nicht gewohnt, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, wurde Anne rot. »Ich meine ja nur, dass es jemand sein sollte, der mir erlaubt, wirklich ich selbst zu sein, und mir Mut macht, etwas anzupacken, anstatt mich immer zu bremsen, wie das die meisten Männer tun.«
»Sehr gut, Anne«, pflichtete Ruthie ihr bei.
»Da bin ich ganz deiner Meinung«, lächelte Amanda und erinnerte sich, wie oft ihre Pläne gescheitert waren, wenn diese sich nicht mit Giles’ Bequemlichkeit hatten vereinbaren lassen. »Und danke für die guten Ratschläge an der Ehemannfront, aber ich wäre jetzt eigentlich schon ganz zufrieden mit einem guten F–«
»Wären wir das nicht alle«, gackerte Simone.
»… Freund, wollte ich sagen. Einfach die zwanzig Jahre Rücksichtnahme und Verpflichtung vergessen und für den Anfang jemand, der mit einem ins Kino geht und nicht meine Mutter ist.«
»Und ich kenne genau den richtigen Mann«, grinste Ruthie unheilschwanger und auf lächerliche Weise selbstzufrieden. »Adrian. Ein Kollege von Mike. Nett. Freundlich. Ziemlich attraktiv.« Sie hielt inne, als käme sie gleich zum Knackpunkt. »Und er ist ganz und gar nicht charmant.«
Dies war, wie Amanda feststellen konnte, als sie sich am folgenden Dienstag auf Drängen Ruthies mit Adrian traf, die Untertreibung des Jahrhunderts. Adrian war nicht nur nicht charmant, er war geistlos. Und dazu auch noch kleinlich. Er nuckelte über eine Stunde an seinem Glas Bier, ohne ihr auch nur anzubieten, ihr Glas Wein nachschenken zu lassen, das Amanda in ihrer Aufregung in wenigen Minuten hinuntergekippt hatte. Schließlich musste sie selbst nachbestellen. Zwei Mal. Und am Ende des endlosen Abends wäre sie durchaus in der Lage gewesen, eine Geschichte des Finanzamtes zu schreiben, in dem Adrian arbeitete, wenn sie dazu Lust gehabt hätte. Und das alles, ohne auch nur das geringste Interesse für Amandas Befinden und Lebensumstände an den Tag zu legen.
»Wie war’s?«, erkundigte sich Clio, sobald Amanda ihm entkommen war und sich zurück in ihren chaotischen Haushalt schlich. »Es ist noch nicht einmal zehn Uhr. War er so schlimm?«
Clio hatte sich aufs Sofa geflegelt. Neben ihr lag zusammengerollt Sean im Halbschlaf, in seinem blauen Boxernachthemd, und Kinky saß auf ihm. Das war immer so, wenn Clio auf ihn aufpasste.
»Schlimmer. Ich hätte schon um neun zu Hause sein können, wenn ich weggekommen wäre. Die schwerste Aufgabe wird darin bestehen, Ruthie nicht zu beichten, wie zuwider er mir war. Er ist mit ihnen befreundet.«
»Es ist doch eine allgemein anerkannte Tatsache«, grinste Clio, »dass eine erst vor Kurzem von ihrem Mann sitzen gelassene Frau mit jedem ausgehen wird, egal, wie aufgeblasen, geistlos oder widerlich er ist. Sag Ruthie die Wahrheit. Sag ihr, dass er stinklangweilig ist.« Clio sprang vom Sofa. »Ich hab außerdem eine viel bessere Idee.« Sie schwenkte die Lokalzeitung vor ihrer Mutter. »Da drin gibt es eine ganze Anzeigenseite, und alle kommen hier aus Laineton. Frauen, die Männer suchen, Männer, die Frauen suchen und, stell dir vor, Männer, die Männer suchen – obwohl das alles bisexuelle Widerlinge zu sein scheinen, die ihre Frauen betrügen – und Frauen, die Frauen suchen. Und das alles hier in unserem langweiligen Laineton! Wer hätte das gedacht? Es gibt auch Schrumpelköpfe, die andere Schrumpelköpfe für Jux und Tollerei suchen.«
»Erzähl das, um Gottes willen, nicht GG, die ist sonst nicht mehr zu bremsen. Und bei ihrem Glück fände sie bestimmt auf Anhieb einen. Dann lass mal sehen.«
Clio und Amanda zogen sich in die Küche zurück und breiteten die Zeitung neben dem spätabendlichen Imbiss aus, den Clio sich aus gerösteter Erdnussbutter und einem Marmeladensandwich hergerichtet hatte. Die Marmelade war überall durchgesickert und hatte die Zeitung rot und klebrig gemacht.
Es erstaunte Amanda, wie viele Menschen gewillt waren, das Risiko einzugehen und sich mit einem völlig Fremden einzulassen. Die erste Anzeige las sie vor: »›Kleine, sehr weibliche Dame mit einem ungewöhnlichen Hobby.‹ Du liebe Zeit, wetten, dass die jede Menge Anrufe bekommt? Was könnte das wohl sein, was meinst du? Männer am Bett anketten und sie mit dem Staubwedel kitzeln? Sich als Nonne verkleiden und sie ein paar Gegrüßet-seist-du-Maria aufsagen lassen?«
»Wahrscheinlich etwas ganz Doofes, wie Dackel züchten. Schau dir die an. ›Attraktive, gut anzufassende Brünette, sucht großen, echten Biker.‹ Was meinst du, ob die in der Vergangenheit lauter falsche Motorradfahrer gehabt hat?«
Amanda kicherte. »Die gefällt mir. ›Fünfundfünfzigjährige Frau, einsachtzig, sucht einen Mann, der’s wirklich bringt.‹ Und ich dachte schon, ich mit meinen vierzig sei jenseits von Gut und Böse.«
»Einundvierzig«, berichtigte Clio grausam und richtete ihren Blick auf die »Mann sucht Frau«-Spalte. »›Stolzer vollblütiger Hengst, dreißig, braucht eine feste Hand.‹ Oooh Mama, den solltest du anrufen!«
»Ich glaube nicht, dass meine Hand fest genug wäre. Sieh dir die mal an. ›Haushaltserfahrener Mann, MSFH. Sucht Frau zum GV, LZB möglich.‹ Was, zum Teufel, soll das denn heißen?«
»Das wird hier unten erklärt«, sagte Clio. »MSFH heißt: Mit Sinn für Humor, GV – kannst du dir ja denken, und LZB ist Langzeitbeziehung.«
»Oder vielleicht auch GSB: Ganz schnelles Bumsen, und dann hörst du nie wieder von ihnen«, meinte Amanda.
»Sei doch nicht so zynisch, Mama. Die hier ist scharf. ›Gut eingefahren, Tachostand siebenundvierzig. Schickes Modell. Ausgezeichnete Kondition, sucht weibliches Modell, fünfunddreißig bis siebenundvierzig, biete Parkplatz.‹«
»O mein Gott, ich glaube nicht, dass ich einen Mann ertragen könnte, der sich mit einem Gebrauchtwagen vergleicht. Jetzt sieh dir diese Frechheit an: ›Großer Mann, zweiunddreißig, liebt Pubs und Clubs. Gern auch allein erziehende Mütter.‹« Sie überflog die Anzeigenseite. Über die Hälfte der weiblichen Anzeigen stammte von allein erziehenden Müttern.
»Mein Gott, der Markt ist ja mehr als voll.«
»Komm schon, Mama. Du musst das positiver sehen. Warum entwerfen wir beide nicht gemeinsam eine Anzeige?«
»Schön. Wie wär’s mit ›Altes Suppenhuhn, einundvierzig, liebt Flanellnachthemden und zeitiges Zubettgehen mit einem guten Buch, sucht interessanten Mann zum Kakaotrinken und für eine Freundschaft‹.«
»Sehr lustig.«
»Aber es stimmt.«
»Das darfst du eben erst später beichten. Oder du musst ein paar deiner schlechten Angewohnheiten aufgeben. Lass mich sie schreiben, Mama. Schließlich betrifft es mich auch, welchen Mann du findest.«
»Vielleicht sollte ich mir gar keinen Mann suchen.«
»Natürlich solltest du das. Es sind jetzt drei Jahre. Und Papa hat Steph. Du hast jemand Netten verdient. Wie wär’s mit: ›Äußerst attraktive geschiedene Frau, einundvierzig, Catherine-Deneuve-Typ, sucht intelligenten, solventen Mann zum gemeinsamen Kaffeetrinken und Plaudern, vielleicht auch mehr.‹«
»Das ist hervorragend. Aber bin ich wirklich der Catherine-Deneuve-Typ?«
»Nein, aber du kannst doch nicht allen Ernstes schreiben ›Geschiedene Frau, einundvierzig, ein bisschen wie die Mutter in 2,4 Children‹, oder?«
Amanda lehnte sich zurück, sah in den Küchenspiegel und zog einen verführerischen Schmollmund. »Ich würde Catherine Deneuve den Vorzug geben.«
»Catherine Deneuve ist inzwischen vielleicht schon im Pensionsalter. Egal, ich schicke es trotzdem ab!« Clio riss den Coupon ab, klebte eine Marke darauf und stürmte durch die Eingangstür zum Briefkasten an der Straßenecke.
»Aber es ist elf Uhr abends!«, rief Amanda ihr hinterher.
»Ja, schon«, erwiderte Clio, »aber bis morgen früh hast du es dir vielleicht schon anders überlegt!«
Besorgt wartete Amanda auf Clios Rückkehr, verwundert über die Spontaneität der Jugend, aber in Sorge, sie könnte auf dem Rückweg überfallen werden. Fünf Minuten später war Clio wieder zurück. »So, das hätten wir. Märchenprinz, wir kommen.«
Amanda umarmte sie, und Clio ließ es sich diesmal sogar gefallen. »Da wäre ich mir nicht so sicher. Ein Haufen Frösche sind wahrscheinlicher.«
»Es geht doch nichts über gesunden Optimismus«, neckte Clio sie.
Amanda lachte. Sie hatte den Hang, alles schwarz zu sehen. Aber was hatte sie schon zu verlieren?
Am nächsten Morgen hatte sie es sich tatsächlich anders überlegt. »Du hast doch nicht etwa unsere Telefonnummer angegeben? Sag, du hast doch nicht die Telefonnummer reingeschrieben?«
»Natürlich habe ich unsere Telefonnummer nicht angegeben«, brummelte Clio mit ihrem Toast zwischen den Zähnen und dem Packen der Schultasche beschäftigt. »Meinst du, ich möchte, dass hier haufenweise Trauerklöße anrufen?«
»Aber ich soll dann mit diesen Verzweifelten ausgehen?«
»Das ist was anderes. Du bist in Not.«
»Danke bestens.«
»Übrigens müssen wir uns was überlegen, um die echten Spinner rauszufiltern.«
»Was wollt ihr machen?«, wollte Sean wissen, der wie üblich längst vor Amanda oder Clio fertig angezogen war und wartete.
Ungewöhnlich taktvoll entschied Clio, dass das Thema eines potenziellen Freundes für ihre Mutter für einen Zehnjährigen nicht gerade geeignet war. »Ach, nur ein Wettbewerb, den Mama in der Galerie veranstaltet.«
»Ach wie langweilig.« Sean verlor sofort das Interesse und vertiefte sich wieder in den Sportteil der Zeitung. Schon erstaunlich, wunderte sich Amanda, dass Sean, der in der Schule mit dem Lesen zu kämpfen hatte, ohne Probleme jedes Wort, das über die magische Angriffstaktik von David Beckham geschrieben wurde, in sich hineinschlang.
Nachdem Sean und Clio zur Bushaltestelle aufgebrochen waren, machte Amanda sich auf den Weg zur Galerie. Es war nur ein Weg von zehn Minuten durch die Nebenstraßen in Richtung Meer. In ein paar Fenstern hingen noch Kürbislaternen, obwohl schon fast Dezember war. Sie atmete die kalte, klare Luft ein und beschleunigte ihren Schritt. Das war das Wetter, das sie am liebsten mochte. Im Winter haben Städte am Meer eine wunderbare Atmosphäre, was der besonderen Qualität des Lichts zu verdanken ist, dem durchsichtigen Verschmelzen der hellen blauen See mit dem weichen Grau des Winterhimmels.
Amanda hielt einen Moment auf der Promenade inne und beobachtete die kreisenden Möwen. Sie waren ausgemachte Bettler, groß und faul versammelten sie sich um jedes Bushäuschen und warteten darauf, dass alte Damen sie fütterten. Die wegen ihrer ungeheuren Fruchtbarkeit und der rowdyhaften Übergriffe der Möwen auf den womöglich leckeren Inhalt der Mülleimer besorgte Stadtverwaltung hatte Schilder aufgestellt, auf denen die Bevölkerung aufgefordert wurde, sie nicht zu füttern. Welche die alten Damen aber geflissentlich übersahen. Die Anwesenheit der Vögel und das spitze ki – ah ihrer Schreie gehörte genauso zum Charme von Laineton wie der Pier an der Promenade.
Laineton war die Stadt, in der Amanda aufgewachsen war. Eine gebürtige Lainetonerin zu sein war schon etwas. Die meisten Leute hier waren zugezogen, angelockt von ihrem schäbigen Charme und ihrer abgenutzten Eleganz. Charakter wurde in Laineton großgeschrieben. Für eine Stadt am Meer ziemlich groß, aber für eine Großstadt nicht groß genug, war sie immer Anziehungspunkt für die unterschiedlichsten, meist extravaganten Menschentypen gewesen, denen es an einem kleineren Ort bald zu eng geworden wäre, die sich aber dem ständigen Kampf und Stress eines Großstadtlebens nicht aussetzen wollten. Das bewahrte den Ort vor der Kleinbürgerlichkeit, wie man sie sonst außerhalb von Großstädten antrifft. Amanda liebte das.
Sie beugte sich über das Geländer, das die Promenade begrenzte. Zwei abgehärtete alte Damen vom Lainetoner Schwimmverein gingen mit großen Schritten über den Kieselstrand aufs eiskalte Meer zu, wie sie dies an jedem Tag im Jahr taten. In ihren glänzenden Badekappen sahen sie aus wie ein paar gekochte Eier.
Sie erkannte Betty, eine der beiden alten Schwestern, die in einem seltsamen Bau weiter unten am Strand wohnten, halb Strandhütte, halb Chalet. Betty fütterte die Möwen, und sie umschwärmten sie. Sie schaute ganz eindeutig keine Hitchcock-Filme an.
Amanda schrie Betty einen Gruß zu und winkte. Hinter ihr erstreckten sich die bonbonfarbenen Häuser den Hügel hoch. Sie zog sich den Mantel fest um den Körper und zitterte schon beim bloßen Gedanken an das eiskalte Wasser. Wie abgehärtet mussten diese alten Schwimmerinnen sein? Sie steuerte die Galerie an.
In den vergangenen Jahren war die einmal harmonische Stadt zweigeteilt worden. Während im Zentrum noch der Wohlstand dominierte, fand man im Ostteil billige Bed & Breakfast Unterkünfte und leere, verrammelte Läden. Es war ein Abstieg in eine Verwahrlosung, die sich auch mit dem Wort »Bohème« nicht mehr rechtfertigen ließ, das man so oft bemüht hatte, um Lainetons besonderes, leicht verwegenes Flair zu beschreiben.
Amanda wollte gerade zur Galerie abbiegen, als sie einem Baulastwagen Platz machen musste. Sie trat zurück auf die Bordsteinkante und schrie dem Fahrzeug ein paar Schimpfwörter nach. Der Fahrer grinste nur und raste den Hang hoch zu den Sozialwohnungen in einer Reihe trister, niedriger Häuserblöcke, die, wie Amanda fand, jeden deprimieren mussten, der darin wohnte. Und das umso mehr, da sie den Blick aufs Meer und den kleinen Hafen hatten, der von Wohlstand nur so strahlte. Lediglich dieser Teil der Stadt war noch immer heruntergekommen und ohne Reiz.
Als sie jetzt genauer hinsah, schien sich an den Häuserblocks einiges zu tun: fünf oder sechs Lastwagen, ein Schaufellader und ein Kran parkten auf dem kleinen Vorplatz, und sie erinnerte sich, dass in der Lokalzeitung Krach geschlagen und gefragt worden war, was irgendein Häusermakler damit wohl vorhatte.
Wenn sie nicht sofort aufhörte, auf die Schwimmer und die Bauleute zu starren, würde sie zu spät aufschließen. Und wie Amanda wusste, war Louise sehr pingelig, was das genaue Einhalten der Öffnungszeiten anging. Nichts vermochte sie mehr zu irritieren als Schilder an Geschäftstüren, die besagten »Bin in fünf Minuten zurück« oder »Bin zur Bank«. »Diese fünf Minuten könnten, wenn man sie zusammenrechnet, darüber entscheiden, ob du dich über Wasser halten kannst oder ob dein Geschäft den Bach runtergeht!«, pflegte sie sich zu ereifern.
Ein wenig außer Atem und wie so viele Male von dem Wunsch beseelt, ihr eigener Chef zu sein, zog Amanda den Rollladen hoch und drehte das GEÖFFNET-Schild um.
Die Wave Gallery befand sich in ausgezeichneter Lage direkt am Ende der Promenade und hatte sich auf Ansichten von Laineton spezialisiert, meist in extrem grellen Farben. Laineton war mit seinen Piers, Theatern und Antiquitätenläden einer der meist gemalten Orte Südenglands. Fast alle Gemälde waren äußerst konventionell gemalt und ziemlich scheußlich. Amanda hätte sich gewünscht, Louise wäre ein wenig wagemutiger in ihrem Geschmack. »Risiko ist gleich Ruin«, lautete eine von Louises Lieblingsdevisen, wenn sie wieder eine der postimpressionistischen Ansichten von Lainetons Strand aufhängte: Kinder mit Strohhüten, die im gesprenkelten Sonnenlicht vor einem so hell leuchtenden Meer Sandburgen bauten, dass es eher an eine griechische Insel als an die Südküste Englands erinnerte. Wenn Amanda allein in der Galerie war, malte sie sich aus, was sie aufhängen würde, wenn sie ihr gehörte.
»Entschuldigen Sie.« Eine ziemlich leger gekleidete junge Frau mit einer großen Tasche kam in die Galerie und drückte sich an einer der knalligsten von Louises Strandansichten vorbei. »Stellen Sie auch Skulpturen aus?«
Amanda wollte gerade erklären, dass ihre Chefin dies für unwirtschaftlich erachtete, aber das Mädchen kniete bereits und öffnete die Tasche. Es musste eine Zaubertasche sein, wie die von Mary Poppins, denn sie hatte bereits zwei große, in Stoff gewickelte Skulpturen herausgeholt, ehe Amanda eingreifen konnte.
»Leider glaube ich, dass wir nicht …«, fing Amanda an.
Das durch frühere Zurückweisungen offenbar sehr hartnäckig gewordene Mädchen ließ sich von Amanda nicht aufhalten und packte weiter aus. Einen Augenblick später standen sich zwei perfekt geschnitzte, weiße Reiher gegenüber, beide mehr als einen halben Meter groß.
»Das ist ihr Paarungsritual«, erklärte die junge Frau. »Sie recken ihre Hälse und strecken ihre Schnäbel in die Luft.«
»Sie sind wunderschön«, erwiderte Amanda und vergaß völlig, dass sie Louise zutiefst missfallen würden. In ihrer vollkommenen Schlichtheit lag ein Zauber, dem Amanda nicht widerstehen konnte.
»Sie beruhen auf Beobachtungen«, redete das Mädchen weiter. »Ich habe an der Universität Naturgeschichte studiert und beobachte noch immer auf der ganzen Welt die Vögel.« Weil sie Amandas Begeisterung spürte, tauchte sie wieder in ihre Mary Poppins-Tasche ein und zog eine wunderbare Holzschnitzarbeit – einen Seevogel – heraus. »Das sind brütende Möwen.« Die Schnitzerei war von derselben magischen Schlichtheit wie die Reiher, stilisiert, fing sie doch die Wirklichkeit ein und eine Schönheit, der man sich nicht ungerührt entziehen konnte.
»Es sind Möwen aus Laineton«, fügte sie hinzu, da sie offenbar erst jetzt wahrnahm, dass alles im Laden Laineton darzustellen schien. »Sie haben vor meinem Fenster gebrütet.«
Amanda prüfte die Vögel. Ihre weißen Brüste, das Grüngelb ihrer Schnäbel und die hellgrauen Flügel mit ihren dramatischen schwarz-weißen Spitzen waren erstaunlich wirklichkeitsgetreu. Das polierte Holz fühlte sich weich an. Amanda hätte sie am liebsten für sich behalten. »Sie sind außergewöhnlich lebendig …«, fing sie an.
»… kommen aber für uns überhaupt nicht infrage«, fiel ihr Louise brüsk ins Wort. Sie kam gerade durch die Tür und trug in der Hand ein besonders scheußliches Gemälde des Musikpavillons, das aussah, als hätte Oskar Kokoschka es unter Drogen auf die Leinwand geworfen. »Leider zu subtil für unsere Klientel. Sie würde Möwen am liebsten vergiften oder ihnen die Pille verabreichen.« Sie bemerkte Amandas gequälten Gesichtsausdruck und deutete auf die unter ihren Arm geklemmte Leinwand. »Das hier stammt von Mrs Wilson aus dem Senioren-Malkurs. Es wird sich gut verkaufen. Lokales Sujet. Lokale Künstlerin. Von den Senioren bekomme ich viele Werke. Und sie haben auch einen vernünftigen Preis.« Bohrender als die Möwen starrte sie die junge Bildhauerin an. »Wie viel wollten Sie dafür haben?«
»Hundertfünfzig Pfund«, sagte das Mädchen stockend. »Aber ich denke, ich könnte noch ein wenig runtergehen.«
Selbst wenn du verhungern müsstest, ging es Amanda durch den Kopf. Sie war wütend auf Louise. Diese beutete die Seniorinnen aus und zahlte ihnen einen Hungerlohn. Aber die lieben Alten waren zu begeistert davon, eine Käuferin gefunden zu haben, und feilschten nicht, wenn Louise ihnen zwanzig Pfund für etwas anbot, wofür sie Monate gebraucht hatten.
»Wirklich. Es tut mir leid, aber wir können uns diesen Preis nicht leisten.«
»Die Reiher sind billiger«, platzte das Mädchen heraus. »Hundert Pfund das Paar.«
»Es tut mir leid …«
»Na komm schon, Louise«, mischte Amanda sich ein, wohl wissend, dass Louise deswegen später mit ihr streiten würde, »überleg doch, es ist bald Weihnachten. Unsere beste Zeit. Außerdem zahlst du den Seniorinnen ohnehin zu wenig. Denk mal an Scrooge. Er wird kommen und dich heimsuchen und dir all die armen Pensionäre zeigen, die in eiskalten Räumen mit Eiszapfen an den Nasen Ölgemälde aus dem Ärmel schütteln. Nimm doch wenigstens eine Skulptur. Um zu sehen, ob sie geht.«
Die fast ebenso farbenprächtig wie ihre Ansichten von Laineton gekleidete Louise verzog missbilligend ihre mit Gold schattierten Lippen und seufzte. »Ich gebe den Reihern drei Wochen. Entweder sie sind verkauft, oder sie gehen zurück. Du kümmerst dich darum, Amanda. Es liegt in deiner Verantwortung. Die werden sich niemals verkaufen, also kannst du genauso gut gleich einen Abholtermin ausmachen, ehe die Künstlerin geht. Ich möchte nicht auf zwei beschissenen Reihern sitzen bleiben.«
Amanda verstand sie absichtlich falsch. »Es sind keine beschissenen Reiher, Louise. Es sind werbende Reiher. Sie haben sich noch nicht zu dem entschieden, was dann oft mit einem beschissenen Gefühl endet. Das ist ein Unterschied.«
»Eigentlich«, mischte sich die junge Frau errötend ein, die offenbar von der Wendung des Gesprächs erstaunt, aber dennoch um Genauigkeit bemüht war, »haben sie sich in diesem Stadium bereits dazu entschlossen, zu, na ja, Sie wissen schon. Reiher neigen – anders als die Menschen – nicht dazu, es sich fünf vor zwölf noch mal anders zu überlegen.«
»Es ist mir völlig egal, ob sie Kondome nehmen oder nicht«, belferte Louise. »Ich möchte nur, dass sie abgeholt werden, wenn sie nicht binnen drei Wochen verkauft sind, mehr nicht.«
»Dann also in drei Wochen«, lächelte Amanda. »Und ich soll verdammt sein, wenn ich sie nicht verkauft kriege.«
»Wir sind hier nicht in der Cork Street«, zischte Louise, während das Mädchen die brütende Möwe wieder einpackte. »Und übrigens scheinst du vergessen zu haben, die Kaffeemaschine einzuschalten.«
Wäre sie nicht so sehr auf das Geld angewiesen, hätte Amanda mit Freuden die Milde Röstung aus Kenia über Louise gekippt, als sie endlich Zeit zum Kaffeekochen hatte. Wenn sie doch nur für sich allein arbeiten könnte. Aber das setzte Kapital voraus, das sie nicht besaß. Auch Louise war geschieden, aber unter völlig anderen Vorzeichen als Amanda. Nachdem sie fünfzehn Jahre mit einem Mann verheiratet gewesen war, den sie nicht leiden konnte, hatte dieser sie schließlich verlassen, aber aus Dankbarkeit, dass sie offenbar nichts bemerkt hatte, hinterließ er ihr fünfzigtausend Pfund und dazu das eheliche Heim. Mit dem Geld hatte sie die Galerie aufgemacht. Giles hingegen hatte Amanda nichts hinterlassen, versäumte es sogar ziemlich oft, den Unterhalt zu bezahlen, obwohl seine Firma boomte, und frisierte sein Einkommen so, dass er gerade eine Stufe über einem Landstreicher war, sollte sich das Jugendamt jemals dafür interessieren. Eigentlich hatte sie sich noch in der Zeit ihrer Ehe danach gesehnt, eine eigene Galerie zu eröffnen, aber Giles hatte ihr immer eingeredet, sie sei verrückt.
Ihr kam das Gespräch der Lektüregruppe wieder in den Sinn. Wer hatte noch mal gesagt, ein guter Ehemann sei derjenige, der einen ermutigte und einem das Gefühl gab, man könne alles erreichen, wenn man es nur versuchte. Pah!
Amanda machte den Kaffee und wich Louises Blicken aus, dann stellte sie die Reiher anstelle eines hässlichen Gipsmodells eines Pariser Straßencafés ins Schaufenster.
»Doch nicht hier!«, protestierte Louise. »Stell sie irgendwo hinten hin. Die schrecken ja die Kunden ab.« Sie nahm einen Schluck der starken schwarzen Flüssigkeit. Louise hatte eine Asbestkehle und trank ihren Kaffee am liebsten so stark, dass selbst Schneewittchen nicht eingeschlafen wäre. »Du kochst wirklich ausgezeichneten Kaffee, Amanda. Und jetzt geh und verkaufe ein paar Ansichten unseres reizenden Laineton. Außerdem muss das Fenster geputzt werden. Ich habe ganz eindeutig einen Fingerabdruck darauf gesehen.«
»Also den können wir nun wirklich nicht brauchen«, erwiderte Amanda fröhlich und widerstand der Versuchung, Louise mit dem Gipsmodell zu erschlagen. »Was tun übrigens all die Lastwagen oben am Eastcliff Estate?«
»Keine Ahnung. Einreißen, hoffe ich. Der Ort ist eine einzige Beleidigung fürs Auge.«
»Und die Behausung von tausend Leuten.«
»Ja, aber man hätte niemals Sozialwohnungen so nah ans Meer bauen dürfen.«
»Lieber irgendwo in der Stadt verstecken. Am besten wohl gleich neben die Umgehungsstraße?«