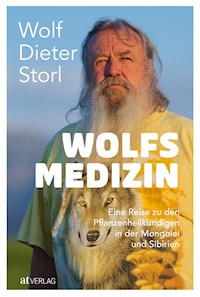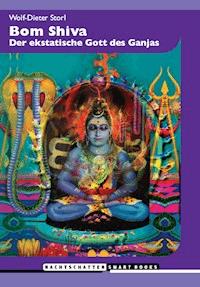19,99 €
9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: GU Selbstversorgung
- Sprache: Deutsch
Viele träumen davon, Selbstversorger zu werden und sich von dem zu ernähren, was im eigenen Garten wächst oder in freier Natur gesammelt werden kann. Der bekannte Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl tut dies seit Jahrzehnten. In diesem ebenso spannenden wie hoch informativen Buch erzählt er seine eigene Selbstversorger-Geschichte und gibt zahlreiche fundierte Informationen, Tipps und Anleitungen für den Eigenanbau von Gemüse, die Wildsammlung von Kräutern, für natürliche Schädlingsbekämpfung, die Herstellung von hochwertigem Kompost und vieles andere mehr. Dabei setzt er auf Nachhaltigkeit, Naturnähe und Ganzheitlichkeit. Ein prall gefüllter Schatz an Profi- und Geheim-Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2017 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2017 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Anja Schmidt (Erstausgabe), Maria Hellstern (Neuauflage)
Lektorat: Dorothea Steinbacher
Bildredaktion: Petra Ender (Neuauflage)
Covergestaltung: Anzinger und Rasp, München
eBook-Herstellung: Alisa Hese
ISBN 978-3-8338-6088-1
8. Auflage 2022
Bildnachweis
Fotos: Frank Brunke, Blickwinkel; Botanikfoto; Florapress; Björn Gaus; GettyImages; Fotolia; Fotosearch; Bernhard Haselbeck; Bettina Stickel; Sabrina Rothe; Stefan Ibele; Pixelio; Frank Teigler; Shutterstock; Ingo und Ingrid Lisa Storl; Wikipedia; Commons
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-6088 02_2017_01
Das vorliegende E-Book basiert auf der 8. Auflage der Printausgabe.
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteur*innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft. Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem Online-Kauf.
KONTAKT ZUM LESERSERVICE
GRÄFE UND UNZER VERLAG Grillparzerstraße 12 81675 Münchenwww.gu.de
Wichtiger Hinweis
Manche der in diesem Buch vorgestellten Pflanzen sind regional geschützt, bzw. Anbau und Verbreitung sind untersagt. Dazu zählen insbesondere Pflanzen, die als aggressive Neophyten eingestuft werden oder die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen wie etwa Hanf. Bitte informieren Sie sich bei den Behörden Ihres (Bundes-)Landes über die geltenden Vorschriften. Wild wachsende Pflanzen, die nicht unter Naturschutz stehen, dürfen in der Regel genutzt werden; sammeln Sie jedoch nur einzelne Pflanzen, sodass der Bestand geschont wird. Die Informationen in diesem Buch wurden von Autor und Verlag sorgfältig geprüft. Dennoch kann bei Schäden, die durch die gegebenen Tipps, Hinweise und Rezepte entstehen, keine Haftung übernommen werden.
DIE NOTWENDIGKEIT EINES GARTENS
Ernten und genießen, was man selbst angebaut hat – das macht glücklich und zufrieden. Selbstversorgung schenkt jedem das herrliche Gefühl von Unabhängigkeit.
SCHWIERIGE ZEITEN
Was in diesem Buch steht, kann überleben helfen. Es sind nicht nur theoretische Erwägungen, die hier zu lesen sind – der Inhalt beruht auf langjährigen Erfahrungen aus dem wechselhaften Leben des Autors. Was kann man tun, wenn die Zeiten schwierig werden, die gemeinschaftlichen Institutionen nicht mehr richtig funktionieren und – möge Gott oder das gütige Schicksal es verhindern! – die Läden leer sind?
Wenn uns unsere Künste nicht weiterhelfen, dann sind wir Menschen gut beraten, wieder auf den Boden zu kommen und uns mit der Erde zu verbinden. Der Erdboden ist tatsächlich der Boden unseres materiellen Daseins. Der Humus, der die Pflanzen sprießen, wachsen und fruchten lässt, ist die Mutter unserer materiellen Existenz. Wir sind Kinder der Erde. Die Begriffe Humus und Humanität, also Menschlichkeit, hängen schließlich zusammen. Und Adam, der Name des ersten Menschen, bedeutet im Hebräischen »Erde, Acker«.
Die letzten Jahrzehnte waren besonders für die westliche Zivilisation eine Zeit des materiellen Überflusses. Man fühlte sich in Sicherheit.
Der Fortschritt schien unaufhaltsam. Neue Maschinen nahmen uns die schwere Arbeit ab, Herbizide und Pestizide hielten Nahrungskonkurrenten in Schach, Antibiotika und Wunderdrogen drängten Krankheiten bei Menschen und Nutzvieh zurück. Der mittelalterliche Traum vom Schlaraffenland war im üppigen Angebot der Supermärkte und Einkaufszentren Wirklichkeit geworden. Ein weltumspannendes Wirtschaftsnetz und, vor allem, billige fossile Energie in Form von Erdöl machten das Wunder möglich.
Doch dann, gegen Ende des zweiten Jahrtausends, erschienen dunkle Wolken am Horizont. Man erkannte, dass die Agrarchemie zunehmend Boden und Wasser vergiftet. Wir ersticken in unseren Abfällen, in Chemiegiften und Plastikmüll. Eine Welt voller Maschinen und Elektronik erzeugt immer mehr Stress; antibiotische Wundermittel verlieren an Schärfe und bringen durch Selektionsdruck neue mikrobielle Supererreger hervor. Allmählich wird klar, dass unsere Ressourcen – Erdöl, Kohle, Mineralien, Metalle, Uran, ja, sogar frisches Wasser – begrenzt sind. Wenn das fossile Öl knapp wird und als Folge immer teurer, wie können dann die Grundbedürfnisse der wachsenden Weltbevölkerung befriedigt werden? Wie kann dann der soziale Frieden gewährleistet werden?
Trend: Konsumverminderung
Die Weltenlenker versuchen das Ruder herumzureißen. In einer Zeit knapper werdender Ressourcen muss den Menschen Konsumverminderung schmackhaft gemacht werden. Ein neuer Verhaltenskodex wird gefordert, etwa der Trend zur vegetarischen Ernährung für die Massen: Als »heilige Kuh« haben die Rinder ausgedient, die »Großvieheinheiten« gelten plötzlich als Nahrungsmittelkonkurrenten, außerdem rülpsen sie das Treibhausgas Methan. Mit subventionierter Förderung erneuerbarer Energie aus Sonnenkollektoren, Wasserturbinen, Windrädern und Ölpalmplantagen auf der Fläche der letzten Urwälder will man die Energieengpässe erträglicher gestalten. Auch mit einer Politik der Bevölkerungsbegrenzung – China macht es uns mit der Ein-Kind-Familie vor –, mit ausgeklügelten Überwachungs- und Kontrollmechanismen und zugleich mit einer Brot-und-Spiele-Politik in den Medien versucht man, die Menschheit abzulenken und den Umbruch abzupuffern: ob nun der neue Superstar gesucht wird oder das neue Topmodel, oder ob man auf die inzwischen immer reizloser werdende Mischung aus Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll setzt. Aber wird die Umstellung so glatt vonstatten gehen, ohne soziales Chaos und Zusammenbrüche? Manche haben da ihre Zweifel, andere spinnen Fantasien von der Besiedlung ferner Planeten – dabei wissen wir nicht einmal, wie man richtig auf dem Planeten Erde lebt!
Amerika war immer das Land der Optimisten. Man schaute zuversichtlich in die Zukunft nach dem Motto: Alles wird immer besser. Aber während meines letzten Besuchs bei meinen Verwandten dort war von dieser Zuversicht kaum mehr etwas zu spüren. Einige sahen einen foodcollapse kommen, einen Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung. Monsanto und andere Chemiekonzerne haben das Monopol für die Nahrungsmittelproduktion an sich gerissen. Aber ihre gewinnträchtigen Terminator-Samen und die genveränderten Pflanzen und Tiere funktionieren nur, wenn allzeit billige Energie, vor allem fossiles Öl, zur Verfügung steht. Terminator-Saaten für Mais und andere Hauptnahrungsmittel sind so stark manipuliert, dass sie kein keimfähiges Saatgut hervorbringen können – der Landwirt kann sein Saatgut nicht mehr selbst erzeugen. Er ist gezwungen, es jedes Jahr von Neuem beim Konzern zu kaufen. Die genveränderten Sorten, die die Menschenmassen ernähren sollen, stehen auf einer gefährlich schmalen genetischen Basis. Ein neuer Virus, ein Keim, ein Pilz – und die Hungerkatastrophe ist da. Es wäre nicht das erste Mal: Mitte des 19. Jahrhunderts befiel der Pilz Phytophthora die Kartoffeln in Irland und vernichtete die Ernte. Saatkartoffeln bestehen im Grunde genommen aus Klonen einer genetisch einheitlichen Pflanze; man pflanzt sie immer wieder aus. Bei der irischen Kartoffel war das der Fall; sie hatte eine sehr enge genetische Basis und war daher leichte Beute für den schmarotzenden Pilz. Die Bevölkerung Irlands wurde halbiert, Hunderttausende verhungerten, Hunderttausende wanderten aus.
Die Familienfarmen, auf die die Bevölkerung in Notzeiten wie etwa der Weltwirtschaftskrise zurückgreifen konnte, sind in Amerika inzwischen durch politische Maßnahmen zugunsten riesiger Agrarkonzerne praktisch verschwunden. Im östlichen Europa war es die Zwangskollektivierung, die die selbstständigen Bauern weitgehend vernichtete. Im EU-Raum wird eine ähnliche Entwicklung durch die Kommissare in Brüssel vorangetrieben.
Kleingärten mit ihrer bunten Vielfalt von Gemüse, Kräutern, Obst und Heilpflanzen versorgen überall auf der Welt Millionen von Menschen mit gesunder, vitaminreicher Nahrung und Medizin, auch in schwierigen Zeiten.
KLEINGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFT
Studien, durchgeführt unter anderem von der Rodale-Gesellschaft (Emmaus, Pennsylvania), zeigen, dass der Leistungsgrad und die Energieeffizienz pro Hektar nirgendwo höher ist als auf kleinen, liebevoll gepflegten, intensiv bearbeiteten Flächen. Die Expertenkommission IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development), die unter anderem von der UNESCO und der Weltgesundheitsorganisation WHO gesponsert wird, kam bei ihrer Sitzung in Johannesburg im April 2008 zum selben Schluss: Die ProblemeHunger und Armut werden am besten auf lokaler Ebene gelöst; in ökologisch benachteiligtenRegionen können Kleinbauern und Gärtner bedeutend mehr Nahrungsmittel erzeugen als die hoch technisierten Agrargroßbetriebe.
Dashatsich in den Schrebergärten im verwüsteten Nachkriegseuropa gezeigt. Das konnte man in der Sowjetunion sehen, wo jeder einen privaten Garten besitzen durfte. Das ehemalige Sowjetimperium ist durch wirtschaftliche Inkompetenz zugrunde gegangen. Wäre nicht der Rückzug des einfachen Bürgers in die Datscha (russische Bezeichnung für kleines Landhäuschen im Grünen) möglich gewesen, dann wäre es noch schlimmer gekommen. Allein auf diesen kleinen Privatgrundstücken, die nur ein Prozent der Gesamtfläche ausmachten, wurden 30 Prozent der Nahrungsmittel der Sowjetunion erzeugt. Dagegen stammten von den 99 Prozent Ackerboden und Weideland der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Staatsbetriebe lediglich 70 Prozent der Lebensmittel – zudem stark subventioniert.
Selbstverständlich können wir uns heutzutage ebensowenig in Amish-Bauern verwandeln wie in indianische Jäger und Sammler, um Krisenzeiten zu überleben. Aber dennoch sind auch wir nicht hoffnungslos ausgeliefert.
DIE AMISH, EINE GESELLSCHAFT MIT PERSPEKTIVE
Die Amish, eine Ethnie alemannisch-pfälzisch sprechender Bauern in Nordamerika, die jede moderne Technologie wie Strom und Kraftmotoren ablehnt, erzeugt auf ihren Farmen vergleichsweise so viel wie die kapital- und energieintensiven corporation-Farmen. Aber mit 87 Prozent weniger Energieaufwand! Das sollte aufhorchen lassen. Energielieferanten sind die Pferde – die erzeugen nebenbei noch Dünger und verdichten die Böden nicht so wie die schweren Maschinen –, einfache Windräder und körperlicherEinsatz. Das Modell funktioniert gut, lässt sich aber dennoch kaum auf die Gesamtgesellschaft übertragen.
Ich lernte die Amish als Junge im ländlichen Ohio kennen. In unserer Nachbarschaft gab es noch bis Ende der 1960er-Jahre eine Schmiede, in der sie ihre Arbeitspferde beschlagen ließen.Da konnte ich oft mit ihnen reden. In den schneereichen Wintern des Mittelwestens kamen sie mit ihren Pferdewagen gut weiter, während die Kraftfahrzeuge der »normalen« Bürger meist stecken blieben. Stromausfälle waren für sie kein Problem, ebenso wenig die Benzinpreise. Überhaupt sind sie unabhängig und selbstversorgend.
Als Wiedertäufer wurden die Amish um 1700 aus ihrer Heimat in der Schweiz, in Süddeutschland, im Elsass und der Pfalz vertrieben. Sie siedelten sich vor allem in Pennsylvania an. Heute leben sie als kinderreiche Großfamilien auf ordentlich gepflegten Einzelhöfen. Jede Hand wird gebraucht. Kinder helfen mit, sobald sie dazu in der Lage sind – sie füttern die Hühner, jäten Unkraut, hacken Gemüsebeete oder erntenErdbeeren. Die Amish haben ihre eigenen Schulen, wo sie, auf hohem Niveau, das Notwendigste lernen: Rechnen, Schreiben und als Sprachen Englisch und Schriftdeutsch (Letzteres, damit sie die Bibel lesen können). Länger in die Schule zu gehen, verdirbt nach Ansicht der Amish die Kinder; sie würden dann zu verkopft und könnten nicht mehr vernünftig praktisch arbeiten. Man hält sich an die Arbeitsteilung, wie sie im ländlichen Europa seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, überliefert wurde.Frauen kümmern sich um das Kleinvieh und den Gemüsegarten, ums Mehlmahlen, Brotbacken, Einmachen und Keltern, sie sind fürs Heilen und die Heilmittelherstellung zuständig; die Männer pflügen mit Pferden den Acker, versorgen das Großvieh, bauen Gebäude und regeln die Beziehungen zur Außenwelt.
Gemeinschaft ohne Stress
Das Leben der Amish ist arbeitsintensiv. Dennoch haben sie Freude daran und finden Erfüllung. Da ist nichts Abstraktes, Entfremdetes, denn man weiß, dass das, was man tut, notwendig ist. Man arbeitet nicht stumm alleine vor sich hin, sondern mit den anderen im kurzweiligen Zusammensein. Wenn ein junges Paar heiratet, trifft sich die ganze Gemeinde, um den Neuvermählten ein Haus samt Hof zu bauen. Fernsehen, Videos, PCs, Autos, Mode und Konsum sind nicht Teil ihrer Welt, auch nicht der Stress, wie wir ihn kennen. In anderen Worten: Diese gewachsene, selbstversorgende Kultur ist uns recht fremd. Wir dagegen leben in einer kompliziert konstruierten, meist urbanen Gesellschaft, wo der soziale Zusammenhang oft auf Kleinstfamilien reduziert ist, wo die Alten in Heime gesteckt werden und die Kinder in Totalschulen, wo staatliche Fürsorge gemeinschaftliche Unterstützung weitgehend ersetzt und Geld und Konsum für Lebensinhalt sorgen. Offensichtlich haben die Amish eine bessere Chance zu überleben, wenn es so weit kommen sollte, dass die Energiekosten ins Unermessliche steigen und die Wirtschaft kollabiert.
Familiengärten
Schon ein kleiner Familiengarten kann in Zeiten steigender Lebensmittelpreise eine wichtigeRolle spielen. Ebenso vorteilhaft ist es, die essbaren Wildpflanzen und Heilkräuter zu kennen.Mit einer 500 Quadratmeter großen Fläche und weniger als 250 Arbeitsstunden kann eine vierköpfige Familie ihren Jahresbedarf an Gemüse, Salat und Kartoffeln decken. Das hat der Gartenexperte Gerhard Schönauer ausgerechnet. Mit einem 3000 Quadratmeter großen Garten kann sich diese Familie sogar mit Eiern, Fleisch und Honig versorgen, wenn Hasen, Tauben, Hühner und Bienen mit in der Gartengemeinschaft leben. Auf einem größeren Grundstück kann man schon ein paar Milchschafe, Ziegen oder ein Schwein halten. Diese liefern zusätzlich wertvollen Dünger und Kompostmaterial, denn »auch Kleinvieh macht Mist«! Mit mehr als einem Hektar könnte man schon eine Kuh halten und einen Karpfenteich anlegen.
Wenn das komplexe zentralisierte Versorgungsnetz, Transport und Energienachschub ins Stocken geraten, dann wird es eng. Die Staatsreserven an Nahrungsmitteln, die in Notzeiten und bei Katastrophen verteilt werden, sind gegenwärtig auf einen Vorrat für wenige Tage geschrumpft. Aufgrund dieser bedrohlichen Szenarien entstehen in den USA grassroots-Bewegungen – Graswurzelbewegungen, die auf autarke Selbstversorgung setzen. Man ist bemüht, die Nahrungsmittelerzeugung zu dezentralisieren und wieder in die Hände der Menschen zu legen. Die langweiligen englischen Rasen, die jedes Haus in den Vororten heute umgeben, werden zunehmend in Überlebens-Gemüsegärten (survival gardens) umgewandelt. Mini farming, Anbau auf kleinster Fläche, wird immer populärer. Es sind keine Aussteiger, alternative Traumtänzer oder Zivilisationsflüchtlinge wie in den Sechziger- und Siebzigerjahren, die das heutzutage propagieren, sondern ganz normale Bürger aus der Mittelschicht, Bewohner der typischen amerikanischen Vorstädte. Es ist ihnen nicht entgangen, dass die Lebensmittelpreise fortlaufend steigen, während die Gehälter stagnierten. Auch die Energie, derer es bedarf, um die Lebensmittel industriell zu erzeugen und dann mit Trucks kreuz und quer durchs Land zu fahren, wird immer teurer. Es ist den Menschen nicht entgangen, dass Obst und Gemüse vom Supermarkt zwar schön aussehen, prall und farbig, aber wenig Nährstoffe enthalten, dafür mehr Pestizidrückstände. Die Bürger versuchen, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugewinnen.
Ein solcher Vorreiter des vorstädtischen mini farming ist Brett L. Markham; auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern hat er neben seinem Beruf als Ingenieur mit einer Investition von 200 Dollar einen Garten angelegt, der seine Familie bis zu 85 Prozent nahrungsautark macht und zugleich durch den Verkauf von überschüssigem Gemüse noch eine Einnahmequelle (7000 Dollar im Jahr) erschlossen hat.
Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls die an der Basis – im Schatten der etablierten Medizinindustrie – entstehende Gesundheitsbewegung, die auf altüberlieferte Heilmethoden und Heilkräuter zurückgreift. Zwar ist der Handel mit Heilpflanzen beziehungsweise die öffentliche Angabe von deren Indikation und Dosierung in den USA nicht legal, aber unter der Bezeichnung Nahrungsergänzungsmittel sind sie erlaubt. Das Wissen wird – wie ich es auf meiner Filmreise bei der Produktion von »Manitus grüne Krieger« erfahren konnte – in Workshops und sogenannten gatherings (Zusammenkünften) von kompetenten Wissenden weitergegeben.
Unauffällig und ohne große Medienaufmerksamkeit entwickelt sich ein Netzwerk des Überlebens. Der inspirierte Dichter und Seher Friedrich Hölderlin hat es schon vor 200 Jahren in dem Gedicht »Patmos« treffend gesagt: »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!«
Den Löwenzahn, eines unserer vitalsten Wildkräuter, liebe ich seit meiner Kindheit. Er kräftigt, als frischer Salat genossen, im Frühjahr unseren vom langen Winter erschöpften Körper.
WARUM ICH DIESES BUCH SCHRIEB
Was auch immer kommen mag, ich bleibe zuversichtlich. Ich bleibe am Boden, bleibe der Erde treu und in meiner Mitte. Schon öfter habe ich in meinem Leben Umbrüche erlebt und etwas über Überlebensstrategien erfahren. Als ich drei, vier Jahre alt war, ging der schreckliche Zweite Weltkrieg zu Ende. Hunger und Kälte suchten das Land heim. Im Winter hingen, da es keine Kohle zum Heizen gab, Eiszapfen an der hohen Decke in der Küche, wo wir uns aufhielten. Es ist nicht einfach für ein Kind, am Abend hungrig ins Bett zu gehen. Manchmal schwebte mir im Traum eine »Bemme« (Scheibe Brot) vor den Augen, und als dann die Zähne beim Zubeißen aufeinanderschlugen, wachte ich weinend auf. Wie viele andere gingen wir »hamstern«, tauschten bei den Bauern auf dem Land Silberlöffel oder Meißner Porzellan gegen ein paar Kartoffeln, Rüben oder was auch immer den Hunger stillen konnte.
Es waren amerikanische Truppen, die Westsachsen zuerst besetzten. Die Familienvilla wurde für amerikanische Offiziere »requiriert«, wir mussten in eine der Fabrikhallen umziehen. In diesen Tagen, unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen, war noch die Non-fraternization-Order in Kraft, ein »Verbrüderungsverbot«, welches die Annäherung an die Bevölkerung zu unterbinden versuchte. Als Kind kriegt man da einiges mit. Ein Nachbar erzählte ganz empört, dass die Amis altes Weißbrot und andere nicht mehr ganz frische Nahrungsmittel einfach auf einen Haufen warfen, mit Sprit übergossen und anzündeten. Es dauerte jedoch nicht lange, da wurde der Non-fraternization-Befehl von den einfachen GIs zunehmend unterlaufen. So etwa von James, einem freundlichen GI aus Chicago, der ein Auge auf meine Tante Anneliese geworfen hatte; immer wieder brachte er uns etwas zu essen mit. Bald konnten wir auch wieder in unser Haus zurückkehren.
Im Sommer zogen die Amerikaner ab. Niemand hatte das erwartet. An ihrer Stelle kamen die Russen. Die Westmächte hatten Thüringen und Westsachsen gegen einen Teil Berlins eingetauscht. Die einfachen russischen Soldaten hatten selbst wenig zu essen. Obwohl es ihnen verboten war, kletterten sie immer wieder über die Zäune oder gingen in die Häuser, wo sie »mausten«, was sie finden konnten: Hühner, Gänse, Obst, Kohle.
Verschiedene Kohlarten – Kohlrabi, Weißkraut, Grünkohl –, ebenso wie Lauch und Sellerie, gehören, schon seit ich denken kann, zu meiner Überlebensnahrung – das hat sich bis heute nicht geändert.
Überleben in schlechten Zeiten
Einmal gelang es dem Großvater, der in besseren Zeiten Tuchfabrikant gewesen war, auf dem Schwarzmarkt ein Stück Butter gegen eine Rolle Tuch einzutauschen. Der ranzige Klumpen wurde im kühlen Keller wie ein wertvoller Schatz aufbewahrt. Für mich hatte er die Aura von etwas ganz Besonderem. Dass die Kostbarkeit ranzig war, wurde mir erst später in Oldenburg bewusst, als ich das erste Mal im Leben frische Butter zu essen bekam. Den Geschmack ranziger Butter mag ich übrigens noch immer.
Im Frühling sammelten wir Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, Kresse und anderes Grünzeug, um Leib und Seele beieinanderzuhalten. Derweil gruben mein Großvater und Herr Glasl, ein Bauer und Zimmermann, der mit seiner Familie als Flüchtling bei uns untergebracht war, den Rasen der Villa um. Bald war daraus ein Gemüseacker geworden. Die Gartenlauben, in denen man in guten Zeiten an sonnigen Sonntagen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und geplaudert hatte, wurden zu Hühnerhäusern und Hasenställen umgebaut. So hatte man nicht nur Eier oder ab und zu mal ein Stückchen Fleisch für die dünne Suppe, sondern auch Felle zum Warmhalten und wertvollen Mist für den Komposthaufen.
Die Hühner wurden behandelt wie die Arbeiter in der Fabrik. Sie durften nicht einfach so ihre Eier in die Nestboxen legen – ihre Produktivität wurde genau kontrolliert! Der Großvater hatte ein ausgeklügeltes System erfunden, bei dem hinter jedem einzelnen Tier eine Klappe zufiel und das Huhn so lange in der Box gackerte, bis es wieder freigelassen wurde. So konnte er genau feststellen, welche Hühner am besten legten. Das Huhn, das am wenigsten Eier legte, war Kandidat für die nächste Hühnersuppe.
Zum Glück gab es schon einige Obstbäume – Kirschen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen –, auch Stachelbeeren und Johannisbeeren im Garten. An der Hauswand wuchs sogar ein Pfirsichbaum, aber im kalten Sachsen brachte er höchstens zwei oder drei reife Früchte hervor. Es war eine regelrechte Zeremonie, wenn der Großvater sie mit dem Messer teilte und jedem eine schmale Scheibe der köstlich süßen Frucht gab. Im Herbst sammelten wir fleißig Preiselbeeren, Heidelbeeren, Vogelbeeren und anderes Wildobst im Wald. Den Eichhörnchen machten wir Haselnüsse und Bucheckern streitig, und im Wald bei Klosterlausitz sammelten wir ganze Körbe voller Pilze. Meine Großmutter schien alle Pilze zu kennen. Stolz füllte ich mein Körbchen mit besonders großen Steinpilzen und Maronen und war sehr enttäuscht, als sich herausstellte, dass sie zu alt und voller Maden waren.
Äpfel gab es auch in meiner Kindheit in jedem Selbstversorgergarten. Sie gedeihen zum Glück auch in rauen Gegenden wie bei uns im Allgäu, wenn man sich die richtigen Sorten in den Garten pflanzt.
Ende1947 »machten mir ’nüber« in den Westen. Dort, in Oldenburg, wartete mein Vater auf uns, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden war. Versteckt im Waggon eines langsamen Güterzugs, fuhr meine Mutter mit mir den ganzen Tag und durch die Nacht, bis wir irgendwo im taufrischen Morgengrauen durch einen Stacheldrahtverhau krochen. Nun waren wir in der britischen Besatzungszone. Um Mitternacht kamen wir in der stockfinsteren Stadt an. Als Allererstes bereitete mir die Tante, in deren Dachkämmerchen wir untergebracht wurden, eine Tasse heiße Milch. Ich musste erbrechen. Ich war einfach die fette Vollmilch nicht gewohnt, sondern nur Magermilch.
Auch im Westen gingen die Menschen noch auf Hamstertouren, sammelten Beeren, Pilze und Bucheckern und legten überall kleine Selbstversorgergärten an. Zum Frühstück gab es immer eine Scheibe Brot mit Zuckerrübenmelasse von der Zuckerrübenfabrik. Insgesamt aber war die Versorgungslage in Westen nicht so schlecht wie im Osten. Und von Jahr zu Jahr wurde es besser.
Der Überlebenskampf, der Hunger in den ersten Jahren meines Lebens hat mich sicherlich geprägt. Denn es war für mich immer wichtig zu wissen, was man essen kann. Essbare Wildpflanzen interessierten mich ebenso wie der Anbau von Nahrungspflanzen. Wahrscheinlich deswegen räumte ich in unserem Hinterhof in Oldenburg als Neun- oder Zehnjähriger den Schutt weg und legte mir meinen ersten Garten an. Ein winziger Gemüsegarten mit einem Kohlpflänzchen, einer Kartoffelstaude, etwas Petersilie und – weil sie mir so gut gefiel – einer Kanadischen Goldrute. Das Beet düngte ich mit den Pferdeäpfeln, die ich auf dem Schulweg aufsammelte und in meinem Ranzen verstaute. Es waren damals, ehe die Kraftfahrzeuge die Straßen wieder eroberten, viele Pferdewagen unterwegs. Der von starken Oldenburger Kaltblütern gezogene, mit Fässern beladene Brauereiwagen fuhr täglich vorbei, und die Bauern karrten noch ihre Kartoffeln, Gemüse, Äpfel und getrockneten Torf mit Pferdewagen auf den Markt. Meine pflanzlichen Zöglinge dankten es mir; sie wuchsen so gut, dass die Hausbesitzerin mich beschuldigte, gute Humuserde aus ihrem Garten gestohlen zu haben.
Den Zuckermais lernte ich erst in Amerika kennen, aber seitdem liebe ich ihn. Jedes Jahr verteidige ich meine Maispflanzen gegen diebische Elstern und schlechtes Wetter, um im Herbst frisch geröstete Kolben genießen zu können.
ABENTEUERLEBEN
Als ich elf Jahre alt war, wanderten wir nach Ohio aus. Der Wohlstand, der Überfluss, ja, die sorglose Verschwendung, die einem dort begegneten, standen im krassen Gegensatz zur Not im Nachkriegseuropa.
Überfluss und Verschwendung
Für uns war es, als wären wir im Schlaraffenland gelandet. Fernsehen gab es dort schon, überall fuhren dicke Straßenkreuzer, und in den Küchen standen Kühlschränke, so groß wie Kleiderschränke. Die waren vollgestopft mit Milchflaschen, Schinken, Eiern, Truthahnschenkeln; im Gefrierfach gab es Sahneeis und popsicles (Eis am Stiel). Wenn man draußen beim Spielen auf etwas Appetit bekam, ging man einfach in das Nachbarhaus und holte sich, ohne fragen zu müssen, einen Keks, ein Eis, ein Glas Limonade oder Milch, oder man machte sich ein Sandwich. Das war selbstverständlich.
Fleisch konnte man sich im Nachkriegseuropa höchstens mal am Sonntag oder zum Feiertag leisten. Hier aber, bei unseren Nachbarn, kam es Tag für Tag auf den Teller, und zwar in so riesigen Mengen, dass der größte Teil davon in der Abfalltonne landete. Deshalb roch es jeden Abend in der Ortschaft nach verbranntem Fleisch; es gab keine öffentliche Müllabfuhr, also wurde der Müll – Papier, Kartons, alte Kleidung, zusammen mit den Essensresten – in einer alten Öltonne verbrannt. Jeder hatte so eine Tonne hinter dem Haus.
Kleine Bäckereien wie in der Alten Welt gab es nicht, dafür aber eine Brotfabrik, welche die ganze Region mit watteweichem Weißbrot und viel zu süßem Kuchen belieferte. Backwaren, die älter als einen Tag waren, wurden in große Säcke gefüllt und als Schweine- oder Hühnerfutter für wenige Cent an die Farmer verkauft. Auch wir haben uns jede Woche einen solchen Sack gekauft, denn noch waren wir mittellose Einwanderer. Beim Fleischer gab es Fleischknochen und Innereien – Leber, Niere, Lunge, Hirn –, alles umsonst. Diese »Schlachtreste« haben sich die Hundebesitzer für ihre Hunde oder die Trapper als Köder für ihre Fallen geholt. Aber auch viele Schwarze, die getrennt von den Weißen in den Armenvierteln wohnten, bedienten sich. Auch wir holten uns diese Leckerbissen und konnten kaum glauben, dass sie einfach verschenkt wurden.
» Was von meinen Jugenderfahrungen blieb, war die innere Überzeugung, dass man, wenn man naturnahe lebt, auch die schwierigsten zeiten überstehen kann. «
Guerillas gegen Maos Truppen
Ich verdiente mein eigenes Geld mit Zeitungsaustragen und indem ich einem Nachbarn, einem alten deutsch-amerikanischen Hufschmied, beim Gärtnern half. Dem Alten bin ich dankbar, denn bei ihm lernte ich die täglichen Pflegemaßnahmen für den Gemüse- und Obstgarten sowie die Kompostierung kennen. Wenn ich nicht arbeitete, zog es mich in den Wald. Häufig schlief ich am Wochenende auf Moos gebettet unter dem Laubdach. Und während der dreimonatigen Sommerferien verbrachte ich oft ganze Wochen in der Waldwildnis. Weit weg von den Menschen schlug ich mein Lager auf, beobachtete die Tiere, erforschte Bachläufe und Hügel.
Und immer versuchte ich vom Land zu leben, so gut es ging. Am Lagerfeuer kochte ich mir Mais und Kartoffeln zusammen mit Wildspargel und Wildkräutern. Ich sammelte Wildobst, unter anderem Holzäpfel, Wildbirnen, Maulbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Hagebutten, Erdbeeren, die kleinen, zuckersüßen Beeren des Zürgelbaums (engl. hackberry), der auch in Mitteleuropa gelegentlich in Parks anzutreffen ist, und die wilden, mit den Kaki-Früchten verwandtenDattelpflaumen (engl. persimmon). Das Bedürfnis, sich überall selbst versorgen zu können, gekoppelt mit einem Misstrauen gegen die so selbstsichere, im Überfluss lebende Gesellschaft, war tief in mir verwurzelt. In der Schule lernten wir zwar, dass der Fortschritt unaufhaltbar sei. Der Lehrer zeichnete uns das Bild von einer immer effizienter werdenden Landwirtschaft der Zukunft, wo Maschinen alles machen und der Farmer im weißen Kittel nur noch Knöpfe drücken muss; bis zum Jahr 2000 würden, dank der Antibiotika, alle Krankheiten ausgerottet sein und sich alle Menschen bester Gesundheit erfreuen; dank der Kernkraft würde es dann Energie in Hülle und Fülle geben. Ich war mir bei alldem nicht so sicher.
Es war niemand da, der mir das, was ich wissen wollte, beibringen konnte, und die heute so beliebten Survival-Kurse gab es damals nicht; sie hätten auch niemanden interessiert. Zum Glück besaß ich ein Pfadfinderhandbuch. Da standen einige Wildpflanzen drin, die man essen könne, wenn man sich in der Wildnis verläuft; auch wie man ohne Streichhölzer Feuer macht oder wie man praktische Knoten knüpft, erfuhr ich aus diesem Buch. Den Teil über essbare Wildpflanzen habe ich praktisch auswendig gelernt.
Manchmal begleiteten mich meine besten Freunde auf den Streifzügen im Wald. Es war die Zeit kurz nach dem Koreakrieg. In der Schule und in den Medien wurde ständig von der »gelben Gefahr« gesprochen. In China hatteMao Tse-tung den Sieg davongetragen und das kommunistisch gewordene, bevölkerungsreiche Land wurde allgemein als Bedrohung empfunden, gegen die der Westen gerüstet sein müsse. Das hat unsere Fantasie beflügelt. Ich überzeugte meine Freunde, eine Partisanentruppe – das Wort Guerilla gab es noch nicht – aufzustellen, falls die Rotchinesen Amerika angreifen und das Land besetzen würden. Wir begannen für den Widerstand zu trainieren: Dazu gehörten schwierige Kletterübungen, Nachtmärsche, mit den über dem Kopf gehaltenen Luftgewehren durch Sümpfe und Flüsse zu waten, unter Zäunen durchzurobben, Sprit von den Farmmaschinen zu klauen, um Molotow-Cocktails daraus zu basteln und diese dann an Brücken und leer stehenden Gebäuden auszuprobieren, Einbrüche ins Schulgebäude und die Beschlagnahme von Nahrungsmitteln aus dem Hauswirtschaftsbereich, wo die Mädchen Kochen, Backen und Haushalten lernten.
Auf Beutefang
Einmal überfielen wir ein Pfadfinderlager auf einem Hügel in der Nähe. Drei von uns Jungen schreckten die im Tal weidende Rinderherde auf, sodass diese laut brüllend in Panik davonstürmte. Die Pfadfinder wurden neugierig und verließen samt ihrem Führer den Zeltplatz, um zu sehen, was los war. Derweil schlichen mein bester Freund Jim und ich ins Lager der »Feinde«, machten die Zelte platt, gossen ihre Wasservorräte im Lagerfeuer aus, füllten unsere Rucksäcke mit ihren Vorräten und machten uns aus dem Staub. Den Pfadfindern blieb nichts anderes übrig, als das Lager zu verlassen. Wir feierten unseren Sieg mit einem üppigen Schmaus aus erbeuteten Fressalien.
AusdenFeldern klauten wir den milchreifen Mais und kochten ihn in unserem Camping-Geschirr mit allen möglichen Wurzeln und Grünzeug. Ab und zu holten wir uns nachts ein Huhn aus dem Hühnerstall eines Farmers und grillten es am Lagerfeuer: Es duftete immer herrlich, war aber meistens zäh wie Leder. Hühnerklauen war gefährlich: Wenn man nicht schnell genug zupackte, gab es einen Riesenradau, dann bellten die Hofhunde und der Farmer kam mit der Schrotflinte herausgestürmt. Die war für solche Fälle meistens mit Steinsalz geladen. Enten zu fangen war auch nicht einfach: Wenn sie merkten, dass wir anschlichen, schwammen sie schnatternd auf die andere Teichseite. Beim Angeln hatten wir mehr Glück. Die am Lagerfeuer gegrillten Fische waren lecker. Trotzdem angelte ich nicht gerne, da mir die Fische ebenso leidtaten wie die am Haken aufgespießten Regenwürmer.
Im Ganzen lebten wir ein richtig freies Tom-Sawyer-und-Huckleberry-Finn-Leben. Es machte Spaß und uns ging es dabei so gut, dass wir glaubten, eigentlich könnten wir auch ohne die lästigen Eltern überleben. Heute wären unsere Streiche wohl unter die Rubrik »Jugendkriminalität« gefallen oder sie hätten zumindest zur Folge gehabt, dass dem einen oder anderen von uns Ritalin verordnet worden wäre. Was von diesen Jugenderfahrungen blieb, war die innere Überzeugung, dass man, wenn man naturnah lebt, auch die schwierigsten Zeiten überstehen kann.
Erkenntnisse der Ethnologie
Jahre später studierte ich Völkerkunde und Kulturanthropologie. Die Steinzeit, die mehr als 99 Prozent der Zeit ausmacht, in der Menschen auf der Erde leben, und die Lebensweise der Jäger und Sammlerinnen, der einfachen Hackbauern und Gärtnervölker faszinierten mich. Genauere ethnologische Untersuchungen zeigten, dass im Gegensatz zu dem Fortschrittsdogma des 19. Jahrhunderts diese Stammesgesellschaften, die es noch bis in unsere Zeit gibt, keineswegs arm, rückständig und primitiv sind. Sie leben glücklicher und stressfreier als der moderne Zivilisationsmensch, und hungern tun sie auch nicht. In einer ursprünglichen, ökologisch intakten, natürlichen Umwelt stand ihnen eine Fülle von hochwertigen Nahrungsquellen zur Verfügung. Sie lebten, wie der Anthropologe Marshall Sahlins schreibt, in der »ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft«. Erst wenn ihre traditionelle Lebensweise durch kolonialistische Ausbeutung gestört und ihre natürliche Umgebung vernichtet wird, dann entwickeln sich Armut, Dreck, Verfall und Rückständigkeit, denen man in der sogenannten Dritten Welt auf Schritt und Tritt begegnet.
Gut recherchierte Studien über die Lebensweise und Ernährung der San, der Buschmänner in der südafrikanischen Kalahari-Wüste, und bei anderen Jäger-und-Sammler-Gesellschaften zeigen Menschen, die – mit weniger Aufwand, als wir es kennen – ein gutes Leben führen und denen eine reichhaltige, breit gefächerte Diät mit mehr als genügend Kalorien zur Verfügung steht. Über 300 verschiedene Pflanzenarten werden bei den San gegessen, weit mehr als die wenigen Dutzend hochgezüchteten Arten, die in den Supermärkten angeboten werden. Dazu kommen eiweißreiche Insekten, Raupen und andere tierische Kost. Um eine Familie zu ernähren, brauchen die sammelnden Frauen und Kinder nicht mehr als zwei oder drei Stunden pro Tag.
Rote, sonnengereifte Johannisbeeren frisch vom Strauch – wie köstlich! Doch wie viele Kinder lernen solche Genüsse heute noch kennen, wo Obst und Gemüse in Plastik verpackt aus dem Supermarkt kommen?
Getrennt von Mutter Erde
Bei den Indianern oder den australischen Aborigines war es nicht viel anders. Voraussetzung war jedoch immer eine intime Naturkenntnis – ein Wissen, das sie sich schon von klein auf aneigneten – bei den täglichen Sammelausflügen mit den Müttern, den Großmüttern, Geschwistern und Tanten – bis es zur zweiten Natur wurde. Ein alter Ureinwohner erzählte einmal dem australischen Völkerkundler Georg Elkin: »Ja, unsere Jungen, wenn sie in die Städte gehen, entwickeln ein großes Maul, so wie die Weißen. Aber im Grunde genommen haben sie Angst. Denn wer nicht weiß, wie man sich von der Erde unmittelbar ernähren kann, ist tief verunsichert, er hat Angst und ist auch manipulierbar, wie ein kleines Kind, das seine Mutter verloren hat.«
Dieses Verlorensein, diese Entfremdung von der Natur, ist in unserer westlichen, über-technisierten Welt zum Normalzustand geworden, zugleich aber auch die untergründige, meist verdrängte Unsicherheit und Lebensangst. Je mehr wir in einer virtuellen Welt leben, die gespeist wird durch endlose Video-Unterhaltung und abstraktes Schulwissen, und unsere natürlichen Wurzeln vergessen, umso mehr Angst werden die Menschen haben.
Angst vor der Natur
Für mich als elfjährigen Jungen war die neue Welt, in die wir ausgewandert waren, aufregend und befreiend. Was für eine herrliche, wilde Natur! Gleich am Stadtrand. Es dauerte nicht lange, bis ich entdeckte, dass meine neuen Spielgefährten meine Begeisterung nicht teilten, sie sahen die Welt anders, als ich es gewohnt war. Für sie war die Natur etwas Gefährliches, etwas, wovor man sich schützen musste. Einmal entdeckte ich beim Spielen zu meiner Freude einen wild wachsenden Johannisbeerbusch mit reifen roten Früchten. Als ich anfing, sie mir in den Mund zu stopfen, schrien die anderen entsetzt: »You’re going to die – Du wirst sterben! Rote Beeren sind giftig!« Als ich später einmal über den Schulzaun kletterte, riefen mir die Klassenkameraden nach: »Du verrückter Kraut! Da wirst du umkommen. Da sind Giftschlangen, tollwütige Tiere und poison ivy (Giftsumach)!« Ich war erstaunt über diese Reaktion, aber so entdeckte ich die Wildnis als mein persönliches Revier. Kein Mensch ging da hinein, außer dem Farmer, der Holz schlug, oder, im Herbst, die schwer bewaffneten Jäger, die praktisch auf alles schossen, was sich bewegte.
Viel später in Oregon – ich hielt gerade eine Ethnologie-Vorlesung am örtlichen College – kam die Sekretärin in den Hörsaal gestürzt: »Dr. Storl, bitte kommen Sie sofort ans Telefon. Ein Notfall, der Chefarzt will sie sprechen!« Der Arzt bat um Rat. Ein Junge hätte rote Beeren gegessen. Da man befürchtete, sie seien giftig, hatte man den Kleinen in die Notaufnahme gebracht und ihm den Magen ausgepumpt. Ob ich vielleicht wisse, welche Pflanze das sein könnte?
»Hatten die Beeren eine blass lachsrote Farbe? Und waren sie nicht sehr saftig, sondern eher trocken und mehlig?«, fragte ich.
Als er bejahte, wusste ich: Das waren die Beeren vom Manzanita-Strauch. Für die Indianer, die einst hier lebten, stellten sie ein Hauptnahrungsmittel dar.
In Europa scheint es nicht viel besser zu sein, was die Entfremdung von der uns tragenden und umgebenden Natur angeht. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass der Bundesbürger im Durchschnitt lediglich sechs Wildpflanzen bestimmen kann: darunter Brennnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen … und dann wird’s schwierig.
Wirwissen zwar viel, gehen lange in die Schule, meinen, wir seien gebildet, aber wenn es um Wissen geht, das überlebensnotwendig sein kann, dann sieht es nicht gerade gut aus.
Lehrjahre beim Gärtnermeister
Es war wohl mein tief verwurzeltes Verlangen, der Erde und den Pflanzen nahe zu sein, das mich in eine biologisch-dynamische Kommune am Ufer der Rhone südlich von Genf führte. Eigentlich war die Aktion als ethnologische Feldforschung geplant: ein Ethnologe, der als Gärtner getarnt in das Dorf ging. Die Arbeit in dem Gemüsegarten nahm mich aber so gefangen, dass ich tatsächlich den Gärtner in mir wiederentdeckte, vorübergehend aus dem akademischen Betrieb ausschied und mehrere Jahre blieb. Dort lernte ich den Gärtner- und Kompostmeister Manfred Stauffer kennen. Er leitete den zwei Hektar großen Gemüsegarten, der die Gemeinschaft von rund 150 Leuten ernährte und zugleich so viel produzierte, dass biologisches Gemüse von hoher Qualität auch auf dem Wochenmarkt in Genf angeboten werden konnte.
Der magere, steinige Boden, Ablagerungen eines urzeitlichen Gletschers, gab wenig her. Deswegen hatte ihn die Stadt der Gemeinschaft auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Manfred Stauffers Schlüssel zum Erfolg war vor allem eine intensive Kompostwirtschaft. Miste aller Art vom eigenen Kuh-, Hühner- und Schweinestall und von den Nachbarhöfen, Abfälle aus den Haushalten, Hühnerfedern von einem Hühnerhof, Schlamm aus den Gräben, Haare vom Friseursalon und sogar die von der Genfer Hafenbehörde herausgefischten Algen ließen wir ankarren, um sie sachkundig zu kompostieren.Auf richtige Fruchtfolgen und Pflanzenzusammenstellungen wurde konsequent geachtet.Wir pflanzten Wildobsthecken, die den Wind bremsen, das Mikroklima verbessern und nebenbei Vitamine für den Wintervorrat liefern. Und obwohl weder Gift noch Kunstdünger verwendet noch mit schweren Maschinen gearbeitet wurde – ein Pferd, eine einfache Motorfräse und ansonsten Hacken und Grabforken genügten –, steigerte sich der Ertrag von Jahr zu Jahr. Über eine Zeitspanne von fünf Jahren verdoppelte sich das Einkommen des Gartens sogar. Der finanzielle Überschuss, der erwirtschaftet wurde, kam den anderen Werkstätten der Kommune zugute. Vieles, was in diesem Buch über das Gärtnern und Kompostieren steht, verdanke ich meinem Lehrmeister Manfred Stauffer.
Der spirituelle Gärtner
In diesem Dorf lernte ich auch Arthur Hermes kennen. Der alte Naturweise, der mir wie eine Wiedergeburt eines Druiden oder Priesters aus fernen Megalith-Zeiten vorkam, kam als Ratgeber. Ansonsten lebte er auf einem Einödhof in einer Waldlichtung hoch oben im Schweizer Jura. Für ihn war die Erde die Mutter Erde, der hohe Himmel der himmlische Vater und die SonneAusdruck des kosmischen Christus; Pflanzen und Tiere waren für ihn unsere Geschwister. Die Waldameisen nannte er »meine kleinen Mitarbeiter«. Von ihm lernte ich vor allem einen liebevollen Umgang mit den Pflanzen. »Wie kleine Kinder, wenn man sie zu Bett bringt, so soll man die jungen Gemüsesetzlinge in Mulch einbetten«, sagte er, »und mit dem Licht der Seele, mit der inneren Sonne, anstrahlen.« Dann würden sie kräftig wachsen und uns richtig ernähren. Auch ihm bin ich dankbar, denn vieles, was in diesem Buch steht, geht auf ihn zurück.
Irgendwann fing mich die Universität doch wieder ein und ich promovierte mit einer Dissertation über Schamanentum. Und dann gingen meine Frau und ich zurück in die USA, wo ich als Anthropologe eine Dozentenstelle suchen wollte. Da aber der neu gewählte Präsident Reagan gerade die Gelder für das Bildungswesen stark gekürzt hatte, gestaltete sich die Suche schwierig. An einem College in Oregon hatte ich Glück: Infolge eines Erleuchtungserlebnisses hatte der dortige Anthropologe von einem Tag auf den anderen seine Stelle gekündigt. Er wurde zuletzt gesehen, als er, ein hölzernes Kreuz tragend, barfuß in Richtung Kalifornien lief. In meiner neuen Stelle war ich in den ersten zwei Jahren zwar wie in einer Vollzeit-Stelle mit Vorlesungen beschäftigt, wurde aber nur als Teilzeit-Mitarbeiter bezahlt – ich verdiente zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.
Gartenabenteuer in Oregon
Wir wohnten in einem umgebauten Hühnerstall, heizten notdürftig mit selbst gesammeltem Holz, ein umfunktioniertes Ölfass diente als Ofen, und unsere kargen Mahlzeiten ergänzten wir mit Wildgemüse und Wurzeln. Den Rasen hinter der Hütte gruben wir um und säten schnell wachsendes Blattgemüse ein – Spinat, Gartenmelde und Senf. Ehe anderes Gemüse reifte, war das Teil der täglichen Mahlzeit.Da lernte ich, dass es nicht unbedingt gesund ist, jeden Tag Spinat und Melde zu essen. Die Zähne wurden glasig und löchrig, denn die Oxalsäure raubt ihnen den notwendigen Kalk. Auch die Nieren schmerzten, denn die Kristalle der Oxalsäure reizen das Nierengewebe.
Neben meinen Seminaren als Soziologe und Anthropologe unterrichtete ich samstags biologisches Gärtnern. Der Kurs war überfüllt und ein Dauerbrenner, sodass uns das College ein Versuchsfeld zur Verfügung stellte. Aus den Vorlesungsnotizen wurde ein Lehrbuch mit dem Titel Culture and Horticulture, das später zum Underground-Bestseller wurde.
Die Karde heilt nach meinen Erfahrungen sogar Borreliose. Ich hatte mir diese Krankheit vor einigen Jahren durch einen Zeckenbiss eingehandelt und ohne Antibiotika durch selbst gemachte Kardenwurzeltinktur kuriert.