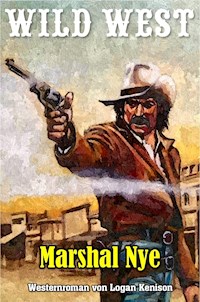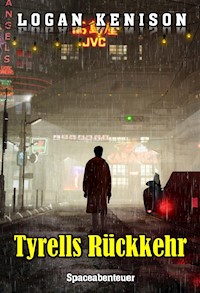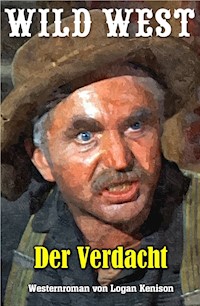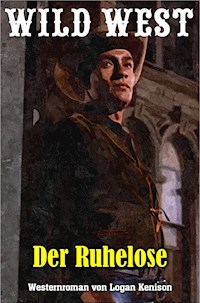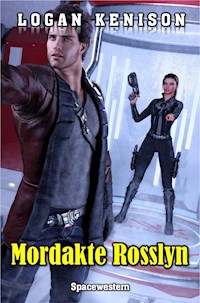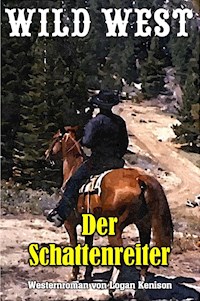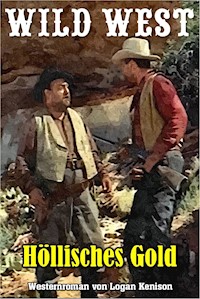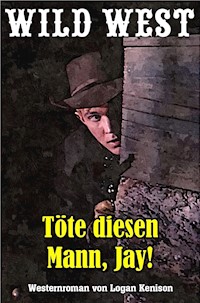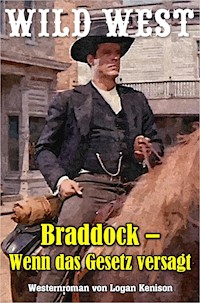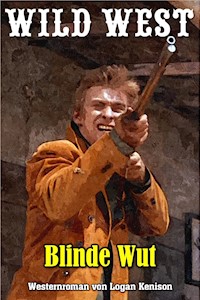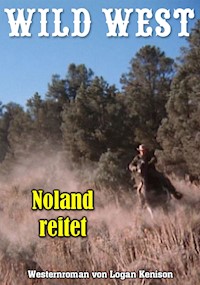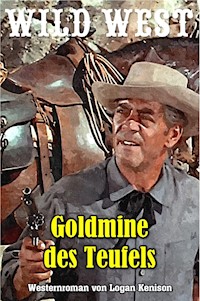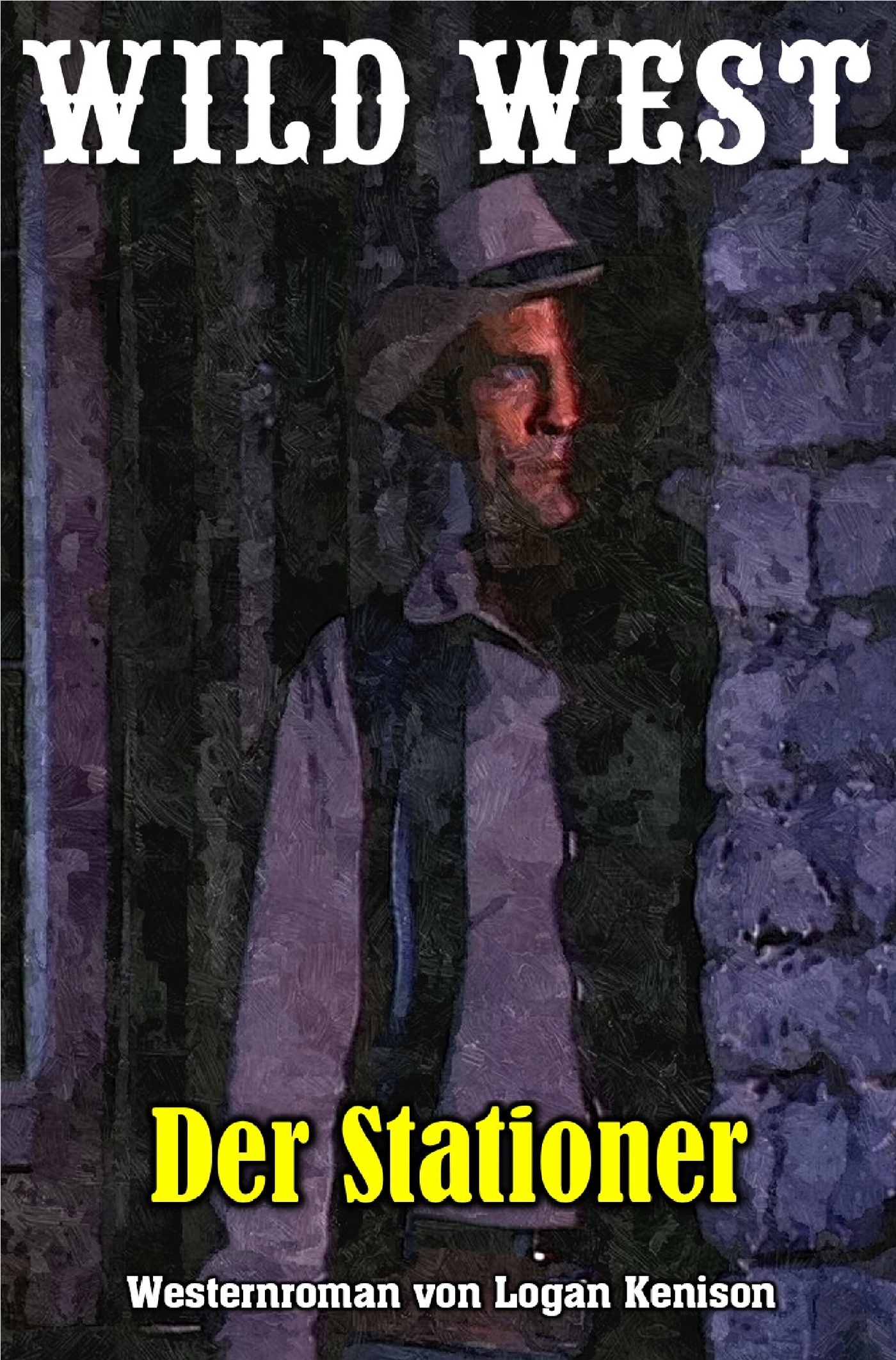
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie verspotteten ihn und bedrohten seine Familie. Sie schlugen ihn zusammen und vertrieben ihn von seinem Land. Doch sie rechneten nicht damit, dass ein seltsames Geschick ihn eines Tages zurück in ihr Land führen könnte. Und der Stationer griff zur Waffe…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Stationer
Western
Ein Roman von
Logan Kenison
Das Buch
Sie verspotteten ihn und bedrohten seine Familie. Sie schlugen ihn zusammen und vertrieben ihn von seinem Land. Doch sie rechneten nicht damit, dass das Geschick ihn eines Tages zurück in ihr Land führen könnte.
Der Autor
Logan Kenison (vormals Joe Tyler) ist Autor von Western-, Abenteuer- und Spacegeschichten. Neben seinen Western, die er mit Leidenschaft verfasst, schreibt er seit 2018 die Reihe Spacewestern.
Lesermeinung
Ein Leser aus den Vereinigten Staaten schrieb am 18. Dezember 2018:
Ich habe dieses Buch genossen. Es ist eine gute Geschichte von Gier, Rache und Rettung. Der Protagonist Scott Hildreth ist eine sympathische Figur, die sich gegen den gierigen Landbaron Adair Feudinger kämpfen muss, der das gesamte County kontrollieren will. Es gibt viele Drehungen und Wendungen, um den Leser zu interessieren. Insgesamt gefällt mir der Schreibstil des Herr[n Kenison].
(5 Sterne)
Inhalt
Impressum
Der Stationer
Weitere Titel von Logan Kenison
Ungekürzte Ausgabe 08/2014
Copyright © 2020 by Logan Kenison.
Lektorat: Carola Lee-Altrichter
Das Cover wurde gestaltet nach Motiven der Episode »Candy unter Verdacht« (Orig.: »The Silence At Stillwater«, USA, 1969) der Bonanza-Komplettbox. Im Handel auf DVD erhältlich. Mit freundlicher Genehmigung von www.fernsehjuwelen.de
E-Mail: [email protected]
Abdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Autors.
Der Stationer
Western von Logan Kenison
Sie warten hinter der Hügelkuppe, bis es völlig dunkel geworden ist. Niemand im Haus ahnt etwas, niemand bemerkt sie. Als der letzte Lichtschein verschwunden ist, geben sie noch eine Stunde zu, denn sie wollen sichergehen, dass die ganze Familie tief und fest schläft. Der Schreck wird doppelt so groß und die Gegenwehr sehr viel geringer ausfallen, wenn sie sie im Schlaf überraschen.
Dann kommen sie. Nicht auf ihren Pferden, nicht schreiend und schießend im Galopp, sondern zu Fuß. Schweigend marschieren sie zum Farmhaus hinab, zwanzig Männer mit Zuckersäcken über den Köpfen, in die sie Augenlöcher geschnitten haben. Im kalten Licht des Mondes werfen sie lange Schatten. Gewehrläufe blitzen silbern. Steine knirschen unter ihren Stiefeln, und hin und wieder knackt ein alter Zweig. Dies und das Rascheln ihrer Hosen, Westen und Hemden sind die einzigen Geräusche, die zu hören sind.
Keiner sagt ein Wort, denn sie kennen ihren Auftrag.
Einer hält das Lasso im Arm – das Mordwerkzeug.
Im Hof steht eine vierhundert Jahre alte Burreiche mit starken Ästen; diese haben sie in ihr Vorhaben miteinbezogen.
Sie erreichen das Haus.
Fackeln flammen auf und fliegen auf die Dächer des Hauses, des Stalls und der Scheune. Schüsse donnern in den Himmel und durchschlagen Glasscheiben, töten die zwei Wellington-Schweine im Koben.
Schwere Stiefeltritte brechen die Haustür auf.
Drei Männer stürmen hinein, schießen in die Decke, brüllen, zerren und stoßen die erschrockenen und von der schweren Tagesarbeit zerschlagenen Einwohner heraus: Einen Mann, eine Frau und ein Mädchen.
Ihre Strategie geht auf. Niemand kann einen Gedanken an Gegenwehr verschwenden; dazu ist keine Zeit. Die Bewohner haben Mühe, all das zu erfassen, was um sie herum geschieht, denn sie denken, dass die Hölle losgebrochen ist.
Draußen fliegt dem Farmer eine Schlinge um den Hals. Sie wird sofort zugezogen und beginnt, ihm die Luft abzuschnüren. Er gurgelt und greift mit beiden Händen nach dem Seil, schafft es jedoch nicht, die Schlinge zu lösen.
Sie schleifen, boxen und stoßen ihn zur Burreiche hinüber.
Die Frau kreischt, denn sie erkennt, wo das enden wird. Das brennende Haus und der Stall, die wiehernden und sterbenden Tiere – all das ist nicht mehr wichtig. Das Schlimmste ist das, was sich bei der Burreiche abspielt.
Einer der Vermummten wirft das Seilende über einen Ast in drei Metern Höhe. Sofort kommen zwei andere Männer und helfen ihm, daran zu ziehen.
Im flackernden Feuerschein spannen die Männer das Lasso, der Farmer schreit und würgt in Todesangst. Seine Frau hat das Mädchen gepackt und drückt es an ihre Brust, verdeckt den kleinen Kopf mit ihren Händen. Das Mädchen weint und schreit; sie spürt, dass etwas Schlimmes vor sich geht.
Drei Männer ziehen das Seil an, dann springt ein vierter herbei, der ihnen hilft. Der Farmer steht noch auf den Zehenspitzen, als sie innehalten. Alle Vermummten stellen sich im Kreis um die Burreiche auf.
Gelächter und Schreie dröhnen durch die Nacht, Schüsse bellen.
Dann gibt der Anführer ein Zeichen, und die vier Männer ziehen das Seil mit Schwung und Kraft nach unten.
Der Farmer schwingt in die Höhe.
Seine Frau schreit und fleht.
Doch die Vermummten kennen keine Gnade. Sie sehen die zappelnden Beine des Mannes einen Meter über dem Erdboden, die hilflosen Versuche, das Seil über dem Kopf zu ergreifen und sich daran in die Höhe zu ziehen, damit sein Gewicht nicht auf der Halsschlinge lastet …
Und sie lachen.
Dann erlahmt das Zappeln, die Arme sinken herab, der Körper des Farmers erschlafft.
Auf ein Zeichen des Anführers hin lassen die vier Männer das Seil los.
Schwer schlägt der Körper am Boden auf, er sackt bewusstlos in sich zusammen.
Seine Frau stößt das Kind weg, befiehlt ihm, fernzubleiben, läuft zu ihrem Mann, zerrt seinen Oberkörper hoch, versucht, die Schlinge zu lösen und abzumachen, doch es gelingt ihr nicht. Sie drückt seinen Kopf an ihre Brust, streicht über seine Wange. Immer noch ist der Mann ohne Bewusstsein, jedoch nicht tot. Seine geschwollene Halsschlagader pocht, und sie spürt seinen Herzschlag.
Die johlenden Männer verstummen, ihr Anführer tritt vor.
Wenn ihr morgen noch hier seid, kommen wir wieder, verkündet er. Dann halten wir nicht im letzten Moment inne. Dann werden wir zu Ende führen, was wir heute begonnen haben. Also verschwindet! Verschwindet aus dem Land. Lasst euch nie wieder hier blicken! Denn sonst wird es euch übel ergehen. Das heute war nur der Vorgeschmack. Lauft fort, ohne euch umzudrehen, und kommt nie wieder!
Dann wenden sie sich ab und gehen fort, und im flackernden Licht sehen sie grausam aus mit ihren Zuckersäcken mit den hineingeschnittenen Löchern, den Gewehren und den harten, breiten Rücken.
Und zurück bleiben die Frau, der bewusstlose Mann in ihrem Arm und das Mädchen, das in fünf Meter Entfernung steht und weint und schreit. Und hinter diesen Dreien brennen das Wohnhaus und der Stall und die Scheune ab, und all die Arbeit, die sie in den vergangenen drei Jahren hineingesteckt haben, ist umsonst gewesen.
*
Im Morgengrauen kommt er zu sich. Sein ganzer Körper pulsiert und brodelt; er glaubt, jeden einzelnen Schlag und Tritt noch zu spüren, jeder Atemzug schmerzt. Wenn er spricht, klingt es heiser und röchelnd. Das Mädchen hat Angst, als sie ihren Vater so reden hört. Sie hält sich die Ohren zu und sitzt weit von der Burreiche entfernt auf dem Boden und weint.
Der Farmer kauert im Hof vor den Trümmern seiner niedergebrannten Gebäude und unterhält sich gedämpft mit seiner Frau. Sie möchten nicht, dass ihre Tochter mitbekommt, was sie besprechen.
Die Frau ist verstört. Sie möchte nicht in die Stadt gehen und dem Sheriff alles erzählen, doch ihr Mann besteht darauf.
Der Sheriff gehört zu denen, sagt die Frau. Wir erreichen gar nichts, wenn wir zu ihm gehen. Außer, dass sie wiederkommen und dich töten.
Und dann weint sie wieder, denn der Schock steckt ihr noch in allen Knochen.
Der Farmer ist ein mutiger Mann, der nicht so schnell aufgeben möchte. Er weiß, dass er nicht viele Möglichkeiten und kaum eine Chance gegen die Revolverreiter hat. Und er glaubt auch zu wissen, wer sie geschickt hat. Doch er hat das Land besiedelt, bearbeitet und beackert, hat die Hütten und Gebäude gebaut und literweise Schweiß in diesen Erdboden vergossen. Er liebt dieses Land. Alles in ihm widerstrebt es einfach, dies aufzugeben und fortzugehen.
Er überlegt, was zu tun ist und was er tun kann. Und er kommt zu dem Schluss: Gar nichts. Denn seine Frau hat Recht. Sheriff Lowell Wilson gehört zu der Bande, die das Land terrorisiert und jeden fortjagt, der südlich des Snake River siedeln möchte. Sheriff Lowell Wilson wird regelmäßig von Adair Feudinger bestochen, dem Besitzer der großen Kingdom Ranch, und jeder in der Stadt weiß es.
Doch keiner tut etwas dagegen.
Denn der ganze Bezirk lebt im Schatten dieser Ranch, die hunderten Menschen Arbeit gibt und Aufträge erteilt. Wer sich gegen Adair Feudinger stellt, hat bald nichts mehr zu lachen. Er bekommt keine Aufträge mehr, und jeden, der ihm einen Auftrag erteilt, ereilt dasselbe Schicksal.
Die Menschen im Pima County im Arizona-Territory haben eine schwere Zeit hinter sich. Der Krieg und die karge Zeit danach haben viele von ihnen an den Rand des Verhungerns getrieben. Einige Familien leben schon seit hundert Jahren hier, doch die meisten sind erst im Sommer 1859 hergezogen mit dem großen Wagentreck aus Fort Lauderdale, Texas. Unter ihnen waren Deutsche, Iren, Schotten, Polen und Holländer. Sie haben versucht, das Land urbar zu machen, ihm ihren Lebensunterhalt abzuringen.
Das Land ist kümmerlich; außer Gras, Gestrüpp und Kakteen scheint hier nicht viel wachsen zu wollen. Und so haben sich viele winzige Ranches und Farmen gebildet, deren Besitzer versuchen, nicht zu verhungern. Die gewaltigste Ranch jedoch ist die Kingdom Ranch, und sie ist von King Wilhelm Feudinger 1818 gegründet worden, als das hier noch Indianerland gewesen ist.
Wilhelm Feudinger war 1809 von Koblenz, Deutschland, nach Amerika ausgewandert und hatte dort sechs Jahre lang für eine Siedlungsgesellschaft gearbeitet, welche deutsche Adlige in Texas gegründet hatten, um Auswanderern den Start in der Neuen Welt zu erleichtern. Feudinger hatte viele Auswanderer übers Ohr gehauen und horrende Summen von ihnen kassiert für Dienstleistungen, die die Gesellschaft nie erbrachte.
Dass diese Siedler Landsleute von ihm waren, die am Ziel einer dreitausend Meilen langen Überlandreise vor dem Nichts standen und ums pure Überleben kämpfen mussten, war ihm egal.
Nach dem Bankrott der Gesellschaft 1815 war Feudinger ein reicher Mann gewesen. Er besaß über eine Viertelmillion Dollars, die er auf die Seite geschafft hatte. Dieses Geld nahm er nun, um im Territorium Arizona, das damals noch zu Mexiko gehörte, ein gewaltiges Stück freien Lands in Besitz zu nehmen und zu besiedeln. Er leistete sich eine kleine Privatarmee, die die Indianer und Mexikaner in der Gegend abknallte und ihn vor allem schützte, was ihn oder sein Reich bedrohte.
In diese Zeit fiel seine Manie, sich King nennen zu lassen, und er stellte sich jedem als King Wilhelm Feudinger vor. Kleine Gehöfte in der Umgebung, meist von Mexikanern bewirtschaftet, verleibte er seinem Imperium ein, die Menschen bezeichnete er fortan als sein Volk; sie waren nichts anderes als Sklaven.
Diese Denkweise gab er an seinen Sohn William weiter, erzog ihn im Glauben, nach europäischer Tradition Alleinherrscher zu sein, der sein Königreich gegen alle fremden und feindlichen Einflüsse verteidigen muss.
William Feudinger herrschte noch despotischer als sein Vater Wilhelm, und auch er war der Meinung, die vermeintliche Familientradition an seinen Nachkommen weitergeben zu müssen.
Da es für die Familie keinen Kampf ums Überleben mehr gab – die Indianer waren vertrieben, die Bevölkerung geknechtet, das Land an Amerika gefallen –, wuchs Adair Feudinger zu einem verzogenen, großspurigen Bengel heran, dem jedes Gespür für Recht und Unrecht, Sinn und Unsinn, Treu und Glauben fehlte, und der nur nach seinen Neigungen handelte, egal, welche Folgen das für seine Umwelt hat.
Obwohl Feudinger inzwischen sechsunddreißig ist, hat sich daran nichts geändert.
Der Farmer weiß, dass er gegen das Imperium dieses Großranchers nichts ausrichten kann. Wenn er seine Farm behalten möchte, muss er sie bewirtschaften. Er muss aussäen und pflanzen, bewässern und jäten, Zäune ziehen und sich um die Tiere kümmern. Er kann einfach nicht zur selben Zeit gegen Adair Feudinger kämpfen.
Das ist unmöglich.
Während er das täte, würden seine Frau und seine Tochter verhungern.
Und Adair Feudinger muss nur mit dem Finger schnippen, und sofort setzen sich fünfundzwanzig Revolverreiter in Bewegung und nehmen den Kampf gegen den Farmer auf.
Die Chancen sind ungleich verteilt, die Lage ist hoffnungslos.
Und so entscheidet sich der Farmer.
Wir gehen, sagt er zu seiner Frau. Wir gehen und verlassen das Land.
Sie sieht ihn halb bestürzt, halb erleichtert an. Ist das dein Ernst? fragt sie.
Er nickt. Dann sieht er zu den kohlschwarzen Trümmern der Gebäude hinüber, sieht die toten Tiere, die bestialisch erstickt und verbrannt sind. Ein schwerer Geruch nach Feuer und Brand liegt immer noch in der Luft.
Wir gehen, sagt er noch einmal.
*
Sie sind zwei Tag lang zu Fuß unterwegs, haben nur kleine Bündel bei sich, die die paar Dinge enthalten, die sie aus den niedergebrannten Ruinen haben bergen können. Das ist wenig genug; sie haben großen Hunger und Durst, fühlen sich zerschunden von dem Marsch durch die brüllend heiße Prärie.
Sie kommen nur langsam vorwärts, denn der Farmer hat schwere Prellungen an Rippen, Armen, Schenkeln und Waden – überall dort, wo ihn die Tritte der Vermummten getroffen haben. Und auch sein Hals, seine Kehle und seine Gurgel schmerzen. Bei jedem Schlucken spürt er den Schmerz, der ihn daran erinnert, wie knapp er dem Tod am Hängebaum entronnen ist.
Das Mädchen weint oft. Ihre Beine sind wund vom Präriestaub. Ihre Mutter möchte sie mit Salbe einreiben, doch sie besitzt keine. Sie redet dem Mädchen zu, versucht es auf andere Gedanken zu bringen. Doch wenn sie weitergehen, ist der Schmerz wieder da, und auch die Tränen im Gesicht der Kleinen.
Der Farmer flucht stumm in sich hinein. Während Adair Feudinger hemdsärmelig auf seiner Veranda sitzt, Rebhühner abknallt und sich von einem schwarzen Bediensteten in Livree gekühltes Bier servieren lässt, müssen der Farmer und seine Familie durch die Sonnenglast marschieren.
Es geht ums Überleben, und das zwingt ihn, seine Frau und die Kleine immer wieder mit heiseren Rufen anzutreiben. Er tut es nicht gern, denn er sieht die Not des Mädchens, und über eine gewisse Strecke trägt er sie, doch dann muss er sie wieder absetzen, denn seine Arme, die Hüften und auch der Rücken schmerzen zu sehr.
Das Mädchen steht ein paar Sekunden lang still, macht dann zwei staksige Schritte und plumpst auf den Hintern. Sie ist sechs, und das Ganze ist einfach zu viel für sie. Sie schreit, und der Farmer blickt traurig auf seine kleine Tochter hinab.
Und dann sieht er den sandfarbenen Wüstenskorpion, die Schwanzglieder mit dem schwarzen Stachel drohend erhoben, der wenige Inch neben der Hand des Mädchens über den Sand krabbelt, und er bewegt sich direkt auf die Kleine zu.
Er möchte schreien, möchte seine Tochter und auch seine Frau warnen, doch er weiß, dass es zu spät sein wird. Bis sie reagieren, bis sie hinsehen und das Tier erkennen und die Bedrohung erfassen, wird der Skorpion das Mädchen erreicht haben, und wenn sie dann eine erschrockene Bewegung macht …
Der Farmer darf gar nicht daran denken, dass der Skorpion sie stechen und sein fürchterliches Gift in ihren Arm spritzen könnte.
Kein Mensch könnte es je wieder aus ihrer Blutbahn herausholen.
Und er weiß, dass er diesen Verlust nicht auch noch ertragen könnte – nicht jetzt, und am besten überhaupt nie. Aber nicht jetzt, nachdem er das Haus und das Land und alle Tiere verloren hat.
Er wird sich nicht um seine Tochter kümmern können, hier in der Wildnis, allein, ohne Medikamente, ohne Verbandszeug, ohne alles.
Er überwindet seine Schmerzen und macht einen langen Schritt nach vorn, sein Schatten fällt auf das verunsichert hochblickende Mädchen, und dann zertritt er den Skorpion mit dem Absatz.
Es knirscht kurz und ein Geräusch entsteht, als wenn etwas platzt.
Dann ist nur noch das Knistern von Sand zu hören.
Er hebt den Fuß, und da liegt der Skorpion. Zerquetscht. Der gefährliche Giftstachel zerbrochen.
Da wird der Farmer sich bewusst, dass er überhaupt keine Schmerzen verspürt hat, als er diesen Schritt gemacht, das Bein gehoben und zugetreten hat. Die Gefahr, der Schreck und der bedingungslose Zwang zur Handlung haben allen Schmerz und alle Pein in den Hintergrund gedrängt; er hat getan, was hat getan werden müssen, um das Unheil abzuhalten.
Die Frau und das Mädchen sehen nun den zerquetschten Skorpion, und sie erschrecken. Sie wissen beide, was das bedeutet, und wie knapp die Kleine dem Tod entronnen ist.
So sollte man diese Revolvermänner auch zertreten, denkt der Farmer. Genau so sollte man sie zerbrechen und vernichten und unschädlich machen.
*
Am Abend dieses Tags erreichen sie den Wagenweg, der Fortuna mit Apache Wells verbindet. Hier fährt in Abständen von zwei Tagen eine Postkutsche. Wahrscheinlich ist sie schon durch, und es dauert lange, bis die nächste kommt.
So wenden sie sich nach Osten und müssen noch fast zwei Stunden gehen, bis sie die Pferdewechselstation erreichen. Sie sind völlig erschöpft, als sie eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit in den Hof wanken. Die Farmerin trägt das Mädchen, und der Farmer hat die Bündel genommen.
Sie wanken zur Pferdetränke und fallen vor ihr nieder, stecken die Köpfe ins Wasser, trinken gierig und spritzen sich das Nass ins Gesicht und auf das staubige Haar.
Von den Geräuschen alarmiert tritt der Stationer aus dem Haus. Er trägt einen 45er bei sich. Vielleicht glaubt er, dass Banditen gekommen sind, um ihn, seine Frau und den mexikanischen Gehilfen zu überfallen oder Pferde zu stehlen.
Als er das Ächzen und Prusten hört, tritt er langsam näher, gefolgt von dem mexikanischen Gehilfen, der einen Spencer-Karabiner bei sich trägt. Seine Frau erscheint mit einer Petroleumlampe und leuchtet den Ankömmlingen ins Gesicht. Da sehen sie den zerschundenen Farmer mit vielen Blutergüssen und Prellungen und dem dunkelroten Striemen am Hals, und sie ahnen, was vorgefallen ist.
Die Frau des Stationers drückt ihrem Mann die Lampe in die Hand und kümmert sich um die Frau, nimmt ihr das Kind ab und spricht allen gut zu. Sie fordert sie auf, in die Station zu kommen, und sagt, sie könne ihnen etwas von dem Abendessen abgeben.
Die Farmerin blickt ihren Mann fragend an, und dieser nickt.
Dann gehen sie ins Haus, und die Tür schließt sich hinter ihnen, und zum ersten Mal seit Tagen haben sie das Gefühl, dass ein ganz klein wenig Wärme und Menschlichkeit in ihre Herzen zurückgekehrt ist.
Die Frau des Stationers hat das Kommando übernommen. Die kümmert sich rührend um das Mädchen, weist den Mexikaner an, eine Kammer bereit zu machen, klappert und scheppert und hantiert in der Küche mit Töpfen und Pfannen, und bald zieht ein appetitanregender Duft durch das Haus.
Als sie sich niedersetzen, blicken der Stationer, seine Frau und der Mexikaner auf sie nieder und sehen ihnen zufrieden beim Essen zu. Die Farmersfamilie schlingt die Mahlzeit hinab; sie alle sind ausgehungert. Hinzu kommt, dass die Frau des Stationers eine ausgezeichnete Köchin ist, die ein wunderbares dickes Irish Stew zubereitet hat.
Nach dem Essen, als die Farmersfamilie ihre Gastgeber dankbar anblickt, kommt der Stationer mit einer Steingutflasche Whisky und zwei Schnapsgläsern an den Tisch und setzt sich.
Ich bin Bill Farnham, sagt er und schenkt die beiden Gläser voll. Eins schiebt er dem Farmer hin, das andere behält er selbst in der Hand.
Hildreth, sagt der Farmer, Scott Hildreth ist mein Name. Danke, Mister, ich denke, Sie haben uns das Leben gerettet.
Nennen Sie mich Bill, sagt der Stationer. Wir könnten Brüder sein. Sie sind so alt wie ich, nicht wahr? Achtunddreißig?