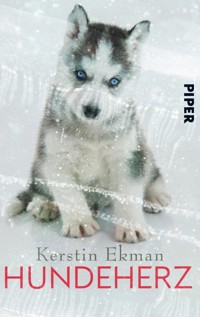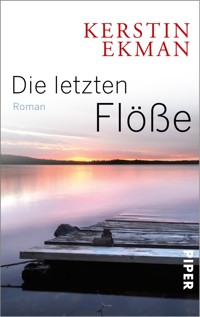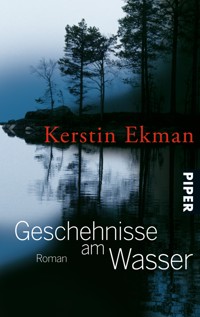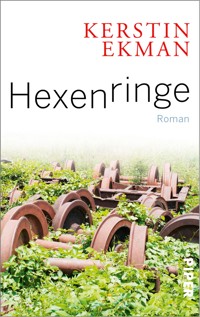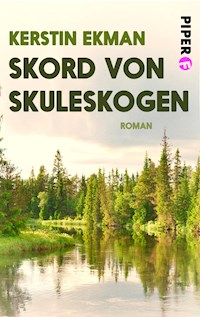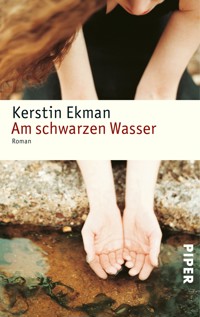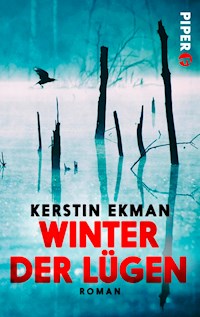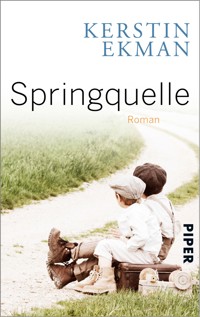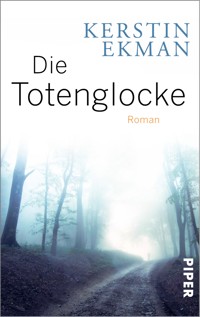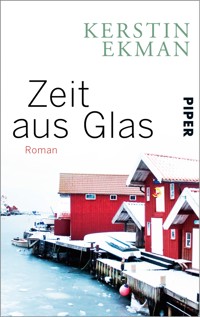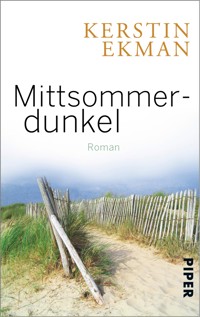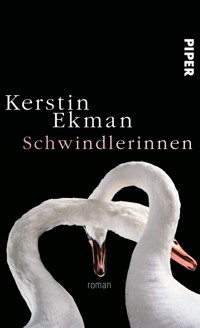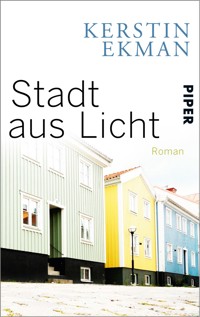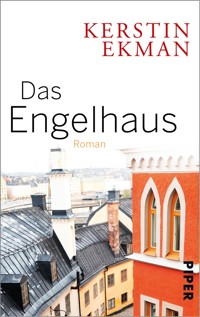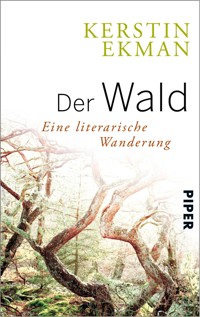
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gab eine Zeit, in der der Wald vom Atlantik bis zu den Karpaten unseren ganzen Kontinent bedeckte. Der Wald ist ein Mythos, ein Natur- und Kulturraum, der einzigartig ist, unermesslich sein Reichtum an Sagen und Geschichten. Kerstin Ekmans lebenslange Beschäftigung mit dem Wald mündet in diesem gewaltigen Werk: Sie erzählt darin von der jahrtausendealten Begegnung zwischen Mensch und Wald, schreibt von Waldgeistern, Volksmärchen, Räubern, Wölfen und Dichtern. Ihre Betrachtungen reichen vom Mittelalter bis heute, von der Urbarmachung über das Jagen bis zum Wirtschaftsraum Wald. Kerstin Ekman streift durch die Kiefernwälder ihrer nordschwedischen Heimat, erzählt von der Heilkraft der Nadelbäume und dem Reichtum von Flora und Fauna. Reich bebildert und mit zahlreichen Zitaten versehen, ist »Der Wald« ein eindrucksvolles Zeugnis einer Welt, die bald verschwunden sein wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Herrarna i skogen« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Die Übersetzung wurde vom Swedish Arts Council, Stockholm gefördert.
Czesław Miłosz wird zitiert aus: © Czesław Miłosz, Symbolische Berge und Wälder. In: ders., Visionen an der Bucht von San Francisco. Übersetzt von Sven Sellmer, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 2008.
Anton Tschechow wird zitiert aus: Anton Čechov, Onkel Vanja. Übersetzt von Peter Urban. Copyright © 1973 Diogenes Verlag AG Zürich
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-95162-3
© 2007 Kerstin Ekman Published by arrangement with Bonnier Group Agency, Stockholm. Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Dorkenwald Design, München Umschlagfoto: Thea Walstra
/
Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Vorwort
Viele Jahre habe ich in einer Waldlandschaft mit einem unendlichen Reichtum an Arten gelebt. Ich bin in ihnen umhergewandert, einen Hauch von Bittermandel und Anis als flatterige, schnell flüchtige Richtungsanzeige in der Nase, und habe schließlich die alte Salweide gefunden, aus deren rauem Stamm der sahnegelbe Wohlriechende Weidenporling sprießt. Wenn sich der Luchs in der Unruhe seiner Brunst durch den Märzschnee bewegt hatte, habe ich die Spur dieser großen Katze gesehen. Mein Hund hat auf einem Baum einen Marder aufgescheucht, und ich habe in dessen Augen aus schwarzem Glas gestarrt. In dunklen Waldseen habe ich Biber schwimmen und auf ihrem vom Wasser gestreiften Kopf die Abendsonne glänzen sehen. Ich bin Pfade gegangen, in die früher die dreißig, vierzig Pferde des Dorfes mit ihren Hufen den Sommer und die Befreiung von den Holzfuhren eingetrampelt hatten. Habe ich Multbeeren gesammelt, dann hatte nur eine Stunde vor mir der Bär an dieser Stelle gewühlt und geschmatzt. Am Rand des Moores haben Auerhahnschnäbel geknappt und Birkhähne gekollert.
Jetzt werden diese Wälder mit Wohnbäumen und Sturzbächen in Verjüngungsflächen verwandelt. Es werden Monokulturen aus Kiefern oder Fichten daraus. Und es wird still.
Ich habe in einer Welt gelebt, die im Verschwinden begriffen ist. Die Dörfer im Binnenland Nordschwedens haben seit den 1760er-Jahren, als sich die ersten Siedler dort niederließen, eine ganz eigene Waldkultur entwickelt. Heute erobern Touristen und junger Laubwald diese Gebiete. Tag und Nacht donnern Holztransporter vorbei. Sie fahren zu den Sägewerken und den Arbeitsmöglichkeiten an der Küste. Ich habe wach gelegen und dem Krach der Holzschlepper gelauscht, die Jahr für Jahr rund um die Uhr den Wald fortschaffen. Ich habe die Wolfskralle im Herzen.
Menschen bin ich in diesen Wäldern selten begegnet. Es heißt ja, wir Schweden hätten ein besonderes Verhältnis zum Wald. Verstecken wir uns darin? Oder ist es gar nicht wahr, dass er uns so sehr am Herzen liegt?
Wie sehr liegen den Deutschen ihre Wälder am Herzen? Heinrich Heines gelassener Bergmann in Die Harzreise verdient seinen Lebensunterhalt als Tourismusassistent und Wanderführer. Der Wald erschreckt aber immer noch viele, so wie einst Goethe, der sich vor der Dunkelheit fürchtete. Bei ihm wurde der Wald zu einem unheimlichen Raum, in dem tausend Augen funkelten, wenn sich die Dunkelheit von den Bergen herabsenkte.
Wir Nordeuropäer sind irgendwann alle aus dem dunklen Wald gekommen, der vom Atlantik bis zu den Karpaten den Kontinent bedeckt hat. In einem Traum von diesem Wald, der einst unsere gemeinsame Welt war, kam mir zum ersten Mal der Gedanke an dieses Buch über den Wald.
Ich habe Streifzüge durch die Literatur über den Wald unternommen, und ich habe auch buchstäblich auf einem Baumstumpf oder an einem Holzlagerplatz gesessen und gelesen. Und zwar nicht nur botanische Bestimmungsbücher. Bei starkem Nordwind, der die Mücken, Gnitzen und Kriebelmücken vertrieben hat, habe ich am Ende eines Waldsees in Jämtland gelegen und mich an Nietzsches Also sprach Zarathustra berauscht. Wie verrückt kann man eigentlich werden?
Auch diese Frage wird im vorliegenden Buch aufgegriffen. Der Wald ist ein Verwandlungsraum, in dem die Psyche der Menschen unheimlichen Veränderungen unterworfen war. Frauen sind im Wald dem Werwolf begegnet, der ihnen das Ungeborene aus dem Leib gerissen hat, Räuber haben Reisenden manchmal bis auf die nackte Haut Zölle abgenommen. Trolle haben in Höhlen und Bergen gehaust. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens gibt es ein langes und inhaltsreiches Kapitel über Waldgeister und mystische Waldwesen. Wir Nordeuropäer kennen den Schrecken vor dem Wald, teilen ihn aber nicht mit den Menschen im Süden des Kontinents. Dort herrschte lichter Laubwald vor, und man hat die Landschaft schon viel früher gerodet und kultiviert. Dabei hat man die Wesen des dunklen Waldes vertrieben.
Die Folklore und der Wald der Dichter sind in diesem Buch nur eine Seite der Geschichte. Im Wald gibt es seit sehr langer Zeit auch schon Eigentumsgrenzen, und jeder hat über seine Jagen gewacht. Schnittholz wurde immer wertvoller. Damit der Staat das Seine erhielt, wurden Gesetze und Forstordnungen erlassen. Und als am Ende des 19.Jahrhunderts im großen Stil Holz für den Export geschlagen wurde, begannen Forscher und Bürokraten wie Borkenkäfer durch die Jagen und über die Korridore der Institutionen zu wimmeln.
Der naturwüchsige Wald ist bald zu Ende. Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, was er uns gibt, und seine wilden Reste zu schützen. Wald ist mehr als eine Papierzellstoffressource und eine Energieplantage für das Wachstum. In ihm schlummern immer noch nicht verwirklichte genetische Möglichkeiten, obwohl es viele tausend Jahre her ist, seit der Felsengrund unseres Landes aus dem Eis hervorschmolz und die ersten Triebe von Kiefer, Birke und Espe einwanderten und sich zwischen Flechten und Moosen festsetzten.
Ich bin im Wald vielleicht nicht vielen Menschen begegnet. Aber es haben mich viele begleitet. Herren, die durch den nahezu undurchdringlichen Wald des Mittelalters geritten sind, und Herren, die irgendwann mit liebenswürdiger Begeisterung seine Flora systematisiert und seine Fauna mit Bärengebrüll und dem Blutdurst der Wölfe ausgemalt haben. Es gab einen Herrn, der hat den Wald in alphabetische Reihenfolge gebracht. Das war 1789. Für einen anderen war das Wort Wald abgedroschen. Er war in unserer Zeit Forsteinrichter und Professor.
Dieses Buch führt nicht geradlinig von einem Punkt zum nächsten. Seine Pfade sind verschlungen. Manchmal verlieren sie sich. Unerwartetes taucht auf, und letzten Endes muss man auch durch Hässliches und Gefährliches hindurch, das man gern umgehen würde. Wer oft in den Wald geht, wird sich zurechtfinden.
Es gibt viel Trauer im Wald, wie die Dichter wussten. Aber es gibt diese Trauer auch auf den großen Kahlschlägen und in den Monokulturen der Aufforstungen.
DER LAUBGRÜNE WALD
Dieser Reiter, 1494 von Meister Amund gemalt, ist an der Decke der Kirche von Södra Råda in Värmland zu sehen. [1]
Das Dilemma
Ein Herr reitet durch den Wald. Es ist kalt, der Atem seines Pferdes dampft. Er ist vor dem Morgengrauen unterwegs, zu einer gefährlichen Tageszeit. Vielleicht summt er, um den Mut nicht zu verlieren. Die Lieder über jene, die Sonnenaufgang und Hahnenschrei retten, sind zahllos.
Auch die Jahreszeit ist gefährlich. Winter und Frühling halten sich die Waage. Die aus dem Gras aufsteigende Feuchtigkeit fällt als Reif zurück. Im Süden wird um diese Zeit das ausgehungerte Vieh auf die Weide gelassen. Laut stößt man Namen von Heiligen aus, um alles Böse fernzuhalten, man macht Krach und entzündet Feuer gegen die Kälte und die Raubtiere. Aber vielleicht vor allem, um die Mächte dort draußen im Dunkeln auf Abstand zu halten.
Er »reitet zu Berge«. Auf Berge hätte sich »Zwerge« besser gereimt als der Tanz der Elfen. Vielleicht hieß es ursprünglich auch so. Nebelgraue Wesen wechselten oft Gestalt und Namen. Sie konnten Trolle oder Zwerge oder Elfen heißen. Sie konnten ihre Nebelhaftigkeit zu einer einzigen Gestalt vereinen. Dann war es ein Bergkönig.
Angeblich steht die erste Beschreibung von Waldangst am Anfang von Dantes Die göttliche Komödie. Doch von der Angst »im schrecklichen Walde« wurde im Norden schon sehr lange gesungen. Möglicherweise sind diese Lieder sogar älter als die Schilderung in der Komödie vom Anfang des 14.Jahrhunderts.
In dem Lied steht nichts von Herrn Olofs Angst. Sie lauert zwischen den Repliken und hinter den Gebärden. Die Bewaffnung, die der Reiter im Wald in einer Variante des Liedes hatte, ist weggefallen. Gegen das Böse, das ihn dort draußen erwartet, hilft keine Waffe. Ebenso wenig helfen ihm Mut und Wille. Es ist hell, aber das Licht, das er sieht, ist nicht das Licht der Sonne, und es wird auch kein Hahn krähen. Das Lied über Herrn Olof hat nicht einmal genug Christentum für ein bisschen Sonnenaufgangsmagie.
Dantes Pilger verirrt sich in einem dunklen Wald und findet sich wieder in einem heiligen Wald, einem laubgrünen, frühlingshaften, duftenden. Dieser Wald verwandelt sich am Ende in ein Paradies aus kristallinen Formen und Licht, in des Pilgers selva antica. Hier wird er von seiner tiefen Angst erlöst, die im Wald Gestalt angenommen hat.
Was hier, wo Herr Olof reitet, lauert, ist nicht so greifbar wie wilde Tiere. Wir dürfen nicht in eine so wohlgesetzte Allegorie wie in Dantes selva antica eintreten. Wir bewegen uns in Nebel, Kälte und Zweideutigkeit. »Ich will nicht, und es darf nicht sein«, sagt der Reiter und weist die Lockung der Waldfrau zurück. Doch es nützt ihm nichts. Seine Wirklichkeit in diesem Wald, wo das Licht vor der Morgendämmerung falsch ist, schillert. Er wendet sich von der Versuchung ab und reißt sein Pferd herum. Trotzdem endet es böse mit ihm. Ihm wird eine unsichtbare Wunde zugefügt, und als er nach Hause reitet, trägt er den Tod in sich.
Wir, die wir nach Freud leben, haben gelernt, Erlebnisse wie die von Herrn Olof als Projektionen des Innern zu interpretieren. Das Unheimliche ist in erster Linie das Heimliche, das, was in unserem Innern zu Hause ist, aber, einmal aus unserem Bewusstsein verdrängt, unheimlich geworden ist. Es erschreckt uns, wenn es in Erscheinung tritt, will es uns doch verleiten, unsere moralischen und sozialen Normen zu überschreiten.
Zu Hause angekommen, fürchtet Herr Olof anscheinend, seine Begegnung dort draußen im Wald auch nur anzudeuten. Die unheimliche Vermischung muss nicht nur abgewiesen, sie muss verschwiegen werden. Im Nebel hat das Unheimliche eine einwandfrei freudsche Gestalt: Es ist mit Tod und Trieb verbunden und hat den Körper einer Frau.
So ist noch immer unsere Lesart, obwohl Syphilis keine die Ehe und Fortpflanzung überschattende Bedrohung mehr darstellt. Man kommt sich vor wie in Thomas Manns Doktor Faustus. Dort experimentiert der Vater der Hauptperson mit osmotischem Druck und stellt eine Welt toten Wachstums her, Formen, die Leben nur imitieren, die sich aber in unheimlicher und unreiner Weise vermehren und miteinander vermischen.
Sind Herrn Olofs Gesichte im Wald von gleicher Art? Die Imitationen entstehen aus fein verteiltem Wasser, aus Tropfen, Dunst und kaltem Dampf. Ihre Gesichter und Körper entwickeln sich wie die Blumen unter dem osmotischen Druck. Das offene Haar – ein Nebelschleier. Aufsteigender Tau, der zu frostigem Flaum erstarrt. Wurmfarn und Rosen aus Eiskristallen, wie man sie auf Glasscheiben sehen kann. Augen aus Eis. Herr Olof befindet sich zwischen dem sündigen Stand der Ledigen und dem der Ehe. Bald wird er seine Braut heiraten und das Geschlecht fortpflanzen. Und an dieser Grenze droht ihm durch Überschreitung und Vermischung der Tod.
Eine solche Interpretation sagt nichts über eine andere Zeit als Freuds aus, die in gewisser Weise ja noch die unsere ist. Der junge Herr des Hochmittelalters brauchte seine Sexualität weder vor noch nach der Hochzeit zu zügeln. Er hatte jedoch eine Schwäche für ritterliche Formen. Seine Welt war hierarchisch. Nicht einmal dort draußen, wo, wie wir behaupten würden, das Chaos herrscht, findet er etwas anderes als eine Spiegelwelt. Sie ist schillernd und veränderlich, denn sie entsteht aus Tau und Reif, doch es gibt dort einen Hof mit König und Königstochter. Ihrem höfischen Auftreten widerspricht nur das offene Haar, das Kennzeichen einer promiskuitiven Frau. Die Tochter des Elfenkönigs streckt sich nach dem jungen Herrn und bittet ihn zum Tanz. Soeben hat sie noch mit des Königs Elfeneidam getanzt, der in dieser gespiegelten Welt ihr Gatte sein muss. Das Lied gibt einen Tanz im Tanz wieder, eine Präsentation ritterlicher Gebärden, die in der langsam schreitenden Form des Balladentanzes außerordentlich dankbar zu gestalten gewesen sein mussten. So lebte es denn auch bis tief ins 17.Jahrhundert fort, als es schließlich aufgezeichnet wurde. Da war es jedoch zur Unterhaltung auf bäuerlichen Festen abgesunken. Der Adel hatte sein Ritterideal aufgegeben, für das er bis weit in die Zeit der Hakenbüchse und selbst der Muskete hinein Turniere und höfische Tänze gepflegt hatte.
In Herbst des Mittelalters beschreibt der holländische Historiker Johan Huizinga, wie die Geschichtsschreiber versuchten, ihre wirre Zeit mithilfe des Rittergedankens zu verstehen. Aber sie erreichten keine Stimmigkeit. Die von der Norm der Ritterlichkeit beherrschten Fürsten verirrten sich »im dunklen Wald der Zeit«, wie Barbara Tuchman in ihrem Buch über das 14.Jahrhundert, Der ferne Spiegel, schreibt. Sie schildert vor allem das Schicksal und Wüten eines brutalen und wahrscheinlich verrückten Machtmenschen. Huizinga erzählt, wie die ritterlich inspirierte Liebe in brutaler Vergewaltigung und schweren Misshandlungen enden konnte.
Nein, die Chronisten erreichten keine Stimmigkeit. Aber sie hielten am Ritterkodex fest: Treue, Tapferkeit und die Sehnsucht nach einem schöneren Leben schwebten ihren Helden vor, wenn sie sich durch das Dunkel und den Tumult ihrer Wirklichkeit bewegten. Anders konnten sie aus der Geschichte keinen Sinn herauslesen; sie machten sie erträglich, indem sie über das Durcheinander, über Gestank und Geschrei diese einfachen und angenehmen Muster breiteten.
Vielleicht breitet das Lied über Herrn Olof ja ebenso das Muster einer Ritterlichkeit über eine unbegreifliche und gefährliche Welterfahrung. Entschlossen und tapfer begibt sich Herr Olof in eine Wirklichkeit, die unmöglich zu meistern ist. Was immer er tut, der Ausgang ist fatal. Nimmt er die Einladung der Elfe an, ist er als christliche Seele verloren. Er lehnt ab und reißt sein Pferd herum. Diese schöne und kraftvolle Handlungsweise nützt ihm jedoch nichts. Er wird nun sterben, und er weiß es. Seine letzten Stunden verlaufen nach einem ebenso formstrengen Schema. Er klagt niemanden an, sondern gibt einem Reitunfall die Schuld an seinem Schicksal. Ohne zu erzählen, was geschehen ist, teilt er seinen Nächsten die den Riten des Sterbelagers gemäßen Aufgaben zu. Er gestaltet sein Vorgehen zeremoniös und so ästhetisch, wie Zeit und Ritterideal es erfordern: Er lässt sein Pferd auf die Weide führen, er lässt sich das Bett herrichten und das Haar bürsten. Er ist bereit, und sein Tun vermittelt die schöne Illusion, dass er sich in ein sinnvolles, wenn auch tragisches Schicksal gefügt hat.
Die Treue zum Ideal, zur Zeremonie des Sterbens, wurde vom Schrecken und von der Verwirrung keineswegs zunichte gemacht. Das Mittelalter kennt zahllose Darstellungen vom Schrecken des Todes. Die wurmstichige Leiche mit ihrem verwesenden, in Fetzen abfallenden Fleisch ersteht immer wieder auf, um die Gesunden und Rotwangigen, die da liebten und jagten und musizierten und sich nach der ritterlichen Mode kleideten, in Todesangst zu versetzen. Dieser Schrecken setzte jedoch nicht die Forderung nach der Form außer Kraft. Olaus Magnus beschreibt in Historien der mittnächtigen Länder, wie Priester mit sakralen Geräten in einem Sack durch Wälder und Morast ritten, um Sterbenden mit den feststehenden nötigen Worten die letzte Ölung zu bringen. Herr Olof erfüllte angesichts des Todes die strengsten Ideale seiner Zeit. Eine kraftvolle Formel, um zu überleben, bieten sie ihm nicht. Aber sie helfen ihm, in schöner Weise auf dem Tanzboden zu sterben.
Als das Tanzlied von Herrn Olof und den Elfen im 17.Jahrhundert in einem Liederbuch aufgezeichnet wurde, führte man den Tanz in den Rittersälen der dunklen, steinernen Burgen nicht mehr auf. Es wurde langsam zum Volkslied. Vielleicht fanden die Gebildeten es allmählich naiv. Das Formschema des Rittergedankens sollte jedoch noch lange weiterleben. Ende des vorvorigen Jahrhunderts ging Wyatt Earp mit der gleichen Entschlossenheit wie Herr Olof hinaus, um sich in einer Viehhürde in sein Schicksal zu ergeben. Nach der Legende, die er selbst ausgeformt hatte, war er bereit, schön und formvollendet zu sterben. Woran er tatsächlich starb, ist nicht ganz geklärt. Aber ein späterer Präsident hätte es wohl a noble cause genannt. Ronald Reagan, der selbst solche Heldenrollen im Film gespielt hatte, verwendete die Terminologie der Ritterlichkeit, um den Krieg der USA in Vietnam zu idealisieren. Dieser Krieg war, wie jeder Krieg, auch für den Angreifer erniedrigend und destruktiv. Natürlich machten die raubgierigen Fürsten des 14.Jahrhunderts nichts anderes. Und die Geschichtsschreiber versuchten, wie Huizinga sagt, der Sache Sinn zu verleihen. Sie wollten eine edle Absicht darin erkennen. Doch damit sind wir von der einfachen und kraftvollen Handlung in den Strophen über Herrn Olof schon weit entfernt. Dort scheint die Ritterlichkeit weder ein menschliches Ziel zu verbergen noch es herauszustreichen. Es gibt keine Absicht, keinen Sinn.
Denn was für einen Sinn hat es schon, wenn ein unbescholtener Mann mit einer tödlichen Krankheit geschlagen wird? Das eigentliche Thema des Tanzliedes ist doch die Unbegreiflichkeit von Herrn Olofs Schicksal. Er kehrt von seinem Ritt in den Wald zurück und legt sich aufs Sterbebett, um uns wissen zu lassen, dass dort draußen eine andere Ordnung herrscht. Er ist Kräften anheimgefallen, die außerhalb des Herrschaftsbereichs seines Willens liegen, außerhalb der Reichweite seines Glaubens und außerhalb seiner Zivilisation.
Offiziell gab es in Herrn Olofs Welt keinen Herrschaftsbereich, in dem nicht die göttliche Ordnung galt. Was wir das Verdrängte nennen würden, das, was eigentlich nicht ausgesprochen werden kann, wurde in den theologisch untadeligen und hochliterarischen Genres nicht behandelt. Ein Leiden, das weder Sinn noch Ursache hatte, ließ sich nur in niedrigen Genres gestalten. In einem Märchen oder einem Tanzlied, in Verkehrte-Welt-Gedichten oder Schauergeschichten durften bei einem ritterlichen und gottesfürchtigen Helden Zufälle wirken und formlose Kräfte walten. Wir können nicht mehr wissen, was dort draußen in der halb formlosen Spiegelwelt des Waldes, die so falsch war wie das Wasser, aus dem sie entstand, seine Heimstatt hatte und was man so sehr fürchtete. Wir können nur ahnen, dass es mit Auflösung zu tun hatte, mit den Grenzen der Zivilisation und dem menschlichen Gebäude aus Glauben, Sitte und Gesetz.
Herr Olof reitet in den Wald und gerät in ein Dilemma.
Der Versuch, dem Wald Herr zu werden, war Zivilisation. Es war a noble cause, damals und noch lange Zeit danach. In dem Lied über Herrn Olof spiegelt sich jedoch nicht dieser Kampf, sondern etwas anderes – das Dilemma an sich.
Des Menschen Natur sind Instinkte. Das heißt vorbereitet sein auf das, was einem begegnet. Programmiert. Eingestellt. Ein Hase weiß das, ohne es zu wissen. Ein Fuchs ebenso. Es kann mit dem Hasen böse enden und mit dem Fuchs auch, aber dem geht kein Dilemma voraus. Hier erwacht ein Bewusstsein, das sagt: Was immer wir tun, es kann das Falsche sein.
Kultur ist Dilemma. Herr Olof reitet geradewegs hinein.
Der Zweig, der nicht abgebrochen werden darf
Das Gefährliche, das dem Menschen an einer Grenze begegnen kann, ist in der Ballade von Herrn Olof und den Elfen als unsichtbare Verletzung gestaltet. Diese unerklärliche Wunde ist das Thema des Liedes. Das Einzige, was die Tragik und den unausgesprochenen Schmerz aufwiegt, ist das letzte Glied des Kehrreims: »Herr Olof kehrt heim, als das Laub grünt im Walde.«
Mit der Zeit hat es in dem Lied etwas Sonderbares auf sich. Herrn Olofs Ritt vor dem Morgengrauen kann nicht viele Stunden gedauert haben. Trotzdem hat, als er nach Hause kommt, die Jahreszeit gewechselt. Den menschlichen Ablauf, der sich in dem Lied in frühen Morgenstunden und weniger als einem Tagesritt bemisst, hat ein zyklischer und langsamer voranschreitender überlagert. Die chronologische Zeit der Strophen wird von der mythologischen des Kehrreims überschattet. Der Wald, der sich belaubt und belebt, steht antithetisch zum Frost der ersten Kehrreimzeile: »fällt der Tau, legt sich Reif«. Winter steht gegen Sommer. Herr Olof kehrt am Ende heim. Es wird Sommer werden. Das wird schon in der ersten Strophe versprochen.
Der Kehrreim kann etwas enthalten, was auf eine sehr viel ältere Vorstellungswelt verweist, auf vorchristliche Vorstellungen über Leben durch Tod. Vielleicht hat sich der Rittergedanke über einen anderen und älteren Gedanken gelegt, mit dem man nicht mehr vertraut ist.
Wird der Wald deshalb wieder grün, weil Herr Olof stirbt?
Opfer und Versöhnung sind Thema der Vegetationsmythen. Dumuzi, der anmutige Hirte des sumerischen Mythos, den Innana geliebt und für den sie ihren Körper geschmückt hat, musste geopfert werden, als sie ihre dunkle Schwester Ereshkigal in der Unterwelt besucht. Der Umbruch wird oft durch einen Irrtum oder ein Verbrechen herbeigeführt. Ursache für Kores Gefangenschaft im dunklen Hades während des Winterhalbjahrs ist ihr blutiger Biss in den Granatapfel.
Junge Männer mit Laub im Haar kommen aus dem Wald geritten. Sie halten belaubte Zweige in Händen. Sie könnten auch von Kopf bis Fuß mit Laub bekleidet sein. Lange Zeit nannte man solche jungen Männer Maigrafen. Les Très Riches Heures du Duc de Berry, ein mit Miniaturen illuminierter Jahreskalender und zugleich Gebetbuch vom Beginn des 15.Jahrhunderts, zeigt den Herzog mit seinem Hofstaat in einem zeremoniellen Maiaufzug. Alle tragen Laub im Haar und an den Kleidern: Hofdamen, Musikanten, Pferde. Am erlesensten ist die kleine Herzogin. Ihr weißes Kopftuch ist anmutig mit Laub bestreut. Es handelt sich natürlich um einen Mairitt auf sehr hohem Niveau. Doch Maizweige zu brechen, Maibäume und Maistangen zu schmücken, den Maigrafen, der aus dem Wald kommt, zu grüßen waren Frühlingsvergnügen, denen sich die Bauern Europas schon so lange widmeten, dass diese Aufzüge sich in einer Vergangenheit verlieren, in der die laubgeschmückten Wagen der Fruchtbarkeitsgottheiten über die Felder gezogen wurden. »Die Maie ist eine der einfachen Grundformen der Religion, die bei allen Völkern anzutreffen sind«, schreibt der Kenner der klassischen Vorzeit Martin P.Nilsson.
Der Monat Mai in Les Très Riches Heures du Duc de Berry zeigt den Festzug zum Wald. Die Malereien des Stundenbuchs stammen von einem der Brüder Limbourg. [2]
War Olafur Liljukrans, wie Herr Olof in der norwegischen Variante des Liedes heißt, oder Ólafur Liljurós aus der isländischen einst ein bekränzter Vegetationskönig, der sterben musste, damit die Erde wieder grünte?
Jedenfalls ist mit ihm, wie es sich bei einem religiösen oder magischen Abenteuer gehört, ein Geheimnis verbunden. Er lügt nachgerade, was die nicht stattgefundene Hochzeit im Wald betrifft. Möchte sie nicht einmal andeutungsweise erwähnen. Stattdessen schiebt er seine unsichtbare tödliche Verletzung auf einen Ast.
Ich war lahm und mein Fohlen in Hast
Ich stieß gegen einen Eichenast
In einem Almanach aus dem Jahr 1399 ist der Monat Mai als Mann mit belaubtem Zweig in den Händen dargestellt. In der Einleitung zu James G.Frazers Ende des vorvorigen Jahrhunderts vorgenommenen Großinventur von Religion und Magie, Der goldene Zweig, schleicht eine finstere Gestalt durch den heiligen Wald von Nemi, wo kein Zweig berührt werden darf. Er hat einen Ast abgebrochen, hält ihn nun in der Hand und trachtet danach, Dianas Priester zu erschlagen und seinen Platz einzunehmen. Die Opferung des Priesters und das Abbrechen des Astes vom heiligen Baum sind die Voraussetzung dafür, dass der Wald ein sakraler Ort bleibt. Hat Herr Olof, lange bevor er seinen Namen und seine mondäne Rittergestalt erhielt, einen Ast abgebrochen, der abgebrochen werden durfte – allerdings nur von der richtigen Person?
An dieser Stelle sollte ich meine Spekulationen vielleicht bremsen. Mir fällt MrCasaubon in George Eliots Middlemarch ein. Er ist ein pedantischer Herr mit ungewöhnlich tiefen Augenhöhlen. Der unmessbaren Tiefe seines Wesens ist der Gedanke entstiegen, er müsse beweisen, dass alle mythischen Gestalten und alle auf der ganzen Welt verstreuten Mythenfragmente Entstellungen einer ursprünglich klaren Tradition seien. Ein einziger Mythos also. Er plant, dabei viel gründlicher und effektiver vorzugehen als frühere Forscher mit denselben Konzepten und Ambitionen. Der arme MrCasaubon verirrt sich jedoch in den Rumpelkammern und auf den verschlungenen Treppen seiner Gelehrtheit und verliert sein Ziel aus den Augen, das ihn einst zu diesen Mühen getrieben hat. Außerdem langweilt er seine hingebungsvolle junge Frau bis an die Grenze seelischer Grausamkeit.
Ein einziger Mythos, ein einsames Talglicht, das blakend erlischt. MrsEliot ist Beherrschern gegenüber unbarmherzig.
Alles, was wir wissen, ist, dass die Erneuerung in Gestalt eines bekränzten jungen Mannes mit einem belaubten Zweig in der Hand aus dem Wald geritten kommt.
Verdure
Die schwedischen Renaissancemenschen lebten in unmittelbarer Nähe des Waldes und waren so vernarrt in mittelalterliche Lieder von Abenteuern wie das von Herrn Olof, dass sie auch neue dichteten. Mitunter haben diese Pastiches die Forscher in die Irre geführt. Das Lied von Herrn Olof und den Elfen ist aber wirklich sehr alt; die Spur des jungen Mannes, der ausreitet und eine fatale Begegnung mit einer Elfe hat, lässt sich bis ins 12.Jahrhundert zurückverfolgen. In Europa gibt es vielerorts und in mehreren hundert Varianten Lieder über ihn. Der mittelhochdeutschen Versnovelle Peter von Staufenberg von 1310, in der es heißt, der Reiter habe keine Wunde, trage jedoch den Tod in der Seele, soll sogar eine historische Begebenheit zugrunde liegen.
Auf dem Kontinent ist der Wald der Liebesbegegnung laubreich und mild. Dort reiten in den Balladen junge Männer aus, um unter Ulmen Nymphen oder irdische Frauen zu lieben. Sub ulmo patula, unter der ausladenden Krone der Ulme, kommt man in den Carmina Burana der Vaganten aus dem 12. und 13.Jahrhundert zusammen. Es wehen laue Frühlingslüftchen, Bäche rauschen, das Laub ist frisch und grün und das Gras mit duftendem Thymian durchsetzt. Die Mädchen tragen Blumenkränze, die sie der Liebesgöttin als Frühlingsopfer darbringen. Und zur selben Zeit liebt sich Walther von der Vogelweides Paar unter schattigen Lindenkronen. Unter ihnen werden die Blumen und das Gras gebrochen, und im Wald singt die Nachtigall.
Under der linden
an der heide,
dâ unser zweier bette was,
dâ mugt ir vinden
schône beide
gebrochen bluomen unde gras.
vor dem walde in einem tal,
tandaradei,
schône sanc diu nahtegal
Östlich des Rheins soll der in den Liedern rauschende Liebesbaum nicht die Ulme, sondern die Linde gewesen sein. In den nordischen Balladen finden sich Eiche und Hasel, doch beherrscht wird der gedichtete Wald von der Linde mit ihrem alliterierenden Laub und ihren vielen Lebens- und Liebesmythen. Tastete ein Vorsänger in dem reichhaltigen Formelvorrat, der ihm zur Verfügung stand, suchend nach Waldesgrün, wählte er fast immer die Linde mit ihren herzförmigen Blättern. Das Gefühl für Zeichen und Bildsymbole in der Natur war im Mittelalter stark ausgeprägt. Auch ein nordisches Schäferstündchen kann unter der Linde vorgeschlagen werden, obschon schüchtern und umschreibend: »So lass uns unter der kleinen grünen Linde ruhen …«
Der Wald der Balladen ist licht mit Rosen und Lilien bewachsen. Nicht der Wald wird beschrieben, sondern eine Waldstimmung. Im 14.Jahrhundert ging jedoch mancher Denker und Autor in den realen Wald. Es gab Mönche, die keine geometrischen Kristall- und Lichtvisionen vom Paradies mehr hatten. Sie wurden Eremiten und ließen im Geiste Franziskus’ das Grün und die Tiere in Gottes Welt ein. Auch Meister Eckehart hatte geahnt, dass in der kreatürlichen Welt mit ihrem grünen Wirrwarr, und sei es nur schwach, das Licht Gottes aufscheinen konnte. Was der englische Franziskaner William Occam predigte, glich einer Verteidigung sinnenhafter Zeugnisse. Im Papstpalast von Avignon, wo er 1324 wegen seiner Ketzereien verhört wurde, entstanden nur wenige Jahrzehnte später Wandmalereien mit Eichhörnchen und kleinen Vögeln zwischen Eichenästen und Weinlaubranken. Im Garderobenturm des Papstpalastes verdichteten sich die Laubranken, Baumkronen und der Kräuterreichtum zu einem Wald.
Die Darstellung des Waldes erfuhr ihre Fortsetzung auf den gewebten, farbenreichen Wolltapisserien, die wir mal als Gobelins, mal als Tapeten bezeichnet haben. Ihr Grün ist meistens bläulich, was mit dem blauen Wald der Balladen übereinzustimmen scheint. Doch ist der grüne Farbstoff in der Wolle der Tapisserie nur zu Blau verblichen, und im Altschwedischen war der blaue Wald in Wirklichkeit schwarz.
In dem blauenden Grün wachsen Blumen mit zierlichen Stängeln und verschiedenfarbigen Blütenblättern. Obwohl es in diesem Millefleurs unzählige davon gibt, stehen sie licht und verheddern sich nicht ineinander. Der Fond ist gemustert wie die prächtigen Kleiderstoffe der Dame mit dem Einhorn, diesen sechs Wandteppichen aus dem 15. Jahrhundert im Clunymuseum in Paris. Es geht eher um Auswahl und Ordnung, um eine Schlossparklandschaft oder ein fürstliches Jagdrevier als um einen Wald. Trotzdem finden sich hier die Eichen und Stechpalmen des Edellaubwalds, auf Lustgartenformat reduziert und üppig mit Eicheln und Beerenpyramiden besetzt. Da sind Pinien mit langen weichen Nadeln und großen Zapfen. Im Grün rings um die Bäume kauern alte und junge Hasen. Und da sind Füchse und Ziegen, Elstern und Fasane und vieles andere, was alltäglich im Wald hinter dem Schloss und den Bauernhöfen hüpfte und flog. Der Künstler, der die Skizzen zu den Tapisserien angefertigt hat, sah tatsächlich Wald und Wiesen vor seinem Fenster. Stiefmütterchen, Maiglöckchen, Schlüsselblumen, Margeriten und Gänseblümchen sind getreu wiedergegeben. Millefleurs ist indes eine Technik, bei der die Fantasie durchgeht. In dieser blauen oder roten Grasdecke finden sich viele Blumen, die der Herrgott noch gar nicht erfunden hat. Es ist zugleich die Parklandschaft eines großen Schlossherrn: Hunde und Löwen mit juwelenbesetzten Halsbändern, ein angeketteter Affe und der Jagdfalke auf einer behandschuhten Hand zeigen, dass kostspielige Launen und Neigungen befriedigt werden konnten. Der Orangenbaum, der blüht und gleichzeitig Früchte trägt, kann durch die Fantasie dorthin verpflanzt worden sein, vielleicht auf fürstlichen Befehl. Denn zu jener Zeit muss er ein Traum in einer kalten Wirklichkeit gewesen sein, hatte im 14.Jahrhundert doch die kleine Eiszeit eingesetzt, die vierhundert Jahre dauern sollte. Zweimal fror zu Beginn des Jahrhunderts die Ostsee zu. Vielleicht ist das Grün der Tapisserien auch eine Erinnerung an eine bessere Welt als dieses nun kalte, von Kriegen verwüstete und von der Pest heimgesuchte Europa des 14.Jahrhunderts. Als die Webereien im Loiretal die Blumenteppiche herstellten und es auf den Hautelissestühlen in Arras, Brüssel und Paris am schönsten grünte, war das Leben in der Kälte ziemlich rau geworden. Und fiel der Tau, legte sich der Reif auch auf die lieblichsten grünen Flusstäler.
Dieser junge Hase sitzt inmitten der Blumen um »Die Dame mit dem Einhorn«. [3]
Im Norden war es natürlich noch schlimmer: Die norwegischen Ansiedlungen auf Grönland waren ausgestorben, und auf Island ließ sich kein Getreide mehr anbauen.
Der natürliche Wirrwarr wird in der frostfreien Welt der Tapisserien zu einem Muster geordnet. Die Bäume tragen Blüten und Früchte, die weder abfallen noch faulen. Die Blumen prangen aus einer noch unzersetzten Streuschicht, der Förna. Die Jagdhunde sitzen manierlich und haben kein blutiges Maul. Nicht Nützlichkeit bietet der zurechtgestutzte Wald dar, sondern Schönheit.
Dies ist die eigentliche Botschaft der Tapisserien, davon erzählen ihre grünen Baumkronen und ihr Blumenreichtum: von einem schönen Leben in einem schönen Wald.
Fürstliche Jäger, Götter aus den alten griechischen Sagen, wilde Männer und Könige erschienen schon lange auf dicken, gewebten Tapisserien, mit denen die Adligen von Burg zu Burg umzogen. Die Teppiche wurden in steinernen Sälen aufgehängt, manchmal mit Abstand zur Wand, um dem einen oder anderen Polonius Raum zu lassen. Zu Beginn der Renaissance gab es dann Werkstätten, die sich ganz auf das Grün des Waldes, frei von menschlichen oder gottähnlichen Wesen, spezialisierten. Bei ihnen schimmerten aus den schweren Laubmassen mit ihren verwickelten Schattierungen und Farbspielen allenfalls Vögel hervor. Es war eine grüne Welt ohne sichtbare Grenze, ein alles überschattender Laubreichtum, den Webereien wie die in Oudenaarde herstellten. Diese Verdure schien sich als Motiv selbst zu genügen. Von dieser grünen Waldwelt umgeben in einer steinernen Burg zu sitzen muss wie der Einzug in eine kollektive Erinnerung und das Wiedererstehen einer Zeit gewesen sein, als die Welt Wald war.
Weintraubenkerne
Außerhalb Katrineholms, wo ich aufgewachsen bin, bestand die Welt vor viereinhalbtausend Jahren aus Meer und rauschendem Laubwald. Als Kind wusste ich das nicht. Wenn wir mit der Schule einen Ausflug zu der Ausgrabungsstätte von Mogetorp machten, bemitleidete ich die Menschen, die auf einer lichten Kiefernheide mit magerer Vegetation auf dem Erdboden leben mussten. Niemand hielt sie für gutmütig und unkriegerisch. Die Steinzeitmenschen, lernten wir, seien Wilde gewesen, die einander mit Steinkeulen bekämpften, ausladende zottige Mähnen hatten und ungegerbte Häute mit der Haarseite nach außen trugen. Zusammen mit unserem Lehrer, Herrn Tjäder, sann unsere Klasse über die Steine der Siedlungsstätte nach, und wir ahnten nicht, dass die Mogetorpsleute die gleiche Intelligenz und das gleiche Potenzial an Erfindungsvermögen und künstlerischer Kraft besessen hatten wie wir. Wir bohrten unbekümmert in der Nase und hielten uns für die Krone der Evolution. Über den Wald der Mogetorpsleute wussten wir nichts. Wir konnten nicht erfahren, welche Kenntnisse sie vom Holz hatten, mit welcher Sorgfalt sie die richtigen Sorten für ihre Bögen, Pfeile und Axtstiele wählten. Erst Ötzi, der Mann aus dem Eis, in dessen Köcher Pfeile aus Rotem Hartriegel steckten, sollte uns einen winzigen Einblick in diese Welt geben. Doch dieser Fund wurde erst in den 1990er-Jahren gemacht.
Die Frauen, die Tonwülste übereinanderlegten und sie zu Krügen aufbauten, hatten Zopffrisuren, in die Stein- und Knochenperlen eingeflochten waren. Sie bereiteten Häute und fertigten Schnüre, Kordeln und Netze. Unter den Funden dominieren Hautschaber, weshalb man annimmt, dass ein Großteil ihrer Zeit mit dem Schaben von Häuten draufging. Sie nähten daraus Kleidungsstücke, und sie stellten Schuhe her.
Als Ötzi erfroren und gut erhalten gefunden wurde, trug er einen Mantel, der in einem verwickelten Muster aus Fellstreifen genäht war, und darüber einen Regenumhang aus geflochtenem Gras. Um die Taille hatte er einen Lendenschurz. Er trug genähte lederne Beinkleider, und seine Schuhe waren aus zwei Lederschichten gefertigt, zwischen die trockenes, isolierendes Gras gestopft war. Ein Birkenporling diente ihm als Medizin oder als Schutz der Schneiden seiner Werkzeuge. Der Mann hatte ordentlich geschnittenes Haar, war rasiert und trug eine Bärenfellmütze, die Eindruck gemacht haben musste. Sein Körper ist 5300Jahre alt.
Die Mogetorpsleute lebten mehrere Jahrhunderte später als er und gehörten der Vråkultur an, die nach der Fundstelle in Stora Malm nahe Katrineholm so benannt wurde. Diese Menschen wohnten auf einer lang gestreckten Insel in den Schären. Sie waren Bauern und düngten ihre Äcker mit Tang. Das Meer, das an ihre Ufer brandete und die Krugscherben schliff, die wir von ihnen gefunden haben, nennen wir Litorinameer. Sie hielten Vieh auf der Weide und fütterten es zudem mit Laubheu aus dem Jungwuchs, der nach der Brandrodung aufgeschossen war. Diese Schärenbauern stammten von jenem Trichterbechervolk ab, das reich dekorierte Tongefäße mit großzügigen Rändern herstellte. Aus Abdrücken von Schnüren und Getreidekörnern ließen sich fortlaufende Muster bilden. Die Auswanderer hatten sich gar nicht mit Kiefern und kargem Tonsand begnügen müssen. Das ging mir in der Bibliothek von Katrineholm auf. Da gab es ein kleines Heft über die Vråkultur. Geschrieben hatte es Sten Florin, und es beinhaltete viele graue Bildchen von Tonscherben. Auf diesen Scherben waren Abdrücke von Getreidekörnern zu sehen. Aber auch noch andere. Kleine gespaltene Matrixfiguren. Sie sahen wie Bildzeichen aus. Eigentlich aber wie Weintraubenkerne.
War das möglich?
Als vor sechstausend Jahren die Töpferinnen der Vråkultur Gefäße mit Trichterbecherrändern herstellten, blieben im Ton Weintraubenkerne haften. [4]
Am Ende des Atlantikums war in dem Edellaubwald, der die Welt dieser Menschen bildete, fast alles möglich. War die Erde leicht, wuchsen dort Linden und Eichen, war sie schwerer, Ulmen und Eschen. Die Kiefer wuchs weiter nördlich als heutzutage. In diesem großen Laubraum gab es Buchen, Hainbuchen, Stechpalmen, Haseln und Roten Hartriegel. Wilde Weinranken und Efeu wanden sich um die Stämme, und auf den Bäumen wuchsen Misteln. In den Brüchen an den Flussufern erhob sich der Traubenfarn, dieses große, auch Königsfarn genannte Kraut.
Hier ein langes Zitat aus dem Kapitel »Die Lauburwälder der Warmzeit« in Sten Selanders Det levande landskapet i Sverige (Die lebendige Landschaft Schwedens). Er besaß ausreichend Kenntnisse, um diesen wohl am ehesten südschwedischen Wald, die Ursprungswelt des Trichterbechervolks, glaubwürdig wiedererstehen zu lassen.
Wir wissen, dass ein Urwald aus Laubbäumen über viele Meilen die Ebenen in eine große, strotzende Decke hüllte, die nur vom Kiefernwald auf Kiesrücken und Sandheiden, von den braunen Schneidriedfeldern der Moore und von den Seebecken mit ihrem Kranz aus Erlenbrüchen und Weidengestrüpp unterbrochen wurde. Und wir wissen, dass dieser Wald sumpfiger, dunkler und unwegsamer war als ein heutiger und voll stickig beißender Dämpfe, die dem Schlamm und dem modernden Holz aus Verhauen und umgestürzten Stämmen entstiegen.
Wir können aus dem grünen Chaos der verschwundenen Landschaft auch Einzelheiten heraufbeschwören. Altersschwache Eichen wurden unter schweren, zottigen Efeuknäueln erstickt, in Lindenkronen verbargen sich Misteln, und wo eine Baumruine eingestürzt war, sprossen die Schösslinge aus dem Boden und wetteiferten mit zottigem dichtem Buschwerk um den Platz. Wildschweine wühlten im Humus nach Eicheln und Wurzeln. Kilometerlange Teppiche aus Frühlingsblumen schimmerten im Spiel der Sonne unter den Haselsträuchern, und im Sommer lugten blasse Orchideen aus dem grünen Schatten hervor. In der lauwarmen Gyttja der Waldtümpel krochen die Sumpfschildkröten umher. Mannshohe Farne und Riesenerlen auf hohen Sockeln spiegelten sich in schwarzem, unbeweglichem Wasser, und wenn Wisente und Auerochsen durch den Sumpfwald plumpsten, krachte es in den Windbrüchen. An den trägen Flüssen ragten Biberdämme auf, Reiherkolonien weißten ihre Wohnbäume an den Seeufern, und die Odinsschwalbe, der Schwarzstorch, segelte über die Baumwipfel hin.
Wir wissen, schreibt Selander. Wir wissen, welche Laubbäume in der dunklen, zum Himmel hin verschlossenen Welt der Auerochsen rauschten. Die Pollendiagramme von Seegründen machen es möglich, in späterer Zeit das Wachsen und Verrotten dieser Wälder aus einer Ära milden Meeresklimas abzulesen. Aber auch die Abdrücke des Zufalls im nassen Ton rings um die Arbeitsplätze der Töpferinnen lassen sich ablesen. Die Tonscherben, die 1935 bei der Ausgrabung des Vråfunds so große Aufregung hervorriefen, wurden einem berühmten Paläobotaniker in Innsbruck geschickt. Er antwortete binnen einer Woche: Über jeden Zweifel erhaben handle es sich um Abdrücke von Kernen der vitis vinifera ssp. silvestris – der Wilden Weinrebe. 1938 fand man auch bei Mogetorp Abdrücke von Kernen der Wilden Weinrebe.
Die Botschaft dieser Weintraubenkerne war so stark, dass sie mich in Gedanken begleitete, als ich mit dem Dackel durchs Schneegestöber von der Bibliothek nach Hause stiefelte. Sie folgte mir auch in Träume, die immer wiederkehren sollten.
Flugträume haben vielleicht alle Menschen. Mein Traum war, dass ich ohne Flügel in der Dämmerung über einen grenzenlosen Wald glitt. Unter mir wogte ein Boden aus Laubkronen. Es war das Dach der Welt, und in seltenen Öffnungen konnte ich Wasserspiegel und Feuer schimmern sehen.
Der Traum hörte auf. Doch hin und wieder hatte ich das Glück, kurz vor dem Einschlafen den Wald erneut von oben zu sehen. Ich sah die Baumkronen und Funken von Feuern unter mir. Wasser glänzte, und ich nahm deutlich Rauchgeruch wahr. Erscheinungen dieser Art (hypnagoge Halluzinationen) gehen oft mit starken Sinnesempfindungen einher. Es war also nichts Absonderliches, dass ich den Rauch der Feuer roch. Falls nicht alles absonderlich ist. Ich war jedes Mal dankbar, wenn die Erscheinung wiederkam, und ein paarmal durften fiktive Figuren sie übernehmen.
Der Waldtraum sagte mir aber vor allem eines: Die Umstände, in denen du lebst, sind äußerst zufällig. Starke Kräfte sind dabei, die Welt umzugestalten.
Mein armes Trichterbechervolk von Mogetorp musste aufbrechen. Es wurde zu kalt in ihrem Wald, die Ernten auf ihren kleinen Äckern fielen zu schlecht aus. Die Umgestaltung ging ganz, ganz langsam vonstatten. Fünfhundert Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung hatten sich die Verhältnisse auf den nun zugewachsenen Schwenden schließlich völlig verändert. Das milde Meer prasste nicht mehr mit Wärme und Feuchtigkeit. Ein trockeneres Klima mit kalten Wintern hatte übernommen. Kiefernwald breitete sich aus. Fichtenschosse ragten in die Höhe.
Die Reflexionen in diesem Buch stammten ursprünglich aus meinem Traum, über dem Wald zu fliegen. Als er mich verlassen hatte, versuchte ich mir den endlosen Wald vorzustellen und mir auszumalen, welche Bäume dort unten blühten und grünten. Ich las über den Edellaubwald, über die Linde und den Gemeinen Schneeball, hohe Eschen und ausladende Ulmen. Kastanien, Eichen und Ebereschen. Weiden an Wasserspiegeln. Haselgestrüpp voll Licht im dunkellaubigen Grün. Birken und vielleicht Erlen rings um die Moore und über einen Baum, den ich noch nie gesehen hatte: die Hainbuche.
Meine Lektüre begann vor langer Zeit und war keineswegs systematisch. Schon als ich jung war und von der Wilden Weinrebe bei Mogetorp gelesen hatte, versuchte ich etwas über den Edellaubwald im Atlantikum zu erfahren. Jenen Wald, der Europa werden sollte und der, von wilden, lachsreichen Flüssen durchkreuzt, bis zu den Karpaten reichte. Diese Flüsse hießen noch nicht Rhein und Donau. Aber irgendwie hießen sie. Denn es lebten Völker in dem Wald, und diese Völker hatten eine Sprache. Deltagebiete, Moraste und gewaltige Sümpfe konnten auf die Dauer nicht verhindern, dass sie Menschen aus dem Süden begegneten, die sie besiegen und beschreiben wollten.
Sicherlich war die Welt Wald, aber gutmütig und unkriegerisch waren die Waldvölker nicht. Caesar merkte in seinem Kommentar zu den gallischen Kriegen an, dass sich die jungen germanischen Männer durch die Jagd auf Auerochsen im Kriegsmut geübt hätten. Im Teutoburger Wald wurden von den Germanen fünftausend Römer hingeschlachtet und gleichzeitig ein Tross mit Frauen, Dienerschaft und Kindern vernichtet. Römische Chronisten haben dieses Ereignis als Verschwörung und Hinterhalt beschrieben. Sturm und peitschender Regen machten die Situation nicht besser, als die Germanen unter Arminius (der Hermann geheißen haben kann) angriffen. Befehlshaber der Römer war General Varus. Als er begriff, dass er drei der besten Legionen des Kaiserreichs in den Tod geführt hatte, beging er Selbstmord. Mit der Zeit schloss sich der Urwald über dem Schlachtfeld. Heute graben Archäologen in dem Glauben, dass die »Schlacht im Teutoburger Wald« dort stattgefunden habe, in der Gegend um Osnabrück. Der Wald setzte dem Vordringen der römischen Zivilisation eine Grenze. Östlich des Rheins gab es nie ein Römerreich.
Flussaufwärts, durch die Bäume
Die Eichen rings ums Mittelmeer wurden zu Kielen von Kriegsgaleeren und Handelsschiffen. Schafe und Ziegen weideten die aufkeimenden Triebe ab, und die Eichenwälder verödeten. Die Völker ahnten aber, dass sie Wäldern entstammten, in denen Pan Schrecken verbreitet hatte. In der Eiche von Dodona beim Zeustempel in Epirus rauschten uralte Erinnerungen.
Als Vergil in der Aeneis seinen Helden aus dem Trojanischen Krieg den Tiber hinauffahren lässt, wird es eine Fahrt durch Verschwundenes und in längst abgeholzte Wälder. Der Flussgott persönlich taucht aus dem Wasser auf und zeigt sich im Laub der Pappeln, als Aeneas schläft und träumt. Tiberinus weist ihn in eine dunkle Vergangenheit. Tag und Nacht rudern die Männer flussaufwärts, sie fahren durch einen Wald und durch dessen Spiegelbild:
Die aber rudern rastlos fort bei Nacht und bei Tage,
nehmen der Windungen Länge, umwölbt von mancherlei Bäumen,
und durchschneiden auf ruhigem Strom die grünenden Wälder.
Am Ende erreichen sie das Lager des archaischen Königs Euander, sein dürftiges Reich liegt dort, wo zu Vergils Zeiten »die römische Macht bis zum Himmel baute«.
Hier ist das Heiligtum der Waldmenschen. In einem Hain geheiligter Bäume fließt lauwarmes Blut um den Altar. Die Männer nehmen auf »grünenden Sitzen« Platz – möglicherweise eine Beschreibung umgestürzter Bäume, aus denen noch Schosse treiben. Bei dem großen Jahresfest, das gerade gefeiert wird, darf Aeneas als geehrter Gast auf einem Ahornthron sitzen, der mit einem Löwenfell bedeckt ist. Das gesamte Rückgrat sowie die »edlen Organe« eines der geopferten Stiere werden serviert, allerdings nicht in Schüsseln. Der Wald hat das Dasein so durchdrungen, dass das Service aus Körben besteht. Man trägt Kränze aus Pappellaub im Haar, trinkt und sieht dem Tanz der Salier um die flackernden Flammen des Opferfeuers zu.
Euander erzählt nun die Geschichte dieser Gegend und beschreibt damit ja zugleich die Vergangenheit Latiums, Roms Ursprung.
Diese Wälder bewohnten als Urstamm Faune und Nymphen
und ein Geschlecht, aus Stämmen und harten Eichen geboren,
die nicht Sitte hatten noch Form, nicht Stiere zu schirren
wussten noch Ernten zu häufen und sparsam Erworbnes zu hegen,
sondern es nährte sie Baumfrucht und Jagd, ein mühsames Leben.
Das Volk der Römer mit seiner hoch entwickelten Zivilisation hat also Ahnen, die aus Baumstämmen hervorgegangen waren. Ihre Nahrung bestand aus Baumfrüchten. Dabei musste es sich um Eicheln handeln, die zu Vergils Zeiten als Schweinefutter galten.
Hier im Wald wohne ein Gott, erzählt Euander, ein Gott, dessen Namen niemand kenne. Und in dieser Stimmung darf Aeneas, der auf einem über ein Bett aus Laub gebreiteten Bärenfell ruht, einschlafen.
Schon bei der Sibylle in Cumae hat Aeneas die bedeutungsschwangere Waldstimmung gespürt. Er soll in die Unterwelt hinabsteigen, einen leeren und öden Raum, der mit der Tiefe des Waldes verglichen wird. Um lebend zurückzukehren, muss er einen goldenen Zweig finden – hier also ein Zweig, der abgebrochen werden darf. Aber nur von demjenigen, den die Sibylle beschützt.
… an schattigem Baume
birgt sich, golden an Blättern und biegsamem Schafte, ein Zweig, der
Juno des Abgrunds heilig genannt; ihn schützt und umhüllt der
ganze Hain, im dunklen Tal umschließen ihn Schatten.
Keinem ist aber der Weg zur Erdentiefe gestattet,
eh er den goldenumlaubten Zweig vom Baume gepflückt hat.
Bevor Aeneas jedoch zu den Toten hinabsteigt, muss er für seinen Freund Misenus den Scheiterhaufen errichten, und wieder wird eine archaische Waldwelt mit uralten Bäumen lebendig:
Fort in den Urwald geht es, die hohe Hausung des Wildes.
Niederkrachen die Kiefern, vom Axthieb dröhnen die Eichen,
dröhnen die Eschenholzbalken, und Keile spalten das Kernholz.
Bergeschen riesigen Wuchses wälzt man her vom Gebirge.
Bald lodert Misenus’ Leiche auf dem Scheiterhaufen hinter einer Wand trauriger Zypressen. Wir erfahren, wie an diesem Scheiterhaufen und Waldaltar geopfert wurde. Als der Tote nur noch glühende Asche ist, schlachtet Aeneas mit dem Schwert »ein schwarzwolliges Lamm« und eine Kuh. Es ist kein Fest des Lichtes:
Nachtaltäre errichtet er dann dem Herrscher des Abgrunds,
legt gleich alles Fleisch der Stiere ganz in die Flammen
und gießt fettes Öl auf die brennenden Eingeweide.
Sieh, da beginnt an der Schwelle des Frühlichts, vor Sonnenaufgang
unter den Füßen der Boden zu brüllen, waldige Höhen
wogen vor Augen …
Der Krieg gegen die Waldvölker
Vergil war Poet. Wenn er sich in die Vergangenheit einlebte, sah er lodernde Feuer, Pappellaub, Zypressen und dunkle Myrtenwälder vor sich. Hier empfand er die Anwesenheit des Göttlichen, denn in den dunkelsten Verstecken des Waldes hätten früher die Götter gethront.
Vergil schrieb die Aeneis im letzten Jahrzehnt seines Lebens; er starb im Jahre 19 v.Chr. In den Fünfzigerjahren hatte Caesar für Rom fast ganz Westeuropa erobert und war so weit vorgedrungen, dass seine Legionen auf einer neu konstruierten Holzbrücke den Rhein überschritten. In seiner Darstellung des Krieges in Gallien befindet er sich in seiner Gegenwart, aber jenseits ihrer Zivilisation. Seine Truppen werden mit gallischen und germanischen Waldvölkern konfrontiert. Genau wie in den Schilderungen jüdischer Geschichtsschreiber von den Eroberungen fremder Länder handelt es sich dabei um eine Welt aus Familien, Clans, Stämmen und Völkern. Die biblischen Chronisten berichten mit religiös inspirierten Worten von der großen Zahl und stattlichen Größe der Feinde sowie den himmelhohen Mauern ihrer Städte. Caesar dagegen hat sein Gefühl gezügelt und breitet seinen Sinn für Systematik über diese Waldwelt mit ihren langhaarigen, behosten Horden: Haruden, Markomannen, Triboker, Vangionen, Nemeter, Sedusier, Sueben, Kondrusen, Eburonen, Caeroser, Caemanen und viele andere mehr. Sie werden keiner poetischen Vernichtung im Namen des einen Gottes geweiht, sondern aus taktischen Gründen, aber nicht minder gewissenhaft ausgerottet. Kommen die Bewohner nicht zur Räson, werden ihre Dörfer niedergebrannt und Überlebende zu Sklavenauktionen gebracht.
Nicht alle Expeditionen verliefen erfolgreich. Die römischen Truppen mit ihrer Disziplin und ihrer tadellosen Schlachtordnung im offenen Feld hatten mit diesen flüchtigen und mit dem Wald vertrauten Feinden Schwierigkeiten. Die Taktik der Stammeskrieger bestand darin, sich in den Wald zurückzuziehen und in kleinen Gruppen überraschend vorzustoßen. Im offenen Gelände setzten die Römer ihnen nach, hielten aber inne, sobald der Wald anfing. Man kann sich leicht vorstellen, wie sie davor zurückscheuten, in diesen dichten Wirrwarr aus Stämmen eines Mischwalds mit schroffen umgestürzten Baumriesen und einer Strauchschicht aus vielstämmigen Haseln, Bergjohannisbeeren, Geißblatt, Hartriegel, Gemeinem Schneeball, Zimtrosen, Pfaffenhütchen, verschlungenem, zottigem Efeu und grobdornigen Brombeeren einzudringen. Die Waldkrieger hatten sich vermutlich ihre Pfade in diese Macchia gehauen. Wie aber verhielt man sich bei einer Begegnung?
Dass der Krieg im Wald eine spezielle Technik erfordert, ist Caesar schnell klar. Er analysiert die Taktik der Feinde und beschreibt eingehend ihre Befestigungsbauten, die sie ohne Mauerwerk und Steine errichtet haben. Hier sind es die Nervier, die zum Bau ihrer Verteidigungsanlagen Bäume und Büsche verwenden:
Um daher gegen räuberische Einfälle der Reiterei ihrer Nachbarn geschützt zu sein, hatten sie seit alten Zeiten zarte Bäume angehauen und umgebogen und die zahlreichen herausgeschossenen Äste zusammen mit Dornbüschen und anderem Gestrüpp dazwischengeflochten und so bewirkt, dass dieses Gehege gleich einer Mauer Schutz gewährte, indem man nicht durchdringen, ja nicht einmal durchblicken konnte.
Die Wälder mit ihren unsicheren und verborgenen Pfaden (silvae incertis occultisque itineribus) bleiben ein Problem in diesem Krieg. Die Gefahr eines Überfalls ist groß, das Heer kann nicht in geschlossener Formation marschieren. Die Barbaren können sich im Schutz des Waldes auch an die Heerlager anschleichen, ohne entdeckt zu werden. Die Kämpfe erinnern an Überfälle in Indianerbüchern; die befestigten Lager liegen hinter Wällen und blockhausartigen Verschanzungen. Die Barbaren fallen darüber her, ziehen sich zurück und verstecken ihre Beute in den Wäldern. Caesars Bestreben ist es, die Feinde aus Sumpf und Wald zu locken, sie zu umzingeln und ihre Lager zu blockieren. Dies gilt vor allem für die lange Operation gegen Vercingetorix.
Caesar lässt seine Truppen in der Befestigungskunst nun zur Waldtechnik übergehen. Er erteilt den Befehl, Baumstämme und grobe Äste zu hauen, sie zu entrinden, anzuspitzen und an der Spitze zu schärfen. Anschließend werden sie in Gräben und Gruben getrieben, die man mit Zweigen und Ästen auffüllt, um zu kaschieren, dass es sich um einen Hinterhalt handelt.
Als fast ganz Gallien unterworfen war, standen noch zwei Völker unter Waffen, die Moriner und die Menapier. Caesar entschloss sich zu einer schnellen Intervention, und die Legionen marschierten in deren Land ein. In diesem Land gab es jedoch große zusammenhängende Wälder und Sümpfe, wohin der Feind sich nun zurückzog und sich unerreichbar machte. Dort, wo die Wälder begannen, legten Caesars Leute ein befestigtes Lager an, wurden aber mitten in der Arbeit überfallen. Die Römer verfolgten die Angreifer in den Wald, erlitten dabei aber große Verluste. Da versuchten sie es mit einer neuen Technik. Wie die Amerikaner in Vietnam gingen die Römer nun gegen den Wald vor, der den Feind schützte. Sie holzten ihn ab, und die Feinde mussten sich immer weiter ins Dunkel des Waldes zurückziehen.
Caesar hat vor den germanischen Völkern Respekt. Er hebt ihre Härte und Keuschheit hervor. Die Sueben, die stärksten und kriegerischsten von ihnen, beschreibt er folgendermaßen:
Indessen gibt es bei diesem Volk kein besonderes und durch Grenzmarken getrenntes Grundeigentum, da sich die Sueben nie länger als ein Jahr am gleichen Ort dauernd aufhalten dürfen. Auch nähren sie sich weniger von Getreide als von der Milch und dem Fleisch ihrer Herden und sind viel auf der Jagd. Weil sie überdies von Jugend auf an kein zwingendes Geschäft, an keine Zucht gewöhnt werden, kurz durchaus nichts gegen ihren freien Willen tun, so verleiht ihnen diese ungebundene Lebensweise, vereint mit ihrer kräftigen Nahrung und täglichen Waffenübungen, große Kraft und entwickelt Menschen von ungeheurer Körpergröße. So haben sie sich auch daran gewöhnt, bei dem sehr kalten Klima ihres Landes keine Kleidung außer Fellen zu tragen, die sehr klein sind und einen großen Teil des Körpers unbedeckt lassen, und in Flüssen zu baden.
Er fährt damit fort, ihren Handel mit fremden Kaufleuten zu schildern; sie verkaufen ihre Kriegsbeute, machen sich aber anders als die Gallier nichts daraus, schöne Pferde zu erwerben, sondern bleiben bei ihren eigenen kleinen, hässlichen und widerstandsfähigen Tieren. Sie benutzen keinen Sattel, das halten sie für schmählich und weichlich. Wein trinken sie nicht, weil sie meinen, dass man davon schlaff wird. Um ihre Siedelstätten herum wollen sie unbebautes Land haben und vertreiben alle Nachbarn. Zwischen ihren Ansiedlungen liegt Meile um Meile ödes Land.
Den römischen Besitzungen näher liegen die Ardennen, der größte Wald in ganz Gallien. Er erstreckt sich von den Ufern des Rheins und den Gebieten der Treverer bis zum Land der Nervier und ist mehr als fünfhundert römische Meilen lang. Hier jagt die römische Reiterei den Häuptling Ambiorix und hat das unerhörte Glück, ihn zu überraschen. »Überall entscheidet sehr viel der Zufall, am meisten aber im Krieg«, schreibt Caesar. Aber obwohl der Angriff erfolgreich verläuft und den Römern alle Wagen und Pferde in die Hände fallen, gelingt es Ambiorix zu fliehen. »Dies wurde dadurch möglich, dass sein Haus ganz von Wald umgeben war und seine Begleiter und Vertrauten auf diesem engen Raum den Sturm der römischen Reiter eine kurze Weile aufhielten. So liegen in der Regel die Wohnungen der Gallier, die sie zum Schutz gegen die brennende Hitze meistens in der Nähe von Wäldern und Flüssen machen.«
Ambiorix’ Leute fliehen in die Wälder und Sümpfe. Einer seiner Helfer, ein alter Mann namens Catuvolcus, »vergiftete sich unter Fluch und Verwünschung des Ambiorix als des Urhebers der ganzen Sache mit dem Beerensaft des Eibenbaumes, der in Gallien und Germanien in großer Menge wächst«.
Der Name des Waldgottes
Nach Caesar hat in erster Linie Tacitus in seiner Germania beschrieben, wie der nordeuropäische Wald im ersten Jahrhundert nach Christus aussah. Dieser Essay ist eigentlich eine ethnologische Schrift, denn Tacitus möchte vor allem über die Volksstämme berichten. Er warnt davor, sie zu unterschätzen, und legt dar, wie ihre Mentalität von der Welt des Waldes und deren Strapazen geprägt wurde. Ganz Germanien sei »im Allgemeinen entweder mit unwirtlichen Wäldern oder mit wüsten Sümpfen bedeckt«. Unheimlich und unwegsam ist der germanische Wald des Tacitus. Dort werden keine Botschaften mit Weintraubenkernen in nassen Ton geschrieben. Er glaubt nicht an eine Einwanderung in diese Gebiete, denn wer sollte »Germanien aufsuchen wollen, landschaftlich ohne Reiz, rau im Klima, trostlos für den Bebauer wie für den Beschauer, es müsste denn seine Heimat sein?«
Von irgendwelchen Reichtümern, die ausgebeutet werden könnten, ist ebenfalls keine Rede. Einzige Ausnahme ist der Bernstein, den die Leute am Meer glesum nennen. Es sind die Aestier, ein Volk, das Wildschweinamulette trägt und die Meeresstrände nach dieser Handelsware durchsucht. Tacitus sagt, sie seien mit der Natur und dem Ursprung des Bernsteins nicht vertraut, denn sie hätten nicht danach geforscht. »Dass es sich jedoch um den Saft von Bäumen handelt, ist unverkennbar: Oft schimmern allerlei kriechende und auch geflügelte Tierchen durch, die sich in der Flüssigkeit verfingen und dann von der erstarrenden Masse eingeschlossen wurden.« Er meint, hier im Norden gebe es Wälder, in denen die Bäume saftreicher seien als üblich.
Tacitus’ Germania basiert nicht auf Reisen und eigener Anschauung, sondern auf Berichten und verloren gegangenen literarischen Quellen. Hin und wieder vermittelt sein Text immerhin den Geruch des germanischen Waldes. Man könne die Natur des Bernsteins mit Feuer prüfen, sagt Tacitus, er brenne wie Kienholz »und gibt eine ölige und stark riechende Flamme; hernach wird er zäh wie Pech oder Harz«.
Genau wie Caesar hebt Tacitus das Gefühl der Öde und die freiwillige Isolierung der Stämme hervor. »Dass die Völkerschaften der Germanen keine Städte bewohnen, ist hinreichend bekannt, ja dass sie nicht einmal zusammenhängende Siedlungen dulden. Sie hausen einzeln und gesondert, gerade wie ein Quell, eine Fläche, ein Gehölz ihnen zusagt.«
Er berichtet von heiligen Hainen, aus denen die Waldvölker Bilder und Zeichen mitnähmen, die sie im Kampf vor sich hertrügen. Man fragt sich, was für Zeichen das wohl waren – seltsam geformte Äste? Wandert man durch die Reste eines Urwalds, so kann man noch heute vom Alter und von den Verdrehungen des Windes geschaffene Merkwürdigkeiten im Holz entdecken. Vielleicht waren die Feldzeichen der Germanen jene Vogelfiguren und Raubtiergesichter, die aus silbergrauen Dürrlingen hervortreten. Wir wissen nichts darüber, denn es war eine schriftlose Kultur. Das Holz toter Kiefern war damals wie heute voll erstarrter bewahrender Säfte und Öle. Doch früher oder später vermoderten sie oder verbrannten in den Waldheiligtümern.
Ganze Wälder scheinen als heilig gegolten zu haben. Der Hain, in dem die religiösen Zeremonien vollzogen wurden, kann das innerste Sanktuarium gewesen sein. In den Ländern rund ums Mittelmeer, wo die Landschaft durch den Raubbau an den Wäldern und Beweidung gewaltsam verändert worden war, bildete der Hain einen Rest des heiligen Waldes. Am Ende wurde das Heilige vielleicht wie in der Eiche von Dodona in Epirus in einem einzigen Baum eingeschlossen. Die Annahme, dass der sakrale Raum anfänglich viel größer war als ein Hain, ist folglich nicht unbegründet:
Im Übrigen glauben die Germanen, dass es der Hoheit der Himmlischen nicht gemäß sei, Götter in Wände einzuschließen oder irgendwie der menschlichen Gestalt nachzubilden. Sie weihen ihnen Lichtungen und Haine, und mit göttlichen Namen benennen sie jenes geheimnisvolle Wesen, das sie nur in frommer Verehrung erblicken.
Tacitus wurde dafür kritisiert, dass er den Germanen einen für ihr primitives Stadium zu hoch entwickelten Pantheismus zuschrieb. Ein Römer dagegen konnte das Bild Gottes von menschlichen Zügen abstrahieren. Die religiöse Praxis im kaiserzeitlichen Rom war wüst eklektisch. Edward Gibbon, der Aufklärer, der über den Untergang und Fall des römischen Imperiums geschrieben hat, fand für diesen Zustand eine treffende Formulierung: »Die verschiedenen in der römischen Welt herrschenden Kulte galten sämtlich dem Volk als gleich wahr, den Philosophen als gleich falsch und der Obrigkeit als gleich nützlich.«
In die Mysterienreligionen waren unzählige Menschen involviert und nahmen mit Lust und Liebe an orientalischen Kulthandlungen teil, die oft ziemlich unappetitlich waren und ein niedriges Abstraktionsniveau besaßen. In einer Zeit, in der der Mensch vom Bauwerk seiner Zivilisation beeindruckt ist, schrumpft der heilige Raum, und man zieht mit dessen Riten in den Keller um. Das haben wir auch in unserer eigenen Zeit beobachtet, und wir sind mit unserem Urteil, was in religiösen Zusammenhängen primitiv und überwunden sei, vorsichtiger geworden.
Es gibt eigentlich keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Bewohner des germanischen Waldes die Anwesenheit eines gesichtslosen Gottes in einem sehr großen Raum erleben konnten. Die Wälder, die auf der anderen Rheinseite ihren Anfang nahmen und für die Römer ein undurchdringliches Chaos darstellten, waren für sie ein Kosmos, in dem etwas anwesend war, dem sie sich unterwarfen, weil es sie mit heiligem Schauder erfüllte.
Zu bestimmter Zeit treffen sich sämtliche Stämme desselben Geblüts, durch Abgesandte vertreten, in einem Haine, der durch die von den Vätern geschauten Vorzeichen und durch uralte Scheu geheiligt ist. Dort leiten sie mit öffentlichem Menschenopfer die schauderhafte Feier ihres rohen Brauches ein. Dem Hain wird auch sonst Verehrung bezeigt: Niemand betritt ihn, er sei denn gefesselt, um seine Unterwürfigkeit und die Macht der Gottheit zu bekunden. Fällt jemand hin, so darf er sich nicht aufheben lassen oder selbst aufstehen; auf dem Erdboden wälzt er sich hinaus. Insgesamt gründet sich der Kultbrauch auf den Glauben, dass von dort der Stamm sich herleite, dort die allbeherrschende Gottheit wohne, der alles andere unterworfen, gehorsam sei.
In Tacitus’ Bericht ist der Waldgott namenlos. Heute wissen wir jedoch, wie er hieß: Perkunas. Möglicherweise hatte er mehrere Namen, aber vieles deutet darauf hin, dass dieser Name uralt ist. Der Wortstamm dieses Gottesnamens ist derselbe wie der im Namen des Herzynischen Waldes. Dieser wurde bereits hundert Jahre vor Christus als nahezu endloses Waldgebiet beschrieben, das sich jenseits des Rheins und nördlich der Donau ostwärts bis zu den Karpaten erstreckte.
Lücken und Lichtungen
Es war ein dunkler und geschlossener Wald. Die Domäne des Auerochsen. Langsam nur sollte er sich öffnen. Lichte Flecken, Durchbrüche im Laubdach. Kleine Einschläge, die rasch wieder zuwuchsen. Schwenderauch und Axthiebe. Neue Öffnungen zur Sonne. Das war das Menschliche im Wald. So hat es begonnen.
Lucus, clairière, clearing – die Wörter für Einschlag haben alle mit Auge, Fenster, Öffnung, Licht zu tun. Das lateinische Wort für Wald, silva, bezeichnete ursprünglich sogar den Einschlag und nicht den Wald. Lucus wurde zum Namen des heiligen Hains selbst, die Öffnung zwischen den Bäumen, wo das Opfer dargebracht wurde und das Licht des Himmels eindrang. Von dort konnte man die Zeichen und Bilder der Sterne sehen, und mit diesem Ausblick beginnen vermutlich Metaphysik und Wissenschaft.
Der Wald hatte einst den Kontinent überwältigt. Er kam mit dem großen Regen. Man stellt sich Ereignisse, die Millennien dauerten, gern so vor, als hätten sie sich in einem Kosmorama abgespielt: Man sieht vor seinen Augen Gletscher schmelzen und Wolkenbrüche die Tundra unter Wasser setzen. In feuchter Wärme explodiert die Vegetation und wird immer üppiger und höher. Menschen, die auf den offenen Weiten unterhalb der Ränder des Eises mit ihren Wildrentierherden als Jäger gelebt haben, werden vom Wald übermannt. Die Beute kann nicht mehr mit Hunden über die offene Tundra zu Steilhängen gehetzt werden, damit sie hinunterstürzt. In dem Urwald, der zur Welt der Stammesvölker wird, verbergen sich Auerochsen, Wisente, Rothirsche und Elche. Allein das Glänzen eines Auges und ein Krachen in modernden Baumruinen verraten sie. Die Stammesvölker öffnen den Wald jetzt mit Lücken und Lichtungen. Sie schwenden, pflanzen in der Asche und lassen die Anpflanzung abwechselnd mit Brandrodung, Saat und Brache Jahr für Jahr den Sonnenumlauf vollziehen.
Straßen und Gassen uralter europäischer Städte verlaufen gemäß dem Sonnenumlaufsystem der Äcker rings um den Stadtkern. Diese Städte begannen einst als Einschlag und ein paar Schwenden. Das Rad kommt aus dem Wald, in den konzentrischen Ringen der Baumstämme liegt es bereits fertig vor, kann wie eine Scheibe herausgehauen und unter den ersten Wagen gesetzt werden.
Aber da hat das Tempo längst zu stottern begonnen. Wir wissen zu viel. Nach dem Ende der schriftlosen Zeit überwältigen uns die Details der Dokumente. Das Kosmorama verschwindet, und wir versinken in der kleinen Zeit.
Noch vermischt sich der Klang der Axthiebe nicht mit dem Kreischen der Säge durch frisches Holz. Doch die Methoden entwickeln sich – als im 14.Jahrhundert die Säge in Gebrauch kommt und man Stämmen Herr wird, die man früher nur hatte fällen können, wenn man Feuer um sie gelegt hat. Die Holzfäller dringen immer weiter vor, und es entsteht das Dilemma.
Flucht aus geschälten Wäldern und vor stinkenden Töpfen
Als Herr Olof in den Wald reitet, verlässt er den Bereich menschlicher Ordnung. Hier gilt kein Gesetz. So war es allerdings nur in der Welt der Ritterromane und Balladen. In Wirklichkeit war der Wald bereits im frühen Mittelalter ein Ort, wo Gesetze angewandt wurden. Die Zeit, als der Wald lediglich Heimstatt des Urbösen oder aber sakral und heilbringend gewesen war, lag weit zurück. Tacitus hatte ihn ja als ein großes, unheimliches Heiligtum der ältesten Germanenstämme beschrieben.
Noch im 14.Jahrhundert gab es in den litauischen Wäldern Völker, die darin ein Wesen oder einen Geist verehrten – oder gar den Wald selbst. Eine solche Unterwerfung erfordert wahrscheinlich, dass einem der Wald die ganze Welt ist und dass er niemandes Jurisdiktion untersteht. Alle Regeln, die im Wald angewandt werden, sind dann religiös inspiriert. Es gab jedoch auch eine andere, alltäglichere, menschlichere Sichtweise, wie schon das Wort beweist, das die germanischen Sprachen für den Wald haben. Wood hat die gleiche Wurzel wie ved, das schwedische Wort für Feuerholz. Demzufolge war der Wald ein Nutzwald. Andere Wörter in europäischen Sprachen, wie forest, forêt und Forst, gehen auf rechtlich begründete Ansprüche auf den Wald zurück. Foresta bedeutete ursprünglich nicht Wald. Der Wald, in dem Dianas Priester den Baum mit dem goldenen Zweig bewachten, hieß nemus. Foresta wurde in merowingischer Zeit zur Bezeichnung für königliche Wälder und Jagdreviere. Man nimmt an, dass es sich vom lateinischen foris, außerhalb, herleitet. Die Waldgebiete, die mit foresta bezeichnet wurden, lagen also außerhalb jeglicher Erwerbsmöglichkeiten. Sie durften weder abgeholzt noch geschwendet, noch urbar gemacht werden. Ebenso wenig durften andere als der fürstliche Besitzer und sein Gefolge dort jagen. Die Jagd, insbesondere auf Hochwild, war königliches Privileg.
In Schweden lebte man im frühen Mittelalter in relativ offenen Landstrichen, und gegen den Wald ging man mit Fälläxten und später mit Sägen vor. Die Gesetzbücher jener Zeit zeugen vom Wald als wirtschaftlicher Ressource und als Gegenstand für Grenzziehungen und endlose Streitereien über Grenzen und Eigentumsrechte.