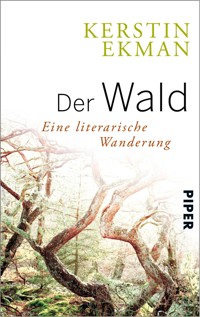3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mittsommer 1974: Die junge Lehrerin Annie Raft irrt mit ihrer kleinen Tochter durch die nordschwedischen Wälder, auf der Suche nach ihrem Freund Dan, der sie eigentlich abholen wollte. Auf dem Weg bemerkt sie einen fremdländisch aussehenden Mann, und wenig später macht sie einen grausigen Fund: ein Zelt mit den Leichen zweier junger Menschen. Achtzehn Jahre später sieht Annie ihre mittlerweile erwachsene Tochter in den Armen eben jenes Fremden … Eine faszinierende Geschichte im düsteren Milieu der nordschwedischen Wildnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage Juli 2011
ISBN 978-3-492-95256-9
© Kerstin Ekman 1993 Titel der schwedischen Originalausgabe: »Händelser vid vatten«, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1993 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1995 Deutsche Erstausgabe: Neuer Malik Verlag, Kiel 1995 Covergestaltung: R.M.E, Roland Eschlbeck / Kornelia Rumberg Covermotiv: Nordic Photos Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Teil 1
Ein Geräusch. Sie wachte davon auf. Es war vier Uhr morgens. Auf der Digitalanzeige des Radioweckers 4:02. Im Zimmer war es dämmergrau. Regentropfen zeichneten ein Streifenmuster auf die Fensterscheiben, und draußen dampfte die Feuchtigkeit aus dem üppig wuchernden Gras.
Sie bekam keine Angst. Wurde aber wachsam. Jetzt hörte sie, was es war: ein Automotor auf niedrigen Touren. So früh konnte niemand zu ihr wollen. Saddie lag auf dem Schaffell vor dem Bett und schlief weiter. Die Hündin war dreizehn und ziemlich taub.
Eine Autotür knallte. Noch eine. Also mindestens zwei Leute. Und dann diese Stille. Keine Stimmen.
Sie schlief mit einer Schrotflinte neben sich. Das Bett stand ein Stück von der Wand entfernt, und in dem Zwischenraum befand sich das Gewehr. Eine recht hübsche Waffe, spanisch. Eine Sabela. Die Patronen lagen hinter dem Radiowecker. Sie brauchte genau zweiundzwanzig Sekunden, um das Gewehr aufzuklappen und die Patronen hineinzustecken. Das hatte sie geübt und dabei die Zeit gestoppt. Tatsächlich hatte sie es jedoch nie laden müssen.
Die Tür war abgeschlossen. Sie hatte noch nie vergessen, ihr Haus zuzusperren. Seit achtzehn Jahren nicht.
Jetzt lag sie da, hatte die Hand auf dem sauber gearbeiteten Kolben der Sabela und befühlte die mattfette Oberfläche. Steif und fröstelnd.
Sie wollte nicht in die Küche gehen und hinausschauen, denn da wäre sie selbst durchs Fenster zu sehen gewesen. Statt dessen stand sie auf, stellte sich an den Türpfosten und lauschte. Saddie kam mit, sackte aber auf dem Teppich unterm Couchtisch zusammen und fing wieder zu schnarchen an. Stimmen waren nicht zu hören.
Schließlich ging sie doch in die Küche. Ohne Gewehr. So macht man das nun mal. Man glaubt, daß es gutgehen wird.
Der Regen rann jetzt lautlos über die Fensterscheiben. Hinter dem Film aus Glas und Wasser stand Mia vor dem Auto.
Ihr Körper war mit einem anderen verschmolzen.
Die beiden waren ganz naß. Mias Jacke war auf den Schultern und am Rücken völlig durchnäßt. Das Haar klebte ihr strähnig am Kopf und wirkte dunkler, als es war. Er hatte richtig dunkles Haar, braunschwarz und glatt. Es steckte Laub darin. Zwergbirkenzweige und Farnblätter. Mia mußte sie hineingesteckt haben. Sie hatte mit ihm gespielt. Die beiden waren so eng miteinander verschlungen, daß es aussah, als wäre er dort draußen im Regen in sie eingedrungen. Dem war aber nicht so. Sie sah etwas ebenso Uraltes. So als ob sich in der Zeit eine Wunde öffnete. Und sich schlösse, verschwunden wäre. Als sich die Gesichter voneinander lösten, erkannte sie ihn.
Sie stützte sich auf die Spüle. Stand in ihrem alten Nachthemd da und vergaß ganz, daß sie sie entdecken konnten. Ihr Herz bewegte sich wie ein Tier in ihrem Brustkorb. Nach einer Weile verspürte sie einen Brechreiz, der sie zum Schlucken zwang. Der Speichel war ihr im Mund zusammengelaufen.
Dasselbe Gesicht. Fester und gröber nach achtzehn Jahren. Aber das war er. Der Regen rann wie über ein Fenster in der Zeit, und da war er, ein Körper, Fleisch.
Sie trat zurück, vom Fenster weg. Sie hatten sie nicht entdeckt. Als Mia den Schlüssel ins Schloß steckte, lag sie schon wieder im Bett. Sie hörte, wie Saddie in den Flur tappte und sich leise freute; sie schlug mit dem Schwanz gegen die Mäntel in der Diele, so daß die Kleiderbügel klapperten. Mia ging in die Küche, und der Automotor sprang an. Wahrscheinlich winkte sie ihm. Dann stieg sie, Saddie auf den Fersen, die Treppe hinauf. Sie ging sich nicht waschen. Und es war ja nicht schwer zu verstehen, weshalb.
Annie hatte kalte Füße bekommen, und die Kälte kroch nun nach oben. Sie traute sich jedoch nicht, in die Küche zu gehen und im Herd Feuer zu machen oder auch nur einen warmen Morgenrock zu suchen. Mia sollte nicht hören, daß sie wach war.
Sie hatten miteinander geschlafen. Vielleicht im Freien, im Regen. Er war jener Junge. Wenn auch viel älter. Mit dem knospenden Laub im nassen Haar glich er auch etwas anderem. Etwas, was sie gesehen hatte. Einem Bild vielleicht. Sie sah ein Messer, obwohl sie das nicht wollte. Sie sah das Messer in den kräftigen, jungen Körpern.
Jetzt lag Mia dort oben in seinem Duft und wollte sich nicht einmal waschen. Sie wollte ihn sich bewahren.
Was sollte sie sagen, wenn Mia herunterkam?
Du bist dreiundzwanzig. Ihr müßt fünfzehn Jahre auseinander sein. Laß die Finger von ihm. Er ist gefährlich.
Es war achtzehn Jahre her, daß sie dieses Gesicht gesehen hatte. Damals war es jung gewesen und die Erregung darin von anderer Art. Aber es war dasselbe Gesicht.
Das Bett über ihr knackte. Mia konnte oder wollte nicht schlafen. Seine Anwesenheit pulsierte ihn ihr. In den Schenkeln, im Bauch, in der Scheide und in den zerküßten Lippen. Und Annie lag steifgefroren und starr ausgestreckt in ihrem Bett.
Sie streckte die Hand nach dem Telefonhörer aus. Es war noch nicht halb fünf. Sie wollte seine Stimme hören, selbst wenn sie vielleicht nicht lange reden konnte. Es bestand die Gefahr, daß man es oben hörte.
Er mußte jetzt verschlossen sein, im Schlaf verklebt wie ein Kuvert. Er meldete sich jedoch nach dem ersten Klingeln, und ihr ging durch den Kopf, wie gewohnt er es war, geweckt zu werden, und daß er an diesem Samstagmorgen eigentlich sollte ausschlafen können.
»Ich bin es nur. Entschuldige. Ich habe dich geweckt.«
»Das macht nichts. Fehlt dir was?«
Seine Stimme war undeutlich.
»Nein, nein.«
»Was ist dann?«
Was sollte sie sagen? Er wartete.
»Ich habe ihn gesehen. Du weißt schon. Den ich in jener Nacht gesehen habe.«
Er schwieg. Er mußte jedoch wissen, wen sie meinte, denn er fragte nicht nach.
»Das ist doch nicht möglich«, sagte er schließlich.
»Doch, ich habe ihn gesehen.«
»Du erkennst ihn doch unmöglich wieder.«
»Ich habe ihn aber erkannt.«
Sie hörte ihn schwer durch den Mund atmen.
»Ich weiß nicht, wer er ist«, sagte sie. »Ich werde es aber bald erfahren. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Ich ruf dich später an.«
Er wollte nicht auflegen. Sie verstand, daß er sie beruhigen wollte, ihr womöglich einreden wollte, daß sie sich getäuscht habe. Doch sie verabschiedete sich. Als sie den Hörer auflegte, hörte sie seinen Atem immer noch.
Seine Stimme blieb bei ihr. So als hätte er mit den Lippen an ihrem Ohr gesprochen. Die Wärme darin. Die Feuchtigkeit in den Wirbeln auf seiner Brust. Ein Tal mit nächtlichem Dunst, Vögel im Laub.
Jetzt hieß es lediglich warten.
Mia schlief nicht sehr lange. Annie saß da und trank Tee, als sie herunterkam. Ihre Lippen waren zerbissen, und sie wirkte abwesend. Sie hätte eigentlich verlegen sein müssen, weil sie nicht angerufen und gesagt hatte, daß sie kommen werde.
Aber sie hatte wohl nicht vorgehabt, sie zu besuchen. Sie war im Auto dieses Mannes gekommen. Man sah, daß sie unablässig an ihn dachte. Er würde nicht wie die Regenwolken überm Fjäll an diesem kühlen Morgen verschwinden. Sie mußten über ihn reden.
»So viele Blumen«, sagte sie schließlich. Sie dachte wohl nicht daran, daß der letzte Schultag gewesen war.
»Ich hab nicht angerufen. Es hat sich einfach so ergeben, daß wir raufgefahren sind.«
Wir, sagte sie, völlig selbstverständlich.
»Wir wollten in Nirsbuan übernachten.«
»Habt ihr es euch anders überlegt?«
»Es ist zu kalt geworden. Da ist nur dieser kleine Herd, und dann gibt es kaum Brennholz. Wir haben aber die Birkhähne gesehen. Die haben im Moor ihr Spiel gemacht.«
»Immer noch?«
»Da oben liegt Schnee. An einigen Stellen jedenfalls.«
Sie hatte sich Annie gegenübergesetzt und hielt den warmen Teebecher zwischen den Händen. Ihr Haar war wieder trocken und kraus und schimmerte rot. Auf dem Dachboden hatte sie einen alten Trainingsanzug gefunden. Er war verwaschen blau, und auf der Brust stand COUP DU MONDE.
»Johan Brandberg hat mich hergebracht«, sagte sie. »Du weißt, wer das ist?«
»Nein.«
»Nein, natürlich nicht, er wohnt ja nicht mehr zu Hause. Schon viele Jahre nicht mehr.«
»Achtzehn.«
Sie blickte auf.
»Dann weißt du also, wer er ist?«
»Ich habe ihn gesehen.«
Mia konnte nicht wissen, was ihre Mutter damals gesehen hatte. Sie hatte tief im Gras gelegen und das Gesicht so fest auf den Boden gedrückt, daß sich hinterher ein Muster von Grashalmen und Moos in der zarten Haut abgezeichnet hatte.
Das Telefon klingelte. Annie nahm ab und hörte, daß von einem Münzfernsprecher aus angerufen wurde. Die Stimme, die nach Mia fragte, war hell. Viel zu hell für sein Alter. Hatte er sie gesehen, war er in die Zeit hinabgeglitten?
Mia ging nach dem Gespräch. Annie brauche sie nicht zu fahren, sagte sie. Er habe aus der Telefonzelle unten beim Laden angerufen und warte dort mit dem Auto.
Sie war dabei, als es geschah. Annie hatte versucht, es ihr zu verheimlichen, sie selbst konnte sich wohl kaum daran erinnern. Aber sie hatte natürlich hinterher davon gehört, bis zum Überdruß und zum Erbrechen. Wenn sie sagte, daß sie in Swartvattnet aufgewachsen sei, schrien die Leute auf. Dort!
Zu Beginn der siebziger Jahre war Svartvattnet ein sterbendes Dorf unter vielen gewesen. Am Walpurgisfeuer fiel der Regen in die Gesichter. Die Luft roch nach Diesel. Die Leute füllten Kaffeedosen mit ölgetränkten Sägespänen und zündeten sie an. An einem einzigen Abend im Jahr erglänzten die Straßen für einige Stunden im Licht dieser Leuchten. Ansonsten nichts.
Und dann war dieses Dorf ein schwarzes Schmuckstück geworden. Sichtbar. Voller Kraft.
Ja, hier war das. Oder besser gesagt, vom Dorf aus gerechnet, vier Kilometer bergauf, an jenem, Lobberån genannten Gewässer. Es hatte andere Namen gehabt und würde noch neue bekommen. An manchen Stellen war es ein reißender Fluß, der sich weiter oben steile Felsabhänge hinabstürzte und Stromschnellen bildete. Hier öffneten sich jedoch zwischen den strömenden Strecken mehrere große und tiefe stille Wasser. Die Ufer waren morastig und voller Blauweidengestrüpp. Milchlattich und Nordischer Sturmhut wuchsen einem weit über den Kopf, und beim Versuch, sich einen Weg zu bahnen, konnte man in Biberburgen fallen. Um den Fluß herum breitete sich ein unzugängliches, von Tierpfaden durchkreuztes Moorland aus. Diese Stelle hatte keinen Namen.
Es war am Mittsommerabend vor bald achtzehn Jahren. Ein heißer Tag. Sie kamen mit dem Zug nach Östersund. Das wußte sie noch. Aber woher wußte sie das?
Scharfe und eindeutige Erinnerungsbilder gab es eigentlich nur wenige. Sie stand mit der Kurbel des Taxentelefons in der Hand da. Das war eine Tatsache, und sie erinnerte sich daran. An viel mehr allerdings nicht. An die Hitze. Später am Tag war der Asphalt vor dem Supermarkt weich.
Sie erinnerte sich nicht, wie sie angezogen waren, und auch nicht, wie spät es war, als der Zug einlief. Am Busbahnhof mußten sie lange warten. Der Bus nach Svartvattnet fuhr um halb drei, damals wie heute. Der Fahrplan war in all den Jahren nicht geändert worden.
Es war Mittsommerabend und folglich Freitag. Der alte Mittsommerabend fiel erst auf den Samstag. Das hatte sie nachgeschlagen. In ihren Notizbüchern stand nichts über diese Reise, denn damals hatte sie noch keine gehabt. Die Einsamkeit hatte noch nicht begonnen. Noch war alles hektisch. In ihrem Kopf, ihrem ganzen Körper sang es. Sie würde ein neues Leben beginnen.
Und das hatte sie auch getan. Als sie die Kurbel des Taxentelefons herumzudrehen versuchte, ging diese ab, und sie hielt sie in der Hand. Sie hätte denken können: Das fängt ja gut an! Aber das dachte sie nicht. Das Singen in ihr war zu stark.
Sie erwischte auf der Straße ein Taxi, und sie liefen lange in Östersund umher. Am Nachmittag saßen sie auf einer Parkbank und aßen irgendeine Art Junkfood. Zum letzten Mal, dachte sie wahrscheinlich. Sie stiegen mit all dem Gepäck aus dem Zugabteil und aus dem Güterschuppen in den Bus. Bei Gravliden wurde Mia übel. Der Name war grauenvoll, er klang nach Grab, und deshalb erinnerte sie sich daran, daß dort Mias Übelkeit begann. Ein alter Mann war zugestiegen, der nach Ziegen roch. In dem vollbesetzten Bus wurde es immer wärmer und die Luft immer drückender. Den Alten umgab ein intensiver Geruch nach Unsauberkeit und Ziegenstall, der sich in unregelmäßigen Wellen, vielleicht mit den Bewegungen im Bus, verbreitete. Leute mit Tragetaschen stiegen aus und ein. Sie waren in Östersund einkaufen gewesen. Ihr ging durch den Kopf, daß sie auf diese Art nicht mehr einkaufen könnte.
Sie hielt eine Tüte bereit, denn Mia war die ganze Zeit drauf und dran, sich zu übergeben. An jeder Haltestelle gingen sie für ein Weilchen ins Freie, damit Mia frische Luft bekam. Es war jedoch ekelhaft warm an diesem Nachmittag. Nach einer Stunde stieg der alte Mann aus, und da wurde es besser. Mia schlief heiß und erschöpft auf ihrem Schoß ein.
»Jetzt wird es bestimmt besser«, sagte der Fahrer.
»Wie lange dauert es noch?«
»Sie wollen nach Svartvattnet, was? Gehören Sie zu den Stjärnbergleuten?«
»Nein.«
Das ging ihn nichts an.
»Dann machen Sie also Urlaub?«
Sie fand die Frage einfältig. Aber er konnte ja nicht wissen, daß sie nun ein anderes Leben beginnen würde. Um weiteren Fragen zu entgehen, bestätigte sie, daß sie Urlaub mache. Mia schlief und konnte sie nicht verbessern. Wie lange es noch dauern würde, erfuhr sie nicht. Er redete nicht mehr mit ihr.
Jetzt begannen die Wälder und die großen Waldschläge. Der Bus hielt nicht mehr so oft. In jedem Dorf wurden auf der Rampe beim Laden Kisten mit Milch und anderen Frischwaren abgestellt. Die Postfräulein kamen heraus, öffneten dem Fahrer die Tür, und der brachte die Postsäcke hinein. Leute saßen in Autos und warteten auf Briefe und Abendzeitungen. Viele hatten Bier getrunken, und sie redeten lautstark mit dem Fahrer und miteinander.
»Was sagen die?« flüsterte Mia.
Aber auch Annie verstand nicht, was sie sagten.
Sie fuhren durch ein fremdes Land. Wenn ein großer, kalter See durch die Tannenstämme schimmerte, war das nur eine Begebenheit in der Einförmigkeit, die gleich wieder verschwinden und durch eine andere ersetzt werden würde. Sie wußte nicht, daß sie an einem System von Seen entlang bergan fuhren, das sich bis ins norwegische Hochgebirge hinzog, wo es Mooren und Gebirgsbächen entsprang. In den Waldschlägen war das große Adernetz des Wassers gekappt worden, und der Boden war zu wildem Fleisch im Körper der Landschaft vertrocknet. Sie wußte auch nicht, daß von der Straße aus nur die kleinen Waldschläge zu sehen waren und daß zunehmend größere Gebiete von ihrer Verbindung mit den Wolken abgeschnitten wurden und somit unfähig, etwas zurückzugeben, wenn der saure Regen durch sie hindurchsickerte.
Röbäck, wo die Kirche stand, erreichten sie erst am Abend. Hier würden sie sich anmelden. Die Gemeinde war groß. Annie wußte nicht, wie weit sie sich erstreckte. Sie stiegen aus und sahen sich die Kirche an, während der Fahrer auslud. Die Kirchenmauern blendeten in der starken Abendsonne. Die Kirche lag auf einer Landzunge im Rösjön, und zum Wasser hin verlief ein weißer Zaun. Er sah aus wie die Reling eines Schiffs. Überhaupt glich die Kirche auf ihrer Landzunge dort draußen in dem großen Bergsee einem Schiff. Vielleicht sollte sie mit all ihren Toten am Jüngsten Tag vom Ufer aus auslaufen.
Das Wasser sah kalt aus. Die Ufer trugen ein dunkles Tannenkleid, nur direkt am Wasser war kein Grün. Gesteinsblöcke und Felsplatten fielen jäh und kahl in den See ab. Sie wußte, daß er kalt war. Zwölf, dreizehn Grad, hatte Dan geschrieben.
»Guck mal, was für komische Kinder«, sagte Mia.
Drüben beim Bus kam eine Gruppe Kinder an. Sie waren nur zu viert, gingen aber hintereinander. Es waren drei Mädchen in langen Röcken, mit Zöpfen und mit Rucksäcken aus Birkenrinde sowie ein Junge mit einer Strickmütze, deren Ohrenklappen sich beim Gehen bewegten. Baumelten. Sie unterhielten sich ein Weilchen mit dem Fahrer. Dann entfernte sich der Trupp auf der Landstraße. Sie gingen langsam. Annie war, als habe sie sie wie eine Projektion gesehen, wie einen Ausschnitt aus einem alten Film oder aus einer anderen Zeit als derjenigen, die gerade herrschte und in der die Milchkästen auf die Rampe vor dem Laden rumsten. Oder waren das gar keine Kinder?
»Das waren vielleicht Trolle«, sagte sie zu Mia, bereute es jedoch im selben Moment, denn Mia sah der kleinen Truppe, die hinter der Straßenbiegung verschwand, sehr ernst nach.
Der Fahrer winkte. Es war Zeit abzufahren.
Svartvattnet war die Endstation des Busses. Der See war blank an diesem Abend. Die Ufer am Fuß der Berge spiegelten sich im Wasser, schwarzblau und jedes Detail in der gezackten Kontur der Tannen so deutlich wie in der Vorlage. Das sah nicht mehr wie ein Spiegelbild im Wasser aus, sondern wie ein zweites Luftmeer und eine Tiefe, die sich in langen, waldigen Hängen zu einem Grund fortsetzte, den sie nicht sehen konnten.
Sie waren steifbeinig, als sie ausstiegen. Mias Lippen waren trocken und gesprungen. Der Saft war schon längst zu Ende. Annie sah sich nach Dan um, damit er sich um Mia kümmerte, während sie selbst in den Laden liefe und für sie etwas zu trinken kaufte. Es war halb acht, und der Laden war schon geschlossen. Doch während die Waren hineingebracht wurden, war der Kaufmann da. Ständig kamen und fuhren Autos. Genau wie in den anderen Dörfern holten die Leute Post und Zeitungen.
Nirgendwo sah sie den Volkswagen und Dan. Mia wollte nicht allein auf dem Platz vor dem Laden warten. Sie ergriff Annies Hand. Ihr kleines, dreieckiges Gesicht war aschfahl unter den Sommersprossen, und die Haare klebten ihr an den Schläfen und an der Stirn, nachdem der Schweiß getrocknet war. Sie mußte Pipi machen und etwas trinken und so allmählich vielleicht etwas essen. Doch bevor Dan kam, konnte Annie nicht viel für sie tun. Sie mußte darauf achten, daß der Fahrer alle ihre Sachen mit auslud. Er habe eine Viertelstunde hereingeholt, sagte er, und sie nahm an, daß Dan deswegen noch nicht aufgetaucht war.
Nachdem alle Autos abgefahren waren und der Kaufmann zugeschlossen hatte und zu seinem Haus auf der Landzunge vor dem Laden hinuntergegangen war, standen sie mit ihren Taschen und Kartons allein auf dem Kiesplatz. Das Schweigen, das dem Autolärm folgte, kam mit Macht. Es war seltsam, diese Stille, nach der sie sich gesehnt hatte, zu erleben und sich gleichzeitig so unwohl zu fühlen. Dan hätte jetzt eigentlich kommen müssen.
Am Mittsommerabend saß Johan Brandberg in seinem Zimmer am Schreibtisch. Es war Nachmittag, und es war heiß geworden. Er las ein Buch über die Antarktisexpedition mit der »Maud« in den fünfziger Jahren. Er hatte frei. Seitdem die Schule zu Ende war, verrichtete er für den Vater Waldrodungsarbeiten. Von einer anderen Arbeit war gar nicht die Rede gewesen. Später im Sommer sollten Väine und er aufforsten. Er fragte sich, wie das wohl sein werde, den ganzen Tag mit Väine unterwegs zu sein. Der Halbbruder war ein knappes Jahr älter als er, und stärker. Nicht nur physisch. Johan fiel die Laika ein, und das ekelte ihn so, daß ihm in dem stickigen Zimmer schlecht wurde.
Er beugte sich über den Schreibtisch und öffnete das Fenster. Unten sah er den Hof und die Scheune und die Einhegung mit ein paar von Vidarts Ziegen. Sie hatten dort alles kahlgefressen, doch auf der anderen Seite des Zauns stand das Grasfell dicht und voller Blumen. Die Trollblumen erkannte er.
Während der Oktoberjagd war die Laika zweimal nach Hause gekommen und hatte sich auf die Vortreppe gesetzt. Am Samstag, dem Tag vor der Verteilung des Wildbrets, erschoß Torsten sie. Übers Wochenende lag die Leiche im Brennholzschuppen. Dann hatte er zu Väine gesagt, daß er sie vergraben solle.
Johan erinnerte sich an das Geräusch, als Väine mit dem Spaten auf die Grasnarbe hinter der Scheune einhieb. Sie war bereits steifgefroren. Er hatte damals ebenfalls am Schreibtisch gesessen, allerdings mit einem Gemeinschaftskundebuch vor sich. Wenn er mich darum gebeten hätte, hatte er sich gedacht. Wenn ich in die Grube gekotzt hätte.
Am Montag hatte er wieder im Schulbus gesessen und war von allem weggefahren. Jetzt mußte er dableiben. Die ganze Woche über. Alle Wochen bis zum zweiundzwanzigsten August. Er würde ein Kiefernareal von acht Hektar roden, und dann würden sie auf dem Waldschlag oberhalb von Alda Drehkiefern pflanzen.
Jetzt hatte er jedenfalls frei und saß dank Gudrun unbehelligt über seinem Buch. Und er konnte Veterinär werden. Oder Vermessungsingenieur. Es gab Bücher über Bücher. Es war nicht alles der gleiche Mist, nicht einmal für Torsten. Per-Ola arbeitete als Kranführer in Åre. Björne fällte für SCA. Das hatte auch Pekka im vergangenen Jahr getan. Jetzt redete er jedoch von den Gruben auf Spitzbergen. Oder von einer Ölplattform. Aber das war wohl nur Geschwätz. Oder Träumerei.
Pekka hatte Träume in der Grütze, genannt Hirnsubstanz. Und was hatte er in den Hoden? Meine sehen genauso aus, dachte er. Und ich habe die gleiche Substanz im Hirn.
Aber nicht die gleichen Gene.
Jetzt kamen diese Gedanken. Er hatte sie, und er wollte sie auch haben. Aber er hätte es niemals gewagt, Gudrun zu fragen. Nicht frei von der Leber weg.
Er hatte diese Gedanken, seit er einmal mit ihr Ski gefahren war. Da war er vielleicht elf, zwölf Jahre alt gewesen. Jedenfalls alt genug, um das Björnfjället zu schaffen. Sie stiegen gerade den letzten Steilhang hinauf, als sie einen Schneescooter hörten. Zuerst war ihnen nicht klar, woher das Geräusch kam, und dann wurde es plötzlich wieder still. Als sie jedoch im Grätenschritt noch ein Stück weiter hinaufgegangen waren und gerade ihre Skier abgeschnallt hatten, um das letzte Stück über die Eiskruste zu klettern, zeichnete sich der Mann auf dem Scooter gegen den Himmel ab.
Wann immer er wollte, konnte sich Johan diesen Anblick ins Gedächtnis zurückrufen. Ein großer Mann. Eine orange Hellyhansenjacke und abgetragene, schwarze Lederhosen. Ein Gürtel mit Silbernieten und ein Messer in einer Hornscheide. Es war größer als alle Messer, die er bisher gesehen hatte, und an der Spitze stark gekrümmt. Der Mann hatte seine Mütze abgenommen und sie auf den Scootersitz gelegt. Schwarzes Haar und an den Schläfen Strähnen, die silbrig wirkten. Schmale Augenschlitze in dem grellen Licht, innen schwarz. Und hinter ihm all die weißen Zacken der norwegischen Fjälls.
»Er schaut nach seinen Renen«, sagte Gudrun. Und nachdem sie oben angekommen waren, rief er »Bouregh!«, und daraufhin sprachen sie südsamisch miteinander. Johan verstand nicht einmal jedes zehnte Wort, und er war zutiefst verlegen, als der Große etwas zu ihm sagte und er nicht antworten konnte. Er zauste ihm durchs Haar. Faßte ihn an.
Wann immer er wollte, konnte er sich dies zurückrufen. Doch er ging sparsam damit um. Es durfte sich nicht abnutzen. Und ebensowenig der Anblick, der sich da oben gegen den Himmel abgezeichnet hatte, der Anblick des Großen, der sein Vater war.
So war das. Eine andere Erklärung gab es nicht.
Jetzt hörte er Vidarts Auto. Es war ein Duett mit kaputtem Auspufftopf. Die Hunde bellten bereits. Sie hatten ihn lange vor ihm gehört.
Vidart reparierte Autos, und manchmal kaufte und verkaufte er Gebrauchtwagen. Den Duett brauchte er nur zum Transport der Milchkannen. In der Regel fuhr seine Frau damit über Torsten Brandbergs Hof zur Einhegung hinauf. Doch damit war jetzt Schluß.
»Scheiß Zigeuner«, meinte Torsten. »Dieser Krüppel, der nicht arbeiten kann. Über den Daumen mit fünftausend veranlagt. Ist doch klar, daß der stehlen muß!«
Er hatte jedoch selbst vier nagelneue Hakkapeliittareifen von Vidart gekauft. Und dafür elfhundert bezahlt. Er hatte auch gar keinen Hehl daraus gemacht. Am Küchentisch erzählte er, daß Vidart einfach die Versicherungsgesellschaft angerufen und gesagt habe: »Mir sind heute nacht vier neue Hakkapeliitta gestohlen worden. Und das Schlimme ist, daß ich sie einem versprochen habe, der heute zur Arbeit runterfahren muß. Sie müssen diesen Schaden also jetzt sofort regulieren.«
»Ist Vidart Zigeuner?« hatte Johan Gudrun hinterher gefragt. Aber sie wußte es nicht. Torsten sagte, daß die, die so hießen, welche seien. »Warum haßt er ihn denn?« fragte Johan. Welch ein Wort! Sie hatte jedoch die Nadel im Stoff stecken lassen, als ob sie in ihrem Inneren dieses Wort in bezug auf Torsten und Vidart prüfte. »Er hat Vidart noch nie gemocht«, sagte sie schließlich. »Wahrscheinlich, weil er hier neu ist.«
Vidart lebte erst seit siebzehn Jahren in Svartvattnet. Das war länger, als Johan alt war. Es waren Harry Vidarts Ziegen, die in der Einhegung umherliefen. Sie sprangen zwischen den Autowracks umher und hatten alle Stämme abgenagt. Torsten hatte zu ihm gesagt, daß er einen verrosteten PV fortschaffen und den elektrischen Zaun zurücksetzen solle. Das Stück der Einhegung, das an der Straße liege, gehöre Brandbergs.
Es war lange her, daß er das gesagt hatte. Vidart hatte das Anwesen von der Witwe des alten Enoksson gekauft, doch die wußte nicht, wie das mit der Einhegung war. Die meisten sagten, daß die Straße dort hinauf Gemeineigentum sei, doch Torsten behauptete, das Stück von der Scheune ab gehöre ihm, ebenso der Teil der Einhegung, auf dem der PV stehe. Der leuchtete fuchsrot vor Rost, und die Ziegen kletterten hinauf, um an eine Salweide heranzukommen, die noch grünte. Ansonsten sah die Einhegung aus, als hätte man eine Bomberladung Entlaubungsgift darübergesprüht.
Vor Zeugen hatte Torsten zu Vidart ein letztes Mal gesagt, daß er das Autowrack beseitigen und den Zaun versetzen solle. Und zwar spätestens bis Montag. Das war in derselben Woche, in der Johans letzter Schultag gewesen war.
Vidart setzte den Zaun ein Stück zurück und entfernte alle losen Teile des Autowracks. Den Rest wollte er mit dem Frontlader holen, aber an dessen Hydraulik stimmte etwas nicht. Und so verging diese Woche.
Am Dienstagmorgen kam Vidarts Frau mit dem Duett, der mit Kannen beladen war, zum Melken. Da stand quer über die Straße ein Gattertor. Sie stieg aus, guckte und sah, daß es nur mit einem verzwirnten Stahldraht verschlossen war. Sie traute sich aber nicht, es zu öffnen, sondern wendete und fuhr davon. Daraufhin fuhr Vidart jeden Morgen und Abend mit dem Traktor über die Lehden zur Einhegung und zum Ziegenstall hinauf.
Auf die Dauer ging das natürlich nicht. Er konnte sich nicht zweimal am Tag ums Melken kümmern, wenn er in der Werkstatt zu tun hatte. Und seine Frau konnte nicht Traktor fahren. Offensichtlich hatte er es jetzt satt. Er schickte jedoch nicht seine Frau im Duett, sondern kam selbst.
Vidart ließ den Motor laufen, während er ausstieg und das Tor öffnete. Er pusselte lange an dem Stahldraht herum. Als er durchfuhr und das Auto hinter der Scheune verschwand, bekam Johan heftiges Herzklopfen. Er wußte, daß der Vater und die Brüder Vidart schon längst gesehen haben mußten. Es war still geworden unten. Zuvor hatte in der Küche das Radio gespielt. Auch die Hunde schwiegen, nachdem der Duett verschwunden war.
Jetzt kam Per-Ola heraus. Johan sah ihn aus dem Schatten der Vortreppe treten. Er hatte sich schon umgezogen und trug eine weiße Hose und ein weißes Hemd. Die anderen saßen offensichtlich noch drinnen. Es war nach wie vor völlig still.
Per-Ola ging in die Schreinerwerkstatt und kam mit einer Kette und einem Hängeschloß wieder heraus. Dann ging er zum Gattertor und band es am Pfosten fest. Dessen Tannenholz leuchtete gelb in der Sonne.
Nachdem er mit dem Schloß fertig war, ging er zurück ins Haus. Jetzt trinken sie Kaffee, dachte Johan. Nein, Branntwein. Oder Branntwein im Kaffee. Gudrun hatte Kaffeegebäck hingestellt, bevor sie gefahren war. Sie war in Byvången und besuchte Torstens Mutter im Altersheim. Die Brüder waren alle zu Hause. Sie saßen unten und warteten, und Torsten bestimmte, was getan werden sollte. Bisher hatte er nur Per-Ola hinausgeschickt. Johan hatte jedoch immer noch heftiges Herzklopfen.
Vidart brauchte länger als eine Stunde zum Melken. Auf dem Hof war es ruhig. Unten in der Küche schien sich niemand zu rühren oder etwas zu sagen. Johan hätte die Stille gern durchbrochen, traute sich aber nicht, das Radio einzuschalten. Am besten wäre es, Torsten wüßte gar nicht, daß er in seinem Zimmer saß und zur Einhegung hinuntersah. Er saß nur still da, und seine Beine, die er seitwärts gedreht hatte, weil sie unter dem Tisch keinen Platz mehr hatten, waren eingeschlafen.
Sowohl die neue Laika als auch der Jämthund begannen in ihrem Zwinger wütend zu bellen. Zu sehen, wie Vidart hinter der Scheune hervorfuhr und das Auto zum Stehen brachte, war wie in einem Film. Johan wußte alles im voraus. Jetzt würde er die Kette und das Schloß entdecken. Daran rütteln. Und dann zum Haus herüberschauen.
Und jetzt?
Er ging auf dem Grabenrand am Gattertor vorbei. Dort war ja kein Zaun. Die Einhegung begann erst ein Stück weiter weg. Torsten hatte das Gattertor wie eine Schranke über die Straße gestellt.
Als Vidart den Kies des Hofes betrat, wurde er langsamer. Das machte die Hunde nur noch wütender. Jetzt erschien Torsten in Johans Blickfeld. Er hatte einen Rechen in der Hand und zog Streifen in den Kies.
»Mach doch mal das Tor auf!« rief Vidart.
»Kusch!« schrie Torsten. Die Hunde verstummten abrupt. Nun war nur das Geräusch der Rechenzinken im Kies zu hören. Doch dann rief Vidart:
»Mach das Tor auf! Ich bin doch mit dem Wagen da.«
Torsten reagierte nicht. Johan stand auf. Er wollte nicht länger zuhören. Er beugte sich vornüber an die Tür, blieb so stehen. Vidart sprach laut und schrill dort unten, als aber Torsten schließlich antwortete, waren nur dessen Worte noch zu verstehen:
»Ich seh keinen Kerl, dem ich aufmachen könnt.«
Wiederum schrilles Gerede. Vidarts Ziegenstimme. Wenn er nur sein Maul halten könnte! Daß er nicht kapierte, daß er jetzt besser Leine zog! Das Auto stehenließ. Und die Milch von der anderen Seite her mit dem Traktor holte.
Johan vernahm ein merkwürdiges Geräusch. Irgend etwas knackste. Er lief ans Fenster und sah hinunter. Torsten hatte den halben Rechenstiel in der Hand, am abgebrochenen Ende zersplittert und spitzig. Er mußte ihn übers Knie gebrochen haben. Vidart stand still und sah ihn groß an. Dann sagte er wieder etwas mit lauter, schnattriger Stimme, und da machte Torsten zwei große Schritte auf ihn zu und zielte mit dem Stiel auf seinen Hals. Die Ziegenstimme meckerte auf, und dann rannten sie beide in die Einhegung, Vidart vorweg. Er zog sein poliogeschädigtes Bein nach, und man sah, daß Torstens Rücken steif war. Trotzdem ging es schnell. Sie rannten an der Scheune vorbei und verschwanden dahinter.
Die Hunde begannen wieder zu bellen und hörten erst auf, als Torsten zurückkam, ohne den Rechenstiel. Als er bei der Veranda war, verschwand er aus Johans Blickfeld. Er schrie die Hunde an, daß sie kuschen sollten, und sie gehorchten ihm. Wenn Vidart gescheit gewesen wäre, hätte er das auch getan. Jetzt klirrte die Scheibe der Verandatür.
Durch die Zwischendecke war zu hören, daß Per-Ola etwas fragte und Torsten darauf antwortete. Dann sagte Per-Ola etwas, worüber die anderen lachten. Vidart war feig gewesen und geflohen. Das war es, worüber sie sich da unten amüsierten. Wenn er aber nach Hause gerannt wäre, hätte er in dem Teil der Einhegung auftauchen müssen, der nicht von der Scheune verdeckt wurde. Er wäre auf seinem Heimweg quer durch die Lehden die ganze Strecke über zu sehen gewesen.
Oder hatte er sich versteckt? In der Küche war es wieder still, und Johan hatte das Gefühl, daß sie so wie er dasaßen und darauf warteten, daß Vidart auftauchte. Es war völlig still in der Hitze. Die Hunde schwiegen. Durch das Fenster drang ein kräftiger Geruch nach Gras zu Johan herein. Es roch auch nach Birkenlaub. Torsten hatte die Vortreppe mit Laub geschmückt.
Johan saß ganz ruhig da und sah hin und wieder auf die Uhr. Elf Minuten waren vergangen, seit Torsten zurückgekommen war. Da schepperte die Verandatür. Jetzt trat der Vater heraus, gefolgt von Per-Ola. Nach einem Weilchen kamen Björne und Pekka und schließlich auch Väine. Sie gingen nicht zur Einhegung, sondern verschwanden hinterm Haus. Nach einer Weile hörte Johan zwei Autos anfahren.
Sobald das Motorengeräusch erstorben war, rannte Johan hinunter. Er dachte nicht. Er rannte lediglich die Treppen hinunter und aus dem Haus. In weniger als zwei Minuten war er hinter der Scheune. Vidart lag auf dem Rücken in der Sonne. Er hatte Blut am Hals. Es war ihm in die Drosselgrube gelaufen, wo er an einer Silberkette eine Marke oder Münze trug. Diese ruhte nun in einer seichten Blutlache und glänzte wie eine kleine Mondsichel. Ein Stück von ihm entfernt stand die gesamte Ziegenherde und glotzte Johan an. Nach einer Weile begannen sie wieder zu grasen.
Johan berührte Vidart leicht an der Hand und an der Wange. Vidart hatte graue Bartstoppeln. Er sah älter aus als gewöhnlich. Die Schirmmütze lag hinter seinem Kopf. Ein großer brauner Schweißfleck war darin. Er hatte ja eben erst die Ziegen gemolken, und das merkte man. Sein Körper und seine Kleidung rochen stark danach.
Es hatte keinen Sinn, nach Hause zu laufen und Hilfe zu holen. Das Haus war leer. Wenn Gudrun zu Hause gewesen wäre, hätte sie sich um Vidart gekümmert. Johan berührte erneut die blaßgraue Wange und fand, daß es sich anfühlte, als ob man einen großen Schafschwamm anfaßte.
Wieder rannte er. Er rannte über die Lehden auf den ersten Hof dort unten zu, es war Westlunds Hof. Elna empfing ihn auf der Vortreppe. Sie fing ihn auf, und er wußte nicht, ob er heulte oder sich übergab. Womöglich beides.
Birger hatte sich zusammen mit Åke Vemdal nach Svartvattnet aufgemacht. Fischen wollten sie. Jetzt an Mittsommer hätte es losgehen müssen. Aber es wurde sozusagen gleich von Anfang an das Übliche: Augenlider anheben und den trüben Augapfel ansehen, dessen Iris sich nach oben verdreht hatte. Den Puls am Handgelenk fühlen. Den Hals konnte er erst berühren, wenn er sich gewaschen hatte.
Immerhin gab es keinen Blutfluß zu stillen. Das Blut war in die Drosselgrube gelaufen und dort geronnen. Er zeigte Åke, wie nahe an der Halsschlagader es ihn erwischt hatte. Die Wunde hatte ausgefranste Ränder, so als wäre sie mit einem splittrigen Gegenstand beigebracht worden.
Vidart kam nach einer Weile wieder zu Bewußtsein. Er sei zusammengeschlagen worden, sagte er. Von Torsten Brandberg.
»Womit hat er zugeschlagen?«
»Mit der Faust.«
Sie halfen ihm aufstehen. Er konnte sich nur mit Mühe aufrechthalten.
»Mir dreht sich alles«, sagte er. »Mir wird schwarz vor Augen.« Birger brachte ihn jedoch auf die Beine. Er hatte das Gefühl, daß Vidart übertrieb. Daß er Åke Vemdal zeigen wollte, wie schlecht es ihm ging. Wo er doch nun einmal das verdammte Glück hatte, daß zufällig der Polizeichef von Byvängen da war, als das passierte. Und der Doktor. Er war jedoch eine ganze Weile bewußtlos gewesen, und Birger wollte nichts riskieren.
»Sie müssen ins Krankenhaus«, sagte er.
Vidart hatte nichts dagegen. Er machte sich jedoch Sorgen wegen der Milch. Sein stechender Blick war wieder da. Er sah verschlagen aus. Sobald er seine Mütze aufgesetzt hatte, war es, als sei er wieder ganz der alte. So ein Mist, daß ich gerade jetzt hier sein muß, dachte Birger. Er sagte es auch, gleich nachdem sie Harry Vidart in Westlunds Küche gebracht hatten. Sie hatten bei Westlunds vorbeigeschaut, weil Birger hören wollte, wie es Elna ging. Er hatte sie vor zwei Wochen wegen ihrer Galle nach Östersund geschickt. Assar rief Ivar Jonssa an. Ein Krankenwagen war nicht nötig. Ivars großes Taxi reichte.
Während sie darauf warteten, gingen sie auf die Veranda und rauchten eine. Birger wollte ein bißchen über Vidart und Torsten Brandberg erzählen, doch während sie dort standen, kam Vidarts Frau. Sie hatten sie natürlich angerufen. Die Haare auf große Lockenwickler gedreht, kam sie schluchzend angelaufen. Nachdem Ivar mit dem Mercedes gekommen war und sie Vidart geholfen hatten, sich auf den zurückgeklappten Sitz zu legen, rief seine Frau:
»Was soll ich denn mit der Milch machen? Und mit dem Auto?«
Assar Westlund sagte, daß er ihr die Milch mit dem Traktor nach Hause bringen werde.
»Den Duett läßt am besten erst noch so lange stehen«, meinte er. »Ich werd mit Torsten reden.«
Dann fuhr das Taxi, und Birger und Åke gingen zu dem Jungen hinein. Er lag auf einem weinroten Plüschsofa in der Stube. Elna hatte die Rollos heruntergezogen, und das bläuliche Licht machte sein Gesicht nur noch weißer. Er war nicht älter als sechzehn, hatte drahtiges schwarzes Haar und schmale braune Augen. Als er aufstand, zeigte sich, daß er groß und schlaksig war. Ansonsten glich er eher Gudrun als Torsten. Er reichte ihnen die Hand zum Gruß, und als sie sich gesetzt hatten, schielte er nach dem Eimer, den ihm Elna hingestellt hatte. Es war ein wenig Erbrochenes darin, und er schob ihn nun hinters Sofa. Er sah verlegen und zugleich ängstlich drein.
»Wie geht es dir?«
Er machte eine Bewegung, sagte aber nichts.
»Vidart ist auf dem Weg ins Krankenhaus«, sagte Birger.
»Aber es ist nicht so schlimm, er ist schon wieder auf den Beinen.«
Die braunen Angen weiteten sich. Hatte der Junge geglaubt, Vidart sei tot?
»Das ist Åke Vemdal. Weißt du, wer er ist?«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Ich bin der neue Polizeichef von Byvängen«, sagte Åke.
»Wer … wer hat das angezeigt?« wollte Johan wissen.
»Niemand hat das angezeigt. Wir haben hier bei Westlunds in der Küche gesessen, wie du gekommen bist. Wir wollten zum Fischen.«
»Was ist eigentlich geschehen?« fragte Åke.
»Ich weiß nicht.«
Er hatte die Arme auf die Schenkel gestützt und den Kopf gesenkt. Der braune Blick ließ sich nicht fangen.
»Aber du hast Hilfe geholt.«
»Ja.«
»Hast du gesehen, wie er zusammengeschlagen wurde?«
Er schüttelte den Kopf.
»Woher hast du dann gewußt, daß er dort liegt?«
»Ich habe gesehen, wie er gekommen ist.«
»Und daß Torsten hinter ihm her ist?«
Der Junge antwortete nicht, sondern sah nach dem Eimer und schluckte mehrere Male, wie um zu zeigen, daß ihm übel sei. Es war zwar heiß in der Stube, aber Birger bezweifelte, daß ihm jetzt wirklich schlecht war. Womöglich tat er nur so, um sich vor der Antwort zu drücken. Åke wartete eine Weile, dann fragte er:
»Hast du gesehen, daß dein Vater hinter ihm her ist?«
»Ich weiß nicht. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.«
»Hast du ihn gesehen? Hatte er irgend etwas in der Hand?«
Johan schwieg.
»Wir haben etwas gefunden«, sagte Åke. »Eine Art spitzen Stock. Abgebrochen.«
Da machte der Junge mit seinem langen Körper eine beinahe katzenhafte Bewegung, lag im nächsten Moment zusammengekauert auf dem Sofa und kehrte ihnen den Rücken zu.
»Warte«, sagte Birger leise. »Wir gehen in die Küche, dann erzähle ich dir die Hintergründe.«
»Kennst du sie denn?«
»Die kennen alle.«
Doch dazu kam es nicht. Aus der Küche waren laute Stimmen zu vernehmen, und dann ging die Stubentür auf, und Gudrun stand auf der Schwelle, alles Licht der Küche hinter sich, so daß ihr Gesicht fast schwarz war.
»Was machen Sie da?«
Sie ging zu Johan und faßte ihn an.
»Er hat zu dieser Sache nichts zu sagen«, erklärte sie. »Er hat bloß für Vidart Hilfe geholt.«
»Wir müssen ihn vernehmen, um zu erfahren, was passiert ist.«
»Den Teufel müssen Sie«, versetzte Gudrun. »Es ist nichts passiert, was er gesehen hat.«
Sie war klein. Es sah eigenartig aus, wie sie den großen Jungen vom Sofa hochzog und ihn mit sich hinausschubste. Er hatte den Kopf gesenkt. Åke ging ihnen nach.
»Diese Sache wird untersucht werden, das wissen Sie.«
»Untersuchen Sie nur. Aber Johan sagt nicht gegen seinen Vater aus.«
Sie schob den Jungen hinaus und warf die Küchentür zu.
Åke tat einen Schritt, als wollte er sie zurückhalten, doch Birger sagte:
»Laß sein. Jetzt kannst du ihn ohnehin nicht vernehmen.«
Sie hörten, wie Gudrun den Motor anließ und wegfuhr. Elna und Assar saßen nebeneinander auf der Bank. Sie wirkten wie Gäste in ihrer eigenen Küche.
»Wir gehen raus«, sagte Birger.
Es war nicht so einfach, Åke, der von nichts wußte, etwas über Torsten Brandberg und Vidart zu erzählen. Er war bis jetzt überhaupt noch nie in Svartvattnet gewesen. Doch es gehörte zu seinem Bezirk. Er kam aus Dorotea und hatte seinen Dienst vor ein paar Monaten angetreten. Sie waren einmal zusammen unterwegs gewesen. Da war es in Richtung Grenze um einen Selbstmord gegangen. Åke hatte niemanden gehabt, den er hätte schicken können, und auch kein Auto. Ein alkoholisierter Bauernsohn war auf den Dachboden gestiegen und hatte sich mit einer Schrotflinte erschossen. Als sie sich mehrere Stunden später ins Auto gesetzt hatten, um zurückzufahren, war es Birger, als hörte er einen Vogel schreien. Erst im nachhinein verstand er, daß das die Mutter gewesen war.
Birger hatte im Vorsommer bei ihnen vorbeigeschaut, als er in der Nähe einen Krankenbesuch gemacht hatte. Da war die Mutter in die Frösökliniken eingeliefert worden, und der Vater saß in der Küche. Er hatte ziemlich lange nur von Kaffee und Zigaretten gelebt und brach zusammen, als Birger kam. Es war das erste Mal, daß er nach dem Tod seines Sohnes weinte. Birger war auf den Dachboden gegangen, um nachzusehen, ob sie saubergemacht hatten. Die Flecken waren jedoch noch da, und an der Decke waren vertrocknete Hirnsubstanz und die Einschläge der Schrotladung zu sehen. Eine zerschossene Glühbirne hing noch an ihrer Schnur. Mit einer Scheuerbürste und einem Schaber machte er, so gut es ging, sauber. Dann sorgte er dafür, daß der Mann, der jetzt allein war, eine Hauspflege bekam, die für ihn kochte.
Åke und er hatten sich beim ersten Besuch dort und auf der langen Heimfahrt kennengelernt.
»Ich kenne Johan«, sagte Birger. »Er geht in Byvängen aufs Gymnasium und ist mit meinem Jungen in einer Klasse. Er ist ein gescheiter Kopf. Aber nur seine Mutter, Gudrun, meint, daß er weitermachen soll. Die andern Jungs sind die Söhne von Torsten und seiner vorigen Frau Mimmi. Sie ist bei Väines Geburt an Hirnblutung gestorben. Damals kam Gudrun, um Torsten mit den Jungs und im Haushalt zu helfen. Sie stammt aus einem großen Samigeschlecht. Aber von der armen Seite. Sie hat für Torsten gearbeitet, und dann ist sie schwanger geworden und hat Johan zur Welt gebracht. Ein knappes Jahr nach Mimmis Tod. Väine und Johan sind also praktisch gleich alt.«
»Sind sie alle miteinander Sami?«
»Nein. Nur Gudrun. Torsten war noch nie ein Freund der Sami. Der Lapp sollt nicht im Dorf wohnen. Das ist seine Meinung, und damit steht er nicht allein. Torsten war schon immer ein Mordsraufbold. Wenn er sich in jungen Jahren hat volllaufen lassen, hat er die Leute gefragt: ›Weißt du einen, der verprügelt gehört?‹ Er hat es fertiggebracht und ist bis nach Byvängen fahren, nur um einen Kerl zusammenzuschlagen. Ich glaub nicht, daß es zwischen Johan und seinen Halbbrüdern jemals gestimmt hat, und zwischen ihm und seinem Vater ebensowenig. Aber du hast ja Gudrun gesehen. Wenn sie dabei ist, krümmen sie dem Jungen kein Härchen. Du siehst also, daß es Johan schlecht ergehen kann, wenn sie sich in den Kopf setzen, daß er Torsten verpfiffen hat.«
»Das kann man doch erklären. Er hat ja nicht gewußt, daß wir da sind.«
»Ich wage zu bezweifeln, daß sie darauf hören«, erwiderte Birger.
Sobald sie in der Diele waren, bedeutete sie ihm mit einer Kopfbewegung, daß er auf der Stelle in sein Zimmer hinaufgehen solle. Nach einer Viertelstunde brachte sie ihm Käsebrote und ein Glas Milch. Johan saß auf dem Bett und hatte sich nicht einmal zur Toilette getraut. Er fürchtete, Torsten würde ihn hören. Gudrun sagte jedoch, daß von den anderen noch keiner zu Hause sei. Da ging er auf die Toilette bei der Diele, und es kam ihm vor, als pinkelte er eine Viertelstunde lang.
Gudrun saß am Schreibtisch und starrte in die Einhegung hinunter, als er zurückkam. Sie sah verdrossen aus, saß da und biß sich Hautfetzchen von den Lippen. Er hatte sich schon immer elend gefühlt, wenn sie verdrossen war. Meistens war es ja seine Schuld. Torsten reizte er, und die Brüder regte er auf.
»Ich hab nicht gewußt, daß die Polizei dort ist«, sagte er.
»Du hast keinen Fehler gemacht«, erwiderte sie. Er fand, daß es mechanisch klang. Er fragte sich, was sie wohl dachte. Ihm ging durch den Kopf, daß sie alles über ihn wußte. Fast alles jedenfalls. Aber er wußte über sie nichts. Sie war seine Mutter, und alles, was sie in der Küche und im Garten tat, war vorhersagbar. Fast alles, was sie sagte, ebenfalls. Aber das Wesentliche wußte er nicht. Nichts über die Zeit, als sie schwanger war. Nichts über sie und den Mann mit dem Scooter. Oder warum sie schließlich Torsten geheiratet hat.
»Wenn er wegen Körperverletzung verurteilt wird, dann nehmen sie ihm wohl seine Waffen weg?« meinte er.
»Noch ist er nicht mal angeklagt.«
»Ich meine nur, falls er es wird. Denn dann kann er ja die Jagd nicht leiten.«
»Hör jetzt auf«, sagte Gudrun. Sie schien zu glauben, er wollte, daß Torsten seine Lizenz verlieren würde. Dann begann er ihr zu erzählen, was er tatsächlich vom Fenster aus beobachtet hatte. Doch sie wollte es gar nicht hören.
»Bleib jetzt ein Weilchen hier«, sagte sie. »Ich werde dann mit Torsten reden.«
Sie wirkte müde, als sie sich erhob. Sie hatte sich fein gemacht, trug eine weiße Baumwollstrickjacke über einem kleingeblümten Kleid und Sandaletten mit hohen Absätzen. Ihr Gesicht sah jedoch wieder alltäglich aus, denn als sie auf dem Bett gesessen hatte, hatte sie sich den Lippenstift weggebissen.
Nach einer Weile hörte er sie in der Küche. Eine Schranktür knallte, Porzellan klapperte. Sie räumte die Geschirrablage aus. Das waren gewohnte Geräusche, und sie beruhigten ihn.
Gegen halb sieben kamen die Autos zurück. Er hörte, daß die Stimmen der Brüder laut und heiser waren. Sie hatten offensichtlich einiges intus. Torsten lachte über etwas, was Väine gesagt hatte. Gudrun briet jetzt Fisch, der Geruch drang zu Johan herauf. Sie aßen ihr verspätetes Abendessen jedoch, ohne daß sie ihn rief. Er saß in seinem Zimmer eingeschlossen, als hätte er etwas verbrochen.
Er war der einzige der Brüder, den Torsten niemals geschlagen hatte, Gudrun hatte ihn beschützt. Doch er, der niemals Schläge bekommen hatte, war derjenige, der sich am meisten davor fürchtete. Und das wußten sie. Gudruns Schutz machte ihn lächerlich.
Er stand auf und ging hinunter. Auf halber Treppe bekam er jedoch Angst. Nicht davor, daß sie ihn schlagen würden. Doch vor Torstens schweren, halbgeschlossenen Augen, seinem Lauern, wenn er betrunken war. Und vor den schnellen Bewegungen der Brüder, mit denen sie ihn erschrecken wollten. Da beschloß er, fischen zu fahren.
In diesen Vorsommernächten fischte er am Hundtjärn, der gleich neben dem Almweg lag. Von dort aus sah er, ob jemand zum Falkenhorst am Lobberåa ging. Daß die Attacke von der großen Straße her käme, glaubte er nicht. Henry Strömgren sah jedes Auto dort oben. Im Sommer zuvor waren zwei Jungvögel verschwunden.
Seine Jacke hing in der Diele, die Angel und seine Stiefel standen im Flur. Er achtete darauf, nicht mit der Angel zu klappern, doch als er draußen war und das Moped angeworfen hatte, trieb er es ordentlich hoch, damit sie nicht glaubten, er würde vor ihnen auskneifen. Er wußte, daß sie ihn sahen.
Würmer holte er sich oben bei Alda, denn dort stellte er immer sein Moped ab und lief zum Hundtjärn hinauf. Die alte Frau war im Pflegeheim, und rings um die Vortreppe schoß das Gras bereits in kräftigen Büscheln in die Höhe. Wie üblich hackte er hinter ihrem Brennholzschuppen nach Würmern.
Auf dem Abfallhaufen ein Stück im Wald fand er eine Konservendose, und im Brennholzschuppen stand eine alte Kartoffelhacke. Er hatte gerade ein paarmal damit gehackt, als er ein Auto hörte. Es rutschte im Kies, wenn es in die Kurve ging. Fast im selben Augenblick, da es hielt, schlugen die Türen. Er lauschte auf Stimmen und Schritte.
Die Brüder umringten ihn, noch ehe er darüber nachdenken konnte, ob er davonlaufen sollte oder nicht. Er stand mit der Kartoffelhacke in der Hand da, und sie umstellten ihn und taten spielerisch. Sie traten von einem Bein aufs andere, wie Fußballspieler, die auf den Anstoß warteten. Er roch Rasierwasser und Bier, als sie näherkamen.
Sie mußten mitten im Essen aufgestanden und ihm gefolgt sein. Gudrun hatte sie nicht zurückhalten können. Sie hatte es sicherlich versucht.
Er verstand, daß nun etwas Neues begann. Es hatte bereits begonnen, als er das Haus verlassen hatte, auf das Moped gestiegen war und es hochgetrieben hatte, um ihnen zu zeigen, daß es ihm egal war, ob sie ihn sahen.
Er rammte die Hacke in die braune Erde, die voller Nesselwurzeln und Glasscherben war. Dann nahm er seine Angel und die Dose mit den Würmern und ging den Almweg hinauf. Sie folgten ihm, schubsten ihn von allen Seiten und fragten, wovor er denn Angst habe. Er begann zu laufen, obwohl er das gar nicht wollte. Da kam ihm Väine nachgestürmt und stellte ihm ein Bein, so daß er hinfiel. Pekka packte ihn am Arm und riß ihn wieder hoch.
»Steh auf, verdammt noch mal!«
»Was wollt ihr?«
Björne jagte ihm die Faust in den Bauch. Obwohl er nicht mit voller Wucht zuschlug, krümmte sich Johan, so als verbeugte er sich, und da lachten sie alle. Während er noch mit dem Brechreiz kämpfte, nahm er den Duft des Waldes wahr. Aber es gab keinen Weg dorthin. Sie waren auf allen Seiten. Per-Ola und Pekka hatten sich Zigaretten angezündet. Björne schüttelte den Kopf, als sie ihm eine anboten, und schob sich einen Priem in den Mund. Der entstellte seine Oberlippe, sie wirkte geschwollen. Er stand, wie so oft, mit offenem Mund da und glotzte Johan an. Aber er schien nicht noch einmal zuschlagen zu wollen.
»Wovor hast denn Angst?« fragte Pekka. »Willst du nicht die Polizei rufen?«
»Meine Fresse, wie stehst du bloß da? Hast Angst, daß du dir in die Hosen pinkelst?« fragte Väine, und die anderen lachten. Väine würde hiernach als ganzer Kerl gelten. Jetzt schlug er zu, aber nur spielerisch und nicht ins Gesicht. Sie ließen ihn gewähren. Womöglich fürchteten sie um ihre Kleider, denn sie hatten sich umgezogen und trugen helle Hosen und Jacken.
Väine wurde immer gereizter, als Johan sich duckte, ohne sich zu verteidigen. Er konnte nicht zeigen, wozu er taugte. Da ging er zu Karateangriffen über und bremste seine steife Hand erst kurz vor Johans Gesicht.
Björne und Pekka hatten sich kurz von den anderen entfernt. Irgend etwas schepperte ein Stück weiter oben im Wald. Dann kamen sie zurück, und Pekka sagte zu Väine:
»Hol das Abschleppseil.«
Sie fesseln mich, dachte Johan. Sie stellen mich gefesselt an eine Tanne. Und dann gehen sie. Das ist alles. Mehr trauen sie sich nicht wegen Gudrun. Oder wegen der Polizei.
Aber Pekka fesselte ihn nicht, als er das Abschleppseil in Händen hatte. Er legte es Johan lediglich um den Körper, unter die Arme, und zog zu. Es fühlte sich an, als habe er eine Schlinge gemacht. Dann schubsten sie ihn vor sich her. Sie wichen ein wenig vom Almweg ab. Zwischen den Tannen sah er einen halb verrotteten Holzdeckel an einem Stein lehnen. Mit Fußtritten trieben sie ihn an den Rand eines runden, mit Steinen ausgelegten Schachts. Da schrie er.
Als sie ihn in die Öffnung hinunterlassen wollten, leistete er so viel Widerstand, wie er nur konnte. Er trat zu, biß einen von ihnen in den Arm und erhielt einen Schlag in den Nacken. Dann stürzte er und verspürte einen heftigen Schmerz, als die Seilschlinge vom Gewicht des Körpers zugezogen wurde.
Er hing mit schweren Beinen an dem Seil, das sich ihm unter den Armen tief eingeschnitten hatte. Wasser fühlte er noch nicht. Über sich hörte er ihre Stimmen, verstand aber nicht, was sie schrien. Dann fiel er.
Er wachte auf und befand sich auf dem Grund eines Brunnens. Der war versiegt, soviel begriff er, und zu Aldas Zeit vielleicht nie benutzt worden. Er saß halb im Matsch des lehmigen Wassers und hatte das Seil um den Körper. Zuerst dachte er, daß er sich etwas gebrochen habe, doch als er vorsichtig seine Glieder bewegte, merkte er, daß es nur dort weh tat, wo das Seil zwickte. Er trug einen dicken Hellyhansenpulli, und dank diesem hatte sich das Abschleppseil nicht so fest eingeschnitten. Den Knoten und das Seilende bekam er nicht zu fassen. Die mußten beide auf dem Rücken sein. Er versuchte sich in dem engen Raum zurechtzusetzen und blickte nach oben. Die Brunnenöffnung war fast weiß vom Licht des Sommerabends. Es zeigte sich kein Gesicht dort oben. Und er hörte auch nichts.
Er saß in lockerem Gemengsel und Wasser. Auf dem Grund waren Steine. Er wackelte, um von einem, der ihn drückte, wegzukommen. Dann tastete er nach seinem Messer, um damit das Seil abzuschneiden. Als er es erwischt und das Nylonseil durchtrennt hatte, nahm der Druck ab, und er arbeitete sich in den Stand empor. Gebrochen war nichts. Es war schwer abzuschätzen, wie tief der Brunnen war. Der helle Kreis hoch oben war inzwischen blau geworden. Er sah jetzt auch ein bißchen mehr von den Brunnenwänden. Das Wasser reichte ein Stückchen über den Fuß seiner Stiefel.
Immerhin hatten sie den Deckel nicht aufgelegt. Sie würden bald zurückkommen und ein Seil herunterlassen. Recht bald. Sie wollten bestimmt nicht, daß jemand anders seine Hilferufe hörte.
Aber er hatte nicht die Absicht, zu rufen. Wahrscheinlich saßen sie im Auto und warteten darauf, daß er anfing, um Hilfe zu schreien. Er ging immer weg, wenn sie jemanden anpöbelten. Es war gräßlich, zuzusehen, wenn Leute zusammengeschlagen wurden. Doch hier unten auf dem Grund des Brunnens spürte er, daß er etwas in sich hatte, von dem sie nichts wußten. Er würde nicht schreien. Dieser Spaß sollte ihnen nicht gegönnt sein. Diesen verfluchten Scheißkerlen.
Das Stehen ermüdete ihn. Er versuchte sich auf verschiedene Weise mit dem Hintern und den Unterarmen an die Brunnenwände zu lehnen, um den Druck zu vermindern. Es stach und schmerzte in den Beinen und im Rücken. Auf die Dauer würde er sich nicht aufrecht halten können.
Wie lange würden sie ihn hier stehenlassen? Eine Stunde? Oder bis in die Nacht? Das schlimmste wäre, wenn sie ins Dorf hinunterführen und sich zu sehr vollaufen ließen. Dann vergäßen sie ihn, und er würde erst spät am Mittsommertag geholt werden. Gudrun würde nach ihm suchen, wenn er nicht nach Hause käme. Sie würde das Moped entdecken, wenn sie mit dem Auto umherführe. Zu rufen lohnte sich deshalb wahrscheinlich erst in den späten Morgenstunden. Aber er wollte nicht rufen. Dieses Mal sollte Gudrun nicht mit ihm nach Hause kommen. Damit war jetzt Schluß.
Sie nahm Mia bei der Hand und ging zum Ufer hinunter. Nahe am Wasser stand ein Haus. Ein altes, ungestrichenes Holzhaus, zerfressen von Regen und Alter. Verwildertes Grün um die Hütte: Büschel von Wiesenkerbel blühten zusammen mit Akeleien in Rabatten, in denen die Erde abgesunken und mausbraun getrocknet war. Johannisbeersträucher wuchsen ineinander und hatten ein Gestrüpp von Zweigen ausgesandt, die Wurzeln geschlagen hatten. Am Hang zum See waren die Himbeersträucher undurchdringlich zusammengewachsen. Das Gras reichte Mia bis zur Taille, und bei der Vortreppe stand ein Dickicht aus Nesseln. Sie wollte nicht länger durch die grüne Masse gehen, die vor Insekten sang. Ein Geruch nach Kräutern und Gift lag darüber.
Annie hob Mia auf einen Brunnendeckel aus Zement und ließ sie dort warten, während sie zum Wasser hinunterging und eine Flasche füllte. Doch Mia wollte das Seewasser nicht trinken. Sie schüttelte den Kopf und preßte die Lippen zusammen. Das Wasser war völlig klar. Es war bis hinab auf den braunen Grund mit den unbeweglichen Steinen wie Glas. Doch Mia trank nicht.
Der Laden, weiß gestrichen und mit den Wimpeln der zwei Länder über der Tür, lag nur wenige Schritte von dem Haus mit den Nesseln entfernt. Der Platz vor den Tanksäulen wurde von den Resten eines vermorschten Zauns begrenzt. Er hatte vermutlich zu einem Häuschen gehört, das jetzt verschwunden war. Ein länglicher, grüngestrichener Holzbau, wahrscheinlich ein Vereinshaus oder ein Versammlungslokal, lag neben einer gezimmerten Scheune, die unter ihrem Schindeldach zusammengebrochen war. Auf der anderen Seite stand ein Haus, in dem offensichtlich jemand wohnte, denn im Erdgeschoß hingen in allen Fenstern dichte, gefältelte Gardinen aus Nylonspitze. Das Dachbodenfenster hatte hingegen ein großes Loch, das mit einem Lumpen zugestopft war. Die andere Fensterhälfte bestand aus einer Masoniteplatte.
Sie fand, daß das Dorf, das jetzt nach dem Rummel bei der Ankunft des Postbusses ganz still dalag, schwer zu verstehen war. Verfall und Verlassenheit lehnten an Neubauten und Ausbesserungen. Warum rissen die Leute die eingestürzten und morschen Gebäude nicht ab? Sahen sie sie gar nicht mehr?
Die Dorfbewohner sahen vielleicht nur das, was es auch in größeren Orten gab. Sie sahen Modernität und Entwicklung, wo sie, Annie, Zerfall und Niedergang sah. Und Dan Ursprünglichkeit. Denn weder in den Briefen noch in den kurzen Telefonaten, die er vermutlich aus der Zelle neben dem Laden geführt hatte, hatte er das Dorf so beschrieben, wie sie es jetzt in dem klaren Abendlicht sah.
Das Grün war obszön. Sie dachte an eine allzu dichte Schambehaarung (wie man sie in der Badeanstalt sieht und den Blick abwendet). Dies hatte sie nicht erwartet. Eher eine Art Kargheit. Spärliche, blasse Farben. Doch alle Vorstellungen, die ihr in den Wochen des Wartens und der Unruhe deutlich vor Augen gestanden hatten, verflogen.
Sie spazierten zu ihren Taschen und setzten sich hin, um zu warten. Auf der anderen Straßenseite waren grasbewachsene Hänge, die in der Sonne leuchteten. Die Wiesenblumen hatten kräftigere Farben, als sie je gesehen hatte. Gegenüber dem Laden stand ein kastenförmiges, grün und dunkelbraun gestrichenes Haus. Das Kellergeschoß lag hoch, denn das Haus stand an dem steilen Hang. Dort war ein kleiner Laden; auf einem Holzschild stand Fiskebuan eingebrannt. An einer Stange, die schräg aus der Wand ragte, hing eine schwedische Flagge. Drinnen war undeutlich ein Mann zu sehen, und Annie nahm Mia bei der Hand und ging über die Straße.
Die Tür war abgeschlossen, doch er öffnete, als sie klopfte. Er verkaufe keine Erfrischungsgetränke, doch Mia könne gerne Saft haben, sagte er. Annie brauchte den Saft und die Semmeln, die er aus der Küche im oberen Stockwerk holte, nicht zu bezahlen. Dafür mußte sie seine Neugier stillen.
Er hatte graumeliertes, nach vorn gekämmtes Haar, das im Nacken und um die Ohren herum lang war, und er trug Hosen mit ausgestellten Beinen. Sie fand, daß diese enggeschnittenen Hosen idiotisch, ja beinahe anstößig aussahen. Doch die Mode war bis hierherauf vorgedrungen, und das hatte sie ebenfalls nicht erwartet. Er sah verbraucht aus. Unter den Augen hingen ihm faltige, schlaffe Säcke auf die Wangen. Seine Nase war groß und grobporig, und er hatte schwere Augenlider. Doch er wirkte alles andere als müde.
Sie erzählte ihm so wenig wie möglich. Daß sie abgeholt würden. Daß sie auf dem Weg nach Nilsbodarna seien. Er fragte, ob sie Nirsbuan meine. Was sie dort wollten?
»Wir werden dort wohnen«, sagte Mia schroff. Sie hatte bisher Saft getrunken und Semmeln gegessen, ohne einen Ton zu sagen. Er lachte. Dieses Lachen vergaß Annie nie. Da kam ihm ein Gedanke:
»Gehört ihr zu den Stjärnbergleuten?«
»Wir kommen aus Stockholm«, erwiderte sie. Aber seine Vermutung war gar nicht so dumm. Schließlich hatte Dan Nilsbodarna dank der Kommune in Stjärnberg gefunden.
»Da schau an, ihr wollt Brandbergs Nirsbuan wegnehmen. Das wird freilich nicht leicht sein«, grinste er. Sie verstand nicht, was er meinte. Sie mochte ihn nicht. Jetzt wollte sie nicht weiter über ihre Verhältnisse reden.
Da hörten sie ein Auto, und Mia stürzte ans Fenster. Aber es war nicht Dan. Es waren vier Mannsbilder, die aus einem großen Volvo stiegen, dem, als er bis dicht vors Haus gefahren war, der Kies um die Reifen spritzte. Genaugenommen waren es drei junge Männer und ein Junge, der am Steuer saß. Er konnte kaum achtzehn Jahre alt sein. Sie verbreiteten eine Duftwolke von Rasierwasser und Branntwein, als sie in den Laden traten. Einer von ihnen war weiß gekleidet und hatte Lehmspuren auf der Hose. Es sah aus, als ob ihn jemand getreten hätte. Die Hose war eng und der Stoff dünn. Annie konnte deutlich seinen Hodensack und sein Glied sehen, die sich am Schenkel abzeichneten, und sie mußte den Blick abwenden, als er sie ansah. Sie hatten sich für die Ereignisse des Mittsommerabends angezogen, und wieder sah sie, daß hier oben die Mode befolgt wurde; sie kam sich mit all ihren Vorstellungen kindisch vor.