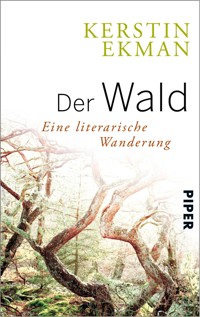5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ann-Marie, Mutter der 17jährigen Elisabeth, kehrt nach vielen Jahren aus Portugal nach Schweden zurück. Während des Wartens auf ihre verschwundene Tochter erinnert sie sich wichtiger Stationen ihres Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Neuer Malik Verlag erschienenen Buchausgabe
1998
ISBN 978-3-492-95762-5
© 1983 Kerstin Ekman Titel der schwedischen Originalausgabe: »En Stad av Ljus«, Albert Bonnier Förlag A.B., Stockholm Deutschsprachige Ausgabe: © 1992 Neuer Malik Verlag, Kiel Umschlaggestaltung: Petra Dorkenwald/Dorkenwald-Design, München Umschlagmotiv: Milan Kuminowski/Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Das Haus
Ich bin in der Krone der Linde, und sie blüht, blüht. Der Sommer ist schon vorgerückt, seine Winde sind schwer und warm. Alles, was mein ist, habe ich hier bei mir. Ich habe es als Nahrung mitgenommen.
Alles, was ich je gesehen habe, ist durchstrahlter, wirbelnder Staub, und ich baue eine andere Stadt daraus; andere Räume, Straßen, Gräber, Bäume baue ich da oben in dem duftenden Wind.
Der Schlaf ist warm und salzig wie Meerwasser. Über der Brust liegt ein Sonnenbalken, doch den sehe ich nicht, und ich spüre auch die Hitze nicht, durch die mein Körper feucht geworden ist und die mir das Nachthemd auf die Haut geklebt hat.
Eine Fliege trippelt auf dem Arm, und die Schwalben schreien pfeifend, wenn sie durch die Luft tauchen. In Wellen kommt der Geruch nach Menschen, Autos, Schlafzimmern, Erdhaufen, Unrat. Die Fliegenfüße senden Signale durch meine Haut, und jetzt werde ich in die Stadt um mich herum, hinab in den Kies und das Eisen auf dem Grund einer Grube geboren.
Das Geräusch komprimierter Luft durch ein Mundstück. Saurer Geschmack, feuchter Kissenbezug und ein Balken aus Staub in der Sonne. Ich erwache, und zwischen dem Gaumendach und dem Gehirn spricht es ohne Ton: »Hölle, Hölle, Hölle.«
Die Pantoffeln. Vademecum und Wasser. Die Kranzschlinge habe ich in die Wanne gestellt, weil ich sie gestern mit Wasser besprengt habe. Im Bad ist es feucht. und das Licht der bald ausgedienten Fünfundzwanzigwattbirne ist schonungsvoll. Während ich pinkle. rinnt, stark und konzentriert, die Nacht aus mir heraus. Sie erfüllt die Luft um mich herum mit ihrem Geruch. einem durchdringenderen als dem der Kranzschlinge. Der Tag beginnt ernstlich, als ich hinunterspüle.
Heißer Tee. Die Sonne wärmt meine Hände. Noch ist nichts geschehen. Das Telefon hat nicht geklingelt. Ich habe die Zeitung nicht aufgeschlagen. Es ist gut, morgens etwas zu essen. und die Fliegen spazieren über das Wachstuch auf meinen Arm. »Klein und glücklich, klein und glücklich«, trippeln ihre Füße.
ich will meine Ruhe haben. Ich habe keine Lust zu öffnen, wenn es klopft. So will ich mein Gesicht nicht zeigen, grauschwarz unter den Augen, zerbrechlich wie billiges Glas. Ich muß jetzt Ann-Sofie ähnlich sehen. Vielleicht gleiche ich ihr mehr als im Alter von acht Jahren. Sie bildeten einen Kreis und tanzten um uns herum. Das ergab sich spontan, wie man so sagt. Seidenschleifen im Haar, Unterhosen mit Urinflecken. Bottinen mit Schnallen, die wie kleine Kastagnetten unablässig zu dem Gesang – oder der Messe – schlugen. Eine schwarze Messe war das, nein, eine graubraune. Spontane Bosheit, ritualisiert.
Ich bleibe am Küchentisch sitzen. Nur ich bin da. Nur ich, das Papier. die Federspitze, die Tinte. Ich verändere mich. Mit jedem Wort verwandle ich mich. Ein Alphabet kriecht aus mir hervor, es bewegt sich über das Papier wie Kleingetier auf einem Flußgrund. Ich krieche aus einem Alphabet hervor; ich bin nur Beweglichkeiten, Reflexe auf einem Grund aus Sand, Bewegungen des Wassers und die Lichtblitze, das bin ich. Die Federspitze schreibt mich.
Ich treibe die Schrift auf das Papier. Nein. die Tinte treibt mich wie Regen, wie einen trockenen Grasbrand über die Seiten. Sie hinterläßt eine Schrift in mir, Spuren im Fleisch, mit Tinte gefüllte Narben. Nur ich bin es, nur die Federspitze, die sich bewegt. Schrift.
Vor ein paar Jahren fuhr ich heim, um ein Haus zu verkaufen. Ich saß im Zug und blickte auf den düsteren Fichtenwald. Ich sah die Seen und die Schlösser, die sich darin spiegeln. Es ist eine schöne Landschaft, doch die Schönheit endet etwa eine Meile* vor der Stadt meiner Kindheit. Der Wald wird dicht, die Böden mit Erlen und Weidengestrüpp versauern zu Moor. Wenn sich die Kiefernheiden öffnen, liegt sie da und in ihr, wie die Rückengräte in einem aufgeschlitzten Strömling, die Eisenbahn. Auf platten Feldern erstreckt sich die Bebauung einiger Jahrzehnte. Sie ist wie andere Ortschaften, die ich kurz zuvor gesehen hatte, die vorbeizogen und in die Zeit und den Wald zurückgedrängt wurden.
Sie beginnt mit Baracken und Stapeln von arsenikimprägniertem Holz. Dann kommen langgestreckte Werkstattgebäude und Mietshäuser mit Flecken im Putz. Wenn das alte Postgebäude mit den Laubgirlanden aus Zement unter dem schadhaften Reichswappen vorübergleitet, mache ich gewöhnlich die Augen zu. Manchmal wünsche ich mir, daß die Stadt in einen Schacht des Vergessens sänke, in ein altes Grubenloch in meinem Innern, das sich langsam mit Wasser füllte.
Einst war hier nichts als Wald und graue, schiefe Katen. Zwischen Laggs und lichter Kiefernheide öffnete sich ein Haferfeld. Ein Kiesrücken, den ein Eiszeitfluß hinterlassen hatte, lag wie ein großer Körper mitten in der Landschaft. Noch hatte kein Weg ihn durchschnitten. Ich versuche mir immer vorzustellen, daß da keine Schienen und kein Bahndamm wären, niemals gewesen wären, daß gepflügte Haferparzellen und braunschimmernde Weiden zum Vorschein kämen, wenn die lange Krankheit des Winters überwunden wäre. Daß Menschen in \Vagen auf gewundenen Wegen dahinschaukelten und daß es still wäre, still. Misthaufen und offene Gräben. Hundegebell und Kirchenglocken, die man weithin hörte. Die Veränderungen in jedem Jahr so gering, daß man sie kaum merkte. und überall diese Stille, von der ich nicht viel wissen kann. Vielleicht stank sie beißend und unverhohlen. Ja, Stille und stete Wiederkehr müssen es gewesen sein. Bis die Eisenbahnschienen wie ein Band hämmernder, scheuender Zeit durch die Landschaft gelegt wurden.
Man begann Bauholz zu transportieren. Behauenen Stein. Eisenträger. Ziegel. Von Hand bearbeitete Sparren. Auch Sprossenbänke und Deckenrosetten aus Gips. Die Schienen dröhnten und sangen unter den Güterwagen, wie seitdem immer. Seltsam. sich vorzustellen, daß es entlang der Bahnlinie nicht einmal während der schlimmsten Schneestürme ganz still gewesen ist. Immer hat sich im Schneegeflimmer und Aufblitzen der Laternen ein Zug bewegt. Langsam stampfend hat er sich mit den ausgebreiteten gewaltigen eisernen Schwingen des Pfluges vorangearbeitet. Der erste Zug, der auf dieser Strecke abfuhr, hatte die Endstation noch nicht erreicht, als auch schon dem nächsten freie Fahrt gegeben wurde. So ist das weitergegangen, ohne Unterlaß. Die Zeit kennt keinen Aufenthalt, auch nicht für eine einzige schneeige Weihnachtsnacht.
Menschen waren mit Koffern und Bündeln nach Göteborg gefahren, um zu emigrieren. Beamte waren bei Häuseransammlungen auf lehmigen Äckern ausgestiegen, um daraus Gemeinden zu machen. Die Leute waren fortgereist, um zu arbeiten oder zu heiraten, und heimgereist, um um Verzeihung oder Geld zu bitten oder um jemand zu beerdigen. So, wie ich heimfuhr, um das Haus zu verkaufen. Nach einigen Jahren ist es vergessen. oder Nutzen und Bedeutung dieser Reise sind ebenso schwer auszumachen wie die der meisten anderen.
Jungen waren zwischen den Stationen in Erster-Klasse-Abteilen schwarzgefahren. Hat Fredrik mir das erzählt? Als Jenny und er frisch verlobt waren, fuhren sie, einfach so, eine Meile weit weg. Das hat sie erzählt. Sie wollten nur allein sein. Sie gingen auf dem Gleis zurück und ließen einander die ganze Zeit nicht los. Sich vorzustellen, daß Jenny und Fredrik sich beim Gedröhn des Göteborgzuges, der hellerleuchtet und nach Eisen riechend an ihnen vorbeidonnerte, nachdem sie die Böschung hinabgeschlüpft waren, mit vor Kälte schmerzenden Lippen küßten!
Tora Otter erzählte, daß ein Mann aus dem Kirchspiel Vallmsta eines Abends im Dezember, als er auf der Bahnstrecke heimging, dem Erlöser begegnete. Er war aus Guttersboda und hatte im Ort eine Versammlung besucht. Gottes Sohn kam ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen, und er brauchte natürlich nicht auf den Abstand zwischen den Eisenbahnschwellen zu achten, die von einer dünnen Eisschicht überzogen im Sternenlicht glänzten. Unmittelbar bevor sie sich trafen, löste sich die Gestalt auf. Sie verschwand wie eine Eisblume auf einer Fensterscheibe, wenn man ihr mit seinem heißen und eifrigen Atem zu nahe kommt. Guttersboda-Petter war auf die Knie gefallen, mußte jedoch wieder aufstehen und seine Schritte mühsam jedem Stück ölbeflecktem Schotter, der zwischen den einzelnen Holzschwellen lag, anpassen.
Diese Begegnung bekam für niemand außer Petter und seine nächste Umgebung eine besondere Bedeutung.
Das, was die Orte entlang der Bahn verändert hat, dürfte die Materie sein, die damit transportiert worden ist: all das gehobelte Holz und die von Hand bearbeiteten Sparren, der behauene Granit, die Porzellanklosetts und Himmelbetten haben ihr Teil zu der Veränderung beigetragen. Menschen, die sich nie begegnet wären, hätte man die Gleise nicht verlegt, vermischten sich auf Sofas und in Betten.
Die ersten, die sich um den Bahnhof herum niederließen, verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Elementarsten: sie verkauften Essen und Getränke. Die allererste war Banvalls-Brita, die an die Tiefbauarbeiter Essen und Branntwein verkaufte. Es heißt. sie habe sie gegen Bezahlung auch ihren Körper benutzen lassen. Schon da kam es zu Vermischungen. Leute, die ich kenne, stammen davon ab. Womöglich gehöre ich selbst dazu. Über meine Vorfahren weiß ich nur bis zur Großelterngeneration etwas. Wenn sie von den Hofstellen rings um Vallmsta gekommen wären, hätte ich das gewußt.
Ich glaube, sie kamen mit der Eisenbahn. Stiegen aus und sahen sich um. Stellten Bündel und Taschen ab und erkundigten sich nach einem Nachtquartier. Wollten wissen, wo man einen Happen zu essen bekommen könnte. Balancierten durch lehmige Radspuren und klopften an fremde Türen. Sahen im Schein eines Wachsstocks oder einer Öllampe nach, ob es Wanzen gab. Schlummerten ein und schliefen unruhig. Wachten auf und fanden, daß das Trinkwasser im Eimer ungewohnt schmeckte. Nicht einmal die Milchsuppe schmeckte wie zu Hause. Dann lebten sie hier, schlecht und recht. Warum sie hierherkamen, werde ich wohl nie erfahren.
Nach den Inhabern der Wirtschaften, Bierkeller und der rollenden Bahnhofsrestauration kamen die höheren Bahnbediensteten. Sie stelzten in prächtigen Uniformen im Lehm umher. Besaßen ein Reitpferd und ein Klavier, bauten Veranden. Das Bahnpersonal holten sie vom Acker. Ein Hufschmied. der kam um das Pferd des Stationsvorstehers zu beschlagen. erwies sich als mechanisches Genie; er hatte einen Pferderechen konstruiert. Es kam noch ein Mann mit dem Zug, hungrig nach Ehre und Geld, und kaufte mit geliehenen Mitteln Wald auf dem Stock. Er verfrachtete Sparren und Grubenholz mit der Eisenbahn. Des weiteren verkaufte er für den Hufschmied. der jetzt Fabrikant geworden war und eine mechanische Werkstatt eingerichtet hatte, Pferderechen. Der Holzhändler baute ein Lagerhaus, und dort stapelte er Sprossenstühle und Deichseln und Schneeschaufeln, die in der Schreinerei hergestellt worden waren. Diese war von einem großen, griesgrämigen Mann gegründet worden, der eine glückliche Hand für Geld hatte, so daß es immer mehr wurde. Jetzt nannte er sich Holzwarenfabrikant.
Danach, meint man, sei nichts geschehen, außer daß alles größer und komplizierter wurde. Wenn man die Nähfabrik nicht zählen will. Es war mein Schwiegervater, der aus Västergötland hierherkam und sie gründete. Er wurde in drei Jahrzehnten wohlhabend und machte im vierten Konkurs. Der Großhändler mit dem Lagerhaus hatte ein Imperium aufgebaut, das weiterhin expandierte und bis in die fünfziger Jahre hinein scheinbar blühte, bis es plötzlich zusammenfiel. Die Organisation war veraltet und das Personal zu zahlreich.
Die Werkstatt des Hufschmiedfabrikanten ging in einer großen schwedischen Exportfirma auf. Deren Werksgebäude liegen meinem Haus gegenüber. Wie morsch dieses Unternehmen ist, weiß niemand. Man sieht das von außen nicht. Sie haben aber angefangen, zeitweilig Leute zu entlassen. Wenn sie damit fertig sind, gibt es diese Stadt nicht mehr. Es wird Gebäude, Neon, Asphalt, kommunale Grünflächen und Stopplichter geben, Leute, die einander Benzin verkaufen, Administratoren und Auszahler, so viele wie einst in der riesigen Firma des Großhändlers, Leute, die einander die Haare legen und die Füße behandeln, Leute, die pflegen, putzen, sammeln, operieren, Rohre verlegen, psychoanalysieren, Telefongespräche vermitteln und Summen in Supermarktkassen eintippen. Wenn jedoch niemand etwas produziert, was mit der Eisenbahn verschickt werden kann, ist es aus, sagt man. Und es fragt sich, ob es nicht bereits aus ist, obwohl die Farben leuchten und die Motoren lärmen.
Errichteten sie denn wirklich sonst nichts, diese Menschen, die seit zwölf Dezennien hier leben? Eisen, Kies, Holz und Öl – ist das die ganze Stadt?
Als die langen Lagerhäuser, unter deren Dächern Tauben hocken, vor so langer Zeit gebaut wurden, geschah dies, um verwahren zu können, was magaziniert werden mußte. Die Tauben aber glaubten, daß die Stadt für sie erbaut worden sei, und sie bewohnen sie weiterhin, und ihrem Glauben hat bis heute nichts widersprochen.
Die Menschen bauten ihre Eisenbahn, weil sie sie brauchten, und die Eisenbahn bräuchte die Stadt, und die Stadt brauchte das, was mit der Eisenbahn kam. Versteht man auf diese Weise eine Stadt? Entsteht sie nur wie ein Reiz im Boden, wie ein kleines, bösartiges Geschwür, da, wo die erste Lok ihr Öl auf den Boden vergoß. das dann der Zerstörung entgegenwächst? Hat man zu der Zeit, da man aus Balkenlagen und langen Ziegeldächern die luftige Stadt der Tauben baute, sonst nichts errichtet? Wirklich nur Häuser?
Die Leute in diesen Häusern leben miteinander. Voneinander. Aber kaum füreinander, das ist mir klargeworden. Wenn sie Geld leihen können, von dem ich nicht weiß, woher es kommt, bauen sie. Dann wächst die Stadt wie ein Ekzem.
Auf der Peninsula, wo ich so lange gelebt habe, sind die alten Städte wie Artischocken aus Stein in ihrer Form eingeschlossen. Sie liegen oben in den Bergen, weiße Hitze auf den Wänden, oder am Meer, die Häuser und Mauern so dicht beieinander wie die Blattschuppen um das, was bei einer Artischocke das Herz genannt wird. In ihrem Herzen liegt die Kirche a praca mit dem Café und dem Brunnen. Da sitzen die Männer auf den Plätzen bei den Bussen; sie haben bagaço vor sich auf den Tischen stehen.
Diese Städte haben ihre Form, genau wie eine Blume oder wie der Schmetterling, der, in der Puppenhülle zusammengepreßt, vollständig ist, ehe er sich als Imago zu erkennen gibt. Die Idee der Stadt war da, bevor ihre Kronblätter aus Kalk und Stein ausschlugen.
Ich weiß nicht, welche Idee dieser Stadt zugrunde liegt und ob sie überhaupt eine hat. Manchmal bekomme ich Angst, wenn ich hierherkomme und sehe, wie sie seit dem letztenmal gewachsen ist. Ich habe, wie alle heutzutage, Angst vor Krebs.
Wenn Menschen eine Stadt bauen, beabsichtigen sie vielleicht doch etwas anderes, als ihnen bewußt ist? Vielleicht streben sie mit ihren gemeinsamen Handlungen auf ein Ziel zu, das sie auf den Festrednertribünen oder in Parteiprogrammen nie zum Ausdruck bringen, nicht einmal in den nach Zigarren duftenden Vorstandszimmern. Wenn nun die Stadt am Ende etwas ausdrückt, was über ihre Konstruktionen und Einrichtungen hinausgeht? Wenn diese Konstruktionen nur Produkte aus Schlacke sind?
Doch was für eine Idee ist das, nach der sie bauen? Und wann hört die Stadt auf zu wachsen? Wann ist ihre Blüte aufgegangen?
Ich brauche nur durch diese graubraunen Straßen zu gehen und die Hundepisse zu riechen, die Kreissäge durch Holz und Nerven schneiden und die Autoreifen in Salz, Kies und Schnee fräsen zu hören, um diejenigen zu hassen, die all diese Häßlichkeit zuwege brachten, und um zu verstehen, daß sie keine anderen Absichten verfolgten als solche, die vernünftig genannt werden. Ich begreife, daß die Menschen hier nur in einem System von Besitzen vereint sind, dessen Manifestationen wuchtig entlang der Straßen stehen, die Fassaden vom Regen geflammt. Dennoch will mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, daß währenddessen auch eine andere Stadt errichtet worden ist, eine wie die der Tauben.
Ich reiste an einem Novembernachmittag hierher. Der Tag war grau, und der Zug geriet schließlich in einen Regen. Ich sah, wie die Seen unruhig und aufgewühlt wurden und Wind und Wasser die Baumkronen kämmten. Über die schmutzigen Fensterscheiben des Zugabteils liefen Wasserstreifen und zitterten im Fahrtwind.
Wahrscheinlich dachte ich an das, was ich zu tun hatte, wenn ich ankam. Das Bewußtsein irrte vor mir her wie der Schein einer Taschenlampe. Das war normal. Ruckartig und flach erhellt es einen Fleck direkt vor dem Jetzt. Wenn ich abgespült habe. Wenn Elisabeth einundzwanzig ist. Der Lichtfleck ist ständig in Bewegung.
Ich würde alles regeln und es ihr unmöglich machen, zurückzukommen. Das Haus verkaufen. Einpacken, was ich behalten wollte, und dann das Auktionshaus anrufen. Ich glaube, ich wollte auch für eine Grabpflege sorgen.
Ich gehe ein paarmal in der Woche zum Grab. Manchmal öfter. Für gewöhnlich entferne ich altes Lindenlaub und achte darauf, daß keine welken Blumen das Grab verschandeln. Der Stein liegt im Gras, und meistens ist er mit braunem Laub bedeckt und fleckig vorn schmutzigen Regen. Ich glaube, der Regen bringt Ruß von der Gießerei. Oder der Ruß kommt über den Himmel von der Ruhr her. In der Regel säubere ich die Oberfläche, indem ich sie mit einem Taschentuch abreibe, denn eigentlich soll sie schwarz und blank sein.
Oft gehe ich auf Umwegen vom Friedhof nach Hause, laufe lange die braunen, lehmigen Trottoire entlang. Ich blicke beim Gehen nach oben, denn das Braun ist so trostlos. Die Bäume in dieser Stadt sind dagegen schön. Sie dürfen frei wachsen und brauchen nicht mit anderen um Licht zu ringen. Es sind vor allem Linden. Gesegnete Menschen, die sie gepflanzt haben! Auf dem Marktplatz stehen Trauerweiden, und da und dort gibt es zwischen den Häusern noch einen alten Birnbaum oder einige Apfelbäume mit halb geknickten Stämmen und knorrigen Ästen. Bei Nässe sind ihre Kronen schwarz und trinken wie Wurzeln die Feuchtigkeit der Luft. Sie sind die einzigen Überbleibsel der Gärten, die es hier einst gab und die nun unter ausgeschachteter Erde und Asphalt begraben liegen.
Das Zentrum ist klein, aber verwinkelt, so daß einige alte Häuser abseits zu liegen scheinen. Die Kapellgata 13 ist graubraun vor Alter, und obschon es ein großes Haus ist, wirkt es klein im Vergleich zu den gegenüberliegenden Gebäuden der Svenska Verkstad Aktiengesellschaft und der Redaktion des »Korrespondenten« gleich nebenan.
Es ist mein Haus. In seinem Holz sitzt Fäulnis, und seine dünnen Fensterscheiben klirren und scheppern, wenn Lastwagen vorbeifahren. Es ist im Winkel gebaut und schützt so die Reste eines alten Gartens. Auf der Innenseite befindet sich eine Eingangstür, die in einen durchs Haus hindurchgehenden Flur mit Steinfußboden führt. Die Tür zur Rechten ist vor langer Zeit von einem sehr geschickten Mann gelbflammig gestrichen worden. Öffnet man sie, kommt man zu einer Treppe, auf deren grauem Holz früher ein schlabbriger Flickenteppich lag. Er war mit Metallstäben befestigt. Im ersten Stock steht, voller Gerümpel, die Brennholzkiste noch vor der Küchentür. Ihr Deckel läßt sich nicht schließen. Vor dem Fenster hängen Zwirngardinen. Die Tür zur Wohnung hat eine Scheibe aus matt geschliffenem Glas und eine Klingel, die seit vielen Jahren kaputt ist. Als Kind versuchte ich immer, die Schraube herumzudrehen, um sie zum Klingen zu bringen. Sie klemmte jedoch und war schon damals stumm.
Hierher bin ich oft gekommen. Eine ganze Kindheit lang, ganz alltäglich. Alle diese Ankünfte sind unecht, weil ich ja hier geboren bin. Hierher kann ich nur zurückkehren.
Wir waren wenige Leute. die ausstiegen, nachdem der lange Zug zum Stehen gekommen war. Ich saß so weit vom, daß ich beim Aussteigen nicht einmal unter dem Dach des Bahnsteigs landete. Weit hinten sah ich ältere Frauen mit Beuteln und Koffern, die ihnen zu schwer waren. Dort ging auch ein Mann, und es sah aus, als trüge er einen Zylinder und einen ärmellosen schwarzen Mantel, einen Umhang. Er war das einzig Ungewöhnliche. Alles andere schien der dunkelnde Novembernachmittag aufsaugen zu können: die Frauen und die Wagenreihe, die sich nach wenigen Minuten schon wieder in Bewegung setzte, die alten braunen Dächer, die aus ihren Holzpfeilern herauswuchsen, und den grauen Zement des Bahnsteigs. Diesen Mann dagegen bezwang er nicht. Sein Mantel war so schwarz, daß er leuchtete. Er verschwand, ohne sich umzusehen. in dem Durchgang zwischen dem Dienstraum des Stationsvorstehers und dem Zeitungskiosk.
Ich schlug den Weg durch das Bahnhofsgebäude ein, weil ich mir einen Fahrplan für die Eilzüge besorgen wollte. In einigen Tagen. wenn alles geregelt sein würde, wollte ich wieder abreisen.
Der Wartesaal war fast leer, doch er hallte wider vor Lärm, Blech gegen Stein. Zwei Jungen mit Zipfelmützen schlugen mit Eishockeyschlägern auf eine leere Bierdose ein und jagten sie zwischen den Wänden umher. In der Nähe der Tür saß, auf einen braungestrichenen Heizkörper gestützt, ein alter Mann mit fast weißem Gesicht und geschlossenen Augen auf einer Bank. Sein Kopf hing nach vorn, und aus dem Mundwinkel rann Speichel. Der Mann war ganz merkwürdig weiß. In der Hand hielt er einen zusammengeknüllten Zettel, an dem seine Finger herumzupften. Ich setzte mich neben ihn, unsicher, ob er nur schlief oder ob er krank war und Hilfe brauchte.
Ich fragte, ob er mit einem Zug fahren wolle. Er reagierte auf meine Stimme, öffnete aber die Augen nicht.
»Ich mag nicht z’rück«, sagte er.
Es war ein alter Mann mit rundem Gesicht und weißem Haar, das so kurz geschnitten war, daß die Kopfhaut durchschimmerte. Er hatte einen schwarzen Überrock an, trug aber weder Handschuhe noch eine Mütze. Das sah seltsam aus. Alte Menschen sind doch in dieser Jahreszeit normalerweise ordentlich angezogen, zugeknöpft bis zum Hals, und sie tragen für gewöhnlich immer etwas auf dem Kopf. Ich fragte, wohin er wolle.
»Wenn Sie mir die Adresse sagen, werde ich Ihnen ein Taxi besorgen.«
Sein Kopf wackelte auf einem Stengel von Hals wie der eines kleinen Kindes. Ich ergriff seine Hand. Sie war kalt, und die Haut fühlte sich trocken und hornig an. Da erhob ich mich und ging in die Fahrkartenausgabe und fragte, wie lange er schon dort sitze. Sie hatten ihn überhaupt noch nicht bemerkt. Sie waren zu zweit da drinnen in dem Geruch nach Thermoskaffee und Achselschweiß. Die beiden gingen zur Tür und lugten durch die Glasscheibe nach draußen. Dann schüttelten sie wieder die Köpfe.
Der Mann war drauf und dran vornüberzukippen, und nach wie vor rann ihm der Speichel aus dem Mundwinkel.
»Er ist doch krank«, sagte ich. »Rufen Sie den Krankenwagen.«
Sie schienen unsicher, aber nun sahen sie ja, daß er beinahe auf den Boden fiel. Ich erwischte ihn im letzten Moment und brachte ihn dazu, sich auf die Seite hinüberzulehnen.
»Rufen Sie schon an!« drängte ich, und der eine nickte und hob da drinnen tatsächlich zögernd einen Telefonhörer ab. Die Jungen schlugen weiterhin die Bierdose umher, der Lärm machte mich rasend.
»Schluß jetzt!« schrie ich, daß es in dem alten Wartesaal widerhallte.
Sie versetzten ihr natürlich noch ein paar Hiebe, doch dann polterten sie mit ihren Schlägern hinaus. Der Alte atmete hörbar und sehr mühsam. Sein Kopf ruhte schwer an meiner Schulter. Er roch stark nach Seife und nach irgend etwas Dumpfigem und Unbestimmtem. Womöglich starb er hier gleich. An den Handgelenken hatte er kleine blutige Kratzspuren, und es war seltsam, daß seine eigenen Nägel, die so gelblich und hart waren, diese Wunden gerissen haben konnten. Er litt wohl unter Juckreiz. »Vielleicht ist er zum Sterben nach Hause gefahren«. überlegte ich. »Er ist sein ganzes Erwachsenenleben lang fort gewesen. Nun kommt er heim. Das ist großartig und auch nicht.«
Vielleicht ist Sterben ganz alltäglich. Der Reizhusten, der Druck auf der Brust, der hartnäckige Juckreiz. Man kratzt kleine Wunden, man fühlt sich elend, und dann ist es aus.
Ich wünschte, daß sie bald mit dem Krankenwagen kämen, damit er nicht so sterben würde, an mich gelehnt. Die zwei da drinnen am Fahrkartenschalter hielten sich zurück, als wären sie der Meinung, daß dies meine Angelegenheit sei. Die Venen auf den weißen Handrücken des Alten lagen geschwollen und prall unter der Haut. Es war Druck darin. Das Blut floß wohl immerhin. Das Herz schlug also.
»Vielleicht passiert jetzt sein ganzes Leben Revue«, dachte ich. »So soll es am Schluß doch angeblich sein. Er hört vielleicht Absätze über einen hölzernen Bahnsteig klappern und riecht Öl und Steinkohlerauch. Er kam wohl heim, um nach etwas zu suchen. Doch das ist verschwunden, ausgetauscht. Wenn er doch nur am Leben bleibt, bis der Krankenwagen kommt! In jemandes Armen zu sterben, ist so intim.« Ich fühlte mich von dem knochigen Körper des Alten nahezu vergewaltigt. Er würde vielleicht anfangen, an mir herumzutappen, und an meinen Mund oder meine Brüste fassen wollen.
Ich versuchte ihn aufzurichten und gegen die Wand oder den Heizkörper zu lehnen, doch er sank an meine Schulter zurück. Er war immerhin lebendig. Er atmete, und die Finger zupften.
Leute kamen durch die blechbeschlagene Tür herein und starrten mich und den Alten an. Ich verstand, daß sie glaubten, wir gehörten zusammen. Die Uhr an der Wand tickte, und die beiden Schaffner in ihrem Schalterraum glotzten mich durch die Glasscheibe an.
Ich versuchte mich umzudrehen, so daß ich hinaussehen konnte. Papier und Abfälle, die bei einem anderen Wetter dort draußen umhergeweht wären, lagen im Regen auf den Asphalt geklatscht. Eine Schar Tauben pickte etwas beim schwarzen Stamm einer Linde, die im Regensturm entlaubt worden war. Die Tauben sind immer vor dem Bahnhofsgebäude. Nicht dieselben Tauben natürlich, aber ihre Nachkommen. Tauben der Tauben der Tauben der Tauben. Paaren sich und brüten und schlüpfen und gurren und koten und suchen Eßbares in Ewigkeit. Nein, nicht in Ewigkeit, aber lange. Autos, Autos, Autos und Dreck. Graubraun. Und sie waren tatsächlich dabei, das Stadthotel zu renovieren.
Wenn der Krankenwagen nicht bald kam, mußte ich versuchen, ihn hier auf die Bank zu legen.
»Wie fühlen Sie sich?« fragte ich mit lauter Stimme. Er rührte sich nicht. Warum war ich zu ihm hingegangen? Ich hätte doch lediglich im Schalterraum Bescheid geben können, daß er dort saß und Hilfe brauchte. Doch ich wußte, daß ich es deswegen getan hatte, weil ich eine über vierzigjährige Frau war und gewohnt, mich wie eine Mutter zu verhalten. Innerlich fühlte ich mich wie dreizehn.
Endlich kam der Krankenwagen von der großen Brücke oberhalb der Post her. Rote und blaue Lichter blitzten in dem graubraunen Nieselregen, zwei junge Burschen stiegen rasch aus und rissen durch die Hecktür eine Trage heraus. Als sie in den Wartesaal kamen, veränderten sie die Luft und die Geräusche. Ihre Bewegungen waren berufsmäßig, und sie zauderten nicht, als sie den Alten auf die Trage legten. Als er ausgestreckt wurde, zeigte sich, daß er groß und schmächtig war. Eine Decke wurde um ihn geschlagen, und das ging so schnell wie bei einer Verkäuferin, die Papier zu einem Päckchen zusammenlegt. In dem Moment, als sie ihn hochhoben, sah ich zum erstenmal einen Schimmer Blau unter seinen weißen Augenlidern. Er hatte also blaue Augen, wenn sie auch rot gerändert und trüb waren.
Sie verschwanden mit ihm. Ich fühlte mich für einen kurzen Moment einsam. Sammelte die Handschuhe und die Tasche zusammen und ging zögernd hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen.
Ich ging über die Fußgängerbrücke zum Marktplatz. Die Häuserzeile auf der anderen Straßenseite hat eine Silhouette. die sich seit meiner Kindheit nicht sehr verändert hat. Doch in dem Grau leuchteten jetzt grelle Schilder in Signalrot und Phosphorgrün. auf denen »Preissturz« und »Superangebote« stand. Die Stadt ist mittleren Alters und aufgetakelt wie eine überalterte Hure. die mit keiner besonders zahlungskräftigen Kundschaft mehr rechnet. Aber bezahlt werden muß. Da gibt’s nichts. Sie trägt ihre bunten Bänder und Fetzen, nicht um zu gefallen, sondern als Embleme, untrügliche Zeichen für das, was sie tut und was man sich von ihr erwarten kann.
Ich erinnere mich, daß auf diesem Marktplatz, wo jetzt Autos stehen, gewöhnlich Zeltleinwände in Regenböen flatterten. Es gab Schaukästen mit Blumen. Oder erinnere ich mich an etwas, was man mir erzählt hat? Ein Bild?
Wir sehnen uns nach etwas und wissen nicht, wonach. Da gewahrt die Sehnsucht, ein kleines Organ, von dem man nicht weiß, ob es ein Darm, eine Nervenwindung oder ein Auge ist, einen gläsernen Blumenschaukasten.
Sofort reagiert es. sowohl vor Schmerz als auch vor Hingerissenheit. mit einem Zucken. Die Sehnsucht verwandelt sich den Blumenschaukasten an und verschmilzt mit ihm. Dann steht sie wie eine kleine Kerzenflamme zwischen Hyazinthen und zerbrechlichen Hahnenfußgewächsen, die Christrosen genannt werden. Sie steht hinter Glas und flackert, und draußen ist es kalt und rauh.
Die Sehnsucht schmilzt Glaskästen und gestreifte Anzüge, ganze Heuwagen. gußeiserne Pumpeinrichtungen und kleine Hütten mit Hohlpfannendächern. Die Sehnsucht erschafft sich Kindheitserinnerungen. Vielleicht erschafft sie alle Arten von Erinnerungen.
Als ich klein war, lief ich einmal zu Jenny, die in der Küche stand und abspülte. Ich trug die Teekanne im Arm. Ich glaube, es war ein grauer Nachmittag, vielleicht im Spätwinter. Ich erinnere mich an eine Frauenstimme, die die Börsenkurse verlas.
»Ich habe sie gesehen«, sagte ich. »Schau, Jenny.«
Ich stellte die Teekanne auf den Küchentisch, und da stand sie nun auf dem Wachstuch und sah wie gewöhnlich braun und angestoßen aus. Jenny guckte, und das Spülwasser tropfte ihr von den Händen. Ich wußte nicht, wie ich es erklären sollte. Da ich selbst nicht mehr sah, was ich eben gesehen hatte, war mir klar, daß sie nichts Besonderes wahrnehmen konnte. Unsere alte Teekanne. Sie hatte vom Abend vorher noch auf dem Rauchtisch gestanden. Auf der Glasplatte lagen Tabakkrümel, und Gläser hatten Ringe darauf hinterlassen. Dort hatte ich die Teekanne gesehen, sie wirklich gesehen, und das versuchte ich Jenny zu erklären.
»Ich habe sie mit neuen Augen gesehen«, sagte ich.
Doch sie verstand das nicht recht. Ich verstand es ja selbst nicht.
Als diese Sache in der Kapellgata passierte, war ich fast vierzig. Es war im November 1973, fünf Monate vor der Revolution. Ich war nach Hause gekommen, um nach Henning zu sehen. Es stand sehr schlecht um ihn, doch ich traf ihn nicht einmal daheim an. Die Wohnung war abgeschlossen und dunkel. Nachdem ich ihn gefunden, ins Krankenhaus verfrachtet und dort bis weit in die Nacht hinein gesessen hatte, kam ich schließlich in die Wohnung zurück.
Da geschah es. daß ich sah. Es begann erst. als ich beim Garderobenspiegel stand. aber vielleicht hatte es sich unten im Hausflur angebahnt oder auch schon, als ich vor der Haustür stand und die aufgesprungene braune Farbe sah, als ich die Tür öffnete und die Steinplatten im Flur, die Zwirngardinen im Treppenhaus, die matte Glasscheibe mit den Blumenranken und die angelaufene Messingschraube der Klingel erblickte.
Ich war morgens von Lissabon abgereist, war geflogen, mit dem Bus und dann mit dem Zug gefahren und auf der Suche nach Henning schließlich in der Stadt umhergeirrt. Zu guter Letzt war ich mit ihm im Krankenwagen gefahren und mit dem Taxi nach Hause. Ich hatte im Flugzeug eine Kleinigkeit gegessen, doch seitdem nichts mehr. Eine Schwesternhelferin hatte mir eine Tasse Kaffee gebracht, während ich bei ihm saß und seine Hand hielt.
Ich trat in die dunkle Diele und machte die Deckenlampe an. Dann stand ich da und schaute in die Stube, die nach wie vor im Dunkeln lag. Ich sah.
Ich sah mitten durch die Gesetze, die die Dinge so zufällig und launenhaft zusammenhalten, und ich sah den goldenen Staub wieder wirbeln. Er wirbelte in Bahnen aus Kraft und Licht. Nicht so, daß Stühle und Tische verschwanden, doch die feinen Linien, die sie ins Licht ritzten, waren nicht stark genug, um die andere Erscheinung, die wirkliche, zu verdrängen. Licht und Schatten waren noch da, doch sie ruhten auf eine Weise beieinander, von der ich bis eben nichts gewußt hatte, die aber doch so selbstverständlich war wie Vogeleier, die in einem Nest beieinanderliegen. Es war Wirklichkeit.
Dauerte es Stunden oder war es nur ein kurzer Moment? Ich weiß es nicht. Das Telefon klingelte, klingelte lange, ehe ich begriff. was ich damit machen mußte. Als ich schließlich den Hörer abhob. war es vorbei. Ich war zurück. Ich sah genau das, was ich erwartet hatte, in diesem Zimmer zu sehen, und ich hörte einen von Hennings Saufbrüdern am Telefon, eine lallende Stimme. Die Gefühle kehrten zurück; der Ekel, das Mitleid und die Müdigkeit.
Eben erst hatte ich die Kiefernzapfen in den geschnitzten Rücken der Eßzimmerstühle mit der gleichen Intensität angestarrt wie die leere Flasche, die unter den Tisch gerollt war, das Bett mit dem schmutziggrauen Laken und den Tisch davor, vollgestellt mit leeren Flaschen und überfüllten Aschenbechern, den Eimer mit Erbrochenem und Urin, die Eulen auf dem »Nordischen Familienbuch«, die Deckenlampe, deren Schale kleine tote Tiere beherbergte. Jetzt empfand ich nur noch Mangel.
Als ich an dem Spätherbstabend, da ich heimgekommen war, um das Haus zu verkaufen, durch dieselbe Tür eintrat, war ich nicht erwartungsvoll. Ich glaube nicht, daß von der Erinnerung an die Erscheinung mehr als eine leichte Unruhe übrig war. Ich war, von ganz anderen Erwartungen erfüllt, auf der Hut, und ich hatte Grund dazu. Die Wohnung konnte im gleichen Zustand sein wie damals. Schlimmstenfalls erwartete mich der Anblick einer ähnlichen Erniedrigung, wenn auch mit Spritzen, befleckten Tupfern und Limonadenflaschen mit blutvermischtem Wasser. Als erstes hatte ich gesehen, daß der Flickenteppich auf der Treppe weg war. Vielleicht hatte Elisabeth ihn in die Mülltonne geworfen. Er war wohl so löchrig, daß man darauf stolperte. Zur gleichen Zeit, als ich die Flurtür aufstieß, ging eine der Haustüren auf, und zwar die, die auf die Kapellgata führte. Obwohl ich fast drinnen war, konnte ich erkennen, daß ein großer Mann in einem Mantel ohne Ärmel, einem Mantel, der seltsamerweise mit roter Seide gefüttert war, hereinkam. Erst auf halber Höhe unserer Treppe wurde mir klar, daß es derselbe war, den ich auf dem Bahnhof gesehen hatte. Er folgte mir nicht. Ich blieb auf der Treppe stehen und horchte. Er trat durch die Tür auf der anderen Seite des langen Hausflurs.
Ich schloß unsere alte Tür auf und trat ein, die Glasscheibe schepperte, als ich öffnete. Schon in der Diele sah ich, daß es nicht so schlimm war. Ein bißchen mädchenhafte, parfümierte Schlamperei nur. Natürlich merkte man den dumpfen Geruch von Marihuana. »Marihuana ist aber nicht gefährlich, Mama! Es ist lange nicht so stark wie Hasch!«
Ich weiß nicht. Es ist vielleicht egal. Ich empfand jedenfalls Zärtlichkeit. als ich einen Gürtel. der mit kleinen Porzellanperlen bestickt war, billiger Plunder aus Indien, und eine gestreifte Baumwollunterhose aufhob. die genauso klein wirkte wie die, die sie mit fünf. sechs Jahren getragen hatte.
Nein, nicht der Marihuanageruch war das Beklemmendste, auch nicht die Schlamperei, denn die war beinahe angenehm. Es war der Stillstand. Eigentlich hatte sich nichts verändert. Es gab keine Anzeichen von Leben. Die Unterhose. Der Gürtel. Die leeren Zigarettenschachteln. Aber nichts, was auf Regsamkeit hindeutete.
Die Weihnachtsdekorationen waren immer noch da. Ein Wichtel aus Garn baumelte in der Türöffnung zur Stube. Ich hatte ihn selbst hingehängt. Es war an Hennings letztem Weihnachten, daß ich mit Hilfe von Kreppapier und Tannenzweigen, die ich mit Flittergold besprühte, unbeholfene oder verbissene Versuche unternahm, alles wie gewöhnlich erscheinen zu lassen.
Nichts war geschehen. Der Wichtel baumelte an seinem Faden, der Staub hatte sich tiefer in die Gardinen und Teppiche gefressen. Alles wurde allmählich graubraun; es bekam die der Vergangenheit eigene Farbe, den Ton des Zusammengeballten, des Nichterkennbaren und Vermoderten. »Hier geschieht nichts. Außer daß jetzt alles hinausfliegt. Zum Teufel«, dachte ich, und wäre die Stille in der Wohnung nicht so kompakt gegenwärtig gewesen, hätte ich es laut gesagt.
Ohne den Mantel abzulegen, rief ich das Büro des Baumeisters an. Doch es war niemand mehr da. Es hatte lange gedauert, bis der Alte auf dem Weg ins Krankenhaus war.
Ich hatte es eilig. Deshalb hatte ich Elisabeth ja auch nach Taormina geschickt. Ich wollte die Zerstörung vorantreiben. Aber das Haus umgab mich dunkel und kompakt vor Zeit.
Dann rief ich beim Baumeister, einem ehemaligen Schulkameraden von mir, zu Hause an. Als sich eine Frauenstimme meldete, glaubte ich, es sei seine Frau. Ich vergesse leicht, daß wir jetzt erwachsene Kinder haben. Ich sagte langsam und deutlich, so, als spräche ich auf ein Tonband, sie solle ihm ausrichten, daß ich angerufen hätte, ich sei nach Hause gekommen, um den Verkauf des Hauses in der Kapellgata abzuwickeln.
»Er weiß Bescheid, worum es geht. Ich bin jetzt bereit zu verkaufen.«
Vor den Fenstern war die Dunkelheit hereingebrochen. Ich ging langsam umher und vergrub die Hände in den Manteltaschen. Ich glaube, ich versuchte es vor mir herzuschieben, hier drinnen etwas anzupacken. Die Straßenlaternen schienen wie gewöhnlich in die Stube und das Herrenzimmer, wie wir zu Zeiten meines Großvaters sagten. Die Laternen hängen an Drähten quer über die Straße. Bei windigem Wetter schaukeln sie und verbreiten Unruhe in den Zimmern, wenn man in ihnen umhergeht, ohne die Lampen einzuschalten. Es war kalt hier drinnen, und mit der Kälte beschlich mich die Müdigkeit. Ich verspürte keinen Hunger, vielmehr war mir schlecht, was, wie ich glaubte, vorübergehen würde, wenn ich etwas äße. Ich wollte aber nicht ausgehen, ich wollte kurz vor Ladenschluß nicht bei Tempo im Gedränge stehen.
Als ich in der Speisekammer kramte, fand ich Spaghetti und eine Büchse fertige Hackfleischsoße. Die Regale waren voller Krümel und rochen schlecht. Es hatte jedoch nicht viel Sinn, jetzt, wo ohnehin alles weg sollte, die Schränke und die Speisekammer zu putzen.
Es dauerte lange, die Spaghetti zu kochen und die Soße warm zu machen. Die Platten des alten Elektroherdes reagieren langsam und feierlich, als wollten sie daran erinnern, welch umständliche Prozedur es doch ist, aus herabstürzendem Wasser Energie zu gewinnen, sie zu transportieren und sie in kaltem Eisen in Wärme umzuwandeln. Jenny hatte auf dem Heimweg vom Einkaufen immer zu mir gesagt, ich solle schon mal vorauslaufen und die Platte einschalten. Das war in Epaglück, als ich bei Otters wohnte. Jenny hat jedoch schon längst einen neuen Herd bekommen, einen Herd mit glühenden Windungen und Vertiefungen in dem weißen Email, die alles Verschüttete auffangen. Bei uns fanden sich Kaffeesatz und braunverbrannte Milch unter einem schwarzen Deckel. den hochzuheben sich Elisabeth hütete.
Ich drehte die Heizkörper auf. Sie tickten in der Stille. Um mich nicht so einsam zu fühlen. aß ich in der Stube vor dem alten Schwarzweißfernseher. der gemütlich dröhnte. Als ich dort saß, klingelte das Telefon. Ich glaubte, es sei Hasse, der aus Porto anrufe, um zu fragen, ob ich angekommen und ob alles gutgegangen sei. Es war jedoch eine viel jüngere Stimme, ein Junge, der nach Elisabeth fragte. Er legte auf, ohne zu sagen, wer er war. Ich saß da und sah das schwarze Telefon an, einen wuchtigen, alten Apparat mit einer mit Stoff bezogenen, ausgefransten Schnur, die nie ausgewechselt worden war. Dann rief ich Hasse an. Er war noch in der Fabrik, und um ihn herum war es laut, deshalb redeten wir nicht lange. Ich erzählte. daß alles gutgegangen sei. Jenny und Elisabeth säßen im Flugzeug nach Taormina, und nun ließe sich alles schnell regeln. Ich sagte, daß ich den Telefonstecker herausziehen wolle. denn ich fände es unangenehm, wenn fremde Menschen anriefen und nach Elisabeth fragten.
Es gab jedoch keinen Stecker. Ich mußte also den Hörer ablegen, und mir war nicht wohl zumute, nachdem ich das getan hatte. Ich hatte das Gefühl, daß man mich erreichen, mich belauschen oder durch den abgelegten Hörer rufen könnte. Obwohl ich einsah, daß das absurd, ja lächerlich war, stülpte ich eine alte Wollmütze darüber.
Ich war nahe daran. mich vor der Dunkelheit zu fürchten, darum schaltete ich den Fernseher wieder ein, schlenderte umher und pusselte an den Sachen herum. »Morgen werde ich Kartons besorgen«, dachte ich. Was aber sollte ich behalten? Alles, was hier war, gehörte zueinander. Wie würde sich das »Nordische Familienbuch« in dem geschnitzten schwarzen Bücherregal in unserer Wohnung in Porto ausnehmen? Oder Hennings Aufzeichnungen, eine gigantische paperasse, eine Bibliothek von Gedanken und Einfällen, Säufergeschwätz und Träumen. Womöglich verbarg sich dazwischen eine Erfindung, ein schlummerndes Vermögen. »Wenn ich einen Sohn bekommen hätte«, überlegte ich und schämte mich wie immer, wenn ich mich bei diesem Gedanken ertappte. Ich blätterte ein wenig in den Papieren und sah, daß es sich bei den obersten um die Patentanmeldung des Radaxgelenks handelte. Universallager hatte er es zuerst genannt. Er mußte es lange versucht haben, und was mochte das gekostet haben? Nun, es ging nicht. Es fraß sich fest.
Der Wichtel baumelte an seiner Schnur, wenn ich an ihm vorbeiging. Plötzlich war das Fernsehprogramm zu Ende. Plötzlich – es mußten schon Stunden vergangen sein. Ich hatte in den Papieren gelesen, da und dort ins »Nordische Familienbuch« geguckt. Alle Kleider zusammengelegt, die Elisabeth auf den Stühlen und auf dem Fußboden hatte liegenlassen. Schubladen mit schwarz angelaufenem Neusilber, das mit rosa Flanell bedeckt war, herausgezogen. Aber trotzdem – drei, vier Stunden? Das Haus ängstigte mich ein bißchen. Es fraß Zeit und Bewußtsein. Es fraß meinen Willen.
In zwei Räumen war ich noch nicht gewesen. Der eine war Elisabeths Zimmer, eigentlich meines. Ich wohnte darin, als ich klein war. Das Schlafzimmer liegt weit von meinem Zimmer entfernt. Das betrat ich nicht. Doch in das alte Schlafzimmer meiner Großeltern, das Henning zur Aufbewahrung von Modellen und Papierstapeln benutzt hatte, und in sein eigenes Zimmer gegenüber der Küche hatte ich einen Blick geworfen. Dort, wie überall sonst im Haus, herrschte Unterwerfung ohne Widerstand. Zeit war auf Zeit geschichtet worden, allerdings nicht deckend. Das Bild von Nerman mit Mutter und Kind hing noch dort. Unter dem Bett lagen Flaschen und die leeren Pappschachteln, die noch immer schwach nach Zigarillos rochen.
Mein Zimmer liegt neben dem Bad auf der anderen Seite des Korridors. Zu Zeiten der Großeltern kann es die Dienstmädchenkammer gewesen sein. Denn Sigrid hatte doch bestimmt ein Mädchen? Sie selbst stand ja im Laden, solange sie gesund war.
Das leere Schlafzimmer betrat ich nicht. Das mache ich nie. Es gab auch jetzt keinen Anlaß dazu. Ich mußte mich jedoch entscheiden, wo ich schlafen wollte.
Als ich die Tür zu Elisabeths Zimmer öffnete, schlugen mir ein süßer Geruch und starke Hitze entgegen. In der Dunkelheit glühte es. Sie war nach Sizilien gefahren und hatte in dem kleinen. nach Weihrauch duftenden Zimmer den Heizstrahler angelassen! Ich machte das Licht an. Das Zimmer wurde rosa und schien noch stärker zu riechen. An der Decke hatte sie eine chinesische Lampe aus rotem Papier mit Seidenquasten angebracht, die schief hing. Ich sah, daß sie im Zug von der offenen Tür her schaukelte. Ich dachte: »Wenn ich die Tür heftig zuschlage, dann fällt der Papierschirm auf den Heizstrahler, und dann ist in einigen Minuten alles geklärt. Kein Packen. Keine Auktion. Auch kein Abriß. Der Baumeister würde diese Losung sicherlich vorziehen.«
Als ich das Papierlicht ausmachte und die Schreibtischlampe einschaltete. sah ich, daß das Zimmer frisch tapeziert war. Das verblüffte mich. Saubere beigegelbe Tapeten mit einem beinah unmerklichen Muster, das wie Heu und Stroh aussah. Fünfziger Jahre. Die hatte sie bestimmt auf dem Dachboden gefunden.
Auf dem Bett lag eine indische Lumpendecke, die ich nur mit spitzen Fingern anfaßte, um sie zusammenzulegen. Man konnte sie natürlich nicht waschen. Aber daran dachte Elisabeth nicht. Sie legte sie nur aufs Bett und ging davon aus, daß das, was aus einem Laden kam, neu und sauber sei. Die Decke war mit indischen Lumpen gefüllt, das heißt mit Unreinlichkeit und Ansteckungsgefahr. Unter der Lumpendecke lag meine alte rosarote Wolldecke mit dem Schleifenmuster, unter der ich das Auge Gottes gesehen hatte, und darunter Sigrids Laken. Das Überschlaglaken hatte eine breite Spitze und das Monogramm SWA, das für Sigrid und Abel Westerdahl stand. Die Laken waren nicht eben sauber. Ich riß sie aus dem Bett und schmiß sie neben die Lumpendecke.
In Großmutters Kommode fanden sich keine sauberen Laken mehr. Ich mußte mich mit der rosaroten Kinderdecke zudecken, die viel zu kurz war. Die Füße ragten heraus, und ich mußte meinen Mantel holen. Elisabeth ist viel kleiner als ich. Außerdem ist sie schmächtig. Ihr dünner kleiner Körper hatte sich sicherlich recht gut in die längliche Mulde, die der Bettboden und die Kapokmatratze bildeten, gefügt. Ich würde bis zum Morgen Rückenschmerzen bekommen, dessen war ich mir gewiß. Doch ich fand es hier am sichersten. Die Tür ließ sich abschließen.
1935 wurde ich in diesem Haus in einem Bett geboren, das jetzt zwischen einer Menge anderem Gerümpel auf dem Dachboden steht. Es ist aus schwarzgestrichenen Eisenrohren und hatte an den vier Ecken einmal Messingknäufe. Vielleicht habe ich sie abgeschraubt. Manchmal glaube ich eine goldgelbe Kugel über einen gelb-grünen Linoleumbelag rollen zu hören, nein, womöglich zu spüren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf der Matratze sind große Flecken, Flecken mit braunen Rändern. Das dürfte Urin sein, doch manchmal habe ich schon gedacht, daß es möglicherweise mein Fruchtwasser ist.
Das Haus ist jetzt wohl Mutter und Vater für mich. Es stand immer hier. Ich hatte selbst den Schlüssel dafür, obwohl ich bei Otters wohnte. An keinem anderen Ort der Welt kann ich das Gefühl haben, wirklich in einem Raum, in einem abgeschiedenen, geschützten und gleichzeitig sehr erschreckenden Raum zu sein. Draußen sind heulender Wind, pechschwarz fließende Finsternis oder sternklare Bedrohung und Eiseskälte. Ein Mahlstrom von Menschen ist dort draußen, von Geschäftigkeit, Bosheit und seltenen Gebärden von Zärtlichkeit. Ich habe zwar lange geglaubt, daß das Haus in meinem Bewußtsein eine Art Symbol sei. Doch das ist falsch. Es steht hier. Es ist da, und es ist eine Zuflucht in ganz und gar konkreter Bedeutung. Die Kirche einer Gläubigen. Die Höhle eines kleinen wilden Tieres.
Jetzt würde ich es zum Abriß verkaufen. Mochte die Nacht, da Wirklichkeit und Unwirklichkeit die Plätze tauschen, schnell vorübergehen!
Ich fand ein altes Transistorradio in Hennings Zimmer. Das Gehäuse war zerschlagen, das Gerät funktionierte aber noch. Er hatte es wohl viele Male auf den Fußboden gefegt, wenn er nach seinem Glas tastete.
Als ich mich ins Bett gelegt hatte, war gerade das Musikprogramm zu Ende. und ich schaltete das Radio aus, denn ich mochte die Popmusik im dritten Programm nicht. Es wurde mir jedoch zu still. Ich ließ es wieder spielen, so leise, daß ich die Musik nur als ein Rauschen und Hämmern vernahm, und schlief allmählich darüber ein. Ich schlief nicht tief, und jedesmal, wenn ich mich in dem schaukelnden Bett umdrehte, wachte ich auf und hörte das Radio. Die Musik wurde schließlich ruhiger. Irgend jemand hat mir gesagt, daß der Rundfunk in Schweden zwischen drei und vier Uhr Selbstmordmusik sende. Aber sie hat doch wohl den Zweck, Selbstmord zu verhindern? Ich versuchte wieder einzuschlafen, mit trockenem Mund. Ich war in mich hinabgeglitten, unter die Absichten, und hatte weder Gleichgültigkeit noch Bereitschaft zu dem gefunden, was zu tun ich im Begriff stand.
Ich vermeinte die ganze Zeit, Wasser zu hören, das irgendwo stand und rann, ein undeutliches Murmeln. Wenn ich in den Schlaf glitt, hielt ich es für Stimmen, die sich unterhielten.
»Nein!« sagte ich. »Nein!«
Ich sprach jedoch wie eine Frau, die Selbstgespräche führt und das weiß. Dann streckte ich die Hand aus und drehte das alte Radio laut. und im selben Augenblick erstarb das Rauschen, und die Stimmen schwiegen.
Ich wurde davon geweckt, daß jemand »Mama« rief. Als ich aufstand. fiel mir sofort wieder ein, daß ich allein in der Wohnung war, ich ging aber trotzdem herum und sah in alle Zimmer. außer ins Schlafzimmer. Sie waren leer. Ich kam in die Küche und fand auch sie leer. Da dachte ich, daß vielleicht ein Kind in den Hof hereingekommen sei. Ich konnte durchs Fenster aber niemand sehen. Es war noch immer fast dunkel, noch nicht einmal fünf Uhr.
Ich hatte Herzklopfen und verspürte große Angst und Beklemmung. Als ich mich hinlegte, wurde es noch schlimmer. Die Handflächen kribbelten, und ich bekam Mühe mit dem Atmen. Ich spürte, daß ich mir selbst nicht helfen konnte, sondern Hasse anrufen mußte. Was war man füreinander, wenn man bei einer solch unerträglichen Angst im Morgengrauen nicht anrufen konnte? Als ich jedoch barfuß in der Diele stand und die Auslandsvorwahlnummer gewählt hatte, sah ich ihn unter den roten Bettbezügen mit den weißen Vögeln in dem schwarzen Doppelbett schlafend vor mir. Das war in einer anderen Welt. Was sollte er mir sagen können?
Schon seit meiner Kindheit ist mir klar, daß Welt an Welt liegt. Es fällt mir schwer, das große Containergefühl zu erlangen.
Mein Herz galoppierte und raste unerträglich.
Unerträglich.
Welch ein Wort! Es bedeutet nicht mehr als Elisabeths affengeil und saunobel. »Sei nicht so saunobel, Mama!« Und eigentlich gibt es nur sehr wenige Dinge, die unerträglich sind. Hasse würde so etwas nicht zu mir sagen, doch es reichte, daß ich dachte, er könnte es sagen. Er würde nicht einmal darauf hinweisen, daß dieses Gespräch über einen Kontinent hinweg teuer werde. Ich legte den Hörer wieder auf. Wenn ich mir ein bißchen Tee kochte, würde es bald vorbei sein. Es war bereits besser.
Elisabeth hatte etliche Kräutertees in knittrigen Tüten. Aber schließlich fand ich eine Dose mit gewöhnlichem Tee. Der alte Herd brauchte lange, und ich wurde zu guter Letzt müde. Ich setzte mich an den Küchentisch und wartete, ich glaube fast, daß ich, den Kopf auf die Arme gestützt, eindämmerte. Da klingelte das Telefon in der Diele. Ich nahm an, daß es Hasse sei, der meine Angst verspürt habe und mich nun anrufe.
Aus dem Hörer war nur entferntes Rauschen und Geschnatter zu vernehmen, als ich ihn abnahm. Nach einer Weile begriff ich, daß es eine andere Sprache war. Dann kam, voll Tränen und Verzweiflung, Jennys Stimme. Sie fragte, wo ich gewesen sei. Ich weiß nicht, ob sie mich verstand, als ich sagte, daß ich zuvor den Hörer abgelegt hätte. Sie rief aus Taormina an, eine verstörte und müde alte Frau, die viele Stunden geflogen war und dann die ganze Nacht nicht geschlafen hatte.
»Elisabeth ist überhaupt nicht ins Flugzeug gestiegen!«
Ich entgegnete. daß das unmöglich sei. Ich hätte sie doch selbst alle beide durch die Paßkontrolle gehen sehen. Doch Jenny sagte. daß sie wieder hinausgegangen sei und daß sie ohne sie gestartet seien.
Nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte, hörte ich das Wasser stürmisch kochen und stürzte in die Küche. Ich goß heißes Wasser über Elisabeths abgestandenen Tee und warf ihr schimmliges Weißbrot in den Abfalleimer. Sie war abgehauen!
Abzuhauen war natürlich bequemer, als zu sagen: »Ich will nicht mit Jenny nach Sizilien fahren!« Wie gewöhnlich folgte sie dem Gesetz des geringsten Widerstands. Dreitausendfünfhundert Kronen! Dreitausendfünfhundert Kronen für eine Reise, aus der nie etwas wurde. War Geld eine Realität für sie? Die Gefühle anderer Menschen? Jennys zum Beispiel. Eine alte Frau, allein in Taormina. Enttäuscht und unruhig.
Ich versuchte, ein klebriges Glas mit Orangenmarmelade abzuwischen, das ich am liebsten weggeworfen hätte. Doch Marmelade auf dem Knäckebrot war zumindest besser als Margarine. Drei Wochen auf Sizilien, und die Orangenmarmelade wäre schimmlig, die Margarine ranzig gewesen. Und den Heizkörper voll aufgedreht! Sie scherte sich nicht um die Feuergefahr und noch weniger um den Stromverbrauch. Oder hatte sie die ganze Zeit vorgehabt, gleich wieder zurückzukommen?
Sie würde natürlich im Lauf des Tages kommen, wenn sie ausgeschlafen hätte. Sie kannte Leute in Stockholm. Die übernachteten beieinander. Alles schien für die so einfach. Das war ein anderes Leben, vollkommen fremd für mich. Das Containergefühl? Weihrauch und Weinflaschen. Indische Lumpendecken. In ein paar Tagen würde sie auftauchen, erkältet und kleinlaut. Dann aber würde ich als eine wirklich unangenehme Überraschung hier am Küchentisch sitzen.
Durchs Fenster sah ich, daß ein Junge in den Hof hinausgetreten war. Es war Gabriel. Er wohnt in einer der Wohnungen auf der anderen Seite des langen Hausflurs, und er sollte dort eigentlich überhaupt nicht wohnen. Das hier ist ein Abrißhaus. Die Mieter sind schon vor Jahren verschwunden, oder sollten es zumindest sein. Elisabeth hat jedoch neue Leute einziehen lassen.
Er stand auf der Treppe und hielt etwas in den Händen. Als er heraufschaute, sah er mich am Küchenfenster. Es war eine Schale, die er da trug, und er hielt sie, als wäre sie ein heiliges Gefäß.
Ich schlief wieder ein und erwachte erneut davon, daß jemand »Mama« rief. Ich stand auf und ging in die Küche. Sie war leer. Ich wußte doch, daß ich allein in der Wohnung war. Das Rufen hatte aber so wirklich und alltäglich geklungen.
Da dachte ich, daß sie im Hausflur stünde, und ich zog mir einen Mantel übers Nachthemd und ging hinunter. Es war niemand da, doch neben der Flurtür stand eine Schale mit Milch, die Gabriel morgens füllte. Er hatte eine Katze. Er hat sie im übrigen immer noch, und im Spätwinter riecht es im Hausflur streng nach ihr.
Jetzt stand die Schale mit der unangetasteten Milch da, und im Schein der Lampe zitterte ein großer, dunkler Fleck auf ihrer Oberfläche. Blut war in die Milch getropft. Ich hob die Schale hoch, vorsichtig, damit das Muster aus Blut möglichst nicht verändert wurde, doch meine Hände begannen zu zittern, und der Fleck zerfloß. Zuerst glich er einem feinen Buchstabenzeichen. Dann wurde er zu einem Schmetterling mit gestreiften Flügeln, und schließlich wuchs er und überzog die ganze Oberfläche, bis am Ende nur noch eine braune und hellrote Fällung übrig war. Ich setzte die Schale ab, weil ich jetzt davon überzeugt war, recht gesehen zu haben. In diesem Moment trat Gabriel aus der anderen Flurtür. Er starrte auf die Schale, als ich sie absetzte, und sah erschüttert drein. Er bekam natürlich Angst wegen dieses Blutflecks.
»Ein Mäusemord«, sagte ich, und er starrte mich an, begriff nicht. Ich fügte hinzu, daß die Katze lediglich Blut in den Schnurrhaaren gehabt habe. Doch Gabriel zog ohne ein Wort seine Flurtür zu.
Als ich nach oben ging. bemerkte ich einen kleinen Blutfleck auf der Treppe. Er war von dem gräulichen Holz nahezu aufgesogen worden. Ich legte die Zeigefingerkuppe darauf, sie wurde jedoch nicht feucht. Langsam stieg ich die Bodentreppe hinauf, um zu sehen, ob da noch mehr Blut sei. Ich hätte für die Haustür ein Schloß besorgen sollen, doch das spielte jetzt keine Rolle mehr. Wer immer es wollte, hat in all den Jahren auf den Dachboden kommen können. Besoffene haben dort oben geschlafen, und einmal legte jemand in der Brennholzkiste direkt vor unserer Küchentür ein kleines Feuer. Ich erwachte vom Rauchgestank. Auf dem Grund der Kiste lagen alte Stiefel und Schuhe und schwelten unter der Asche von Zeitungen. Die Kiste steht immer noch da, innen schwarzgebrannt.
Gleich hinter der Bodentür stand das eiserne Bettgestell mit seiner fleckigen Sprungfedermatratze, das, in dem ich geboren wurde. Lisa hielt sich am Gestänge des Kopfendes fest und schrie. Eine grausame Prozedur. Ich habe oft Mitleid mit ihr empfunden, wenn ich die blaßbraunen Flecken auf der Matratze gesehen habe.
November 1977. Blut in Lisas Bett. Ein großer, nasser Fleck.
Neben dem Bett stand, mit dem Rücken gegen die Tür eines der Bodenräume gepreßt, Ann-Sofie. Ich streckte die Hand aus und drehte den alten Schalter herum, so daß die Deckenlampe anging. Sie fing zu wimmern an und hielt den Unterarm vor die Augen. Da schaltete ich das Licht natürlich wieder aus. Das Licht vom Dachfenster her reichte aus, um den Blutfleck im Bett und ihr graues Gesicht zu sehen. Ich fragte sie, was passiert sei. Sie stolperte heran, seitwärts wie eine Krabbe, und plumpste auf das Bett.
»Wir gehen zu mir hinunter«, sagte ich.
Es schien, als zöge ein Gewicht sie nach hinten, als sie meinen ausgestreckten Arm ergriff. Den ganzen Weg nach unten stützte sie sich auf mich. Als wir in die Wohnung kamen, gab ich ihr Binden aus Elisabeths Kommode mit ins Bad. Ich setzte Kaffeewasser auf, während sie drinnen das Wasser laufen ließ. Als sie herauskam, wies ich ihr einen Stuhl zu, auf den ich eine Zeitung gelegt hatte, damit sie mit ihrem blutigen Hosenboden den Sitz nicht befleckte. Ich fragte, ob sie nicht ins Krankenhaus fahren wolle, doch sie schüttelte den Kopf. Ich überlegte einen Moment, ob ich sie dazu zwingen sollte. Dann goß ich ihr Pulverkaffee auf und ließ sie rauchen und schweigen.
Sie war fast fünfzig. Es konnte nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn sie so heftige Blutungen bekam. Ich genierte mich jedoch, sie zu fragen, ob sie noch immer menstruiere. Als ich wissen wollte, was sie auf dem Dachboden gemacht habe, sagte sie, daß sie es nicht wisse.
»Ich war wohl benebelt«, murmelte sie.
Das war auch nicht zu übersehen. Ich dachte: »Ann-Sofie ist eine Sau. Es ist nicht witzig, daß sie mir ähnlich sieht.« Sie kam in die Schule und begann zwei Klassen über mir. Wir sahen uns so ähnlich, daß uns die großen Mädchen umringten, zusammenschubsten und schrien: »Schaut, das ist Soffans kleine Schwester!«
Sie war das Kind von Instleuten* und hieß Soffan Sager. An ihr war alles gröber als an mir. Wohl deshalb, weil sie älter war, aber auch, weil sie anders war. Ich hatte vorher nicht gewußt, daß es mich gab. Doch als sie uns zusammenschubsten und sagten, daß wir uns ähnlich sähen, wurde ich als Bild, als Wahnbild geboren.
Soffan Sager war jetzt alt. Ihr Gesicht war grob, an den Wangen saßen zwei Wülste aus Unterhautfett, die sich bis unters Kinn zogen. Als sie mir am Küchentisch gegenübersaß, kniff ich unter mein eigenes Kinn und spürte eine seltsame körnige Fettansammlung, die, ohne daß ich es bemerkt hatte, dahin gekommen war. Ann-Sofie war jedoch immer schon gröber gewesen als ich. Ihr Haar war gleichzeitig grauer und blonder. Schon in der Kindheit bestand ein Unterschied zwischen uns. Es waren lediglich unsere kurzen, ziemlich geraden Nasen mit den schmalen Nasenrücken, die sich ähnelten, und unsere Münder. Vielleicht auch unsere Augen, ihre Stellung oder irgend etwas in ihrem Ausdruck. Warum behaupteten sonst alle Leute, daß wir uns glichen, wo meine Augen doch dunkelblau sind wie Lisas und ihre wässrigblau oder grau waren? Ann-Sofie hatte schlechte Zähne; sie hatte es mit den Zahnarztbesuchen nicht so genau genommen. Ihre Zahnhälse waren braun von Zahnstein und Tabak.
Als sie die Schule abgeschlossen hatte, sah ich sie drei, vier Jahre lang nicht. An einem Winterabend war ich mit Fredrik und Jenny in einer großen Pension im Norden der Stadt. Dort fand die Weihnachtsfeier der Handwerkerinnung statt, und weiß der Himmel, warum ich dabei war; es machte mir jedenfalls keinen Spaß. Das Essen bestand aus einem riesigen Büfett. wo fast alles in Mayonnaise schwamm. Die Frauen waren alle älter als fünfzig. und sie bewegten sich wie gewaltige Kähne durch den Raum. Ihre Leiber waren von Spirellakorsetts geformt: sie trugen Kleider, die sie bei der Schneiderin hatten machen lassen und die nach chemischer Waschflüssigkeit und schweren Parfüms rochen. Lediglich zwei, drei von ihnen waren schlank, und eine von ihnen war noch immer ausgelassen. Sie trat während des Kabaretts in einem Trainingsanzug und mit einer roten Zipfelmütze auf und sang »Was kann der Sigismund dafür, daß er so schön ist«. Das Unterhaltungsprogramm begann jedoch erst beim Kaffee. Ehe man sich mit seinen Heringstellern zu Tisch setzte, stand man vor einer Tür in der Gästeetage der Pension nach den Schnäpsen an. Zu diesem Zweck war eigens ein Zimmer gemietet worden. Wie gewöhnlich war Alkohol hierzulande restringiert, und die Pension hatte keine Konzession. Es war eine muntere und laute Schlange. Sie bestand natürlich vorwiegend aus Männern. Jenny war jedoch auch dabei. Sie trug einen Rock, der bis zu den Knöcheln reichte. Er erregte viel Aufmerksamkeit, denn es gab nicht viele in der Stadt, die schon etwas vom New Look gehört hatten.
Warum ging ich in eines der anderen Zimmer? Vielleicht suchte ich die Toilette? Das Zimmer liegt tief in meinem Gedächtnis, im Detail nahezu unerreichbar. Keine Farben, nur Düsterkeit, Tabakgeruch, eine Art Kälte und staubige, verkratzte Oberflächen, Verschlissenheit. Im Halbdunkel dort ein Mädchen, in einem Sofa versunken. An ihre blaurosa Beine erinnere ich mich, an den Schock über diese nackten, noppiggefrorenen. Beine. Es war Ann-Sofie, und sie trug Arbeitskleidung. Der Zauberer saß am Tisch und trank Kognak-Soda. Er war mit einem Frack bekleidet und hatte den Umhang über einen Stuhl gelegt.
Er war ein großer, schlanker Mann. Er erschien mir oft in meinen Tagträumen. Ihn jedoch wirklich aus der Nähe zu sehen, brachte mich in Verlegenheit und versetzte mich in große Angst, so als ob er die Absicht hätte, die Frackhose aufzuknöpfen und mir sein Geschlechtsteil zu zeigen. Es war dumm von mir, so etwas zu denken, denn meine Träume waren ganz und gar nicht von dieser Art gewesen. Ich träumte oder dachte mir aus, daß er mich abholte oder daß wir vor dem Hotel aufeinanderstießen, wenn er aus einer Zaubervorstellung käme. Dann nähme er mich an Orte und in Häuser mit, wo ich noch nie gewesen war.
In Wirklichkeit hatte er zu den Orten, von denen ich träumte, keinen Zutritt. Ich brauchte jedoch nicht sein wirkliches Ich, sondern sein Aussehen und das Ungewöhnliche, das nahezu Undenkbare an ihm und seinem großen, schlanken Körper, dem Frack und dem Umhang, dessen Futter purpurviolett aufblitzte, wenn er sich bewegte.
Ich wußte sehr wohl, wer er war. Seine Eltern gehörten der Handwerkerinnung an. Der Alte besaß eine Kupferschmiede. Sie waren ordentliche, arbeitsame und ein bißchen knausrige Leute. Sie hatten nur diesen einen Sohn, der über dreißig war, es aber nie mit einem richtigen Beruf versucht hatte. Es hieß, daß er saufe. Doch während die Leute tratschten und die Eltern bemitleideten, reiste er umher und zauberte. Er nannte sich Illusionist. Eigentlich hieß er Egon Holmlund, doch er verwendete einen Künstlernamen. Das war auch mein Name für ihn, wenn ich unsere Begegnungen erfand und mir lange Geschichten ausspann.