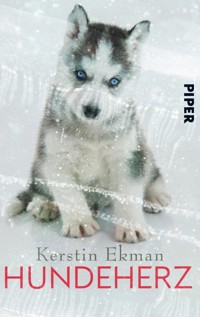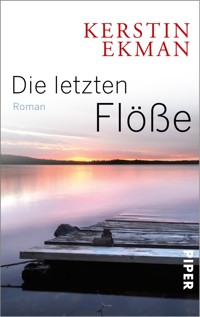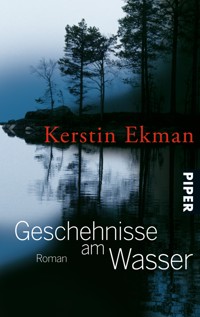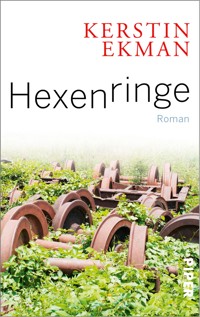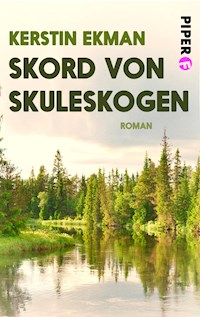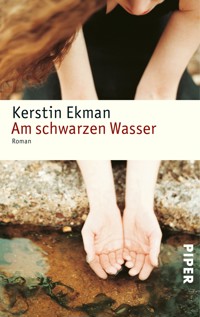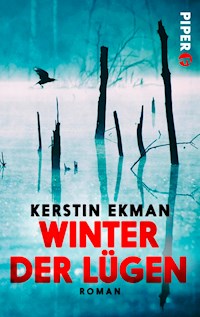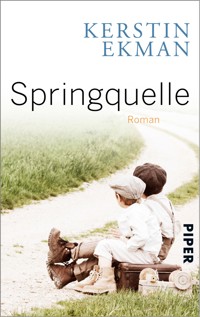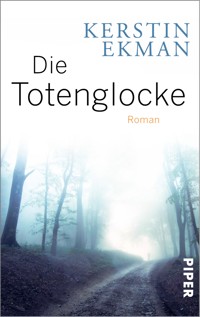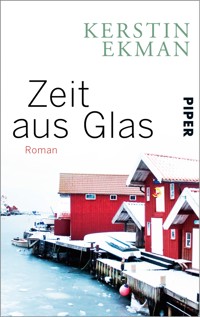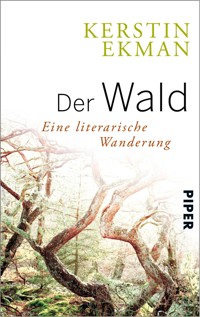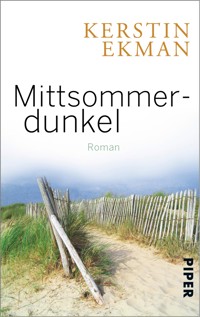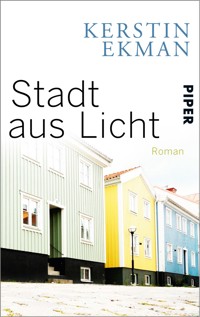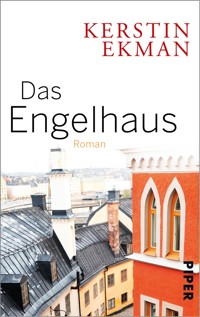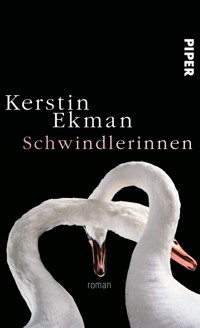
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lillemor Troj, die gefeierte 80-jährige Schriftstellerin, sitzt bei ihrem verblüfften Verleger: Er will nicht glauben, dass sie einen Unterhaltungsromanvorgelegt hat. Lillemor selbst aber kennt das Manuskript noch gar nicht –denn wieder hat es ihre jahrzehntelange Freundin Babba geschrieben, wie alle anderen Bücher auch. Nur diesmal enthält es die ungeschminkte, boshafte Wahrheit über die große Autorin Lillemor Troj. Es ist die Geschichte der beiden Frauen, ihrer Schwächen und Verletzungen – und natürlich ist es die Chronik ihres großen Betrugs …Kerstin Ekman nimmt sich selbst und die vornehme Welt der Literatur aufs Korn, wenn sie von der großen Abrechnung der beiden Frauen erzählt, von Aufrichtigkeit und Lügen, Einsamkeit und Nähe, Einbildung und Wirklichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Grand final i skojarbranschen« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95844-8
© Kerstin Ekman, 2011
Published in the German language by arrangement with Bonnier Group Agency, Stockholm, Sweden.
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2012 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de
Umschlagmotiv: Tim Flach/getty images
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Der Verleger trägt Sakko und T-Shirt. Sie selbst hat eine rosa Jacke aus dünnem Lederimitat an, dazu eine graue Hose und eine weiße Seidenbluse. Zu Hause im Garderobenspiegel sah das gut aus, fand sie, doch als sie den Raum betritt und sieht, wie er gekleidet ist, fühlt sie sich alt und lächerlich.
Vorhin hat sie an einem Fußgängerüberweg am Valhallavägen neben einer Dichterin gestanden, die sie für tot gehalten hatte: Im weinroten Mantel und mit Baskenmütze samt Silberbrosche wirkte sie jedoch höchst lebendig und gepflegt. So haben wir in den Fünfzigerjahren ausgesehen, denkt Lillemor. Und erst vor ein paar Tagen war im Svenska Dagbladet ein Bild von Nelly Sachs: blaues Seidenkleid mit Kragen, silberner Halsschmuck mit kleinen Anhängern. Sicherlich trug sie auch Pumps, doch die waren auf dem Bild nicht zu sehen. Vermutlich solche, wie ich sie anhabe.
Er redet schon eine Weile, und sie hat nicht hingehört. Peinlich, dass das Bewusstsein beim geringsten Anlass so leicht in die Vergangenheit abgleitet. Als sie sich jetzt seiner Beredsamkeit bewusst wird, kommt ihr der Gedanke: Er bittet mich womöglich, meine Memoiren zu schreiben! Ihr Unbehagen ist nicht weit vom Schrecken entfernt.
»Entschuldigung«, sagt sie. »Ich habe nicht ganz verstanden.«
Taub ist sie nicht. Jedenfalls nicht ganz, noch nicht. Wenn aber die Gedanken abschweifen, muss sie etwas vorschützen.
»Ich habe dein Manuskript bekommen«, sagt er unnötig laut und tätschelt einen dicken Stapel Papier, nein, eigentlich schlägt er mit der Hand darauf. Das ist so seltsam, dass sie lieber schweigt. Merkt sie doch, dass er verärgert ist. Sitzt da hinter seinem Schreibtisch, schlägt Respekt gebietend auf einen Manuskriptpacken und ist dabei gekleidet wie früher die Kerle in den Bierschenken. Dort saßen die Säufer in Sakko und Unterhemd und nahmen auch drinnen ihre Schiebermütze nicht ab. Dreitagebart hatten sie auch, genau wie er.
»Komm bitte mal zur Sache, Max«, sagt sie. »Du hast mich herbestellt, also hast du etwas auf dem Herzen.«
»Aber nicht doch, liebste Lillemor!« Er steht auf und versucht, jovial zu wirken. Setzt sich sogar neben sie auf das kleine Sofa. Aber er ist verärgert.
»Ich habe dich keineswegs herbestellt! Ich wollte mich mit dir treffen. Die Sache mit deinem Manuskript kann ich doch nicht am Telefon klären.«
»Ich habe kein Manuskript geschickt.«
»Nein. Ich weiß, du hast es nicht hierhergeschickt. Nicht an uns.«
Stille breitet sich aus, ein viel zu langes Schweigen. Er fürchtet wohl, die Situation nicht mehr zu beherrschen, denn er kehrt an seinen Schreibtisch zurück, baut sich in Sakko und Unterhemd auf und blickt sie streng an.
»Du hast es an einen anderen Verlag geschickt«, sagt er. »Und mir will nicht einleuchten, warum.«
Pause. Offenbar Raum für eine Erklärung. Da sie keine hat, schweigt sie.
»Du fragst dich wahrscheinlich, wie ich an dein Manuskript gekommen bin.«
»Ja, allerdings«, erwidert sie. »Zumal es gar keines gibt.«
Da legt er wieder die Hand auf den Papierstapel. Seine Fingerrücken sind schwarz behaart. Sie fragt sich, ob seine Brust auch so haarig ist. Das wäre ja gruselig. Sune war jedenfalls glatt. Wie Jakob. Der hier ist ein Esau, aufgeblasen, aber vielleicht nicht böswillig. In diesem Moment vermisst sie ihre vorherige Verlegerin sehr, ja nahezu schmerzlich. Eigentlich alle drei, auch die beiden Verleger, mit denen sie hier schon zu tun hatte. Den Ersten, mit dem sie verhandelt hat, einen schüchternen Rotgesichtigen. Den Zweiten, korrekt und mit trockenem Humor. Und schließlich die gute Sara, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Die vermisst sie am meisten.
»Komm jetzt bitte zur Sache, Max«, sagt sie und klingt müde, weil sie müde klingen will. »Du hast ein Manuskript, das du andauernd tätschelst, als ob es ein kleiner Hund wäre. Aber du tätschelst es nicht liebevoll.«
»Nein, und ich bin natürlich enttäuscht«, sagt er und schafft es tatsächlich, betrübt zu klingen. »Ich hätte nie gedacht, dass du uns verlassen würdest, nicht nach all den Jahren, die du jetzt beim Verlag bist, über fünfzig schon.«
»Zweiundfünfzig.«
»Und das, ohne etwas zu sagen! Einfach –«
Sie unterbricht ihn: »Wenn das Manuskript an einen anderen Verlag ging, wie kannst du es dann haben und in einem fort tätscheln?«
»Lillemor, ich verstehe dich nicht, und ich finde auch nicht, dass du das veröffentlichen solltest.«
»Bitte, beantworte meine Frage«, sagt sie. »Wie kannst du im Besitz eines Manuskripts sein, das an einen anderen Verlag ging?«
Wieder breitet sich Stille aus, sehr lange.
»Wir haben Kontakte«, sagt er schließlich. »Wir – ich meine, nicht wir, sondern der Konzern besitzt Verlage, die, wie du vielleicht gar nicht weißt, den Besitzer gewechselt haben. Du hast es an Rabben und Sjabben geschickt. Und dort hat jemand – der Name tut nichts zur Sache – mal bei uns gearbeitet und möchte wieder hierher. Also hat er angerufen.«
Schweigen. Er zieht mit dem Mittelfinger das Halsbündchen seines T-Shirts herunter und kratzt sich. Er ist tatsächlich fast bis zum Hals schwarz behaart. Ein Schuljunge, denkt sie. Ein Schuljunge mit rauer Stimme und schwarzen Haaren auf Brust und Fingergliedern.
»Und du hast es abgekauft?«
»So könnte man es ausdrücken, ja. Du wirst folglich eine Ablehnung bekommen, du verstehst. Also an dieses Pseudonym und an die Adresse, die du angegeben hast. Einen Brief des Inhalts, dass das Buch nicht zum Verlagsprofil passt, du aber hoffentlich nichts dagegen hast, dass er es an uns weitergeschickt hat.«
»War’s teuer?«, fragt sie und ist jetzt wirklich interessiert.
»Jaa – schon, in der Tat. Aber ich finde, das ist es wert.«
»Das Manuskript?«
»Nein, nein. Das ist nichts, was du veröffentlichen solltest. Ich möchte dir nur helfen.«
»Wobei?«
Darauf kann er offensichtlich nicht antworten. Er trommelt jetzt auf dem leidigen Papierstapel herum. Der paperasse. Dieses Wort hat sie in ihrem langen Schriftstellerinnenleben so oft gehört, dass sie es irgendwann im Larousse nachgeschlagen hat: papier sans valeur. Doch das kann er nicht wissen.
»Lass es mich lesen«, sagt sie. »Ich werde allmählich wirklich neugierig.«
Als sie sich das Manuskript nehmen will, legt er beide Hände darauf und sagt, das sei Dynamit und sie dürfe es unter gar keinen Umständen mitnehmen. Er scheint jetzt fast zu glauben, dass sie nicht weiß, was drinsteht. Glauben oder nicht glauben. Er bewegt sich vielleicht genau dazwischen, jedenfalls ist er sehr verlegen.
»Ich will es lesen«, beharrt sie.
»Unten im Autorenraum, da kannst du es lesen. Dieses Manuskript darf das Haus nicht verlassen.«
Er trägt den Manuskriptpacken auf dem Weg nach unten. Lillemor tun die Knie weh. Treppab spürt sie die Arthrose. Als sie beim ersten Mal die andere Treppe hinaufgestiegen ist, die sie in das Zimmer des Buchverlegers geführt hat, trug sie Stöckelschuhe. Das geht jetzt nicht mehr. Sie erinnert sich auch, dass ihr das helle Haar wie ein Heiligenschein um den Kopf stand und sich nicht mal mit Pilsner und Lockenwicklern bändigen ließ. Damals gab es wohl noch keinen Haarbalsam, denkt sie, und dann ist sie verlegen, weil er wieder etwas gesagt und sie es nicht gehört hat. Sie muss nachfragen und ihn bitten, stehen zu bleiben und sich zu ihr umzudrehen. Anders versteht sie ihn nicht.
»Ich habe gesagt, du kannst dieses Buch nicht allen Ernstes veröffentlichen wollen. Es käme dann nächstes Jahr heraus. Wenn du achtzig wirst. Das kannst du nicht wollen. Außerdem wäre es einer Lillemor Troj nicht würdig, unter Pseudonym zu veröffentlichen.«
Er scheint doch davon auszugehen, dass sie dieses Manuskript verfasst hat.
»Ist es denn so schlecht?«
»Absolut nicht! Aber es ist so – wie soll ich sagen –, es ist so ganz anders als das, was du sonst schreibst.«
Als sie endlich den Treppenabsatz erreicht haben und die nächste Treppe zum Erdgeschoss hinuntergehen wollen, sagt er: »Das ist ja der reinste Unterhaltungsroman.«
Da steigt sie erneut in den Brunnen der Zeit hinab, und ebenso deutlich wie das Wort paperasse vernimmt sie die Worte: Was ist eigentlich verkehrt an Unterhaltung?
In dem kleinen Autorenraum angelangt, an dessen Wänden Porträts von Nobelpreisträgern und anderen großen Schriftstellern – alles Männer – hängen, legt er den Papierstapel auf den Schreibtisch und sagt: »Meiner Meinung nach solltest du das noch mal durchsehen. Bestimmt kommst du dann zu einer anderen Entscheidung. Ich bin überzeugt davon, Lillemor. Möchtest du ein Tässchen Kaffee?«
»Ja bitte, gern.«
Wie gut, dass er geht. Er macht sie nervös. Hier, wo sie so oft gesessen und ihre Bücher signiert und mit Widmungen versehen hat, fühlt sie sich zu Hause. Kaum ist er gegangen, nimmt sie den Stapel und beginnt auf der ersten Seite zu lesen.
Jugend Freude List
Dreimal habe ich mich im Oktober 1953 im Engelska Parken an Lillemor Troj herangeschlichen. Bestimmt hat sie mich unter den Bäumen stehen sehen, aber sie tat so, als bemerkte sie mich nicht, weil ich nämlich aus Kramfors bin. Das ist sie zwar auch, aber daran wollte sie nicht erinnert werden. Sie sagte stets, sie habe in Härnösand Abitur gemacht, was ja auch stimmt. Als ich das zweite Mal dort stand, waren wir einander so nahe, dass sie mich eigentlich hätte grüßen müssen. Doch sie schwang sich auf ihr Fahrrad und schaute stur geradeaus.
Ich hatte mir jetzt schon zweimal freigenommen, um auf sie zu warten. So konnte das nicht weitergehen, denn meinem Vorgesetzten passte es nicht, dass ich mir freinahm. Ich arbeitete damals in der Stadtbibliothek von Uppsala. Wo Lillemor wohnte, wusste ich nicht, nur dass sie Literaturgeschichte und Poetik studierte. Wenn ich sie also treffen wollte, musste ich die Zeiten der Prüfungsseminare im Philologischen Institut am Ende des Parks abpassen. Ich sagte, ich müsse zum Zahnarzt, und beim dritten Mal meinte mein Chef, ich hätte anscheinend schlechte Zähne. Da sah ich durch seinen braunen Anzug hindurch. Ich sah, dass sein Baumwollunterhemd so graugelb war wie seine lange Unterhose und geflickte Ärmelbündchen hatte. Seine Brust mit den grauen Haarbüscheln und den pigmentlosen Flecken war über zwei fehlenden Rippen und einem ausgeheilten tuberkulösen Herd eingesunken.
Das ist meine Kunst. Sie ist nicht mal schwierig. Ich kann auch Gebäude durchdringen. Von meinem Aussichtsposten aus sah ich das Haus, in dem ein eierköpfiger kleiner Professor durch das Charmeusefutter der Hosentasche an seinem Schwanz fingerte, als Shelleys Ode an den Westwind durchgenommen wurde. Ich hörte Lillemor etwas sagen. Sie verwendete das Wort frappant. Shelleys Ansicht, dass aus seinen Worten Erneuerung entstehen sollte, während sie gleichzeitig mit Funken aus einem erloschenen Ascheherd und mit einem Wirbelsturm aus Laub verglichen wurden, sei frappant. Sie äußerte sich scheu, wie es sich für eine Angehörige des weiblichen Geschlechts gehörte, dabei aber hoffnungsvoll sicher. Und sie hatte allen Grund der Welt, sicher zu sein, denn der Eierkopf intensivierte sein Gefingere, als er sie ansah.
Ich hatte diese Prüfungsseminare drei Jahre zuvor durchlaufen. Zwar waren die Studenten jetzt noch ganz am Anfang, sprachen also eher über die Antike. Vielleicht über Sappho. Aber dass er fingerte, dessen war ich mir sicher.
Die Fähigkeit, durch Steinwände und Unterhemden zu sehen, war mir damals ein Zeitvertreib. Mehr wurde daraus eigentlich nie. Sie verkürzte mir die Warterei, als ich auf meinen Kreppsohlen dort im Laub stand, das in schwefelgelben, brandroten und schwarz gesprenkelten Haufen unter den Bäumen moderte.
Diesmal, es war das dritte Mal, würde ich mich nicht an der Nase herumführen lassen. Ich hatte mich ganz in der Nähe des Eingangs zum Philogogicum hinter einen Ahorn gestellt. Sowie Lillemor sich auf ihr Fahrrad setzte, wollte ich hervortreten.
Nun schwärmten sie heraus. Ihre Stimmen klangen in dem stillen Park wie Vogelgezwitscher. Sie steckten sich Zigaretten und Pfeifen an. Feuerfliegen glühten unter ihrem eifrigen Gepaffe. Daraus würden Tumoren und Emphyseme entstehen, ich sah ihr Haar ergrauen und ihre Wangen vertrocknen und einfallen. Ich sah auch drei Besoffene auf Pontus Wikners Grab, zwei Männer und eine fette, verbrauchte Frau, deren Schlüpfer auf die Schenkel gerutscht war. Das war aber erst vor ein paar Jahren, denn so ging es damals dort nicht zu, allenfalls in Dragarbrunn. 1953 fiel auf dem Friedhof das Laub still auf unbefleckte Grabsteine herab. Zeiten zu durchdringen ist im Prinzip nicht schwieriger als Gebäude und Körper.
Diesmal war ich gewappnet. Als Lillemor sich auf ihr Fahrrad setzte und ihren grauen Plisseerock um den Sattel drapierte, peilte ich sie an und stapfte durchs Laub. Wir stießen auf dem Kiesweg aufeinander. Sie geriet ins Schwanken und sprang vom Rad. Ich grüßte, und sie tat überrascht. So begann unser gemeinsames Leben.
Es tut weh, wenn ich daran denke, dass sie es mir nehmen wollte. Sie scheint zu glauben, das ginge so einfach. Überlegt sie es sich anders – und wann hat sie das nicht getan! –, packe ich diese Geschichte in den Karton für havarierte Projekte. Diesen Karton bewahre ich ebenso wie alle Karteikästen und Ordner auf dem Dachboden auf. Dort sind auch ihre Tagebücher. Über deren Verlust kann sie sich ja Gedanken machen, sobald sie ihn entdeckt.
Als sie geheiratet hatte, schrieb sie, dass in dem hellhörigen Haus Radioapparate lärmten, Toiletten rauschten und Schranktüren schlügen und dass sie glaube, man werde von wahrer Stille scheu. Weiter schrieb sie, dass sie ihre Volantgardinen in der Küche gewaschen und mit einem Döschen Pulver hellblau gefärbt habe. Sie hätten das Blau des Himmels angenommen, fügte sie hinzu, da sie die Dinge immer von der lichten Seite zu sehen versuchte. In ihre Küche war also der Himmel eingezogen, und sie war ein Engel, der Heringe briet und von Stille scheu wurde. Obwohl ich glaube, dass Stille ihr eher Schrecken einjagte.
Das Präsens ist eine Zeitform, die sie missbilligte. Sogar verbot. Sie sagte, es sei das Tempus der Angst. Doch da übertrieb sie, denke ich. Im Übrigen sollte man mit einem Wort wie Angst nicht leichtfertig umgehen, und das sagte ich ihr auch.
»Na, dann eben Bangigkeit«, sagte sie. »Angst hat man wohl eher in diesen bibbrigen Morgenstunden, wenn man die Rezensionen noch nicht gelesen hat.«
»O nein, das ist bloß Bangigkeit. Gerade du müsstest wissen, was Angst ist.«
»In Übersetzungen ist das Präsens jedoch unmöglich«, erklärte sie. »Besonders im Englischen. Im angelsächsischen Sprachraum scheut man davor zurück.«
Man scheut also vor der Gegenwart zurück. Denn das Präsens ist ja die Gegenwart. Lillemor wollte das Imperfekt haben, wahrscheinlich weil man die Dinge damit hinter sich gelassen hat und sie in einer Erzählform, fest wie Gusseisen, beherrscht. Noch schlimmer wäre natürlich das Plusquamperfekt, von diesem Altmännertempus lässt man klugerweise die Finger. Damit wird das Vergangene nur noch weiter nach hinten verschoben, und es ist, als stakste man in sehr fernen Erinnerungen herum, farblos geworden wie alte Diapositive.
Wenn das Präsens Angst ist, gebe ich es ihr. Das Imperfekt ist für mich, da alles hinter mir zu liegen scheint. Das Leben. Jetzt ist nur noch diese unvermeidliche Ackerei übrig. Aufstehen, Radio anmachen, Teewasser aufsetzen. Weiterackern.
Das nächste Mal traf ich sie dann in einer Konditorei. Ich hatte Landings vorgeschlagen, doch sie zog Güntherska vor, das ein bisschen abseits in der Östra Ågatan lag. Als wir schließlich im Engelska Parken aufeinandergestoßen waren, hatte ich kurzerhand mein Anliegen vorgetragen; sie war verblüfft. Ich hatte mit Entrüstung und Zurückweisung gerechnet, denn sie war konventionell, schließlich war die Familie auf dem Weg nach oben.
»Ich kann das allerdings nicht machen, ohne es gelesen zu haben«, hatte sie gesagt und dafür jetzt zwei Tage Zeit gehabt. Ich musste fast eine Dreiviertelstunde warten, bis sie auftauchte. Ihre Wangen waren rosig, sie war wohl wieder schnell geradelt, und sie steckte sich eine Zigarette an.
»Diese Geschichte ist gar nicht dumm!«, sagte sie. »Du kannst ja schreiben.«
»Ich will den ersten Preis.«
Es roch nach Kaffee, Vanille und Tabak, als ich mir das Foto anschaute, das Lillemor mitgebracht hatte. Es war eine Atelieraufnahme. Das blonde Haar, gescheitelt und mit gelocktem Pony, war ordentlich frisiert. Ihren bis zum Lockenkranz im Nacken flachen Hinterkopf sah man nicht. Ihre Augen waren sehr groß und tief, die gezupften Augenbrauen darüber diskret mit einem Stift nachgezogen. Die Lippen waren sorgfältig geschminkt und glänzten. Sie trug den ausgeschnittenen rosaroten Angorapulli wie auch jetzt, doch auf dem Bild war er hellgrau. Um den Hals hatte sie eine Perlenkette, die adrett auf den zerbrechlich wirkenden Schlüsselbeinen lag.
Die Kellnerin kam, und Lillemor bestellte Kaffee und zwei Schokorollen mit Pistazien und Sahne. Da sie die letzte Zigarette aus ihrer Packung geraucht hatte, ergänzte sie die Bestellung um eine Schachtel Marlboro. Mir war klar, dass ich sie einladen sollte, und ich reduzierte den letzten Teil der Bestellung auf zwei einzelne Zigaretten der Marke Boy. Sie hatte sich die Lippen geleckt. Die Gier, von der sie nichts wusste, lag weit vor dem Gedanken.
»Das mit dem Foto gefällt mir nicht«, sagte Lillemor. »Wozu brauchen Sie das?«
»Zum Veröffentlichen. Ist doch ein Magazin.«
Sie sah mich an, nachdenklich. Ich war nicht hübsch, aber sie war es. Im Güntherska hatte ich mich so gesetzt, dass ich den Konditoreispiegel im Rücken hatte. Normalerweise wäre es mir egal gewesen, aber jetzt war die Frage des Aussehens so wichtig, um nicht zu sagen: schicksalsträchtig, dass ich den direkten Beweis dafür, niemals einen Preis in einem Magazin gewinnen zu können, vermied. Ich hatte mein Abitur in allen Fächern außer Sport mit Eins plus gemacht. Doch darum ging es jetzt nicht.
Wir verabredeten, dass Lillemor die Hälfte der Preissumme von fünfhundert Kronen dafür bekommen sollte, dass sie die Geschichte unter ihrem Namen einschickte und im Restaurant Metropol in Stockholm den Preis entgegennehmen würde.
»Du scheinst dir ja recht sicher zu sein!«
»Ja«, sagte ich. »Ich werde gewinnen.«
Natürlich überlegte sie es sich anders. Schon nach einer Woche rief sie an und sagte, es sei doch bescheuert, bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb für einen anderen Menschen einen Preis entgegenzunehmen. Außerdem sei es Betrug. Sie rief mich in der Bibliothek an, was meinen Chef aufbrachte. Wir durften keine Privatgespräche führen. Wie üblich überlegte sie es sich dann doch noch mal. Sie hatte ja auch die Geschichte und das Foto schon eingeschickt.
Die Zuerkennung des ersten Preises beruhte nicht nur darauf, dass ich schreiben kann. Anstatt Lucia wie selbstverständlich zum Opfer zu machen, hatte ich sie in der Wettbewerbskonkurrenz morden lassen. Das war allerhand, und den alten Knackern in der Jury gefiel das sicherlich im gleichen Maße wie die von Lillemor Troj eingesandte Fotografie. Die Mordmethode war natürlich fragwürdig. Von einem Glas Wasser, in dem ein paar Stunden Maiglöckchen gestanden haben, wird einem höchstens schlecht. Aber es ging durch. Es ist zumindest zweifelhaft, ob im Dezember zum Blühen gebrachte Maiglöckchen überhaupt noch Gift absondern, und von der damals führenden Krimiautorin, die in der Jury saß, hatte ich in dem Magazin einen ironischen Kommentar bekommen. Ganz offensichtlich hatte sie nicht für meine Geschichte gestimmt.
Wir saßen in Lillemors Zimmer im Studentinnenheim Parthenon in der Sankt Johannesgatan. Sie erzählte mit Bravour von ihrem Besuch in Stockholm und wie sie den Preis entgegengenommen hatte. Ich weiß nicht, ob ich schon damals an ihre dramatische Ader herankommen wollte. Sie ist eine Schauspielerin. Und die verkümmert ohne Publikum. Dieses Talent ist vielleicht nicht angeboren, aber frühzeitig erworben. Ein süßes Mädchen lernt seine Erlebnisse so aufzubauschen, dass die Schilderung hörenswert wird.
Sie machte in einem Elektrokocher Wasser heiß und bot Tee an. Auf dem Tisch zwischen uns reihte sie die Geschenke auf, die sie und die Luciakandidatinnen erhalten hatten. Sie stammten von Firmen, die in dem Zeitungsbericht erwähnt werden wollten. Ich durfte nun wählen zwischen einem Minifläschchen Parfüm (Hermès) und einem Döschen Pancake Make-up, das den Teint glatt und braunrosa machte, zwischen einem Paar nahtloser Nylonstrümpfe und einem rosa Plastikschminktäschchen mit Reißverschluss. Die Strümpfe saßen allerdings schon an Lillemors Beinen. Sie hatte den Scheck mit der Preissumme eingelöst, gab mir jetzt das Geld, und ich gab ihr zweihundertfünfzig Kronen zurück.
Sie saß in einem Korbsessel, den sie mit schwarzer Lackfarbe angestrichen und mit einem roten Kissen bestückt hatte. Hinter ihr an der Wand hing eine Kalebasse neben der ungerahmten Farbreproduktion eines Van-Gogh-Gemäldes: ein Straßencafé am Abend. Von den Straßenlaternen ergoss sich das Licht in die Anilinschatten der Reproduktion. Ich saß auf der Ottomane.
Als ich die Scheine in meine Brieftasche steckte, sagte Lillemor: »Ich finde, du könntest dir einen neuen Mantel kaufen.«
Ich verstand nicht, was an meinem braunen Mantel verkehrt war. Ich hatte ihn zu einer Jacke umgearbeitet.
»Du solltest nicht in so einem abgeschnittenen alten Ding herumlaufen«, sagte Lillemor. »Du siehst darin nur noch größer aus.«
»Es kommt mir nicht zu, mich kleiner zu machen, als ich bin«, erwiderte ich.
Ich hatte nicht erwartet, dass wir Freundinnen würden, aber doch wenigstens in Kontakt blieben. Daraus wurde nichts. Zweimal besuchte ich sie noch im Studentinnenheim, aber sie bot mir keinen Tee mehr an. Und beim letzten Mal erzählte sie, dass sie sich verlobt habe. Das Foto ihres Zukünftigen stand auf der Kommode, und ich hatte das Gefühl, dass er uns bei unserer Unterhaltung beobachtete. Er schien ein dunkler Typ zu sein. Die Fotografie hatte jedoch einen Braunstich, und sein Haar war in Wirklichkeit von der schwedischen Nichtfarbe. Im Lauf der Jahre sollte er einen dicken Bauch bekommen, was im Verein mit seinen kurzen Beinen fatal war.
Da saß Lillemor nun. Sie war mir so gelegen gekommen. Auf dem Bild in der Zeitung war sie vom Blitzlicht geblendet, doch es wurde ein Ausschnitt aus der Lichtflut gemacht: glänzende schwarze Hüften, vom Korsett geformt, während die Rüsche am Busen das gespannt Straffe milderte und Lillemor mädchenhaft verletzlich und verwirrt wirken ließ. Genauso dankbar, überwältigt und durch und durch glücklich, wie ein Mädchen aufzutreten hat, das in einem Kurzkrimiwettbewerb mit Luciathema Siegerin geworden ist. Als ich das Bild in der Zeitung sah, glaubte ich fast selbst an den Betrug. Lillemor war perfekt.
Zuerst war sie die Lucia in der Kurzgeschichte gewesen. (»Was geschieht in der dunkelsten aller Nächte? Wer war das weiß gekleidete Mädchen mit dem Blutfleck auf der Brust? Schick Deine Kurzgeschichte bis zum 15. Oktober an unsere Redaktion.«) Dann hatte sie den Preis entgegengenommen und mit schlanken Fesseln auf dem Podium gestanden. Und jetzt war sie also verlobt.
»Warum schreibst du keinen Krimi?«, fragte sie. »Jetzt brauchst du doch keine Komplexe mehr zu haben.«
Sie war der Meinung, dass man zum Schreiben Selbstvertrauen braucht. Doch sie irrte sich. Man braucht Anonymität.
Ja, ich hatte es mir andersüberlegt, denkt Lillemor. Aber diese merkwürdige Person sagte wahrscheinlich nur: »Ach was!« Und legte auf. Die Hälfte der Preissumme entsprach genau dem Betrag, den ich monatlich von meinem Studiendarlehen ausbezahlt bekam, und deshalb war es gar nicht so abwegig, dass ich es mir doch noch mal überlegte. Nie aber habe ich auch nur einem Menschen etwas von meinem Deal mit Babba Andersson erzählt.
In jenem Herbst hat sie eines Vormittags Babba angerufen und ihr von dem Brief erzählt, in dem stand, dass sie gewonnen habe. Oder hatte sie »wir« gesagt? Diese Person schien jedenfalls nicht die Spur überrascht zu sein. Irgendwann Anfang Dezember fuhr Lillemor mit der Bahn nach Stockholm und ging zum Restaurant Metropol an der Ecke Sveavägen und Odengatan. Dort saß eine Jury aus acht Herren in gestreiftem Anzug, dieser älteren, asymmetrisch mit Crêpe de Chine drapierten Krimiautorin und einem Chefredakteur im Blazer mit Clubknöpfen. Eigenartig, dass der Text in der paperasse Erinnerungen weckt, deren sie sich kaum bewusst war. Sie sieht zehn Luciakandidatinnen in weißer Bluse und engem schwarzem Rock im Gänsemarsch hereinkommen und auf einem Podium Aufstellung nehmen.
Sie muss bei den Herren gesessen und zugesehen haben, denn sie hat sie noch genau so in Erinnerung: auf einer Estrade. Einige waren hübscher als sie, und viele hatten einen größeren Busen und einen knackigeren Po. Aber keine war so sehr der Luciatyp wie ich, denkt sie. Das hatte sie den Komplimenten entnommen, die man ihr machte. Zum Essen schloss sich die Jury in einen separaten Raum ein, folglich muss sie selbst mit den Luciakandidatinnen gegessen haben. Sie erinnert sich nicht mehr genau. Nur daran, dass die Mädchenstimmen vor der Entscheidung vor Aufregung schrill wurden. Zu Kaffee, Likör und Kognac-Sodas kam die Jury wieder heraus, und da erhielten die Kandidatinnen recht handfeste Komplimente. Lillemor legte jedoch keiner die Hand auf den Po. Als Akademikerin und Autorin von Kurzgeschichten wurde sie eben anders behandelt als Verkäuferinnen und Büroangestellte.
Die Stimmzettel des Leserkreises wurden aus einem Karton gekippt und ausgezählt. Sie wurden der Entscheidung der Jury gegenübergestellt. Das Mädchen, das zur Lucia des Magazins gewählt wurde, weinte. Die übrigen neun lächelten, auch wenn es schwerfiel. Sie erinnert sich aber nur an diese eine, die derart weinte, dass ihr die Wimperntusche als grauschwarze Lavierung unter den Augen verlief. Die großen runden Blitzgeräte der Fotografen blendeten, die Kameras klickten. Schließlich war Lillemor an der Reihe, aufs Podium zu steigen, der Chefredakteur hielt eine Rede auf sie, und es blitzte wieder.
So hatte sie sich das wohl nicht vorgestellt. Sie hatte gedacht, man würde sich mit der Atelieraufnahme begnügen, auf der Frisur, Gesicht und Kleidung in Ordnung waren. Diese Minuten, in denen sie auf dem Podium stand und von den Blitzen aus den blanken Lampentrichtern geblendet wurde, hatten etwas Loderndes und Unkontrolliertes, ja Besinnungsloses an sich. Genau in dem Moment dürfte ich es bereut haben, denkt sie. Ich muss befürchtet haben, dass es ruchbar würde. In der Studentenvereinigung. In der Prüfungskommission.
Als ihr diese Szene durch den Kopf geht, kommt der Kaffee, und sie legt reflexartig die Hände auf die Seite, die sie gerade gelesen hat. Es ist Kattis, die ihr die Tasse Cappuccino bringt. Sie weiß genau, was Lillemor gern hat. Verlagssekretärinnen gibt es nicht mehr, jetzt sind alle Assistentinnen oder etwas noch Feineres. Den Kaffee dürfen sie aber nach wie vor bringen.
Kattis sieht den Manuskriptpacken und ruft: »Ein neuer Roman! Wie wunderbar!«
Lillemor glaubt an die freundliche Seele, schüttelt aber doch den Kopf.
»Sie tun immer so geheimnisvoll«, sagt Kattis.
Du kannst Gift darauf nehmen, dass ich allen Grund dazu habe, denkt Lillemor und lehnt die Zimtschnecke dankend ab, die Kattis ihr anbietet.
»Rufen Sie mich an, wenn Sie Saft oder Obst oder sonst etwas haben möchten. Werden Sie lange bleiben?«
»Ich weiß noch nicht«, erwidert Lillemor. Doch sie merkt schnell, dass sie nicht lange bleiben wird, weil es ständig Unterbrechungen gäbe. Es würde Freundlichkeiten hageln. Und bald käme Max herunter, um sie zu kontrollieren.
Als Kattis gegangen ist, steckt Lillemor den Manuskriptpacken in ihre Tasche von Furla. Sie hatte beim Kauf sorgfältig darauf geachtet, dass ein A4-Format hineinpasst. Und es passt sogar die ganze paperasse hinein.
Sie will das Haus nicht durch die Rezeption verlassen, deshalb bleibt sie an der Tür zum Hof stehen und überlegt. Wenn man den Knopf mit dem Schlüsselsymbol drückt, kommt man hinaus. Lillemor ist sich jedoch nicht sicher, dass sie dann auch auf die Luntmakargatan gelangt. Sie will keinesfalls auf den Sveavägen gehen, da Max möglicherweise bereits entdeckt hat, dass der Autorenraum leer ist.
Das große Tor zur Luntmakargatan geht auf, und ein LKW ächzt herein. Sie eilt über den Hof und huscht hinaus. Der Manuskriptpacken in der Tasche ist schwer. Max glaubt wohl, dass sie das alles geschrieben hat. So weit, so gut.
Und wenn er es nicht glaubt? Seit sie im Autorenraum den ersten Abschnitt gelesen hatte, war ihr leicht übel.
Sie muss ihre Ruhe haben. Auf dem Weg zum U-Bahnhof Hötorget bei der Tunnelgatan angelangt, wird ihr klar, dass Max schon hinter ihr her sein kann. Er nimmt sich natürlich ein Taxi, das dann warten darf, bis sie am Karlaplan aus dem U-Bahnhof auftaucht, in die Breitenfeldsgatan einbiegt und zu ihrem Haus geht. Für ihn, der glaubt oder auch nicht glaubt, ist das Manuskript in ihrer Tasche wohl eine Art Gedankenexperiment wie Schrödingers Katze. Er muss den Kasten öffnen, um zu sehen, ob die Katze noch lebt. Lillemor biegt also lieber in den Tunnel ab, eilt an einem schmuddeligen, frierenden Geiger vorbei, stürmt nach nicht mal zehn Minuten an der Statue des Schriftstellers Hjalmar Söderberg mit den roten Handschuhen seiner Figur Tomas Weber vorüber und ist auch schon in der Königlichen Bibliothek. Ihren Mantel muss sie in ein kleines Schließfach knüllen, weil die großen Schränke, in die man einen Max Mara aus Kamelhaar hängen kann, so spät am Nachmittag alle belegt sind. Wenn sie jetzt bloß mit der Tasche, in der sie das Manuskript hat, durchkommt! Sie hängt sie sich über die linke Schulter, und zum Glück nickt die Frau hinter der Theke freundlich als Zeichen des Wiedererkennens und merkt überhaupt nicht, dass sie etwas mit hineinnimmt. Genau wie Max begriffen hat, steckt in ihrer Tasche eine Bombe, und bevor diese sich an eine Entscheidung herangetickt hat, muss Lillemor in Ruhe lesen können.
Sie will durch eine der schweren alten Schwingtüren in den großen Lesesaal und weiter zum Zeitschriftenraum gehen, doch im letzten Moment fällt ihr ein, dass der ja verlegt wurde. Sie hat sich dort immer wohlgefühlt und sich gefreut, dass sie immer noch schlank genug ist, um zwischen einem Pfeiler und einem Bücherregal hindurch den Weg zu den Tischen abkürzen zu können. Sonnenschutzfenster sorgten für ein behagliches und gleichmäßiges Licht unter den Leuchtstoffröhren. Lillemor würde sich jetzt am liebsten in die helle Ruhe und Zeitlosigkeit des alten Zeitschriftenraums setzen, muss sich aber nun in unterirdische Regionen begeben, wo es kein Tageslicht gibt.
Dort unten ist es fast menschenleer. Als sie die Lampe über der Tischplatte angeknipst und sich den dicken Manuskriptpacken zurechtgelegt hat, kommt ein Student und setzt sich zu ihr an den Schreibtisch, obwohl es noch viele freie Plätze gibt. Er ist bestimmt ein Gewohnheitstier wie sie, das am liebsten seinen vertrauten Platz einnimmt. Jetzt loggt er sich in seinen Computer ein. Lillemor versucht, sich auf die Manuskriptseiten zu konzentrieren, aber von seiner Tastatur dringt ihr ein emsiges Klicken und von seiner Nase ein lockeres Geschniefe ans Ohr. Ab und zu schnäuzt er sich inhaltsreich in ein Papierhandtuch aus der Toilette, sodass Lillemor flieht und sich in die Leseecke setzt, die gerade leer ist. Es kann aber jemand kommen, und damit das dicke Manuskript keine Aufmerksamkeit erregt, zieht sie wahllos einen Zeitschriftenband aus einem Regal. Es ist Ny Illustrerad Tidning aus irgendeinem 1880er-Jahr, die sie aufgeschlagen auf den Tisch legt. Ihren Extischnachbarn hört sie immer noch schniefen, wenn auch jetzt entfernt.
Sie kann sich gerade noch mal anschauen, was sie über die Begegnung im Engelska Parken schon gelesen hat, da bekommt sie auch hier Gesellschaft. Wenigstens ist es kein Bekannter. Aber den Affen kennen alle, nur der Affe kennt keinen. Es überrascht sie also nicht, als der Mensch, rundes Gesicht und Schifferbart und in ihrem Alter, zischt: »Neuer Roman in Arbeit?«
Die Königliche Bibliothek ist zu einem Treff für alte Knacker geworden, denkt sie. Hier laufen zu viele pensionierte Humanisten herum und lechzen nach Gesellschaft.
»Ich prüfe nur Zitate«, brummelt sie und macht einen möglichst beschäftigten Eindruck. Während sie in der Ny Illustrerad Tidning blättert, fesselt sie eine Initiale mit einem ausgemergelten Jungen mit einer Krücke. Über ihm schwebt ein Schutzengel, und unter ihm ist ein Blumenstrauß. Um glaubwürdig zu wirken, liest sie das Gedicht mit dem Titel Erbarmen.
Wie kann dein Herz ihr widerstehn
Der Bitte derer, die vergehn
Zum Leid verdammt am Lebensmorgen?
Unwillkürlich denkt sie an den Geiger im Tunnel, an dem sie vorbeigestürmt ist, ohne ihm etwas in den Geigenkasten zu legen. Und als sie weiterliest, sieht sie Fernsehbilder abgemagerter Kinder in Afrika vor sich. Mit aufgetriebenen Bäuchen und großen Augen. Hier liegt der Dichter ein bisschen daneben, aber vom Inhalt her ist das Gedicht zeitlos.
Und große Augen bitten scheu
Und blasse Lippen lächeln treu
Vom Weh sie beben stets aufs neu
Und flüstern: Hilf mir jetzt, nicht morgen!
Ihr Nachbar hat jetzt seine Nordisk Tidskrift aus der Hand gelegt, beugt sich schamlos vor und liest mit. Sie sieht ihn mit einem, wie sie hofft, strafenden Blick an, aber das berührt ihn nicht.
Er lächelt schmeichlerisch und flüstert: »Erbärmlich, was? Richtiger Kitsch. Aber Sie haben jetzt was Schönes in Arbeit, nicht wahr?«
Da steht Lillemor auf, nimmt den Manuskriptpacken und verlässt den Raum. Sie ist überzeugt, dass er es nie gewagt hätte, das Gedicht erbärmlich zu nennen, hätte er nicht den Namen Carl David af Wirsén darunter gelesen. Jede Zeit hat ihre Übereinkünfte. Die Königliche Bibliothek wird in hundert Jahren noch stehen, und irgendjemand wird dann darüber feixen, was Lillemor Troj in ihrem Romanzyklus Kuckucksspeichel über die Armen geschrieben hat. Obwohl – wer sollte das sein? Sie ist sich nur einer Sache sicher, der des Vergessens. Es ist ein Wasserfall. Und wir stürzen hinab. Zu Wirséns Zeiten ist man sanfter gefallen.
Sie weiß nicht, wohin sie gehen kann, um ihre Ruhe zu haben, und bleibt, nachdem sie aus den unterirdischen Regionen aufgetaucht ist, im Lesesaal an einem Fenster stehen und starrt hinaus auf den überdimensionierten Linné zwischen bereiften Dahlien. Aus dem Regal mit den Enzyklopädien hat sie ein Buch genommen und vor sich hingelegt. Es ist ein Lexikon von Aschehoug und Gyldendal, und als sie hinter sich Schritte hört, liest sie zerstreut ein paar Zeilen, um einen beschäftigten Eindruck zu machen. Dabei lernt sie, dass Airbag auf Norwegisch sikkerhetspute heißt.
Ja, wer an dem Inhalt dieser Tasche zu tragen hat, dem kann ein sikkerhetspute nützlich sein. Es ist nicht gut, an der Fensterbank zu lehnen und die Bäume im Humlegården anzustarren, die zu einem kranken Graugrün verblasst sind. Angst ist Präsens, denkt sie und möchte wieder lesen, im Imperfekt verschwinden. Aber hier unter den Leuten kann sie das nicht. Wenn es nicht Angst ist, was sie empfindet, dann ist es zumindest Furcht. Ein ganz normaler, grundloser Angstanfall wäre dem vorzuziehen. Sich fallen lassen zu dürfen, ohnmächtig zu werden oder zu schreien.
Um sie herum ist alles irrenhausgrün. Hatten nicht die Wände auf Station 57 genau diese Farbe? Sie weiß es nicht mehr, fürchtet aber, es bald zu erfahren, wenn sie weiterliest. Die Pfeiler mit ihren pseudokorinthischen Kapitellen sind speigrün. Ich darf mit dem Manuskript nicht ohnmächtig werden, denkt sie, nicht mal schwanken. Sie starrt auf den Fußboden, doch auch das Linoleum ist grün. Überall trotten Leute mit Bücherlasten herum. Nirgends kann sie in Ruhe sitzen, denn auch auf die Galerien kann sie nicht. Dort ist es zu eng, und es gibt nur Leseplatten für die Ahnentafeln des schwedischen Adels oder die Biografien der Geistlichen des Bistums Skara. Ganz oben in dem engen Gang mit den Schriften der Akademie für Schöne Literatur, Geschichte und Altertümer, wo lediglich ein mickriges Geländer sie von der Tiefe trennt, wird ihr normalerweise schwindlig.
Da kommt ihr die Idee, die breite und sichere Treppe mit dem starken Staketengeländer im Forschungssaal zur Galerie hinaufzugehen. Dort setzt sie sich an einen Tisch, die Konkordanz der Werke Vilhelm Ekelunds im Rücken. Deren Nähe beruhigt natürlich nicht recht, aber sie braucht wenigstens keinen der vier dicken Bände aufzuschlagen. Hier ist sie allein. Unten sitzen die Forscher bei Leselampen mit grünen Glasschirmen, und über ihnen und unter ihr leuchten weiße Lichtkugeln.
Orgasmus Ablehnung
Ich schrieb auf Karteikarten, die ich aus der Bibliothek mit nach Hause nahm. Oben gab es ausreichend Raum für eine Überschrift, darunter waren zwei rote Linien und anschließend weitere in Grauschwarz. Auf einer Karte hatten zweiundzwanzig Zeilen Platz, wenn man beide Seiten beschrieb. Die Gestaltung der Karten bestimmte das Format dessen, was ich schrieb. In gewisser Weise bestimmte sie auch den Inhalt. Erzählungen hatten auf den Karten keinen Platz. Ich schrieb mit Füller und Tinte, und die Karten verwahrte ich in einem Karteikasten mit alphabetischem Register.
Die Kurzgeschichte über den Messermord an Lucia hatte ich mir auf Spaziergängen ausgedacht, wobei ich kaum wusste, wo ich war. Ich fühlte mich wie in einem Rausch, der ebenso gut von Drogen hätte herrühren können. Mit List und Mühe hatte ich die Erzählung auf der Underwood der Bibliothek getippt, ständig gewärtig, dass der Stadtbibliothekar auf mich herabstoßen konnte. Zur Ausarbeitung hatte ich vier Karten aus dem Kasten benutzt. Sie trugen die Überschriften Die Spirelladame, Die Lucia des Männerchors, Kussechter Lippenstift und Pathologie. Die letzte Karte hatte ich beschrieben, nachdem ich mit einem Kommilitonen, der Arzt geworden war, dem Anatomischen Institut einen Sonntagsbesuch abgestattet hatte.
Um Die Spirelladame einbauen zu können, hatte ich mein Konzept geändert. Ich entdeckte, dass ich unter den Karten Lieblinge hatte, das Kurzgeschichtenschreiben führte aber auch zu Ausschuss. Abstrakte Überlegungen und lyrische Impressionen waren nicht sonderlich brauchbar und konnten nach einiger Zeit im Karteikasten schal wirken. Tatsachenbeschreibungen und Anekdoten aus Kramfors und der Stadtbibliothek hielten meistens stand, aber auch pure Bosheiten, Wutausbrüche und nächtliche Träume, sofern sie nicht zu verworren waren.
1951 hatte ich einen Volksschullehrer namens Herman Gustafsson kennengelernt. Er absolvierte ein Aufbaustudium in Geschichte, bezog aber weiter einen Teil seines Lehrergehalts. Er hatte bereits Literaturgeschichte und Nordische Sprachen studiert und wollte nun den Magister machen, nicht um Studienrat zu werden, sondern um sich auf eine Rektorenstelle zu bewerben. Hermans Pläne hatten nichts Vages oder Verträumtes an sich. Er wollte das erreichen, was er sich vorgenommen hatte.
Er lieh sich viel in der Stadtbibliothek aus und gestand, dass er sich dort wohler fühlte als in der Universitätsbibliothek Carolina Rediviva. Als er mitbekam, dass ich studierte Philologin und Bibliothekarin war, wurde er verlegen, was eigentlich nicht seine Art war. Er hatte mich für eine Ausleihhilfe gehalten. Von da an aßen wir manchmal in der Milchbar am Fyris Torg gemeinsam zu Mittag. Ich sagte, er könne Babba zu mir sagen, so habe man mich nämlich zu Hause und in der Schule genannt. Niemand sagte Barbro zu mir. Anfangs hatte er mich, dem Namensschild auf der Informationstheke entsprechend, mit Fräulein Andersson angesprochen.
Herman war groß und korpulent. Er hatte Hängebacken und eng stehende Augen. Frisch vom Friseur, war sein graublondes Haar auf dem ganzen Kopf einen halben Zentimeter lang. Diese Igelschnitt genannte Frisur war über Filme der Besatzungsmächte in Deutschland Mode geworden. Im Verein mit seinem stämmigen Körper, seinen massigen Schenkeln und Stampferwaden gab sie ihm das Aussehen eines Unteroffiziers in der amerikanischen Zone.
Herman und ich waren nicht ineinander verliebt, es war eine Freundschaft. Wir lasen die gleichen Bücher, brannten Stearinkerzen ab und tranken Tee. Ziemlich bald schliefen wir auch miteinander. In seiner Heimatstadt hatte er eine Verlobte, das wusste ich von Anfang an.
Als Liebespaar waren wir ungezwungen, vielleicht gerade weil wir nicht verliebt waren. Wir gaben einander Anleitungen und korrigierten hier und dort eine Stellung. Trotz unseres sachlichen Verhältnisses gerieten wir oft in einen lang anhaltenden Taumel des Genusses. Unsere Herzen klopften, Herman tropfte der Schweiß von der zottigen Brust, die Geschlechtsorgane wurden heiß und brannten lustvoll, Muskeln zogen sich außerhalb der Kontrolle unseres Willens zusammen, zuckten oder zitterten. Hinterher machten wir Witze darüber. Diese heftigen Augenblicke hinterließen aber auch etwas anderes. Manchmal überkam mich das starke Gefühl, Hermans Seele oder seinem wahren Ich sehr nahe zu sein. Oder Herman als Kind.
Er entdeckte meinen Karteikasten. Aus purer Neugier öffnete er ihn, als ich Kaffeegebäck einkaufen war. Bei meiner Rückkehr hatte er den Kasten auf dem Schoß und blätterte darin. Es ließ sich nicht sagen, wie viele Karten er gelesen hatte.
»Sammelst du Aphorismen und dergleichen?«, fragte er. Ihm war nicht klar, dass er eine Grenze überschritten hatte.
Ich antwortete nur mit Mühe, denn mein Mund war trocken. »Stimmt«, sagte ich.
Dann nahm ich ihm den Kasten weg und stellte ihn auf die Kommode neben den Messingleuchter mit dem schwerem Fuß. Als ich den sah und meinen Blick danach zu Hermans Hinterkopf wandern ließ, dachte ich mir, dass es lange dauern würde, Herman, stark wie er war, damit zu erschlagen.
»Obwohl es auch irgendwelche Beschreibungen waren«, sagte er. »Schreibst du Zitate aus Büchern heraus?«
»Ja.«
Ich schloss den Kasten weg und hatte ihn von da an immer weggeschlossen, wenn Herman mich besuchte.
Eines Abends schlug er mir vor, eine Kurzgeschichte zu schreiben und sie an die Zeitschrift All Världens Berättare zu schicken. Mir war klar, dass diese Idee mit den Karteikarten zusammenhing. Er hatte keineswegs geglaubt, dass es Zitate waren.
»Du hast doch Talent«, sagte er.
Dieses Wort erfüllte mich mit heller Wut, doch ich schwieg. Mit von Plundergebäck vollem Mund begann er eine Geschichte zu skizzieren und war davon so begeistert, dass er gegen den elektrischen Heizkörper trat. Der geriet zu nahe an die Kommode, und als wir später am Abend zusammen im Bett lagen, sengte er an der Stirnseite der Kommode einen großen schwarzbraunen Fleck ins Holz.
Ich musste natürlich für den Schaden aufkommen, und das war teuer. Die Vermieterin rächte sich auf diese Weise an uns, denn sie hatte entdeckt, was wir auf ihrer Ottomane trieben, wenn sie aus dem Haus ging, indem sie ganz leise zurückgekehrt war. Einmal sahen wir, wie sich im Luftzug der Vorhang über der Tür zum Flur bewegte, und wussten, dass sie ihn geöffnet hatte, um uns besser belauschen zu können. Da schalteten wir das Radio ein und ließen sie einen Vortrag über Rentierzucht hören, während wir uns zu einem viel zu schnellen Orgasmus hetzten.
Nach einiger Zeit kündigte mir die Vermieterin, und ich ließ mich seelenruhig darauf ein. Das war aber gar nicht ihre Absicht. Sie hatte nur diesem Verhältnis ein Ende setzen wollen. Es wäre schwierig geworden, das längliche, zugige Zimmer, die einstige Dienstmädchenkammer, wieder zu vermieten. Das Haus lag in der Svartbäcksgatan und hatte ein Plumpsklo im Treppenaufgang. Der Abort grenzte an mein Zimmer, und im Flur roch es schwach danach. Ich durfte bleiben. Die Vermieterin traute sich nicht mal, Herman das Haus zu verbieten.
Die Geschichte, die Herman bei Tee und Plundergebäck zusammenphantasiert hatte, handelte von einem Pfarrer, der Konfirmanden zum Sommerunterricht empfing. Unter seinen Eleven war ein schlagfertiger und spöttischer junger Mann. Es stellte sich heraus, dass es der Teufel war.
In Hermans Erzählung war der junge Teufel nicht viel schlimmer als Karsten Kirsewetter in Olle Hedbergs Werk, und ich konnte das Vorbild erahnen: glattes schwarzes Haar, lebhafte dunkle Augen, leicht erregbares Geschlechtsorgan. Ich machte ihn weißblond, verstärkte seine spöttische Ader, bis sie leicht schmierig war, und schrieb dann das Manuskript von meinem Spiralblock auf der Underwood der Bibliothek ins Reine. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Vielleicht wollte ich Herman imponieren. Er war denn auch Feuer und Flamme. Und konnte überhaupt nicht verstehen, dass ich die Geschichte nicht einschicken wollte.
Im Frühjahr 1954 war er mit seinem Examen fertig. Er änderte seinen Namen in Bärenryd und verabschiedete sich von mir. Es war gar keine Frage, dass er nach Hause zurückkehren und heiraten würde. Wir machten Witze, waren aber beide ein wenig gerührt, als wir das letzte Mal miteinander schliefen.
Drei Wochen nach Hermans Abreise bekam ich von All Världens Berättare ein dickes Kuvert. Es enthielt den Durchschlag der Geschichte, den ich Herman gegeben hatte, und einen Brief von gerade mal einer Zeile:
»Wir haben von Ihrer Kurzgeschichte Kenntnis genommen und danken für Ihr Interesse.«
Ich hockte auf der Ottomane, vornübergebeugt, und wartete mit offenem Mund darauf, dass der Schmerz dieser Demütigung vergehen würde. Aber er verging nicht. Er saß direkt über dem Zwerchfell. Als ich endlich meinen Blick unter Kontrolle hatte, stand in seinem Fokus still die Kommode mit dem schwarzen Brandfleck. Drum herum aber flatterte oder wimmelte etwas. Vorhänge, Tapetenmuster.
Ich war noch nie ernstlich krank gewesen. Phobien und Angstattacken waren mir ebenfalls fremd. Ich verstand nicht, was sich jetzt abspielte. Das heißt, es war als körperlicher Schmerz zu verstehen. Er ging vom Zwerchfell aus und presste mir in kurzen Stößen Luft aus der Kehle und dem offenen Mund. In den Handflächen hatte ich ein Stechen.
Es wurde nicht besser, als ich mich aufs Bett legte, vielmehr kam noch eine heftige Übelkeit hinzu. Die Zimmerdecke bewegte sich, die Stockflecken, an deren Ähnlichkeit mit Tiergesichtern, Erdteilen und Früchten ich sonst meinen Spaß hatte, sahen jetzt gar nichts mehr ähnlich. Es waren lediglich unruhige Formen aus braunen Streifen mit gekerbten Rändern. Zweifellos eine Art Muster, da sich die gekerbten und bogigen Konturen wiederholten. Doch vollkommen bedeutungslos.
Im Zimmer war es stickig. Es roch intensiv nach staubigen Vorhängen und schwach nach Plumpsklo. Es war der Geruch meines Lebens.
Wie war es so weit gekommen? Ich hörte Pferdehufe dumpf die Steigung der Svartbäcksgatan hinauftrampeln und dachte mir, dass das Pferd auf dem Weg zum Schlachthof in Boländerna war. Auf seinen eigenen Beinen.
Ich ging mit schweren Schritten auf und ab. Nach etwa einer Stunde kam ich mir allmählich lächerlich vor. Ich trank ein wenig Wasser. Davon wurde es auch nicht besser. Ich war in zwei Babbas verwandelt: eine, die vor Schmerz wimmerte und den Brechreiz zu unterdrücken versuchte, und eine, die belustigt die Misshandelte betrachtete.
Ja, es war eine Misshandlung. Ich nahm den Brief und las den Namen des Redakteurs, der ihn unterschrieben hatte. Uno Florén. Uno Florén. Ich kaute still auf dem Namen herum, aber er sagte mir nichts. Er hatte kein Gesicht, sodass sich meine Gedanken ruckartig weiterbewegten und schließlich bei Herman landeten. Ich sah sein großes, hochrotes Gesicht vor mir, wie er Makkaroni in weißer Soße in sich hineinstopfte. Endlich konnte ich mich übergeben.
Ich gewöhnte mir an, viel zu Fuß zu gehen. Sobald ich nicht in die Bibliothek musste, zog ich los. Ich ging bis nach Rickomberga, bis zur Kirche von Vaksala oder nach Ulleråker, wo es vorkam, dass ich sehnsüchtig zu den Gitterfenstern der Nervenheilanstalt aufblickte. Mit dem Schlafen hatte ich keine Probleme, im Gegenteil: Ich sank wie bewusstlos in den Schlaf. Wenn ich aufwachte, war der Schmerz so zuverlässig da, als würde einem mit einer Nähnadel ins freiliegende Zahnmark gestochen.
Uno Florén war ein leerer Fleck, doch Herman Gustafsson konnte ich sehen: Er saß in der Milchbar und schaufelte Nudeln in sich hinein. Ein Stillstand war eingetreten. Den Karteikasten verstaute ich ganz hinten im Schrank, hinter den Koffern. Die Karten waren eine Quelle der Heiterkeit, munterer Bosheit und einer Art aufgeräumter Zärtlichkeit gewesen, die Vermieterinnen ebenso gelten konnte wie einer Plankenwand und Türen aus dem 18. Jahrhundert in Dragarbrunn. Manchmal waren sie berauschend gewesen. Von ihrem giftigen Potenzial hatte ich nichts geahnt. Jetzt waren sie explodiert wie Kreosot in einem entzündeten Zahn.
Natürlich wurde es besser. Der Herbst verging. Die nassen und gedankenleeren Spaziergänge brachten schließlich Linderung. Die Schmerzattacken kamen in immer größeren Abständen. Der Gedanke an den leeren Fleck Uno Florén oder den etwas schuppigen und rot geäderten Fleck Herman Gustafsson tat nach wie vor weh. Ich lernte aber, meine Gedankentätigkeit zu disziplinieren.
Tun Menschen das nicht ganz allgemein?
Herman ist ein Schock. Oder eine Erfindung. Doch warum sollte sich Babba einen rotschuppigen großen Kerl mit dickem Bauch und stämmigen Waden ausdenken und behaupten, er sei ein guter Liebhaber? Und kann es wirklich wahr sein, dass sie mit einem Mann geschlafen hat?
Lillemor muss sich beruhigen. Deshalb nimmt sie aus dem Regal hinter sich einen Band mit Briefen von Gustaf Fröding und legt ihn aufgeschlagen auf den Tisch, damit er besetzt aussieht. Dann knautscht sie die paperasse wieder in ihre Tasche und geht den etwas schmerzhaften Weg die Wendeltreppe hinunter. Bis in die Cafeteria Sumlen muss sie noch eine weitere lange Treppe überwinden, aber Lillemor braucht dringend einen Kaffee. Vor dem, den Kattis ihr gebracht hat, ist sie ja auf und davon. Koffein beruhigt sie inzwischen. Sogar einschlafen kann sie danach.
Eine halbe Stunde vor Schluss sind nicht mehr viele Leute in dem Café. Und zum Glück keine nach Gesellschaft lechzenden alten Forscher oder Greise aus Vorständen literarischer Gesellschaften. Sie könnte das Manuskript hervorholen, lässt es aber sein, weil sie überlegen muss, was da im weiteren Verlauf noch stehen kann. Ein klitschiges Gefühl, daran zu denken. Aber sie muss unbedingt versuchen, sich zu wappnen.
Babba hat Herman 1951 kennengelernt, steht da. Zwei Jahre später hat sie die Luciageschichte geschrieben, die den Preis davontrug. Diese Zeit brauchte sie wohl, um über die Ablehnung von All Världens Berättare hinwegzukommen. Oder vielmehr um zu erkennen, dass sie sich einer solchen Gefahr nicht mehr aussetzen wollte. Diesen Part durfte ich übernehmen, denkt Lillemor, für die 1953 das Jahr ihrer Verlobung mit Rolf war. Im späten Herbst war das, doch für sie steht die Verlobung in keinerlei Zusammenhang mit der Luciageschichte und der Fahrt nach Stockholm. Die liegen in einer anderen Gedächtnisschublade.
Als Rolf und sie sich verloben mussten, wollte sie es am Ulvafall stattfinden lassen. Das war originell, und er wusste offensichtlich nicht, was für ein Gesicht er aufsetzen sollte, als sie diesen Vorschlag machte. Ihre Menstruation war schon elf Tage überfällig, und es war eine stürmische Zeit gewesen. Er versuchte gelassen zu bleiben und sie zu beruhigen. Eines grauen Morgens kam dann doch Blut. Sie glaubte zuerst nicht, dass es wahr war. Der Fleck in ihrem Babydollhöschen war so winzig. Ein Streifen. Fast wie Rost. Sie dachte an rostige Nägel im Waschtrog und kratzte mit dem Zeigefingernagel an dem Fleck. Im Wasser verlor er die Kontur und roch nach Eisen.
Als das ausgestanden war, überrollte sie eine neue Woge der Furcht. Ja des Schreckens. Sie sagte zu Rolf, sie wage nicht mehr, mit ihm zu schlafen. Sie müssten sich verloben. Sie brauche Sicherheit.
Später bereute sie es, denn eigentlich musste ja er ihr einen Antrag machen. Sie hatte sich oft ausgemalt, wie das ablaufen würde, und nun hatte sie diese Möglichkeit zunichtegemacht. Sie fand das Leben so kompliziert, schmuddlig und graubleich wie jenen Dienstagmorgen, an dem sie den rostroten Streifen entdeckt hatte.
Rolf würde bald seinen Magister in Politik haben und mit der Lizenziatsarbeit in Staatswissenschaft beginnen. Er machte zwar nicht ständig einen drauf, war Geselligkeiten aber keineswegs abhold und galt als witzig. Er wollte das Leben gern von der heiteren Seite nehmen, und deswegen hatte Lillemor sich so erbärmlich gefühlt, als sie in seinen Armen in Tränen aufgelöst war.
Wenn es so schlimm gewesen wäre, wie von ihr befürchtet, dann hätte sich das natürlich bereinigen lassen. Der Gynäkologieprofessor an der Uniklinik betrieb in seinem großen, modernen Steingebäude am Fluss, das Gelber Pavillon genannt wurde, eine Privatpraxis. Bei einem Juvenalordensdiner ohne Damen war das Haus unter diesem Namen in einem Couplet vorgekommen. Der Refrain war der ursprüngliche von Emil Norlander.
Kommen Sie doch mit herein
in den Gelben Pavillon,
dort sitzt Gott Amor selbst
seit langer Zeit gefangen.
Und wenn Sie es denn woll’n,
gibt’s killekillekillekill,
ein kleines Liebesspiel.
Verfasst hatte es Rolf, ohne es Lillemor zu zeigen. Sie fand es jedoch in einer Schreibtischschublade und war äußerst pikiert. Sie wusste, dass dieses Haus auch Denkmal ungeborener Kinder genannt wurde.
Warum kommt das jetzt hoch? Ist das Rolf in einer Nussschale? Killekillekillekill und ein kleines Liebesspiel. Du lieber Himmel, denkt sie. Ich habe ihn fast vergessen. Und jetzt geht er am Rollator.
Sie erinnert sich, dass er verlegen wirkte, als er seinen Eltern an einem Sonntag nach dem Essen von der geplanten Verlobung erzählte. Was sein Vater wohl gesagt hätte, wenn er denn etwas hätte sagen können? Er saß auf seinem Stuhl und sah sie aus freundlichen Augen an. Er war Ortsvorsteher einer Stadt in Bergslagen gewesen, hatte aber vor drei Jahren eine Gehirnblutung erlitten. Daraufhin waren sie nach Uppsala zurückgezogen und hatten sich in der Wohnung des Generals am Stora Torget niedergelassen. Der General nutzte sie nicht mehr, denn er lebte mit seiner Haushälterin auf dem Familiengut außerhalb der Stadt.
Seine Mutter war nicht begeistert, holte aber trotzdem eine Karaffe Portwein und vier Gläser, damit sie auf die Verlobung anstoßen konnten. Sie am Ulvafall zu begehen, das war natürlich meine Idee, ist sich Lillemor klar. Ich habe vermutlich gesagt, dass wir sie in der Natur erleben wollten, oder etwas in der Art, und anschließend könnte ja alles stattfinden, was sein müsse. Diners. Anzeigen. Besuchstour. Ich war eine Gans. Ob es das Haus am Stora Torget noch gibt? Dort hat jedenfalls Hennes & Mauritz eröffnet. Oder war das schon vorher?
Der Fyrisån hatte einen hübschen kleinen Wasserfall mit irgendwelchen Gebäuden auf beiden Seiten. Rolf muss mit dem schwarzen Ford Eifel seines Vaters hingefahren sein, der während des Kriegs aufgebockt gewesen war. Im Wasserschleier des Katarakts war es kalt, daran erinnert sie sich noch deutlich. Und dass Rolf die Sache humorvoll nahm, ihr den Ring über den schlanken Finger streifte und sie lieb und unerotisch küsste. Er merkte wohl, dass die Stimmung dementsprechend war. Ein Windstoß kam, und auf dem Autodach blieb gelbes Laub kleben. Der Himmel war graubleich und glatt wie Haut. Das Gras braungelb und verwachsen und voller Feuchtigkeit und Pilze. Oder ist das eine spätere Erinnerung? Es war wohl kaum die Natur, die sie sich vorgestellt hatte. Der Wasserfall klang ohnehin wie ein Automotor.
Ich will beten.
Diese Erinnerung ist ihr peinlich. Rolf muss betreten dreingeschaut haben. Er ging zwar bei seinen Besuchen auf Sjöborg mit dem Großvater und seiner Haushälterin immer in den Gottesdienst. Doch das war Teil des gesellschaftlichen Lebens. Komischerweise hat sie ganz deutlich vor Augen, dass er einen großen gelben Badeschwamm in der Hand hatte, während sie im Wind das Vaterunser betete und in die Strudel unter dem Wasserfall blickte. Vielleicht wollte er die Gelegenheit nutzen und das Auto waschen, aber sie kann sich nicht erinnern, dass er einen Eimer dabeigehabt hätte.
Das Personal im Sumlen rumpelt jetzt auffordernd mit den Stühlen, die umgekehrt auf die Tische gestellt werden sollen, damit der Fußboden gewischt werden kann. Die Geschirrwagen werden scheppernd in die Küche geschoben. Lillemor weiß nicht, wohin sie gehen soll. Sie kann sich natürlich auf die Galerie über dem Forschersaal setzen, denn bis die gesamte Bibliothek geschlossen wird, dauert es noch ein paar Stunden.
Da taucht eine Frau auf. Hat sie die ganze Zeit hinter ihrem Rücken gesessen? Sie beugt sich vor und legt Lillemor die Hand auf den Arm. Das tun die Leute oft. Das tun sie im ICA oder in der Markthalle in Östermalm oder in Hedengrens Buchhandlung oder sogar auf der Straße. Selbst völlig Fremde legen ihr die Hand auf den Arm. Sie wollen sich vergewissern, dass ich wirklich bin, denkt sie. Aber das bin ich nicht.
Sie sind freundlich und fangen fast immer mit derselben Phrase an: »Ich muss Ihnen sagen …« Diese Frau bildet keine Ausnahme. Sie hat ganz glattes, grau meliertes braunes Haar, das unterhalb der Ohren und an der Stirn absolut gerade geschnitten ist. Ihre Strickjacke ist von der Art, die Lillemor im Stillen als Intellektuellenklamotte zu bezeichnen pflegt: aus Baumwolle, in zwei Graunuancen quer gestreift, schenkellang. Die Brille hängt ihr an einer Schnur auf der Brust.
»Ich muss Ihnen sagen, wie viel mir Ihre Bücher bedeuten. Danke!«
Lillemor weiß genau, was sie antworten muss. Sie tut es immer mit einer gewissen Zurückhaltung. Das steht ihr, ist aber auch ein Anspruch. Die Leute erwarten nämlich, dass sie nett, bescheiden, fröhlich, tiefsinnig und erfreut ist. Babba wäre das alles wahrlich nicht. Gar nichts davon. Lillemor ist es, zumindest einigermaßen.
Diesmal aber gerät sie aus dem Konzept und sagt: »Bedanken Sie sich nicht bei mir.«
Die Frau schaut verdutzt drein. Dann ruft sie aus: »Sie meinen, dass Sie nicht … dass es nicht Ihr Verdienst ist. Dass Sie …«
»Genau«, sagt Lillemor.
Dann sucht sie das Weite. Sie will jetzt nach Hause. Nur zu Hause kann sie ganz sicher sein, Blicken und Stimmen und Leuten, die sie anfassen, zu entgehen. Die Frau folgt ihr hoffentlich nicht die Treppe hinauf? Womöglich möchte sie noch mehr wissen. Ob es die Inspiration oder gar Gott sei, der Lillemor Troj ihre Romane eingebe. Sie muss jetzt einfach nach Hause. Selbst wenn Max in einem Taxi vor dem Eingang sitzt.
Ruhe haben. Das ist mein Mantra, denkt sie. Ich muss meine Ruhe haben mit diesem furchterregenden Papierstapel.
Sherry Käseglocke Fleischwolf
1954 heiratete Lillemor einen Staatswissenschaftler namens Rolf Nyrén. Der erste Gratulationsempfang fand in Kramfors statt, und ich bin hin. Astrid Troj war es gelungen, den Verkaufsleiter des Papierkonzerns hinzulotsen, da sie seine Frau vom Roten Kreuz her kannte. Zwei Lehrer erschienen, einer mit seiner Frau und einer, der nach Knoblauch roch. Er war Gesundheitsfanatiker und der Bruder des Propsts. Astrid Troj hatte im Vorfeld schon Befürchtungen gehegt, aber alle von ihrer Seite kamen mit Hut. Von der Nyrén-Uddfeldt-Seite kamen nur Rolfs Mutter und seine beiden Schwestern. Wenn man nicht sehr scharfe Augen hatte, war Astrid ihre Nervosität nicht anzumerken. Die schien sie nur noch liebenswürdiger und unbefangener zu machen. Es war doch jetzt Frühling, fast schon Sommer. Dadurch wurde das Haus größer (fand Astrid), die Terrassentüren standen zu den Fliesen und dem Steingarten hin offen. Sicherlich hatte Lillemor gesagt, sie sollten die Sonnenuhr entfernen, und Kurt Troj hatte sie weggebracht, weil er sich auf das Stilgefühl seiner Frauen verließ. Das von Lillemor hatte sich mit jedem Monat in Uppsala weiterentwickelt. Sie hatte ihre Aussprache verfeinert und ließ sich kein ungebeugtes norrländisches Prädikativ entschlüpfen. Ja sie wählte jetzt den Begriff Norrländisch. Als Gymnasiastin hätte sie sich darüber geärgert, es müsse Ångermanländisch heißen.
Das Haus habe etwas von einem Schuhkarton und sei bestimmt aus dem Katalog, sagte die ältere Schwägerin halblaut. Drinnen war es hell, und in den Sonnenstreifen schwebten blaue Zigarettenrauchschleier. Es roch nach Wein, der Sherry war halbsüß und versetzte die Nasenflügel der jüngeren Schwägerin in gequältes Beben. Die Geschenke kamen auf den Esstisch. Damasttücher mit altem Muster und moderne Wolldecken mit Streifen in Hellgrün, Rosa und Gelb. Salatschüsseln aus Teak. Toaster. Dessertteller mit Blumendekor. Die Frau des Konzernverkaufsleiters drehte sie um und sah, dass sie von Bavaria waren. Sie und die anderen Damen drückten sich am Tisch entlang und lasen die Karten.
Lillemor trug ein rosarotes Kleid mit gefälteltem Rock und darüber einen Bolero. Astrid nähte gut, obendrein war es billig. Lillemors Haar war elektrisch geladen und wölkte sich, obwohl sie es auf eine Netzwurst gewickelt hatte, um einen Pagenkopf hinzukriegen. Es umgab sie wie eine Mandorla aus Sonnenlicht, und sie hatte nichts zu befürchten, sie war jung. Wenn sie sich mit den Schwägerinnen unterhielt, war sie von euphorischer Freundlichkeit. Die Ältere roch komischerweise nach Hund. Sie hatten sich an den Vitrinenschrank gestellt, was Astrid zu beunruhigen schien.
Ich war früh gekommen und hatte eine Käseglocke auf den Geschenketisch gestellt. Es war die dritte und keineswegs die teuerste. Lillemor hörte sich beschwipst an, als sie sagte, dass man nie genug Käseglocken haben könne. Dann korrigierte sie sich, man könne sie ja umtauschen, und leise: »Deine tausche ich nicht um, aber wo hast du sie denn gekauft? Im Porzellanladen?«
Die Käseglocke war aus grünem Glas mit eingeätzten Blumen. Eine Art Ewigkeitsblumen, nichts Modernes. Sie stand jedoch auf einem Untersatz aus Teak. Ich zog mich zur Wand zurück.
»Nimm dir doch Torte«, sagte Lillemor.
Wir waren ja nicht unbedingt Freundinnen, und die Käseglocke war leicht übertrieben. Doch wir hatten immerhin diese Kurzgeschichte und den ersten Preis gemeinsam. Ich stand neben dem Schrank und lauschte. Die Stimmen waren schriller geworden.
»Der muss sehr alt sein!«
»Antik, meinen Sie?«
»Kaum, aber er erinnert mich an etwas. Er ist originell, sehen Sie sich nur die Regalfächer und Glasscheiben an. Was meinen Sie, Fräulein Nyrén?«
»Ungenberg. Doktor Ungenberg.«
»Oh, verzeihen Sie. Ihre Mutter sagte nur …«
»Ja, soll ich sagen, wie er aussieht?«
Kurt war ahnungslos und schenkte ihnen Sherry ein. Am anderen Ende des Raums hatte Astrids Rücken sich versteift. Lillemor war von dem Südwein und der Freundlichkeit zu aufgedreht, um eine Gefahr zu wittern, und außerdem war ihr der Schrank ihres Großvaters vertraut.
Jetzt hob Rolfs ältere Schwester die Stimme und sagte zu Kurt Troj: »Sie müssen unbedingt unseren kleinen Zwist schlichten.«
Astrid Troj eilte quer durch den Raum, kam jedoch zu spät. »Nehmen Sie sich etwas Torte«, sagte sie. »Ich glaube, die Damen haben noch keine Mandeltorte abbekommen.«
Es war aussichtslos. Das waren keine Gänschen. Das waren Raubfische.
»Was ist das bloß für ein Schrank? Er ist offensichtlich antik, nun, jedenfalls alt. Wir verstehen nur nicht … er ist schrecklich originell. Meine Schwester, Frau Doktor Ungenberg, hat eine bizarre Idee.«
Und die Frau Doktor, Rolfs jüngere Schwester, tat ihre Idee kund: »Friseurschrank. Ich finde, er sieht aus wie ein Friseurschrank.«
Und daraufhin die ältere Schwester: »Ist es ein Erbstück?«
In etwa ein, zwei Stunden würde Astrid in dem Schuhkarton ein Glas in den offenen Kamin schleudern und laut fluchen, ja geradezu schreien. Aber jetzt noch nicht. Und Kurt würde es nicht verstehen, nicht richtig verstehen. Es würde um Haare auf dem Boden und Bartstoppeln auf der Emaille gehen. Rasierpinsel, Seifennäpfe, gemangelte Gesichtshandtücher, abgezogene Rasiermesser in den Regalfächern. Um Großvater, den Barbier. Der anderer Leute Körper anfasste.