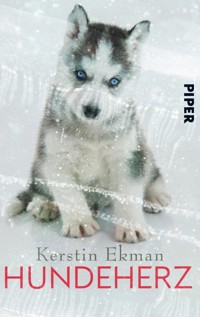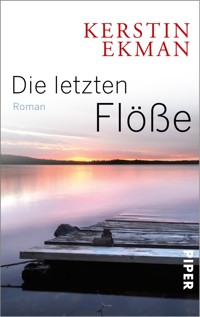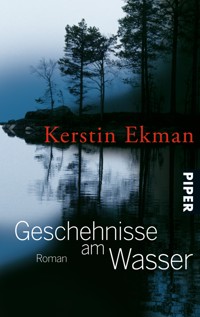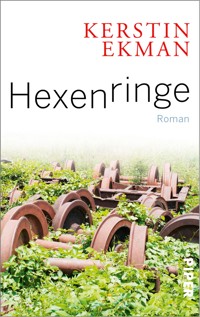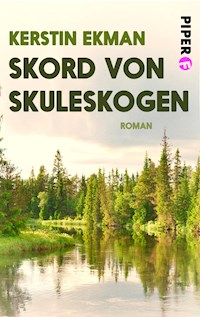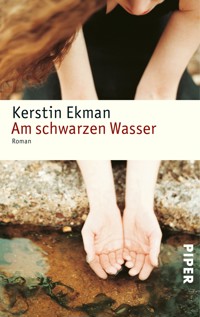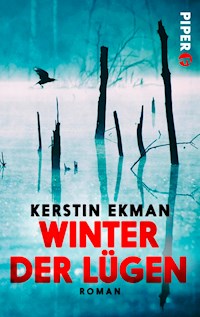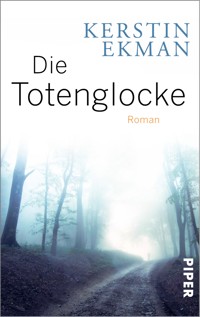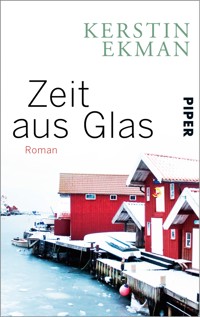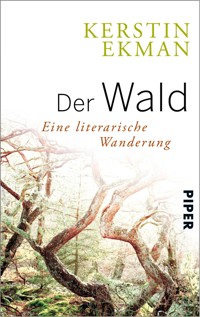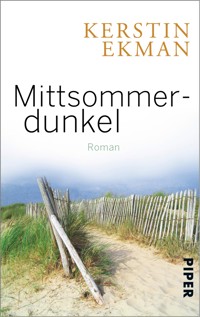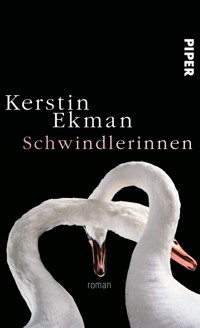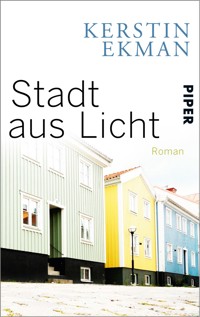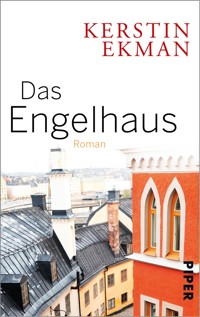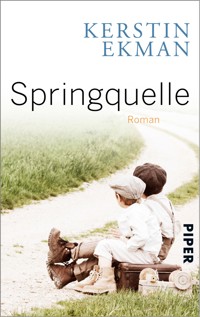
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mühsam hält sich Tora, ein ehemaliges Dienstmädchen, mit dem Verkauf von Brot und selbstgemachten Bonbons über Wasser. Eines Tages möchte sie ihr eigenes Café eröffnen, und schon bald scheint die lang ersehnte Unabhängigkeit zum Greifen nah. Doch die Krisenzeiten des Ersten Weltkriegs machen auch vor Schweden nicht Halt ... Humorvoll und eindringlich erzählt Kerstin Ekman vom mutigen und selbstbewußten Kampf unbeugsamer Frauengestalten in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. – »Witzig und wortreich, präzise und detailliert beschreibt Kerstin Ekman den Alltag ihrer Protagonistinnen.« (die tageszeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2003
ISBN 978-3-492-95757-1
© 1976 Kerstin Ekman Titel der schwedischen Originalausgabe: »Springkällan«, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1976 Deutschsprachige Ausgabe: © 2003 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Neuer Malik Verlag, Kiel 1989 Umschlaggestaltung: Dorkenwald Design, München Umschlagfoto: S. Kobold / Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Unterhalb des Höhenrückens gibt es eine alte Quelle, die nie versiegt. Früher brach sie in dem feuchten und vom Laub dämmrigen Park, in dem die Heilsarmee zu spielen pflegte, mit anmutigem Sprung hervor. Man nannte sie Himmelsöquelle. Jetzt ist sie mit Steinen gefüllt.
Früher tanzten die Leute bei der Himmelsöquelle. Sie schmückten sie mit frischem Grün und zierten sie mit Bändern. Das war Aberglaube. In der Dreifaltigkeitsnacht tranken die Menschen ihr Wasser, um gesund zu werden. Sie überantworteten ihre Leiden Münzen und Stecknadeln und warfen diese in die Quelle, die alles heilen sollte: das Gliederreißen, das sie krumm machte, und den bösen Finger, der die Fingerspitzen anschwellen und eitern ließ, Wundrosen, die in hitzigen Rötungen aufflammten und sich durch ihre Körper fraßen, den Husten, den Ohrzwang, von dem man aufwachte und weinte, die galoppierende Schwindsucht, die Englische Krankheit, die den Rücken verkrümmte, Katarrhe, Hühneraugen und eitrige Knochen von unzureichend behandelten Wunden in altem, schlechtem Heilfleisch, die schmählichen, zähen Ausflüsse und die Skrofeln, die durch Staub und Schmutz wuchsen und die Augen der Kinder tränen und ihre Hälse anschwellen ließen.
Die Quelle wurde von all dem, was sie aufnehmen mußte, nicht verdorben. Sie blieb rein und unverseucht und versiegte nie. Wenn die Brunnen in den Höfen austrockneten oder wenn man, nachdem sie im Spätsommer zu stinken angefangen hatten, ihre Deckel wegen der Gefahr von Epidemien versiegelt hatte, holten die Leute ihr Wasser dort oben.
Am Ende aber verstellte man die Himmelsöquelle mit einem Stein, und niemand wußte, warum.
Eines Nachts im Januar 1910 saßen zwei Frauen im Keller des Hauses Hovlundagata 60 und tranken Kaffee. Sie saßen vor einem Backofen, hinter dessen eiserner Tür das Feuer bullerte. Auf dem Tisch unter der weit herabgezogenen Lampe ging ein Roggenteig. In allen Ecken war es dunkel, und von Frida Eriksson waren nur das Tuch und die alten Segeltuchschuhe, die sie immer beim Waschen trug, zu sehen.
Alle beide brauchten Kaffee. Tora Otter würde bis in die Morgenstunden hinein backen und mußte sich wachhalten. Frida brauchte ihn, um einschlafen zu können. Nach einer Woche in den Waschküchen schmerzte und kribbelte es in ihrem Leib, und sie konnte freitags abends oft nur schwer einschlafen. Meistens tranken die beiden Frauen Kaffee aus Kaffeesatz, der gezogen hatte und verdünnt und aufgewärmt worden war, bis er hellbraun und säuerlich war. Dies hier war jedoch starker, frisch gekochter Kaffee. Sie bliesen und brummelten darüber und bewegten die Fingerspitzen unter den heißen Untertassen hin und her. Sie schlürften ihn durch Zuckerstücke, die langsam lockerer wurden und sich auflösten, in sich hinein.
Als Tora ausgetrunken hatte, ging sie hinauf in die Wohnung und holte ungesalzene Butter. Die Jungen schliefen. Sie stopfte ihnen die gestrickten Decken ums Kinn und befühlte den Kachelofen. Als sie wieder nach unten kam und die Lampe hochzog, war Frida auf dem Stuhl eingeschlafen. Sie saß mit den Händen unter der Schürze da und machte ein Nickerchen. Sie war blaß und hatte keine Zähne mehr im Mund. Die Augenlider waren groß und dünn. Sie war kaum wiederzuerkennen, wenn sie die Augen geschlossen hatte. Tora faßte sie sanft an der Schulter.
»Ich hab Butter g’holt«, sagte sie.
Frida wachte auf. Sie nahm mit dem Zeigefinger Butter auf und spreizte dann den Daumen der anderen Hand ab, so daß sich die Haut in der Daumenfalte straffte. Sie war aufgeweicht und wieder eingetrocknet, grauweiß und rissig vom Wasser. Die Schrunden gingen so gerade in die dünne Haut, als wären sie mit dem Messer hineingeschnitten. Sie leuchteten hell und deutlich rot. Sie fettete beide Daumenfalten und die Risse am ersten Zeigefingergelenk ein. Dann zog sie Wollgarn aus der Schürzentasche und umwickelte es damit. Tora half ihr, die Enden zu verknoten.
»Das tut gut«, sagte sie.
Mit einem Stöckchen machte Tora die heiße Ofentür auf, legte Holz nach und öffnete die Luftklappe ein wenig. Dann wusch sie sich in einer Waschschüssel, die auf einer Holzkiste unter dem Fenster stand, die Hände und trocknete sie gründlich ab, damit nichts kleben bliebe, wenn sie sie in den lauwarmen Teig steckte. Der Ofen wummerte, und in der Ecke, in der Frida saß, war es warm.
»Mein Gott, wie warm und gut der doch is, der Backofen!« sagte sie. »Hier sollt man die ganze Nacht sitzn.«
»Mach das doch, du, dann hab ich Gesellschaft!«
»Da wär’s nicht weit her mit der Gesellschaft. Ich schlaf bestimmt bald ein.«
»Bleib wenigstens sitzn, bis ich den Teig durchg’arbeitet hab, dann trinkn wir noch mal ’ne Tasse Kaffee. Ich hab Brot aus’m Café.«
Sie tranken aufgewärmten Kaffee, jetzt aber aus Tassen, und tunkten Brot vom Vortag aus dem Café Cosmopolite ein. Frida hatte kaum die Tasse weggestellt, da war sie auch schon wieder eingenickt.
»Du solltest hinaufgehn und dich ins Bett legn«, meinte Tora. »Ich kann mit dir mitkommen, ich wollt sowieso hinauf und nach den Buben schaun.«
Sie ergriff Fridas spitzen Ellbogen, und sie gingen ohne Lampe durch den langen, dunklen Kellergang, der ihnen so vertraut war. Als sie zur Kellertreppe hinaufkamen, hörten sie Männer. Im Dunkeln standen sie still hinter der Tür, bis die Haustür hinter dem letzten zugeschlagen war.
»Jetzt sind sie weg«, sagte Tora. »Geh jetzt hinauf und leg dich ins Bett!«
Ein dickes Eisenrohr kam aus der Wand der Waschküche und lief, mit Schellen befestigt, bis zum Zementbottich, über dem ein Messinghahn saß. Den brauchte man nur aufzudrehen. Früher hatte sie mit den Eimern am Joch zehnmal zum Brunnen gehen müssen, um die Einweichbottiche zu füllen. Jetzt drehte sie nur den Hahn auf. Woher das Wasser kam, wußte sie allerdings nicht.
Frida ging waschen, seit sie geheiratet hatte. Angefangen hatte sie bei den Spülplätzen draußen am Vallmarsee, wo man die Wäsche mit Karren hinziehen mußte. Die Frauen hatten in einer Reihe gekniet und die gewaschenen Wäschestücke geschlagen, und sie erinnerte sich, wie sie patschnasse, schwere Laken ins Gesicht bekommen hatte, bevor sie das Auswinden richtig gelernt hatte. Die Waschfrauen waren von Haus aus grantig, und sie schickten zurück, womit sie nicht zufrieden waren. Man mußte ein Paket in passender Größe zusammenlegen und die Enden kräftig und schnell in entgegengesetzer Richtung drehen. Die Frauen fluchten, um sich bei Laune zu halten. Es dampfte um die heißen Laken, wenn sie ins Wasser schlugen, und es kam Dampf aus ihren Mündern, denn es war kalt, im Dezember wie im März. Frida hatte sich vor ihnen gefürchtet. Doch es war keine da, die sich jetzt vor ihr gefürchtet hätte. Alles war anders. Die Gerüche, die Flüche und das Wasser, das kalt und klar aus dem Messinghahn schoß.
Es war natürlich Trinkwasser. Sie hatte gehört, daß es beim Großhändler droben ein Klosett geben und sogar darin reines Trinkwasser sein sollte. Wenn ihr auch niemand sagen konnte, woher es kam.
Viele Jahre lang hatte sie im Waschhaus am Marktplatz gewaschen. Ein Bahnarbeiter namens Dahlgren hatte über dem Abwassergraben, der durch sein Grundstück floß, ein Waschhaus errichtet, den Graben gestaut und die Einrichtung vermietet. Sie erinnerte sich, wie der Abwassergraben noch ein Bach gewesen war und alte Männer dort unten gesessen und Barsche geangelt hatten. Das Wasser floß ruhig, fast unmerklich durch den Ort. Jetzt war der Graben an vielen Stellen überbaut, um ihn herum verbreitete sich Gestank, und das Wasser war braun. Er nahm Schmutz auf und wurde schmutzig. Am Ende war Dahlgrens Waschhaus nicht mehr zu benutzen. Das Wasser des Grabens verfärbte die Wäsche, so daß die Hausfrauen klagten.
Das ginge so nicht mehr, sagten diejenigen, die sich auf öffentliche Belange verstanden, und so begann der Streit um das Wasserwerk und den Abwasserkanal. Er dauerte vier Jahre. Frida verstand ihn nicht. Die eine Seite wollte den Abfluß in den Vallmarsee leiten, die anderen in den Malsee. Sie schrieben in der Zeitung gegeneinander. Der alte Eisenbahnbauinspektor Sterkell stellte seinen Sitz im Gemeindevorstand zur Verfügung. Er hatte den Vallmarsee vorgeschlagen, und nun besaß er das Vertrauen der Versammlung nicht mehr, denn die Malseephalanx hatte gewonnen, und der Wasserturm wurde gebaut. Er sollte schließlich wie der berühmte Campanile in Venedig aussehen und stand gleich neben Lusknäppan, wo Frida aufgewachsen war. Fabrikant Wärnström verkaufte Land für das Wasserwerk, Großhändler Lindh für den Turm.
Es gab ein Fest auf dem Marktplatz, als die Wasserleitung eingeweiht wurde und die Feuerwehr die Leitung erprobte. Sterkell war nicht dabei. Bahnmeister J. A. Ström stieg auf die Rednerbühne und bezeigte Großhändler Lindh die Dankbarkeit des Ortes für seinen Eifer und seine Fürsorge um die für den Ort lebenswichtige Wasserfrage sowie Fabrikant Wärnström für seine Spende von eintausend Kronen für die Verschönerung des Wasserturms mit Granitornamenten. Das Oktett des Musikkorps der Eisenbahner spielte, und der Brandmeister ließ das Wasser aus einem Schlauch strömen. Frida aber wußte nicht, wen sie hätte fragen können. Sie kümmerte sich normalerweise nicht um öffentliche Angelegenheiten, doch nach dem vielen Wasser, das sie ihr Lebtag schon geschleppt hatte, wurde sie nachdenklich. Nach so vielen versiegten Brunnen und Brunnen voller Gestank und Krankheitserreger, über die sie sich schon gebeugt hatte, wollte sie wissen: Woher kommt das Wasser?
Als sie aus der Waschküche des Großhändlers kam, wo sie Wäsche eingeweicht hatte, kam ihr die Idee, Konrad zu fragen. Die Kleinen spielten unten im Hof, obwohl es schon spät war, und die halbwüchsige Dagmar war bereits zu den Otterbuben hinuntergegangen, auf die sie aufpaßte, wenn Tora backen ging. Nur Konrad war daheim, und er saß wie immer mit einem Buch vor sich am Küchentisch und verbrauchte Licht. Sie ging hin und klappte die Vorderseite hoch und meinte zu erkennen, wie es hieß. »Die Frau«.
»Was ist denn das?«
»Bebels ›Die Frau‹«, antwortete Konrad, ohne aufzusehen, obwohl ihr Ton scharf war. »Das ist nicht so was, falls du das meinst. Ich hab’s mir von Ebon Johansson geliehn.«
»Dann ist es Sozialismus«, stellte Frida fest.
Er schwieg und übertrug etwas in ein Heft mit schwarzen Deckeln, das er vor sich liegen hatte. Manchmal sah sie nach, was er da aus den Büchern abschrieb, doch meistens war es unverständliches Zeug, wahrscheinlich auch für ihn selbst. Er war erst sechzehn Jahre alt und hatte dadurch, daß Tora Otter ein Wort für ihn eingelegt hatte, seine Stellung als Lehrling und Laufbursche im Café Cosmopolite wiederbekommen. Im August, während des Generalstreiks, hatte er mit Meringemasse STRAIK! auf das Caféfenster geschrieben und war weggegangen. Er habe sich angeschlossen, hatte er zur Witwe Göhlin gesagt. Jetzt fürchtete Frida, daß er seine Stelle wieder verlieren würde. Er fing um sechs Uhr morgens an, blieb aber immer bis spät in die Nacht auf.
Auf dem Herd kochte das Wasser, und sie begann Roggenmehl hineinzurühren.
»Beim Großhändler haben se ’ne Wasserleitung«, erzählte sie. »Da braucht man nur aufdrehn.«
»Das ist doch gut«, meinte Konrad, ohne von seinem Buch aufzusehen.
»Weißt du, wo das herkommt?« fragte sie.
»Das Wasser?«
»Ja.«
Er schlug »Die Frau« zu.
»Weißt du das denn nicht? Das pumpen se bei Malstugan rauf. Da haben se doch ’ne Pumpstation gebaut.«
»Aber das muß doch irgendwann mal ausgehn.«
»Das ist Grundwasser«, erklärte Konrad.
Sie wußte nicht, was das war. Konrad begann auf dem Flickenteppich zwischen der Flurtür und der Zimmertür auf und ab zu gehen und vom Wasser zu erzählen, das unter ihnen und unter der ganzen Erde sei, und Frida, die mit dem Rücken zu ihm stand und den Brei rührte, wußte nicht, was sie glauben sollte. Es fülle alle Hohlräume und Spalten in der Erde, sagte er. Es rinne durch lockere Erdablagerungen und Sandschichten und Kiesbänke und dringe überall durch, wo es versickern könne.
»Du weißt aber genau Bescheid, du, wie es unter der Erde aussieht«, sagte sie und schmunzelte. Doch er fuhr, ohne sich von ihr beirren zu lassen, damit fort, über das Wasser zu erzählen, das weder Dianas noch Gabbro aufhalten könnten, wie es in unterirdischen Strömen fließe und wie es, wenn es regne, in den Hohlräumen der Berge perle und gluckse. Die unterirdische Wasserlandschaft sei ein Bild, wenn auch ein gespiegeltes und auf den Kopf gestelltes Bild, der Landschaft auf der Erde mit ihren Höhen und Tälern und tiefen Senken. Das Grundwasser strebe, wie alles andere auch, nach dem Gleichgewicht, sagte Konrad, und wo das Gleichgewicht zwischen dem Druck des Wassers und dem der Luft über der Erde erreicht sei, da befinde sich der Grundwasserspiegel. In den Senken und Niederungen sei er nahe an der Erdoberfläche, und manchmal breche er hervor. Dort sprudelten die Quellen.
Im Park unterhalb des Höhenrückens, dachte Frida. Wo die Heilsarmee immer spielt.
Der Brei war dick geworden und mußte nun nur noch ausquellen. Sie sollte nach David und Anna rufen. Konrad redete noch immer von hydrostatischem und artesischem Druck. Sie hatte eine ganze Weile nicht zugehört.
»Weißt du, warum sie die Himmelsöquelle verstellt haben?« fragte sie. Er wußte jedoch nicht einmal, wo sie gewesen war.
Am Montag ging sie ins Lindhsche Haus zum Waschen. Das Einweichwasser war flockig vom Schmutz, und es roch übel, als sie die Wäsche herauszunehmen begann. Für gewöhnlich achtete sie nicht darauf. Anfangs hatte sie das getan und dann jedesmal, wenn sie schwanger gewesen war. Der Gestank war früher, als die Wäsche zwischen den Waschtagen ein halbes Jahr liegenblieb, auch muffiger gewesen. Am Bottich stand Rut und fischte mit einem Waschholz die Unterhosen des Großhändlers heraus. Sie schwammen wie große, weiße Blasen auf dem schlierigen Wasser.
»Nimm die Hände dazu!« sagte Frida. »Sonst fallen sie dir runter.«
Sie hielt Rut nicht für eine große Hilfe. Sie war erst sechzehn, in der Küche des Großhändlers die Jüngste. Wenn Frida zum Waschen kam, plapperte sie wie ein Wasserfall, denn oben in der Küche hatte sie nicht viel zu sagen.
»Weißt du, daß der Großhändler vierzehn Unterhosen gebraucht hat, seit wir das letzte Mal gewaschen haben?« schwatzte sie. »Das ist doch wohl nicht ganz gescheit, über ein Dutzend Unterhosen seit September! Ich frag mich, ob er noch ein Dutzend im Schrank hat. Aber schau dir die mal an! Man sieht ja kaum, daß die gebraucht wordn ist. Doch, da war immerhin ein kleiner, brauner Fleck, er wischt sich schludrig ab. Hier, nimm, Frida!«
Doch sie ließ sie fallen, und das Waschholz schnellte über den Fußboden davon. Es hatte nicht viel Wucht, landete aber auf Fridas Füßen, und das tat weh. Sie hatte die Segeltuchschuhe an. Die benutzte sie nur beim Waschen, und sie hatte für die Hühneraugen Löcher in den Stoff geschnitten. Wenn ihr nichts drauffiel, konnte sie einen ganzen Tag auf den Holzrosten in der Waschküche umhergehen, ohne sie in nennenswerter Weise zu spüren.
Sie hatten moderne, mit gewelltem Zinkblech verkleidete Waschbretter und rubbelten die Wäsche in Seifenlösung. Als erstes rieben sie die Unterhosen des Großhändlers und seine Nachthemden, auf denen manchmal Schokoladenflecken waren.
»Er will Kakao haben, wenn er ins Bett geht«, sagte Rut. »Und da tut er dann ein Pulver rein, von dem er schläft. Lilibeth schläft gar nicht, sagt se immer. Obwohl ich das kaum glaub.«
Sie nannte Alexander Lindh selbst hier unten im Keller Großhändler, seine verheiratete Tochter aber Lilibeth, und die Haushälterin hieß bloß die alte Hex.
»Sieh dich vor!« warnte Frida.
»Ach was, hier kommt schon niemand runter. Weißt du, warum es diesmal so viele Binden sind? Die alte Hex ist von Doktor Hubendick operiert worden. Weißt du, was er gefunden hat? Ein Fläschchen ›Dralles Illusion‹ mit Veilchenduft. Das Zeug, das se immer auflegt, wenn se weggeht.«
»Leise!« sagte Frida. »Wo denn?«
»Na da, du weißt schon. Sie hat’s reing’steckt, verstehst, zu weit reing’schobn. Es ist verschwundn.«
»Du hast ein dermaßen lockeres Mundwerk, daß du dich eines schönen Tags noch unglücklich machen wirst«, sagte Frida. »Stell dir vor, dich hätte jemand gehört! So was behauptet man schon seit eh und je von denen, die nicht verheiratet sind. Jetzt bist still!«
»Bitte, wenn du meinst«, entgegnete Rut. »Aber ich weiß, daß es wahr ist, das Hausmädchen hat es nämlich Margit erzählt.«
Sie schwieg tatsächlich eine Weile und rubbelte Servierschürzen. Um neun Uhr rief das Küchenmädchen auf der Treppe, daß sie zum Kaffeetrinken heraufkommen sollten, und Frida zog die sackleinene Schürze aus und ließ den Rock, den sie mit Nadeln hochgesteckt hatte, herunter. Sie wechselte die Schuhe und band das Kopftuch neu. Gleichwohl fühlte sie sich unbehaglich, in dem abgetragenen Kleid, das am Bauch naß war, ohne Zähne und in schiefgetretenen Schuhen da oben zu sitzen. Die anderen hatten natürlich schon Kaffee getrunken. Frida weichte in ihrem Kaffee Weißbrot auf und hielt den Blick die meiste Zeit auf ihre Tasse gesenkt. Rut sagte jetzt auch nichts. Das Hausmädchen lief umher, daß die Bänder ihrer langen Arbeitsschürze, die sie über ihrem schwarzen Kleid trug, flatterten, füllte Wasser in Karaffen und wusch Gläser ab. Die Haushälterin saß in dem Raum hinter der Küche an der Schreibplatte und führte das Haushaltsbuch. Es roch nach Essig in der Küche des Großhändlers, denn die Köchin war dabei, Kräuterströmlinge einzulegen, und hatte den Sud zum Abkühlen ans offene Fenster gestellt.
Als sie wieder nach unten kamen, war das Feuer unter dem ummauerten Kessel ausgegangen. Frida heizte erneut ein, während Rut das noch heiße Wasser mit einer Blechkelle in den Holzzuber schöpfte. Sie begannen, die Küchenhandtücher, die sehr fleckig waren, zu rubbeln. Rut redete wieder unbeschwert drauflos. Sie erzählte, daß Lilibeth Iversen-Lindh immer nur weiße Blusen trage.
»Die können Einfälle haben, so viel se wolln«, sagte sie. »Und nichts hindert se daran. Jeden Tag muß se eine frische haben, und das Hausmädchen steht im Servierraum und bügelt se alle. Du solltest mal die Manschetten sehn! Die darf man bloß in lauwarmem Seifenwasser waschen. Ich sag dir, Frida, das Beste wirst du nie zu sehn kriegen. Das, was nicht mit in die große Wäsche darf. Die Unterwäsche. Das sind fast nur Spitzen. Und die Nachthemden. In denen könnt se auf eine Gesellschaft gehn, wenn se wollte. Er darf nie zu ihr rein, drum begreif ich nicht, wozu se die eigentlich hat. Nie auch nur eine Nacht, du.«
»Das weißt du doch nicht!«
»Doch, das wissen alle hier im Haus, auch wenn se so tun, als ob se keine Ahnung hätten. Nicht eine Nacht, seit se verheiratet sind! Und damals war se so verliebt, daß der Großhändler in die Heirat hat einwilligen müssn, obwohl Iversen keine Öre gehabt hat.«
»Der ist doch Ingenieur«, entgegnete Frida.
»Ingenieur! Naa, du, so nennt man ihn bloß. Der ist nicht mehr Ingenieur als Halta Lasse. Er kommt aus Kristiania, das liegt in Norwegen, und seine Mama hat Fisch verkauft auf dem Markt.«
»Nein, das ist doch gelogen«, sagte Frida. »Du weißt nicht, wovon du redest. Sie hat ein Geschäft gehabt.«
»Ein Fischgeschäft!«
Rut rieb Küchenhandtücher, in denen die Köchin Fleisch geklopft hatte. Es war schwer, die Blutflecken herauszubekommen, obgleich sie so lange eingeweicht worden waren.
»Jedenfalls«, fuhr Rut fort, »war er in der Nacht, als sie geheiratet haben, bei ihr, und dann kein einziges Mal mehr. Und das ist über zehn Jahre her.«
Die Waschbank stand vor dem Fenster zur Straße. Manchmal sah man Füße vorbeigehen. Wenn es vom Waschkessel her nicht zu sehr dampfte. konnte man Leute sehen, die über den Bahnhofsplatz gingen.
»Ebon Johansson«, sagte Rut. »Jetzt ist er wieder z’rück. Aber Arbeit kriegt der keine. Weil er Streikführer war. Der hätte wegen Aufwiegelung festgenommen werden können, hat die alte Hex gesagt. Und nach Svartsjö kommen. Weißt du, daß Tora Otter, die für Göhlin backt, mit dem gegangen ist, bevor se geheiratet hat?«
»Das ist doch deine Tante«, sagte Frida ein wenig scharf.
»Naa! Jedenfalls keine leibliche Tante. Meine Tante Stella ist mit ihrem Bruder Rickard verheiratet, aber der soll angeblich auch nicht ihr richtiger Bruder sein, nach dem, was ich gehört hab. Sie war mal Kellnerin im Bahnhofshotel und hat ein lila Straßenkostüm und einen Hut mit ’nem Vogel drauf gehabt. Und dann hat se zwei Kinder gekriegt, ohne daß se verheiratet war. Am Ende hat se ’nen Kerl aus Göteborg geheiratet, und der ist gestorbn, und sie hat sich von Mamsell Winlöf, der, der das Bahnhofshotel früher gehört hat, Geld geliehn. Die war im übrigen genauso, wie se jung war. Obwohl die keine Kinder gekriegt hat, weil se zur weisen Frau gegangen ist. Und heutzutag hat Tora Otter nicht mal Sonntagskleider.«
»Du quatschst«, sagte Frida. Aber es stimmte. Sie wußte, daß Tora keine Festtagskleider hatte. »Du quatschst halt, wie du’s verstehst«, sagte sie. »Sei jetzt mal ’n bißchen still! Wir haben noch die ganzen Laken vor uns!«
Am Dienstag war großer Waschtag. Halta Lasse, der Hausknecht des Großhändlers, machte morgens um fünf Uhr unter dem Kessel Feuer und begann das Wasser zu erhitzen. Als Frida kurz nach sechs kam, kochte es noch nicht. Gemeinsam hoben sie den großen Holzbottich auf das Gestell, Halta Lasse auf der einen Seite und Rut und sie auf der anderen. Es wurde allmählich beschwerlich. Es gab viele Dinge, die sie früher geschafft hatte, ohne darüber nachzudenken, und die ihr nun so schwer vorkamen. Sie sah Rut und deren kräftige Muskeln an den roten, rauhen Oberarmen an, und sie erinnerte sich, daß sie vor zwanzig Jahren selbst so ausgesehen hatte. Jetzt hatte sie vor allem Knoten und Sehnen unter der Haut. Manchmal mochte sie sich nicht leiden. Und das nicht nur, wenn sie unter Leuten war und sich wegen ihrer Kleider und Zähne schämte. Es konnte auch über sie kommen, wenn sie alleine war. Das war früher nie so gewesen. Da hatte sie sich über so etwas nie Gedanken gemacht.
Das Wasser kochte. Die Haushälterin hatte Rut drei Dosen Waschpulver gegeben, das sie auflösen sollten, bevor sie das Wasser auf die Wäsche schöpften.
»Früher haben wir ein Säckchen Birkenasche genommen«, sagte Frida. »Das ging gut damit.« Ihr graute ein wenig vor der scharfen Lauge. Ich bin ’ne Memme g’wordn, dachte sie. Hab Angst, mich zu verheben, und Angst, Lauge in die Augen zu kriegen. Und Angst, mich unter Leuten zu zeigen.
Wenn sie große Wäsche machte, bekam sie am Tag eine Krone und Kost, darum mußte sie zum Essen auf jeden Fall hinauf in die Küche des Großhändlers. Dienstags gab es Fleischsuppe mit Kloß zu Mittag. Sie war aus Bouillon gekocht und enthielt Lauch und Pastinaken und dünne Möhrenscheibchen, doch war das Gemüse so weich und zerkocht, daß sie es am Gaumen zerdrücken konnte. Mit dem Fleisch war das schon schwieriger. Die Köchin hatte den Kloß dick gemacht und mit Bittermandel abgeschmeckt. Droben im Speisezimmer aßen sie als Suppe nur Bouillon, und Frida fragte sich, wie sie es schafften, davon satt zu werden. Es wurden aber auch gekochte kalte Zunge mit Gemüse in Gelee, kleine Kalbskoteletts mit Erbsen und gebräuntem Reis und zum Schluß Karamelpudding serviert. Für die Küche hatte die Köchin Reispudding mit Fruchtsoße gemacht. Frida erinnerte sich daran, wie sie einmal eine ganze Form Pudding, gelb von Eiern und von weichen Rosinen gesprenkelt, nach Hause mitbekommen hatte. Diesmal bekam sie jedoch nichts mit. Es wurde alles aufgegessen. Halta Lasse aß wie ein Pferd, und Rut, die stand ihm kaum nach.
Als sie nach dem Mittagessen nach unten kamen, stellten sie einen Holzzuber unter das Zapfloch des großen Waschbottichs, und dann zog Frida den hölzernen Pfropfen heraus, den sie mit einem Lumpen umwickelt hatte, damit es nicht leckte. Die abgekühlte Lauge kam herausgeströmt, weißgelb und dicklich. Sie schütteten sie in den Kessel zurück. Wenn sie es nicht schnell genug schafften, steckte Frida den Pfropfen wieder hinein, damit von der Lauge nichts verlorenging. Rut war jetzt still. Sie lief mit klappernden Holzschuhen zwischen dem ummauerten Kessel und dem Waschbottich hin und her und goß um. Damit sie sich nicht verbrannte, hatte sie den Griff der Schöpfkelle mit einem Handtuch umwickelt. Ihre Unterarme waren bereits flammendrot von der Lauge.
»Du solltest vorsichtiger sein«, warnte Frida. Sie wußte aber selbst, wie das war. Wenn man jung war, glaubte man, daß der Körper unverwüstlich sei. Vor nichts hatte man Angst. Auf keinen Fall vor Arbeit. Sie versuchte, mit Rut Schritt zu halten, als sie das Wasser in den ummauerten Kessel zurückschütteten, schaffte es aber nicht. In den Fußballen hatte sie vom langen Stehen und Gehen schneidende Schmerzen. Die Hühneraugen jedoch spürte sie dank der Löcher, die sie in die Segeltuchschuhe geschnitten hatte, nicht.
Halta Lasse wollte mit ihnen schwatzen, als er Holz herunterbrachte, bekam aber kaum eine Antwort. Während sie darauf warteten, daß die Lauge wieder aufkochte, mußte sich Frida unbedingt auf die Waschbank setzen. Sie hatten noch zwei Zuber eingeweichter Wäsche vor sich, die ganz zum Schluß gewaschen werden sollten. In dem einen waren Binden. Rut war gerade dabei, sie zu reiben. In dem anderen die Taschentücher.
»Ich weiß nicht, was mit mir ist«, sagte Frida von ihrem Sitzplatz aus.
»Hast was mit dem Rücken?«
»Nein.«
Vor allem die Füße taten weh, doch das hätte sie noch aushalten können. Aber sich an die Taschentücher zu machen, dazu konnte sie sich nicht überwinden. Das darin Eingetrocknete löste sich im Wasser und wurde, wenn man sie sich vornahm, glitschig zwischen den Fingern. Es ging jetzt nicht. Wenn sie bloß begreifen könnte, was mit ihr los war. Und allein schon, wenn sie Ruts Zuber sah, in dem sich das schwarzgewordene Blut aus den Binden löste und das Wasser rostbraun färbte, wurde ihr speiübel.
Sie trat an den ummauerten Kessel und hob den Holzdeckel hoch und sah, daß das Wasser fast kochte.
»Ich fang schon mal an zu schöpfen«, sagte sie. »Du kannst die Taschentücher machen.«
Dies war das erste Mal, daß sie sich vor etwas zu drücken versuchte.
Zum zwölften und letzten Mal schöpfte sie abends um sechs. Die Waschküche war voller Dampf, und manchmal sahen sie sich gar nicht über den Waschbottich hinweg, wenn sie die heiße Lauge, die jetzt schmierig und braun durch die Wäsche sickerte, hineinschütteten. Am Ende zog Frida den Pfropfen aus dem Loch und ließ sie auslaufen und in den Abfluß gurgeln. Dann standen sie beide da und sahen ihr nach, und Rut sagte: »Des isses g’wesn.« Frida mußte schmunzeln, denn das Mädchen hatte am Nachmittag kaum ein Wort gesagt.
»Ich glaube, es braucht einen großen Waschtag, um dich ruhig zu kriegen«, sagte sie.
Sie machten ein letztes Mal Wasser warm, während sie oben zu Abend aßen, und dann gossen sie noch eine Spülung heißes Wasser über die Wäsche, bevor sie Feierabend machten. Klarspülen würden sie im See draußen bei Gertrudsborg, wo die alte Großhändlersgattin wohnte, und dort sollte die Wäsche auch aufgehängt werden. Den ganzen Tag hatte sich Frida keine Gedanken darüber gemacht, ob es wohl Trockenwetter geben würde, doch es war ein ruhiger Abend, als sie nach Hause ging. Die Luft war bitterkalt.
Am Mittwochmorgen wand sie die Wäsche aus und legte sie in Körbe, die Rut und sie nach oben trugen und auf den Leiterwagen luden, der von Gertrudsborg hereingekommen war. Der Fuhrknecht stiefelte auf ein paar Bier oder ein Glas Calabria hinüber in die dritte Klasse des Bahnhofshotels, und als er zurückkam, ging er breitbeinig.
»Schau zu, daß du die Körbe raufschaffst!« sagte Frida. »Wir haben viel zum Spüln heut.«
»Daß Waschweiber doch immer so grantig sein müssen«, bemerkte der Knecht. »Egal, was ist.«
Er grapschte Rut an den Hintern, als sie mit dem Waschkorb vor ihm die Treppe hinaufgehen mußte. Sie ergriff einen nassen Kopfkissenbezug und schlug damit nach ihm. Sie lachte und schrie so, daß Frida hart dazwischenfahren mußte. Sie war froh, als sie alle Wäsche endlich auf der Ladefläche verstaut hatten und der Wagen den steilen Hang in Richtung Wasserturm und Schule hinaufholperte.
Das Wasser war kalt. Sie lagen auf den Knien auf dem schwankenden Steg unterhalb von Gertrudsborg und schlugen mit krummen Hölzern die Wäsche. Manchmal ging der Steg so tief nach unten, daß ihnen das Wasser über die Knie schwappte.
»Ich finde, die hätten ruhig Gunhild runterschicken können«, meinte Rut. »Die hat sowieso kaum was zu tun. Bloß ’n bißchen Essen machen für die Frau vom Großhändler. Außerdem ißt die nichts, trinkt bloß Portwein. Sie kommt auch nicht gerade oft in den Ort. Und im Lindhschen Haus will sie nicht übernachten. Auf gar keinen Fall.«
Rut war ungeübt, das merkte man, wenn sie die Laken zu Paketen zusammendrehte. Sie gingen oft wieder auf, wenn sie sie umdrehte, um die andere Seite zu schlagen, und dann mußte sie noch einmal von vorn anfangen. Aber die ganze Zeit redete sie und redete. Und Frida ließ sie gewähren, denn das zerstreute wenigstens die Gedanken.
»Die hat Glück gehabt, daß se hier rauskommen hat dürfen«, sagte Rut. »Gunhild, mein ich. Se war schwanger und hätte aufhörn solln, und dann war’s nichts. Aber Hausmädchen ist se nimmer g’wordn, jedenfalls nicht drinnen.«
»War’s nichts?« fragte Frida.
»Naa. Weiß der Himmel, wie’s manche anstelln. Bei Ebba Julin war es ja genauso, obwohl es g’heißn hat, daß se’s abg’schnürt haben soll. Ich weiß es nicht.«
»Ebba Karlson meinst du, die, die den Brauer geheiratet hat.«
»Ja, freilich. Der ist jeden Abend, an dem sie serviert hat, im Bahnhofshotel g’sessn, weil er ganz vernarrt war in sie. Und am End hat sie ihm dann versprochen, daß se ihn heirat, wenn se ’ne Dreizimmerwohnung und ’ne Hausgehilfin kriegt. Und Julin hat natürlich alles mögliche versprochn, der war doch verliebt wie’n Kater, obwohl er schon über sechzig war. Ja, Ebba ist ja auch nicht mehr ganz jung, über dreißig auf jeden Fall, obwohl se jünger aussieht, weil se nie Kinder gekriegt hat. Und das, obwohl se liederlich g’wesn ist und sich immer mit Mannsbildern rumgetriebn hat, bevor se den Brauer g’heiratet hat. Und jetzt geht se mit gekräuselten Haaren und einer Brosche an der Bluse in den Milchladen und ist so etepetete, daß se alles umdreht und die Milch zurückschickt, weil se nach Petroleum schmeckt, und sagt, daß die Butter ranzig riecht. Und Frau Björk traut sich nichts dagegen sagen, weil se doch Kunden sind. Aber es schmeckt wirklich alles nach Petroleum dort, das sagen andere auch. Frau Björk nimmt’s nicht so genau, obwohl se natürlich billig ist. Er, der Björk, tut überhaupt nichts. Er hat ja bei Wilhelmsson aufhörn müssen, wie er sich das Bein gebrochn hat und es nie mehr recht g’wordn ist. Doktor Hubendick sollt ja operieren, weil das Schienbein rausg’standn ist, ham se erzählt, und g’jammert hat er, der arme Kerl, und am End ist er ohnmächtig g’wordn, wie se ihn hingetragn ham. Aber es hat g’eitert, nachdem Hubendick ihn operiert g’habt hat, und dann ist es nie richtig verheilt, und jetzt hat er Knochenfraß und sitzt im Laden und wickelt sich ständig seine Bandagen um. Ja, ich würd da keine Milch kaufn, nicht mal, wenn ich’s bezahlt kriegen tät. Mensch, Frida, du hast ja ganz g’schwollene Hände! Verträgst das Wasser nicht mehr? Es ist wohl doch zu kalt.«
»Ich weiß nicht«, sagte Frida. »Ich nehm an, es sind die Gelenke.«
»Jetzt könnt se aber mal zum Kaffee rufen«, meinte Rut. »Das tät gar nichts schaden. Auch wenn sie ihn ziemlich dünn macht.«
Sie schlug zu, daß es hoch aufspritzte. Und mit einem Mal war Frida so matt, daß sie nicht mehr an sich hielt.
»Dein Mundwerk geht wie g’schmiert. Sei jetzt mal ’n Weilchen still!«
Denn sie erinnerte sich, obschon nur schwach, an etwas lange Vergangenes, und es waren seltsamerweise die Wasserspritzer auf den Armen, die die Erinnerung in ihr wachriefen. An den Geruch des Sees erinnerte sie sich und an das Glitzern des Wassers, an einen viel intensiveren Geruch als jetzt und an blaues Wasser. Nicht dieses schwarze, eiskalte Wasser in den Eislöchern, in denen harschige Eisbrocken herumtrieben. Sie hatten in einer Reihe gekniet und Wäsche geschlagen und Tratsch und Erinnerungen ausgetauscht und darauf gewartet, daß es nach Kaffee riechen würde. Alles war damals anders gewesen. Mädchen in Ruts Alter hatten still zu sein, was für sie auch ganz selbstverständlich gewesen war. Es herrschte immerzu gute Laune. Sogar im Winter, sie konnte sich da auf nichts anderes besinnen. Denn sie hatten die Waschkessel mit draußen gehabt und die heiße Wäsche daraus direkt in die Eislöcher getaucht, und die Wärme der Wäsche hatte die Kälte des Wassers erträglich gemacht. Der Körper, an den man nie einen Gedanken verschwendete, wurde nicht matt. Jedenfalls nicht vor dem Abend. Es war, als hätte einem die Arbeit nicht zugesetzt, dachte sie. Aber das war seinerzeit.
Dann fing man an, matter zu werden und ängstlich davor, wie es wohl weitergehen würde. Wann dies jedoch angefangen hatte, wußte sie nicht mehr. Daran konnte sie sich einfach nicht erinnern.
»Du solltest nicht soviel reden«, sagte sie zu Rut. »Arbeit und halt den Mund, dann kannst du vielleicht beim Großhändler bleiben. In so einer Küche gibt’s viel zu lernen. Du hast Glück gehabt, du, drum geh nicht leichtsinnig mit der Stelle um. Eriksson hat jetzt keine Arbeit, weil er beim Streik dabei war. Und kein Mensch weiß, wie’s weitergehen soll.«
Sie bereute jedoch sogleich, daß sie das dem Mädchen, das es nur weitertragen würde, erzählt hatte.
Sie gingen zu Fuß in den Ort, nachdem sie Feierabend gemacht hatten. Bis auf einen Korb Handtücher war alles geschlagen und fertig, und am Donnerstag würden sie mit dem Aufhängen beginnen.
Auf der Wiese unterhalb des Küchengartens von Gertrudsborg spannten sie Wäscheleinen. Der Boden war noch gefroren und hart, und Schnee war nicht sehr viel gefallen, so daß es schwierig war, die angespitzten Stangen aufzustellen. Es war schon acht Uhr, als sie endlich die Wäschekörbe hinaustrugen. Sie begannen mit den Laken, die sie doppelt hängten. Weiß und sauber sahen sie aus, viel mehr würde die Wintersonne sie jedoch nicht bleichen. Die Laken schlugen hart, als der Wind in sie fuhr. Oben im Schlafzimmerfenster sahen sie ein Gesicht hinter der Gardine, doch sie taten, als bemerkten sie es nicht, als sie mit ihren Klammerschürzen vor dem Bauch umhergingen und Handtücher aufhängten. Die alte Frau Lindh bekam vor den Fenstern nicht oft etwas zu sehen, das sich bewegte. Dann hängten sie Unterwäsche auf, und bald flatterten die vierzehn Unterhosen des Großhändlers in einer lückenlosen Reihe. Die Kälte drang jedoch in sie, sie gefroren schnell und hingen dann steif und unbeweglich an der Leine.
Es war ein besserer Tag als der Mittwoch, an dem sie nur Wäsche geschlagen hatten. Nun waren lediglich die Handtücher übrig, danach brauchten sie die Hände nicht mehr in das kalte Wasser zu stecken. Frida war es, als kehrten ihre Kräfte zurück und als schwände ihre Angst. Beim Elf-Uhr-Kaffee saß sie am Küchenfenster und sah hinaus auf den kahlen Apfelbaum, in dem die Leinfinken mit ihren roten Kappen zwischen den Zweigen auf und nieder hüpften. In den Eislöchern gefror das Wasser des Sees in dünnen Schichten und wurde spiegelnd schwarz. Sie versuchte, an die Sonne zu denken und an Wasserspritzer und laute, fröhliche Stimmen an einem Spülplatz. Aber das war nun weit entglitten, und sie wußte nicht, wohin es entschwunden war. Manche Erinnerungen waren zerbrechlich. Wenn man zu sehr an ihnen rührte, wurden sie nur schwächer. Scham und Schmerz dagegen brannten sich in um so deutlicheren Spuren in das Gedächtnis ein. Sie verstand nicht, warum das so sein mußte.
Am Freitag mangelten sie in der Mangelstube hinter der Eisenbahnersiedlung. Das war ein alter Holzschuppen mit dünnen Wänden, so daß das Gepolter der Holzrollen gegen die Kästen und der träge Lauf der Marmorplatte bis hinaus auf die Straße zu hören waren. Es roch alt und nicht sonderlich gut dort drinnen, da war es schön, mit den großen Laken zu schlagen, die nach Sonne und Luft dufteten. Aber Rut war unmöglich. Sie schwatzte und vergaß darüber, beim Ziehen ordentlich dagegenzuhalten. Einmal ließ sie los, so daß Frida rücklings gegen die Wand fiel und fast zu Boden stürzte. Ihr wurde sterbensangst, daß sie sich weh tun würde. Deshalb schimpfte sie Rut aus.
Immer wieder merkte sie, daß sie ängstlicher war als früher. Angst, sich zu verletzen, wenn sie stürzte, Angst, die Hand zwischen die Mangel und die Rollen zu bekommen. Und mit dem Mädchen hatte sie überhaupt keine Geduld. Als Rut zu locker und zu schlampig aufrollte, so daß die Laken Falten schlugen und beim Mangeln lauter Knicke und Knitter bekamen, schimpfte Frida, obwohl es nichts nützte. Sie ließ die Rollen heftig auf den Kasten krachen, und Rut bemerkte ihre schlechte Laune, hielt schließlich tatsächlich den Mund und trat schweigend und polternd die Mangel.
Wütend und matt zu arbeiten und dabei nur den einen Gedanken im Kopf zu haben, fertig zu werden, hat nicht viel Sinn, das merkte Frida, als sie sich schließlich die großen Damasttischdecken vornahm. Sie rollten sie nur schief auf, wodurch sie sich verzogen. Zwei der größten, mit französischen Lilien gemusterte Tischdecken wurden knittrig anstatt glänzend, und die Falten so hart gepreßt, daß Frida die Decken wieder aufweichen und über Nacht trocknen lassen mußte.
»Ich geh morgen früh hier rauf«, sagte sie zu Rut. »Da bleibt nichts anderes übrig.«
Sie falteten die Servietten, die sie ganz zuletzt gemangelt hatten, zusammen, legten sie in schrägen Reihen unter die Mangelrollen und walzten sie. Danach war Schluß. Sie gingen dann dreimal mit den Wäschekörben zwischen sich zum Lindhschen Haus. Die Haushälterin zählte die Wäschestücke nach und sah natürlich, daß zwei Tischdecken fehlten.
»Die muß ich aufweichen und aufhängen«, sagte Frida.
»Aber nicht hier!«
Der Großhändler hatte auf der Rückseite des Hauses einen Garten, eine Miniaturausgabe des Parks des Stammgutes. Zwischen Zypressen und Gipsgöttinnen konnte man keine Wäscheleine spannen, das war vollkommen klar.
»Ich häng sie daheim auf«, sagte Frida. »Und morgen geh ich dann hin und mangle sie.«
»Und stehst dafür ein«, fügte die Haushälterin hinzu, und Frida wechselte einen Blick mit Rut.
Als sie am Abend in die Hovlundagata 60 heimkam, spannte sie zwischen der Ecke des Holzschuppens und der Ulme, die im Hof stand, eine Leine. Unter der Hofpumpe machte sie die Tischdecken des Großhändlers naß und hängte sie auf. Sie wußte, daß sie am Morgen noch dasein würden.
Oben in der Wohnung waren die Kleinen auf dem Küchensofa schon eingeschlafen. Sie hatte sie den ganzen Tag über nicht gesehen und wußte nicht, was sie gegessen hatten. Dagmar sollte ein Auge auf sie haben und ihnen etwas zu essen geben, doch die saß drinnen im Zimmer über der Hemdennäherei, die sie übernommen hatten, und Frida wußte nicht, wie sehr sie die Kinder sich selbst überlassen hatte. Jetzt war sie bereits in Tora Otters Wohnung hinuntergegangen, um auf die Jungen aufzupassen, während Tora im Keller Brot buk.
Daß Eriksson nicht zu Hause war, sah Frida auf den ersten Blick. Konrad saß mit der Zeitung am Küchentisch.
»Wo ist Papa?« fragte sie.
Konrad schaute so komisch drein. Sie mußte noch einmal fragen.
»Der ist nach Norrköping auf und davon«, sagte er.
»Auf und davon?«
»Ja, um Arbeit zu finden. Hier kriegt er keine.«
»Aber die Miete!« klagte sie. »Wir können rausgeschmissen werden.«
Konrad schwieg und tat, als läse er Zeitung, doch sie sah, daß sich seine Augen nicht bewegten.
»Wir brauchen diesen Monat zwölf Kronen für die Miete!«
»Er wollte aus Norrköping Geld schicken, sobald er was gekriegt hat. Im Hafen oder so. Er hat gemeint, daß er da auf jeden Fall etwas kriegen würde.«
Sie setzte sich Konrad gegenüber auf einen Küchenstuhl und begann zu überlegen. Dagmar bekam von Tora Otter für die vier Nächte in der Woche, in denen sie auf die Jungen aufpaßte, Brot. Konrad bekam nicht so viel im Cosmopolite, weil er bloß Lehrling war. Sie nahm seinen Lohn immer für die Miete her. Jetzt aber hatte Erikssons Geld so lange gefehlt. Zwanzig Kronen hatte er gewöhnlich in der Lohntüte gehabt. Das war im letzten Sommer. Zwei gingen für die Krankenkasse und für den Gewerkschaftsbeitrag drauf. Mindestens fünfzehn hatte sie normalerweise für das Essen einbehalten können. Sie selbst verdiente eine Krone am Tag oder manchmal auch einsfünfzig, wenn sie in fremden Häusern waschen oder putzen ging. Das verwendete sie immer für Leuchtöl und Kleidung und den Schuster. Sie brauchten Holz. Das Holz und die Miete.
Nach wie vor liefen die Kinder umher und sammelten Knochen und Schrott. Sie brachte es nichts übers Herz, ihnen zu sagen, wie wenig das einbrachte, so wenig, daß es beinahe zwecklos war, wenn die Miete nicht bezahlt war. Und das Holz.
»Das kann er doch nicht machen!« sagte sie.
»Er macht das doch, um Arbeit zu kriegen und Geld zu schicken«, erklärte Konrad. »Begreifst du das denn nicht?«
Doch es war, als könne sie es ganz einfach nicht fassen. Er war fort. Er war auf und davon.
»Es ist doch gar nicht sicher, daß er dort überhaupt Arbeit kriegt. Die haben se vielleicht überall auf die schwarze Liste gesetzt. Da seht ihr, wie’s kommt!«
»Du warst gegen den Streik«, sagte Konrad und zog sich die Zeitung heran. »Das ist alles. Und jetzt bist du grantig, weil du beim Waschen warst. Das bist du jedesmal.«
Sie setzte sich an den Küchentisch und betrachtete ihre Hände. Die Gelenke waren angeschwollen, und über ihnen
war die Haut glänzend und gespannt. In den Handflächen war sie dagegen aufgeweicht und gräulich vom Wasser, und während dieses Tages in der Mangelstube war sie getrocknet und aufgesprungen, so daß die Schrunden wieder rot leuchteten.
»Habt ihr gegessn?«
»Dagmar hat was zurechtgemacht.«
Sie hatte keinen Hunger. Ihr war zum Speien. Man ist nicht mehr das, was man mal war, dachte sie. Da hatte Konrad recht. Sie erhob sich und holte etwas Wollgarn aus der obersten Kommodenschublade. Sie versuchte ihr Gesicht im Spiegel zu sehen. Doch in der Ecke, in der die Kommode stand, war es
dunkel, und das Glas war alt und blaugrau. Sie sah ein dunkles Oval. Augen und Mund waren undeutlich. Nur Löcher und Schatten. Um das Spiegelgesicht hing der Brautschleier, den sie um den Rand des Frisierspiegels drapiert hatte. Sie riß ihn herunter und stopfte ihn in die oberste Kommodenschublade, und dabei merkte sie, daß er speckig war vom Staub und Schmutz.
»Was machst du denn da, Mama?« fragte Konrad. Es klang ängstlich.
»Nichts. Ich werde runtergehen zu Tora Otter und fragen, ob sie ungesalzene Butter hat. Ich geh jetzt«, sagte sie.
Sie war matt. Schon am Morgen lag diese Mattigkeit wie ein großes, schweres Ei in ihrem Körper.
Tora Otter kam mit einem Kamm voller Läuse, Nissen und Haare von Dagmar angestürmt. Den hatte sie auf ihrer Kommode gefunden. Frida schämte sich. Sie hätte für Dagmar und Anna jeden Abend die Schale und den Läusekamm hervorholen sollen. Doch sie war dazu nicht imstande gewesen. Jetzt tränkte Tora ihre Schädel bis auf die Kopfhaut mit Sabadillessig, und dann mußten sie, während er einwirkte, mit Tüchern um den Kopf dasitzen. Anna weinte, weil sie Essig in die Augen bekommen hatte. Dagmar schämte sich nur. Und Tora fegte in der Küche umher und meckerte, verbrannte eine Zeitung im Rauchfang, um die Kakerlaken zu vernichten, und wischte das Gröbste vom Küchentisch auf. Sie war mehr als zehn Jahr jünger, sie kannte keine Mattigkeit. Noch nicht, dachte Frida.
Die Mattigkeit in ihr wuchs und wurde immer schwerer. Sie wollte sich nur ein Weilchen ausruhen. Den Augenblick, bevor die Gedanken verscheucht wurden und sie auf dem Kissen einschlief, fand sie angenehm. Das war der angenehmste Rausch, den sie je erlebt hatte.
Gleichwohl konnte sie die Nacht nicht durchschlafen. Früher als nötig und früher als irgend jemand sonst im Haus wachte sie auf und lag mit trockenem Mund und brennenden Augen und konnte nicht mehr einschlafen. Eriksson hatte aus Norrköping geschrieben und gemeint, daß er vielleicht in einem Hafenarbeiterkollektiv mitmachen könne. Bisher habe er nur Gelegenheitsarbeiten. Wenn er aber eine Stelle in dem Kollektiv bekomme, solle die Familie nach Norrköping nachkommen. Er teile sich in Saltängen mit jemand ein Zimmer, schrieb er.
Es ging nicht, sich vorzustellen, was für ein Gefühl das sein würde, sich in den Zug zu setzen und diesen Ort zu verlassen. Sie war hier aufgewachsen und hatte hier gearbeitet. Die beiden ersten Kinder waren oben in Lusknäppan, wo sie selbst geboren worden war, gekommen. Dagmar und Konrad waren in Hovlunda auf die Welt gekommen, bevor die letzte Hütte abgerissen wurde. David und Anna waren hier in der Hovlundagata 60 geboren. Großmutters Grab war in Vallmsta und das von Mama auf dem Friedhof bei Malstugan. Tora Otter wohnte hier. Frida konnte für Leute waschen, die sie kannten, und sie wußte, daß Konrad eine ordentliche Arbeit hatte. Dagmar, die einen verwachsenen Rücken hatte und kaum mehr tun konnte als Kragenecken umklappen bei ihrer Hemdennäherei und Kinder hüten, bekam von Tora für die Arbeit, die sie verrichtete, Brot. In Norrköping, wer würde Dagmar dort haben wollen? Und Saltängen. Allein der Name erschreckte sie: Salzwiese. Strolche und Jungenbanden. Wie sollte sie es wagen, David und Anna an einem solchen Ort zur Schule zu schicken?
Sie hatte lange wach gelegen und sollte aufstehen. Aber sie blieb liegen und horchte auf Pantoffel, die auf der Treppe schlurften, und auf das Kreischen der Pumpe. Es schepperte und hallte von Blecheimern und Kannen. Das alte Haus konnte ächzen und stöhnen, wenn es windig war, und die Kinderstimmen unten im Hof waren laut und hell wie Möwengeschrei.
Doch sie war an die Geräusche gewöhnt und wußte, daß die schlurfenden Schritte der gebrechlichen, alten Lundin gehörten und das dumpfe Klopfen vom Schuster aus dem Keller kam und daß die Pumpe ärger kreischte, wenn die Kinder damit spielten. Der Hund, der stundenlang bellte, heiser und ohne Überzeugung, gehörte dem Hausverwalter. Daß man ihn darauf nicht ansprechen durfte, wußte sie auch.
Ihr war indes nicht klar, wie es sein würde, nach Norrköping zu ziehen.
Als sie hinunterging und Wasser holte, stand sie an der Pumpe, zupfte Rostflocken davon ab und schob sie in den Mund. Das war eine Unsitte, die sie angenommen hatte und von der sie nicht lassen konnte. Am Ende wollte sie nicht einmal mehr Konrad Wasser holen lassen, selbst wenn er sich dazu anbot. Sie konnte nicht auskommen ohne diese Flocken, sie zupfte und zupfte und schob sie in den Mund und fand, daß sie salzig schmeckten wie Blut. Zu guter Letzt waren keine Flocken mehr an der Pumpe. Da begann sie am Kohleneimer, der in einer Ecke der Küche vor sich hinrostete, und an einem Eisenrohr, das vom Kamin in den lädierten Kachelofen führte, herumzuzupfen. Selbst da begriff sie noch nicht. Solange nicht, bis sie eines Morgens vor dem Küchenherd stand und den braunen, mit Einmachhaut zugebundenen Topf betrachtete, der auf dem Kaminsims stand.
PHOSPHORLATWERGE
zur Vertilgung von Ratten
Sie pusselte die Schnur und das Papier auf. Das Pulver hatte Feuchtigkeit angezogen und war zusammengebacken. Sie benutzte es jetzt nur noch selten, denn Konrad hatte Deckel von Anschovisdosen vor die Rattenlöcher genagelt. Sie stocherte mit dem Finger in der Masse und bekam den Impuls, ihn in den Mund zu stecken. Erst da begriff sie.
Ihre Brüste waren angeschwollen, und die Haut darauf war gespannt. Ihr war schlecht gewesen, und sie hatte diese Mattigkeit verspürt, die ihr jeglichen Willen raubte. Den ganzen Herbst über hatte sie keine Regelblutung gehabt, doch das hatte sie auf die Mattigkeit geschoben. Es war auch früher schon vorgekommen, daß sie ganz einfach ausgeblieben war. Im vorigen Jahr war sie unregelmäßig gewesen. Sie hatte schon geglaubt, daß sie aufhören und sie die Sache und all die Angst für immer loshaben würde.
Aber dem war nicht so. Sie war schwanger. Sie wußte sogar, wann es passiert war, und begriff, daß sie Anfang des fünften Monats sein mußte. Ihr Körper wies jedoch keine anderen Anzeichen auf, als daß die Brüste angeschwollen und blauadrig geworden waren. Er konnte nichts anderes aufweisen, glaubte sie, da er gar nicht mehr zu geben hatte. Sie mochte sich nicht und nicht diesen Körper, der keine Nahrung und keinen Genuß mehr zu geben hatte. Sie mochte auch dieses Geschöpf nicht, das sich seit mehreren Monaten mit ihr um ein Leben schlug, wo nur ganz wenig Leben da war zum Teilen.
Es mußte weg. Sie brauchte sich da nicht selbst zu belügen und ein Gewissen vorzuheucheln, wie sie es früher getan hatte, wenn sie auf schlimme Gedanken gekommen war. Ein Gewissen konnte sich leisten, wer Milch, Brot, Fleisch, Kartoffeln, Kleider, Holz, Leuchtöl und Schuhe hatte. Sie selbst lief genau wie die Kinder auf Brandsohlen, schnitt Zeitungspapier zurecht und legte es in die Schuhe, damit die Nässe nicht durchdringe.
Es mußte weg. Egal wie. Ihre Gedanken kreisten um den braunen Topf. Der Kaminsims war speckig von Staub, Ruß und Bratdunst. Um sie herum nahm die Vernachlässigung immer mehr zu.
Zuerst dachte sie daran, es wegzubaden. Sie würde sich im Blechzuber in heißes Wasser setzen und so lange immer weiter heißes Wasser nachgießen, wie sie es aushielt, bis sie es weggebrüht hätte, wie man Ungeziefer aus einem alten Bett wegbrüht.
Sie war jedoch nie allein in der Küche, deshalb ging das nicht. Außerdem glaubte sie nicht daran. Das meiste in dieser Richtung waren nur Backfischphantasien: ein ums andere Mal vom Küchentisch hüpfen oder versuchen, sich zu verheben. Das half nichts. Als sie sehr jung und mit ihrem ersten Kind schwanger gewesen war, hatte ihr jemand gesagt, daß sie Seifenwasser trinken und dann, so schnell sie könne, rennen sollen. Sie mußte jedoch lernen, daß, wenn es sitzen sollte, auch sitzen blieb. Die beiden ersten Kinder waren bei ihrer Mutter, die die Leute Banvalls-Brita genannt hatten, aufgewachsen. Sie waren jetzt erwachsen.
Es hieß, daß manche zur weisen Frau gingen. Doch sie wußte nicht, wie es dazu kam, daß diese ihnen helfen wollte, ob sie sie bezahlten oder ob es andere Wege gab, sie dazu zu bewegen. Ihrer würde sich die Hebamme nie annehmen, bevor es Zeit zur Entbindung war.
Sie hatte gehört, daß man Essigessenz einspritzen solle. Aber womit? Das waren keine Pläne, es fiel ihr nur so ein, wenn sie morgens wach lag. Seife, Lauge, Essig. Sie hatte kaum mehr einen Gedanken im Kopf. Wenn sie aber eine Schublade öffnete, schlossen sich ihre Finger um spitzige Gegenstände. Langsam gewöhnte sie sich daran. Zuerst war es ihr so erschreckend und ekelhaft vorgekommen, daß sie geglaubt hatte, es sei unmöglich auszuführen. Aber viele hatten es doch schon vor ihr getan. Es ging. Sie wußte das. Am liebsten hätte man jemand zu Hilfe dabei, aber es gab viele, die es allein gemacht hatten. Und es war das einzige, was sicher war und half. Alles andere waren nur Hirngespinste und Wunschträume armer Mädchen. Sie konnte bald keine Schublade mehr öffnen, ohne daran erinnert zu werden. Stricknadeln, Schaumschläger, Spicknadeln.
Am allergefährlichsten war der braune Glastopf. PHOSPHORLATWERGE – zur Vertilgung von Ratten. Das würde allem ein Ende setzen.
In aller Frühe kam an einem Samstagmorgen nach dem Dreikönigsfest ein Junge auf einem Wagen zum Markt des Ortes. Es war noch dunkel. Während der Schnee von den Pferdehufen festgetrampelt wurde und unter den Wagenrädern und Kufen knarzte, wanderte der Junge auf und ab und sah den Marktleuten zu, die mit ihren Stangen klapperten und in der Kälte die steife Zeltleinwand ausbreiteten. Als die Dämmerung anbrach, ging er unten am südlichen Ende des Marktplatzes umher und beobachtete die Frauen, die aus Kisten, die sie direkt in den Schnee gestellt hatten, Quirle und Eier und Suppenhühner verkauften. Sie stampften mit den Füßen und schlugen die Arme um ihre Körper, denn es war kalt. Einige hatten Stroh, andere Wollbüschel um die Eier gelegt, damit sie nicht erfroren. Dann kam der Handel in Schwung, der Metzger schlug die Klappen seines roten Verkaufswagens auf, und der Fischhändler stellte einen Bock unter den Karren, so daß dieser waagerecht stand, und begann auf der Laufgewichtswaage Hechte abzuwiegen.
Der Junge stand schon so lange da, daß die Eierverkäuferinnen nach und nach auf ihn aufmerksam geworden waren. Sie sahen, daß er ordentlich gekleidet war, daß er dicksohlige Stiefel anhatte, eine Hose und eine Joppe, die selbstgenäht aussahen, eine Strickjacke mit Stehkragen und eine neue schwarze Mütze mit glänzendem Schirm. Er trug einen Rucksack, den er nicht ablegte. Schließlich schaute er lange einer Frau aus Vanstorp zu, die Hausgebackenes, gewöhnliches Feingebäck und ein paar Eier verkaufte. Er streifte die Mütze vom Kopf, trat zu ihr und fragte schließlich, ob sie Tora Lans sei.
Es erregte Aufsehen, daß er nach Tora Otter unter ihrem Mädchennamen fragte. Unter den Frauen ging das Getratsche los. Mehrere ältere hielten es für nicht schwer zu erraten, wer er sein könnte, nachdem sie ihm entlockt hatten, daß er am Morgen mit einem Wagen aus Stegsjö gekommen war. Sie zeigten ihm, wo Tora ihren Stand hatte.
Tora stand jetzt am nördlichen Ende des Marktplatzes unter einem Dach aus Zeltleinwand. Die Kartoffelbrote, die sie mehrere Jahre lang gebacken hatte, gingen nicht mehr wie früher. Die Leute waren allmählich von Weißbrot und Gebäck aus feinem Roggenmehl verwöhnt und fanden, daß die Laibe grau und nach Notzeit aussahen. Am besten verkauften sich jetzt die Bonbons, die sie zu kochen begonnen hatte, um zusätzlich etwas zu verdienen. Zuerst hatte sie nur weißrote Zuckerstangen hergestellt, doch nun kochte sie verschiedene Sorten: Dragées, Geleefrüchte, gebrannte Mandeln und Pfefferminzpastillen. Die ganze Herrlichkeit würde zusammenkleben, wenn Regen oder Schnee in die Kisten käme, darum hatte sie sich Stangen und Zeltleinwand angeschafft und weiter oben einen Standplatz gemietet. Es war teuer, fünfundzwanzig Kronen im Jahr, doch sie hatte gefunden, daß sich das lohnte.
Nachdem die Frauen dem Lungen aus Stegsjö gezeigt hatten, wo sie ihren Stand hatte, stellte er sich zu dem Gärtner hinter ihr und guckte, ohne sich zu ihr hinzuwagen. Es war jetzt helllichter Tag. Wolken waren aufgezogen. Leute kauften Bonbons von Tora Otters Stand, an dem zwei Frauen bedienten. Er stand hinter dem Glaskasten des Gärtners und beobachtete zwischen unruhigen Flammen von Stearinkerzen und blauen Hyazinthen hindurch Tora und Tekla Johansson, die ihr beim Abwiegen der Bonbons half. Er beobachtete alles genau, die Tüten und Messinggewichte und die Vogelschnäbel, die sich trafen, wenn sich die Marmorplatten der Waage im Gleichgewicht befanden. Er betrachtete die beiden Frauen in ihren schwarzen Mänteln und Strohschuhen. Sie waren gleich angezogen, trugen weiße Schürzen, deren Brusttuch auf dem Mantelstoff festgesteckt war, weiße Ärmelschoner, Halbhandschuhe und Fellmützen, die sie mit einem Schal um die Ohren gebunden hatten. Es war vermutlich nicht leicht für ihn zu entscheiden, wer Tora war.
Es schneite auf seine Mütze und seine Schultern. Er stampfte und stampfte, es war ganz eindeutig, daß er kalte Füße hatte. Als der schlimmste Vormittagsansturm vorüber war, ging Tekla in Ankers Konditorei Kaffee trinken, und Tora blieb allein zurück.
Da sahen die Leute, wie der Jungen seinen Platz verließ und um ihren Stand herumging und ein Stück davon entfernt wartete, während sie mit einem Kunden abrechnete. Dann war sie allein und begann ihre geschwollenen roten Finger zu reiben und mit den Strohschuhen zu stampfen. Da mußte sie ihn bemerkt haben. Der Käsehändler, der gerade einen reifen Svecia schnitt, hielt mit dem Draht mitten im Käse inne. Emma Lundholm, die das Stück Käse bekommen sollte, erzählte ihm, daß Tora den Jungen nicht mehr gesehen habe, seit sie ihn an ein Schusterehepaar in Stegsjö weggegeben habe, und das sei fünfzehn Jahre her. Daß sie nicht wisse, wer er sei, könne ja wohl jeder sehen.
Der Junge nahm die Mütze ab und trat vor. Der Käsehändler, Emma Lundholm und der Gärtner, der sich hinter den Glaskasten gestellt hatte und durch die mit Eisblumen überzogenen Scheiben schielte, hörten, wie er sie fragte, ob sie Tora Lans sei. Das leugnete sie nicht, sagte jedoch, daß sie jetzt Tora Otter heiße.
»Ich bin Erik Lans«, sagte der Junge.
Tora sagte kein Wort.
»Aus Stegsjö«, fügte er hinzu.
Jetzt konnte niemand verstehen, was sie antwortete, doch sie sahen, daß sie sich über die Theke beugte und mit ihm sprach, schnell und kurz angebunden, wie es ihre Art war. Sie sahen beide nicht froh aus. Sie packte Dragées in eine Türe und gab ihm auch eine Krone aus der Kasse, die er in den Handschuh steckte. Der Junge schien die ganze Zeit ängstlich zu sein. Es kam Kundschaft, und sie schickte ihn in Ankers Konditorei quer über die Straße. Er rannte mit seinem Rucksack, der ihm auf dem Rücken auf und ab hüpfte, hinüber.
Man glaubte, Tora würde dem Jungen zu Anker folgen, als Tekla zurückkam, aber sie tat es nicht. Sie fertigte weiterhin ab und schickte Tekla nach Kaffee für sich und setzte sich auf eine der Kisten hinter dem Stand, um ihn zu trinken. Marktleute, die auf ihren Vormittagskaffee in die Konditorei gingen, sahen den Jungen dort mit seiner Mütze neben sich auf der Bank sitzen. Er hatte Schokolade getrunken und Zweiöresemmeln gegessen, niemand aber wußte, ob er auf Tora wartete oder sich nur aufwärmte. Schließlich ging er, und niemand sah, wohin er sich aufmachte. Tora verließ ihren Platz hinter dem Bonbonstand den ganzen Tag nicht. Um vier Uhr begann sie wie alle andern zusammenzupacken. Von dem Jungen war nach wie vor nichts zu sehen. Sie ging nicht zu Fuß nach Hause, als Kalle Bira mit dem Wagen kam, sondern setzte sich neben ihn, nachdem die Kisten, Stangen und die Leinwand verstaut waren. Dort saß sie gut sichtbar, als die Fuhre zur Hovlundagata heimschaukelte.
Den Grund und Boden zu besitzen, auf dem man geht, vermittelt ein ganz eigenes Gefühl unter den Fußsohlen. Dessen konnte sich Großhändler Alexander Lindh auf so gut wie der ganzen Nordseite erfreuen. Außerdem hatte er südlich der Landvägsgata Löskebo mit zweihundert Morgen Land gekauft. Pferderechen, Sprossenbänke, Waschtische und ganze Häuser, Gußwaren, Ziegel, Papierbrei, Dreschmaschinen, Pflüge, Grubenholz und Sparren verließen den Güterbahnhof des Ortes. Das brachte Geld, um Land zu kaufen.
Die königliche Majestät erteilte dem Besitzer des Stammgutes die Erlaubnis, unter anderem halbe Hufe von Malgstugan zu verkaufen, und Fabrikant Wärnström griff zu. Er konnte nun weit südlich des Friedhofs auf eigenem Grund und Boden wandern. Nach 1907 löste sich eine Scholle Land nach der andern, trieb vom Stammgut ab und landete bei Wärnström oder Lindh und damit auf dem städtischen Planungsgebiet des Ortes.
Wämström war als Hufschmied und Schlosser in den Ort gekommen, ohne Kapital. Alexander Lindh war mit nicht viel mehr als einer Reisetasche voll reiner und fein säuberlich zusammengelegter Hemden, gestärkter Kragen und Strümpfe aus dem Zug gestiegen. Um billig zu kaufen und teuer verkaufen zu können, hatte er Darlehen aufnehmen müssen. Die Zeiten waren jedoch knapp gewesen an Geld und die Gesellschaft unbeweglich und träge. Die ersten zwei Jahrzehnte hatten seine Geduld und manches Mal auch seinen Glauben an die Zukunft arg strapaziert. Er hatte das, was in seinen Besitz gelangt war, festgehalten und teuer verkauft, wenn er dazu gezwungen war.
Jetzt sah alles anders aus. Er begann, um den Bahnhof herum Grundstücke an Leute zu veräußern, die zuvor von ihm Land gepachtet hatten. Seinem Bruder Adolf verkaufte er einen steinigen Hügel, auf dem Adolf eine Villa errichtete, die mit sprießender Fichtenhecke und geschuppten Türmen eine der stattlichsten Manifestationen der gesellschaftlichen Düsterkeit wurde. Adolf schritt durch die langen Korridore und zwinkerte mit den Augenlidern, und von hohen, braunen Paneelen starrten Elchköpfe auf ihn herab. Er verstand nicht, weshalb sein Bruder den Leuten Bauplätze für nur fünfzig Öre pro Quadratmeter verkaufte, während er selbst fast eine Krone hatte bezahlen müssen. Er erfuhr nun am eigenen Leib, daß es ein ganz eigenes Gefühl war, den Grund und Boden zu besitzen, auf dem man ging, und er begann es beglückend zu finden, daß das nicht mehr Leute erprobt hatten. Zu seinem Entsetzen fuhr Alexander jedoch damit fort, billig zu verkaufen.
Es bestand, anders als Bruder Adolf glaubte, keinerlei Gefahr, daß sanftmütige Bahnarbeiter und Möbelschreiner die Welt besitzen wollten, seit sie begonnen hatten, ihre Grundstücke freizukaufen. Ganz im Gegenteil, niemand würde die Prinzipien des Eigentums eifriger verteidigen als derjenige, der seine Stachelbeerbüsche in eigene Erde pflanzte, und das wußte Alexander. Revolutionäre Gefühle waren das nicht, die da vom Grund und Boden durch die Fußsohlen aufstiegen. Fünfundsechzig Öre waren ein wohlfeiler Preis, für alle Beteiligten.
Carl Wärnström kaufte Ihro Gnaden, die Witwe geworden war, eineinhalb Hufen von Lilla Himmelsö ab, und er bezahlte einhundertzehntausend Kronen. Es war ein großes Gebiet südlich der Hovlundagata und des Höhenrückens. Es erstreckte sich auf der einen Seite bis zur Bahnlinie nach Norrköping und auf der anderen bis zur Landstraße nach Nyköping. Er bot es der Gemeinde für achtzigtausend Kronen an, unter der Bedingung, daß unterhalb des Höhenrückens ein Sportplatz angelegt würde und daß er den Wald selbst abholzen dürfte. Aber Großhändler Lindh sprach sich in der Gemeindeversammlung dagegen aus und warnte die Gemeinde davor, sich zu verschulden. Die Gemeinde stimme Lindhs Antrag zu.