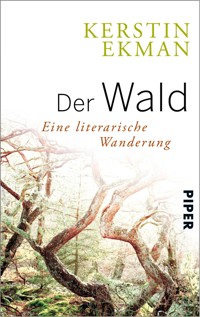18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»›Wolfslichter‹ ist eine Synthese aus allem, was die Literatur am besten kann.« Skånska Dagbladet In der Stille des Neujahrsmorgens sichtet Ulf, Jagdleiter in Hälsingland, einen Wolf. Stolz streift der Einzelgänger, der kürzlich eine Ricke gerissen hat, durch das verschneite Moor. Doch dem Jagenden droht selbst Gefahr: Zwei Wölfe dürfen in der Provinz geschossen werden, und so wahrt Ulf das Geheimnis ihrer Begegnung. Während seine Frau Inga den in Gedanken an das Tier verlorenen Mann liebevoll drängt, nochmals seine Jagdtagebücher durchzulesen, eskaliert Ulfs Konflikt mit den jüngeren Kameraden. Denn die sind nur auf Blut und Trophäen aus. Ein feinsinniges und packendes, großes Alterswerk! »Ekmans Roman ist wie eine schillernde Wolke. In ständiger Wandlung erzählt er vom Altern, von einer Begegnung, die die Weltanschauung eines Menschen verändert, von der Macht der Erinnerung und der Vorbereitung auf den Tod.« Dagens Nyheter »Ein aufschlussreicher Roman über den Konflikt zwischen uns Menschen und der Welt, in der wir leben. Eine melancholische, sehr berührende Geschichte.« Aftonbladet Ausgezeichnet mit dem Natur & Kultur Kulturpreis 2023 Shortlist des Nordic Council Literature Prize 2022
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Die schwedische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Löpa varg im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
ISBN 978-3-492-05967-1
© Kerstin Ekman, 2021
Published in the German language by arrangement with Bonnier Rights, Stockholm
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Cornelia Niere nach einem Entwurf von Eva Wilsson
Coverabbildung: Rainer Fuhrmann/EyeEm/Getty Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Es war kalt.
Einen Tag nach Neujahr …
»Ich finde, du solltest …«
Die Hasenjagd wirkte ziemlich monoton …
Wer ruft in einer Sommernacht an?
Ich stand unter der Fichte …
Es war so heiß …
Das Vereinshaus verfügt …
In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen.
Ich saß mit einem der Bände …
Alles war mehr oder weniger grau.
Zu Hause war Schnee geräumt.
Am Abend setzte ich mich aufs Paneelsofa …
Die Abende waren meist lang und angenehm.
Eines Vormittags im März …
In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen.
Inga kam mit einer schwarzen Hose …
Es ist der achtzehnte September.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Es war kalt. Noch kaum Tageslicht. Nur eine leise Ahnung. Der Stutzen lag nach wie vor auf der Bank auf der anderen Seite des Tisches. Ungeladen. Warum, weiß ich nicht. Es kommt halt so. Nicht bei allen, das ist mir klar. Die meisten wollen schießen, solang der Zeigefinger den Abzug drücken kann. Solang das Glied sich aufrichtet, lebt und tötet man.
Ich hatte schon viele getötet. Vielleicht sollte es jetzt genug sein. Kasper hatte achtundzwanzig Elche zum Schuss gestellt. Natürlich nicht alle nur für mich. Wurde die Beute aber von einem anderen Ansitz aus erlegt, ließ er den Schützen nicht an sie heran, sondern zog die Lefzen hoch und fletschte die Zähne. Kam der Schütze näher, versteifte er sich und knurrte. Sobald er auf dem Wild stand und schon an dessen Decke zerrte, ließ er nur noch sein Herrchen heran. So war Kasper.
Trissa war nicht schlechter. Allerdings war sie lange meine einzige Hündin, haben sie doch den Nachteil, im Herbst läufig zu werden. Ich kann mich nicht an alle ihre Elche erinnern. Es sind nur die Besonderen, die man in Erinnerung behält. Die Hunde aber kann ich aufzählen, da lässt mich das Gedächtnis nicht im Stich.
Justus, Bång, Reppen und Blix gehörten eigentlich Vater. Skott war mein erster eigener, und mit ihm habe ich damals die kleine Schrotflinte bekommen. Wie hatte ich darauf gewartet, dass es Herbst wurde und der Welpe groß genug war, um Hasen zu spüren! Skott muss im Februar geboren worden sein, ich war damals gerade zwölf Jahre alt. Wir jagten gut zusammen, Skott und ich. Er sah im Wesentlichen wie ein Drever aus, obwohl auch ein Dackel in ihm steckte. Es muss aber noch etwas anderes beteiligt gewesen sein, denn seine Ohren standen aufrecht und kippten an der Spitze nach vorn. Mutter sagte immer, er habe so schöne, lustige Ohren.
Er wollte andauernd jagen. Quetschte sich in Baue, obwohl er dafür zu groß war. Einmal blieb er stecken, und wir versuchten, ihn auszugraben. Der Fuchs stob davon, wir erhaschten noch einen Blick auf ihn, und Vater fluchte. Die haben ja immer ihre Nebenausgänge. Skott dagegen saß fest. Wir gruben nach ihm, drangen aber nicht bis zu ihm vor, und als wir im Dunkeln nach Hause gingen, heulte ich fast. Heulte im Übrigen tatsächlich, ging hinter Vater her und wischte mir mit dem Ärmel über die Wangen.
Am nächsten Morgen stand ich zeitig auf und ging zu dem Bau. Und nach der Schule wieder. Dann schwänzte ich zwei Tage. Lag am Eingang des Baus und rief Skott zu, er solle nicht aufgeben, und grub. Vater kam mit der Brechstange und einem größeren Spaten, wir gruben Tag um Tag, trafen aber nie auf die richtige Stelle.
Schließlich kam er heraus. Nach vier Tagen drückte er sich durch dasselbe Loch, aus dem der Fuchs entwischt war. Hatte sich hinausgehungert. Er war durstig und schlapp, und Vater trug ihn nach Hause. Mutter stellte ihm den Trinknapf mit ein paar Tropfen Wasser hin. »Immer nur ein kleines bisschen!«, sagte sie. Ebenso das Fressen. Sie fürchtete, er würde sich den Magen verderben.
Ich trank meinen Kaffee, den Blick ständig auf das Moor und den Waldrand gerichtet. Immerhin gab es in dem alten Wohnwagen einen zweiflammigen Gaskocher und ein zischendes Gasheizsystem. Sonst hätte ich nicht dort sitzen können. Als ich jünger war, fror ich in der Deckung mit nichts als Fichtenreisern unterm Arsch. Damals gab es ja noch keine Daunenjacken. Großvaters alter Kutschpelz war gar nicht so dumm, aber schwer mitzuschleppen.
Als ich mit Anton Pettersons Wohnwagen nach Hause gekommen war, hatte Inga schallend gelacht. Der sehe aus wie eine Prinzesstorte, sagte sie. Anton hatte ihn grün gestrichen, um den Schimmel zu kaschieren, der sich in großen Flecken ausgebreitet hatte. Der Wagen war klein und hatte wie früher üblich ein rundes Dach; er hat mir stets gute Dienste geleistet. Ich habe ihn zu einem meiner Jagen hinaufgebracht und in der Nähe des Moors, nicht weit vom Abfuhrweg entfernt, auf einem Stück festem Boden abgestellt. Von diesem Wagen aus habe ich den großen Keiler gesehen, den ich Schwarzen Teufel nenne. Obwohl es ja heißt, dass es so weit im Norden keine Wildschweine gebe. Auch Rehe habe ich gesehen. Vorige Woche zogen, vorsichtig auf dem Harsch trippelnd, vier Stück übers Moor. Noch ist nicht sicher, dass sie den ärgsten Winter überleben.
Es geschah am Neujahrsmorgen. Eigentlich hätte ich zu Hause bleiben und Inga bei den Vorbereitungen helfen sollen. Ich hatte am zweiten Januar einen runden Geburtstag, und das Haus würde voller Leute sein. Doch ich war um fünf aufgestanden und hatte mir Proviant, die Büchse und das Fernglas bereitgelegt. Meinte, durchaus ein paar Stunden dort oben in der Stille sitzen zu können. Als ich ankam, war es noch immer dunkel. Gegen die Kälte ist der Wagen ja nur eine kleine Schale, weshalb es drinnen bitterkalt war. Zenta rollte sich dicht neben meinen Beinen zusammen. Ich wollte mir schon eine Decke über die Schultern legen, doch da zeigte sich überm Wald der erste Schimmer Tageslicht. Weil es eine Weile dauert, bis es im Wagen warm wird, konnte ich noch die Skier nehmen und nach Fährten Ausschau halten. Zenta durfte drinnen bleiben. Sie lag auf dem alten Schaffell, und ich breitete zudem die Decke über sie. Wir hatten die Abschussquote für Elchkälber noch nicht ausgeschöpft, sodass ich sie immer noch holen könnte, wenn ich auf eine Fährte träfe, und sie darauf ansetzen. Aber wollte ich das überhaupt?
Es ist verdammt seltsam, nicht zu wissen, was man will.
Draußen glitten die Skier leicht und leise durch den Neuschnee der Nacht. Am Rand des Moors stieß ich auf eine Fährte. Allerdings nicht die eines Elchs. Vorsichtig fuhr ich näher heran.
So groß! Das war mein erster Gedanke. Schließlich war es schon lange sehr kalt, weshalb es keine Hundespur sein konnte, die bei Tauwetter zerschmolzen und größer geworden war. Mit einer Zündholzschachtel nahm ich an der Spur Maß. Zwei Schachtellängen. Ergibt zehn Zentimeter. Es war die Hinterpranke.
Ein Wolf.
Als ich der Fährte folgte, sah ich, dass der Schnee sie ein Stück weiter zwischen den Bäumen besser bewahrt hatte. Da und dort waren in den Trittsiegeln deutlich die langen, kräftigen Krallen zu erkennen. Die Vorderpranke war etwas größer als zwei Schachteln. Es musste ein großer Rüde sein. Manchmal hatte er still dagesessen. Dort zeichneten sich tief der Hinterleib und die Pranken ab. Später wurde die Spur undeutlich und zertrampelt, und es sah aus, als hätte er eine gute Weile gelegen. Die Kälte bereitete ihm ja keine Probleme, so dicht, wie sein Fell mit den glatten Grannenhaaren über der Unterwolle jetzt sein musste.
Aus seinem Körperabdruck sprach Ruhe. Der Wolf hatte lange gerastet und gewusst, dass er hier nicht behelligt wurde. Den Wohnwagen hatte er selbstverständlich schon oft gesehen, falls dies denn ein Ort war, den er regelmäßig aufsuchte. Von einem Sammelplatz konnte nicht die Rede sein, weil nur er hier umhergestreift war. Für ein jagendes Rudel war schließlich gar nicht die richtige Zeit, um an einer Stelle zusammenzukommen, die auch die Welpen wiederfanden.
Dass er gerastet hatte, hätte mir etwas sagen müssen. Dennoch war ich überrascht, als ich den Kadaver entdeckte, ja geradezu aufgeregt. An den Schleifspuren im Schnee des vereisten Moors erkannte ich, dass die Beute unter die Fichten hier gezogen worden war. Was für ein vorsichtiger Jäger! Er stellte sich zum Fressen nicht draußen ins Moor, wo er zu sehen gewesen wäre.
Als ich die Schleifspur zurückverfolgte, kam ich zu der Stelle, an der er gerissen hatte. Dort machte ich Fährten von Klauen und grobe Trittsiegel von Pranken aus. Der Schnee war aufgewühlt und mit Haarbüscheln und Blut durchsetzt. Zwischen den Büscheln graubrauner Rehdecke fand ich ein langes, gelbgraues Haar mit schwarzer Spitze. Lang und starr, wie es war, stammte es sicherlich von seinem Rücken. Er musste imposant sein, wenn er das Fell sträubte. Ich bekam schließlich meine Brieftasche in der Jacke zu fassen und fummelte mit kältesteifen Fingern das Haar zwischen zwei Hunderter.
So leise ich konnte, fuhr ich auf meinen Skiern zu seiner Beute zurück. Das Skelett war schon zu sehen. Es war eine kleine Ricke, wohl eines der Rehe, die ich vor Weihnachten übers Moor hatte ziehen sehen. Darunter muss auch ein Bock gewesen sein. Ich meinte damals, durchs Fernglas kleine Rosenstöcke erkannt zu haben. Was zum Teufel macht ihr so weit im Norden, hatte ich mir gedacht. Der Schnee ist tief, und ihr müsst verhungern.
An der Beute saß immer noch Fleisch. Der Fuchs schien noch nicht da gewesen zu sein, denn ich sah keine Spuren. Ich hatte weder Kolkraben noch Krähen gehört. Hatte er den Kadaver der Ricke auch deshalb hergeschleift, um ihn zu verstecken?
Der Schlachtplatz weckte Fragen. Die wichtigste: Ist er noch hier? Rehe laufen nicht weit, wenn es nicht nötig ist, jedenfalls nicht in hohem Schnee. Natürlich waren sie jetzt tief beunruhigt. Aber sie neigen dazu, an ihren Standort zurückzukehren. Ein Jäger wie dieser Wolf wusste das vermutlich. Würde er zurückkommen? Er hatte ja noch nicht aufgefressen. Vielleicht ruhte er ja.
Da entdeckte ich, dass seine Fährte von der Stelle, an die er seine Beute geschleift hatte, noch weiterführte. Vorsichtig fuhr ich auf meinen Skiern daran entlang. Seltsamerweise war sie bald zu Ende, er war umgekehrt. Schien jedoch lange dagestanden und sich schließlich gesetzt zu haben, bevor er kehrtgemacht hatte. Was hatte er im Blick gehabt? Oder hatte er Witterung von den Rehen aufgenommen? In dem Fall wäre er nicht umgekehrt. Am Ende hatte er ausgiebig an eine zarte Kiefer gepinkelt. Aber er war umgekehrt.
Das Einzige, was man in dieser Richtung sehen konnte, war ein kleiner Hügel mit spärlichen Fichten. Ich fuhr durch den unberührten Schnee dorthin. Da entdeckte ich neue Wolfsfährten, kleinere als die seinen. Sie konnten von einer Wölfin stammen. Dort hatte, vielleicht eine ganze Weile, eine gestanden. War sie es gewesen, die er gesehen hatte?
Viele Fragen und keine Antworten.
Jetzt war es ordentlich hell geworden. Ich fuhr vorsichtig zum Wagen zurück und ging hinein. Es war nicht leicht, mit den Skiern und der Tür keinen Lärm zu machen. Doch es geschah, wenn auch natürlich nicht sofort. Ziemlich lange saß ich mit meinem Kaffee da und starrte hinaus, als ich am Rand des Moors flüchtig etwas zu sehen meinte. Ich wusste nicht, ob ich richtig gesehen hatte, und wartete lange, absolut still. Ich war mir so gut wie sicher, dass sich etwas bewegt hatte.
Um neue Augen zu bekommen (Vater hatte das immer so genannt), wandte ich für einen Moment den Blick ab und tastete nach dem Fernglas. Ich bewegte mich vorsichtig, weil Zenta nicht mitbekommen sollte, dass ich etwas gesehen hatte. Sie wäre sonst sofort hochgefahren.
Ich fixierte die Stelle, an der ich die Bewegung wahrgenommen hatte. Dabei fiel mir ein Bild ein, das in meiner Kindheit im Büro an der Wand hing. Bei Großvater im Haus war das. Auf dem Bild war ein Wald mit vielen Bäumen und dichtem Geäst, bemoosten Baumstümpfen und jeder Menge Büsche und Gestrüpp. Finde den grünen Jäger stand am unteren Rand. Man sollte genau hinsehen und versuchen, einen Jäger zu erkennen, der in diesem Wirrwarr lauerte. Er trug einen spitzen grünen Hut mit schmaler Krempe. Mal war er zu sehen, mal entzog er sich.
Finde den grauen Jäger, dachte ich jetzt. Ich wusste allerdings nicht, ob ich ihn zu Gesicht bekommen würde. Mit zunehmendem Licht hatte sich der Himmel grünlich gefärbt. Es war so unerhört, so unglaublich still. Ich saß reglos da wie ein Uhu auf einer Kiefer oder ein schneebedeckter Stein im Wald.
Der Winter gleicht manchmal einem weißen Blatt Papier oder einer bläulichen Scheibe, worauf sich schreiben lässt. Als ich zuletzt hier war, hatte niemand sich bewegt und Fährten geschrieben. Ich hatte keine Trittsiegel von Pranken oder Klauen gesehen, nicht mal eine kleine Stickerei von Wühlmausfüßen. Keine Vögel. Keine Spuren. Alles schien vom Weiß getilgt zu sein, der Wald unter den schneebeladenen Ästen war schwarz und ruhte in sich selbst. Jetzt war es anders. Ebenso still. Doch es war etwas geschehen.
Oben in Bratten gab es ein Wolfspaar, wie ich wusste. Sie müssten Welpen bekommen haben, die jetzt Jungwölfe waren. Es war jedoch weit bis dorthin, mindestens zwanzig Kilometer. Dieser Wolf hier war möglicherweise ein einsamer Stromer. Er konnte von noch weiter her gekommen sein. Auf der Jagd nach Beute. Und natürlich Paarung.
Eine knappe Stunde verging. Mittlerweile war es einigermaßen warm. Zenta hatte sich von der Decke befreit und schlief. Ich überlegte, noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Wagte es aber nicht. Wusste ich doch, dass sich drüben am Waldrand einer bewegt hatte. Einer, der sehr wachsam war.
Da kam er. Mit einer Selbstverständlichkeit, die leicht zu begreifen war: Dies war schließlich seine Welt. Er kam ein Stückchen von meiner Skispur entfernt aus dem Wald. Blieb zwischen einem Wacholder und einer Krüppelkiefer am Rand des Moors stehen. Aufmerksam äugte er über dessen kleine Schneeweite hin, wandte den Kopf so, dass ich sein Profil mit der edlen Schnauze, der steilen Stirn und den aufrechten Gehören sah.
Das Fernglas zu heben und scharf auf ihn einzustellen, erforderte große Vorsicht. Er wandte den Kopf jetzt wieder in Richtung Moor. Durch das Glas konnte ich sogar das dichte Haar in seinen Gehören und den schwarzen Rand darum herum erkennen. Seine Seher standen leicht schräg und waren sehr hell. Alles in allem machte er mit seinem Kragen aus Deckhaaren und der von den Wangen ausgehenden rauen Wolle einen imposanten Eindruck. Die Zeichnung der Wangen war weiß, lief am Hals abwärts in einer Spitze aus. Über den Sehern hatte er weißgraue Flecken. Auch darunter, doch da schob sich ein dunkler Streifen hinein.
Seine Vorderläufe waren hoch und weiß. Jedenfalls vorn. Nichts von dem Weiß an ihm war weiß wie Schnee. Eher gelblich weiß. Ansonsten war sein Fell grau mit einem Einschlag von diesem Weiß. Graubein wurde er vor Zeiten genannt, als man sich seinen eigentlichen Namen, der in Schweden Ulv lautete, nicht auszusprechen traute. Hohe Beine hatte er. Ein großer Rüde. Wie ich beim Anblick der Fährte schon vermutet hatte.
Er bewegte sich ein wenig, um den Rand des Moors abzuschnüffeln. Als wollte er sich zu der Stelle begeben, wo seine Beute lag, doch er blieb stehen, hob die Nase und schnupperte. Natürlich lag meine Witterung noch in der Luft. Ein leichter Wind kam auf, und damit erreichte sie ihn. Jetzt machte er kehrt und verzog sich zwischen die Fichten. Verschwand.
Graupfote, dachte ich. Denn so wurde er früher ja ebenfalls genannt. Und Schleicher habe ich Großmutter sagen hören. Grobkrallig und hochbeinig war er jetzt in den Wald geschlichen, fort in die Wildnis, in sein Pfotenland.
Als ich nach diesem Anblick wieder zu mir kam, merkte ich, wie steif ich vom Stillsitzen war. Ich hatte keine Ahnung, wie lange es gedauert hatte. Was ich erlebt hatte, lag jenseits aller Zeit und ihrer Messung.
Fröstelnd trank ich noch eine Tasse Kaffee, aß ein Käsebrot und gab auch Zenta eins. Dachte, wenn es hier oben Handyempfang gäbe, müsste ich wohl Inga anrufen, die bestimmt den Zettel auf dem Küchentisch entdeckt hatte. Wahrscheinlich trank sie jetzt ihren Morgenkaffee. Aber ich glaube nicht, dass ich sie angerufen hätte. Ich brauchte nach dieser Sache noch ein Weilchen meine Ruhe.
Als ich das Moor und den Moorrand abspähte, entdeckte ich kein Zeichen von Leben. Er würde nicht mehr zum Vorschein kommen. An keinem der Tage, die ich hier schon gesessen hatte, war er aufgetaucht. Ahnungslos hatte ich im Wagen gehockt, während der andere im Wald sein Leben lebte. Er war also aufs Moor hinausgezogen und hatte diese Ricke gerissen. Zumindest ein Mal hatte er davon gefressen.
An diesem Tag, der mit tiefer Kälte und Stille begonnen hatte, brach früh die Dunkelheit herein. Der Himmel graute schon, und Wolken trieben nun darüber hin. Schneeflocken stoben im scharfen Wind. Am Abend zuvor hatte ich im Wetterbericht gehört, dass viel Schnee zu erwarten sei. Nicht genug damit, dass nun alle Spuren ausgelöscht würden; wenn die Forststraßen zugeweht wurden, kam man mit dem Auto nicht mehr hierher. Das Holz, das auf dem Lagerplatz gelegen hatte, war abtransportiert. Da oben schien Schluss zu sein, und wenn nicht geräumt wurde, war mit dem Auto bis weit ins Frühjahr kein Durchkommen mehr. Hochbein würde jetzt freilich seine Ruhe haben.
Ja, in Gedanken nannte ich ihn so. Ich dachte lange über den Ausdruck nach: seine Ruhe haben. Er gefiel mir. Bevor ich fuhr, hätte ich ihn gern mit einem Stock in den Schnee geschrieben: Du wirst jetzt deine Ruhe haben, Hochbein. Eine undeutbare Schrift, die bald vom wirbelnden Schnee bedeckt wäre. Ihre Bedeutung aber wäre in seinem kräftigen Körper zu spüren, wenn der Schnee sich aufhäufte und das Moor weiß und glatt wurde. Ein unbeschriebenes Moor. Ich war schläfrig. Das kam wohl von der nachlassenden Spannung. Doch ich musste jetzt aufbrechen, bevor alles zuwehte. Als ich das Auto auf dem Abfuhrweg in Gang gebracht hatte, war es, als würde ich in eine Spitztüte voll grauem, wirbelndem Schnee fahren.
Ich hatte vor, am Abend davon zu erzählen, wenn wir nach Rapport den Fernseher ausgeschaltet hätten. Lächerlicherweise wollten die Worte aber nicht aus mir heraus. Inga schaute mich über ihr Buch hinweg an und fragte, was mich so amüsiere.
Das war ein bisschen zu viel gesagt. Ich hatte vielleicht den Mund verzogen beim Gedanken an mein Zögern, was diese schlichten Worte betraf: Ich habe einen Wolf gesehen. Als könnte der Name den Gefährlichen noch immer aus dem Wald rufen. Die Witterung der Menschen schützte ihn. Er sollte aber auch deren Worte scheuen. Doch die verstand er nicht.
Ich hätte weiß Gott gern den grauen Schatten hervorgelockt. Wenn es denn möglich gewesen wäre. Doch Hochbein war dort oben unerreichbar.
Warum, zum Kuckuck, konnte ich nicht sagen: Ich habe einen Wolf gesehen, und das Ganze aus der Welt schaffen? Ich wollte nicht. Ich wollte dieses Erlebnis zumindest ein Weilchen noch für mich allein haben.
Draußen tobte jetzt der Sturm, und irgendetwas ruckte und schepperte. Inga legte ihr Buch beiseite und schaute zu den schwarzen Fenstern.
»Die Skier«, sagte ich, um sie zu beruhigen. »Ich habe sie vom Dachgepäckträger genommen und auf die Vortreppe gestellt. Sie sind wohl umgefallen.«
»Oje«, sagte sie, »wir gehen jetzt besser ins Bett. Bestimmt gibt es bald Stromausfall. Ich stelle noch Wasser bereit.«
Da fiel mir ein Herbststurm ein, der vor langer Zeit in Norrstigen gewütet hatte. Es war im alten Haus gewesen. Nachdem das Licht ausgegangen war, saß ich mit meinen Eltern und Geschwistern im Halbdunkel und horchte auf das Krachen der umstürzenden großen Kiefern. Manchmal schlugen herunterfallende Äste gegen die Fenster, und der Wind heulte. Wir fragten uns wohl alle fünf, ob die große Fichte mit ihren federnden Wurzeln sich würde halten können. Oder würde sie aufs Haus fallen? Niemand sagte etwas. Obwohl es gefährlich war, ging Vater hinaus. Er wollte im anderen Haus nach seinen Eltern sehen. Als er zurückkam, sagte er, sie seien ins Bett gegangen. Es war erst vier Uhr nachmittags.
»Das ist doch das Einzige, was man tun kann«, hatte Großvater gesagt.
Wenn der Strom ausfiele, würde die Pumpe nicht funktionieren, also half ich Inga, Eimer und Töpfe mit Wasser zu füllen. Als ich die Tür aufmachte, um Zenta hinauszulassen, wehte Schnee herein, und ich sagte zu ihr, sie solle sich beeilen. Aber sie wollte gar nicht hinaus, und da musste sie auch nicht. Eine alte Hündin kann lange verhalten. Genau in dem Moment, als wir alle drei die Treppe hinaufstiegen, ging das Licht aus.
»Verdammter Mist«, sagte Inga, die heute eine kernigere Ausdrucksweise hatte als während ihrer Zeit im Dienst. Wir konnten im Bett nun nicht mehr lesen, und so lagen wir nebeneinander im Dunkeln und plauderten. Trotzdem sagte ich nichts von Hochbein. Nach einer Weile hörte ich, wie Ingas Atem ruhig und regelmäßig wurde. Sie war eingeschlafen.
Vielleicht würde ich trotz des Sturmgetoses auch bald wegdösen. Wie immer kurz vor dem Einschlafen schweiften die Gedanken launenhaft umher. Dass mein Name Ulf lautet, würde einem Wolf nichts bedeuten, dachte ich. Nicht mal einem alten Gråhund bedeutete er etwas. Für Zenta war ich das Herrchen. Sie wusste allerdings genau, wen Inga meinte, wenn sie Uffe sagte. Dann hob die Hündin den Kopf und sah mich an. Das kam vor.
Es wogt mein Leben, wird bewegt eine Zeit. Diese Worte hörte ich schon ziemlich lange in meinem Innern. Seit ich wegen meiner Brustenge zuletzt beim Arzt gewesen war, sangen oder leierten sie mir durch den Kopf. Ich hatte keine Ahnung, woher sie stammten. Vielleicht aus einem alten Buch von Vater. Als ich Inga davon erzählte, gab sie die Worte natürlich im Internet ein. Das Ergebnis war eine Enttäuschung, denn im weiteren Verlauf wurde das Gedicht schlechter: im schwellenden Beben bei der Winde Streit. Das war nicht sonderlich gelungen. Die erste Zeile gefiel mir aber nach wie vor: Es wogt mein Leben, wird bewegt eine Zeit. Das brachte mich auf den Gedanken, dass ich lebe, solang sich etwas bewegt.
Selbstverständlich wird sich weiterhin alles bewegen, auch wenn man selbst es nicht mehr tut. Das ist bloß schwer zu begreifen. Würden zum Beispiel die Geranien am Fenster weiterwachsen und in der Frühlingssonne austreiben und blühen? Vorausgesetzt natürlich, Inga vergaß nicht, sie zu gießen. Würde sie sie gießen, wenn ich starb?
Ich war jetzt hellwach und sah ein, dass man so nicht denken kann. Dann spürte ich ein Stechen in den Beinen und wusste, dass ich sie mir erfroren hatte. Jetzt war es aus mit dem Schlaf.
Ja du, Hochbein. So dachte ich. Als wären wir miteinander verbunden. Dem war aber nicht so. Die Sache war einseitig. Wie mit Gott.
Meine Gedanken kreisten. Ihnen nahekommen. Sie sehen. Nur sehen. Solang sich etwas bewegt. So hatte ich gedacht, bevor ich ihn sah.
Eigentlich war es seltsam, ihn überhaupt irgendwie zu nennen. Doch wir Menschen wollen nun mal Namen geben und Unterscheidungen treffen. Und sei es nur Fahrradlenker für einen Elchspießer mit zwei langen Stangen oder Schwarzer Teufel für den schweren Keiler.
Hochbein wusste nichts von seinem Namen. Im Rudel war er sein Geruch und seine imposante Gestalt. Oder zumindest seine hohen weißen Läufe? Ohne Worte natürlich.
Hatte er ein Rudel? Vielleicht streifte er auch bloß ruhelos nach Beute und Paarung umher, ein einsamer Wanderer, der bereits weitergezogen war. Dann war es sinnlos herumzusitzen und zu warten, und dann konnte es mir auch egal sein, dass der Abfuhrweg zugeweht war. Mit dem Schneemobil würde man schon noch hinaufkommen.
Hätte ich heute Morgen meine Kamera mitnehmen sollen? Sie war zu Hause geblieben, und nachdem ich jetzt reichlich Zeit zum Nachdenken gehabt hatte, war ich zu dem Schluss gelangt, dass es schon genug Bilder gab. Sehen die Leute überhaupt etwas in der Wirklichkeit?
Auch mit Worten an ihn heranzukommen war schwierig. Es war, als ob ich mich nicht recht traute. Im Übrigen ist es nicht leicht, ein Lebewesen zu beschreiben. Ihm einen Namen zu geben war wohl der Versuch, mich anzunähern und mit ihm in Beziehung zu treten. Einseitig natürlich, immer einseitig. Man kann ihnen mit Worten nicht beikommen. Überall sonst können Worte fürchterliche Macht haben. Aber nicht über sie.
Dass ich mich irrte, wurde mir in dem Moment klar, als ich dies gedacht hatte. Unsere Worte haben tödliche Macht über sie, Wort und Buchstabe des Gesetzes: Die Lizenzjagd beginnt am zweiten Januar.
Er läuft. Der Harsch ist dünn und bricht so leicht, dass er die Läufe nicht verletzt. Er flieht jetzt. Der dicht fallende Schnee und die Dunkelheit lösen allmählich alles um ihn herum auf, seine Muskeln erschlaffen.
So kann man es sehen. Dass er lange liegt und in Unwissenheit versinkt. Die steifen, leicht beweglichen Gehöre wachen für ihn, denn unter dem dumpfen Vergessen des Halbschlafs schlummert die Erinnerung an die Witterung. Sie kann aufgerührt werden und Form annehmen. Der Schnee stiebt und dringt zwischen die nadeligen Fransen.
Er weiß, was eine Fichte ist, hat aber kein Wort dafür. Weiß, dass die großen, alten Fichten Schutz bieten. Er steht auf und streckt die Vorderläufe, und als Leben in ihnen ist, streckt er nacheinander die Hinterläufe und dehnt sie. Manchmal verspürt er wohl Lust, diejenigen zu rufen, die er verlassen hat, als er zum Stromer wurde. Mehr, als dass er den Hals reckt, wird aber nicht daraus. Das Maul öffnet sich nicht, denn die Wachsamkeit gewinnt wieder die Oberhand.
Wenn er nun aufwacht und eine Witterung aufnimmt, die in den Leisten Widerhall findet! Eine Wölfin. Sie, von der auf dem kleinen Hügel Fährten waren. Das Schneegestöber löscht das schwache Bild sogleich aus. Als sie sich aber erneut zwischen den Fichten zeigt, läuft er ihr nach. Der gute, satte Geruch der Wölfin wird immer stärker, und ebenso die Unruhe in seinen Leisten.