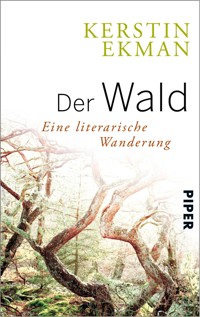5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schweden zu Beginn der Gründerzeit: Am Ende des 19. Jahrhunderts dringt die neue Zeit auch in die hintersten Winkel des Landes, dorthin, wo Tora Lans in ärmlichsten Verhältnissen zur Welt kommt. Ihr Leben als Dienstmädchen scheint ebenso vorherbestimmt wie das ihrer Mutter Edla und der Großmutter Sara, bei der Tora nach dem Tod der Mutter aufwächst. Doch das erwachende Selbstvertrauen und der trotzige Lebenswille des jungen Mädchens helfen ihr, sich gegen ein Schicksal in Armut und Abhängigkeit aufzulehnen. – »Der Roman ist kein Elendspanorama, denn Kerstin Ekman setzt auf Ironie und Humor. Immer bleibt Spannung und Leselust erhalten.« (taz)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Anna Sofia Hjorth
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2002
ISBN 978-3-492-95765-6
© 1974 Kerstin Ekman Titel der schwedischen Originalausgabe: »Häxringarna«, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 1974 Deutschsprachige Ausgabe: © 2002 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Neuer Malik Verlag, Kiel 1998 Umschlaggestaltung: Dorkenwald Design, München Umschlagfoto: Thor Jorgen Udvang / Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Das war Sara Sabina Lans: Grau wie eine Maus, arm wie eine Laus, schlottrig und mager wie eine Füchsin im Sommer. Niemand nannte sie bei ihrem Vornamen. Er war nicht sehr oft zu Hause. Er hatte seine Abkommandierungen und Regimentstreffen auf Malmahed, und er exerzierte in der Korporalschaft auf Fyrö, ein Fasanengockel in seiner Uniform. Sie hatte die Kinder und die Kate mit dem Kartoffelacker, jene Kate, die mit den Jahren fast vom Flieder erdrückt wurde, in der es aber kein Glück gab, zumindest nicht bis 1884, als der Zug dem Soldaten Lans die Beine abfuhr.
Sie räucherte Schinken für die Bauern. Das war ihre sauberste Arbeit. Ansonsten gab es nichts noch so Grobes, Kotiges und Matschiges, dessen sie sich nicht angenommen hätte. Sie schrubbte Ställe im Frühjahr. Sie machte große Wäsche und half beim Schlachten. Sie wusch Leichen. Ihr ganzes Leben lang war sie hinter Überbleibseln und günstigen Gelegenheiten her. Sie war zäh wie Gras und giftig wie Nesseln. Ihr Grabstein findet sich auf dem Kirchhof von Vallmsta. Darauf steht:
Hier ruht der Soldat Nr.27
der Rotte von Skebo
Johannes Lans
* 29.Juli 1833 † 12.Juni 1902
und seine Ehefrau
Eines Tages zu Beginn der siebziger Jahre ging Sara Sabina Lans, die Frau des Soldaten, zu Isakssons Laden und Gasthaus, um dort Kümmel zu verkaufen. Es war an einem Septembernachmittag in Sörmland, als sie sich aufmachte. Die Sonne stand bereits so tief, daß ihre Strahlen von den Spiegelscherben, die gegen den Nachtmahr im Stallfenster lagen, reflektiert wurden. Der Liebstöckel an der Hausecke war verblüht und roch nicht mehr so widerlich. Die Bäume verfärbten sich schon, alle, außer der großen Birke, unter die sich die Hütte duckte. Sie verlor selten ein Blatt vor Allerheiligen. Das kam daher, daß unter ihrer Wurzel eine weiße Schlange lebte.
Im großen Moor zwischen Äppelrik und Jettersberg sprang die Frau des Soldaten von Stein zu Stein, einen Kissenbezug mit frischgedroschenem Kümmel im Arm. Hinter ihr ging Frans, der bald darauf Halsweh bekam und im Winter, der diesem ungewöhnlich späten und milden Herbst folgte, starb. Hinter ihnen hüpfte Edla.
Es war ein klarer und sonniger Tag, doch unter den Erlen im Moor wehte es kühl, und aus den schwarzen, glänzenden Löchern roch es sauer nach fauligem Wasser. Frans fand es schrecklich, sich umzusehen, und noch schlimmer, nach vorne zu schauen, denn seine Mutter hatte die Röcke hochgerafft und am Schürzenband festgemacht. Wenn sie sprang, konnte er ihre dünnen, knotigen Beine bis zu den Schenkeln hinauf sehen. Sie waren weiß wie die einer Leiche und über und über von dem Geschlängel bläulicher Adern durchzogen. Edla kam als letzte; sie hatte Mühe mit ihren kurzen Beinen, von einem Stein zum nächsten zu gelangen.
Dies war der direkteste Weg zur Bahnstation. Dorthin war Isaksson aus Backe gleich nach der Einweihung der Eisenbahn mit seiner Frau, dem Ladenburschen und zwei Dienstmädchen gezogen. Er hatte vor, seinen ganzen Betrieb vom alten Gerichtsplatz herzuholen, und in seinem Stall standen bereits zwölf Kutschpferde. Mehrere Jahre lang hatten die Bahngleise zwischen Stockholm und Göteborg dagelegen, ohne daß sie gestohlen worden waren. Nun war es nicht mehr lange hin bis zum fünften Jahrestag der Einweihung, die mit knatternden Fahnen und furzenden Hörnern und mit einer den Eisenbahnwaggons entstiegenen, lächelnden und steifbeinigen Königlichen Hoheit begangen worden war. Der bedächtige schwedische Arbeiter hatte sich an jenes Mittelmaß gewöhnen können, das zur Bedienung der Eisenbahn erforderlich ist, im großen und ganzen jedenfalls. An dieser Bahnstation, der bei der Einweihung elf Minuten königlicher Anwesenheit zuteil geworden war und die gut einhundertzwanzig Kilometer von Stockholm entfernt und siebenundzwanzig Meter über dem Meer lag, stand bereits eine Viertelstunde vor Ankunft des Zuges der Pumper Oskar Edvin Johansson, die Mütze auf dem Kopf und die Knopfreihe des Uniformrockes von oben bis unten zugeknöpft, mit gefülltem Wasserbehälter und glänzenden Ölkannen in der ersten kühlen Herbstsonne.
Das Bahnhofsgebäude stand auf sumpfigem Grund zwischen zwei schilfreichen Seen. Die Landschaft war eben, und die Bäume, die aus dem wäßrigen Boden emporragten, rangen um ihr Leben. Der Elch fühlte sich wohl hier. In unmittelbarer Umgebung lagen drei Höfe: Jettersberg, Löskebo und Malstugan, eine 99-Jahre-Pachtung des Stammgutes.
Vor Isakssons Laden standen drei Wagen, ein Phaeton und zwei Ackerwagen, einer davon mit Roggensäcken beladen. Zwei Bauern und ein Jungbauer standen drinnen bei Isaksson und unterhielten sich gemächlich. Der Jungbauer hatte die Peitsche nicht in das Futteral am Kutschbock gesteckt, sondern mit hineingenommen. Die Peitschenschnur ließ er über der Siruptonne kreisen, wo zwei Fliegen tanzten. Er sah Sara Sabina Lans als erster aus dem Wäldchen am Rand des Moores kommen. Er sagte, daß dort das widerwärtige und knickrige Weib des Soldaten komme, hol’s der Teufel. Er wollte ausspucken, stand aber zu weit vom Napf weg und traute sich nicht. Breitbeinig, doch unsicher stand er da in dieser Gesellschaft und spielte mit der Peitsche.
»Ja, knickrig«, bestätigte Malstuger, der dem Fenster am nächsten stand, und beobachtete die Frau, wie sie mit dem gestreiften Kissenbezug vor der Brust und den zwei Kindern im Schlepp vom Moor heraufkam. »Se hat bloß nix, womit se knickern könnt.«
»Wenn se aber was zu fassen kriegt«, meinte Abraham Krona, »is se wie ’ne Füchsin. Die läßt nix los.«
Sie lachten.
Draußen lief Edla hinter der Mutter und Frans her und spürte den Schweiß auf ihrem Rücken. Die Mutter entzog sich jetzt dem Blickfeld des Ladens. Sie ging nicht beiseite, um wie die anderen Leute die Schuhe zu wechseln, denn sie besaß nur das eine Paar. Doch sie wechselte das Kopftuch und putzte den Kindern die Nasen.
In diesem Augenblick fuhr der Zug ein, und Edla glaubte, dies sei das Ende. Sie glaubte, dies sei der Tod, der von einem hohen Berg herabgestürzt komme. Sie war noch nie zuvor am Bahnhof gewesen. Jetzt kreischte sie los wie eine Signalpfeife. Die Mutter mußte ihr einen Arm um den Rücken legen und sie mit der anderen Hand tätscheln. Auch Frans wurde etwas blaß, doch sobald das erste schrille Getöse vorüber war, lachte er. Es gab noch eine Menge Geräusche, ehe alles in ein gleichmäßiges, kurzen Ächzen überging. Als würde da ein Riese sitzen und sein Geschäft machen, fuhr es Edla durch den Kopf, und sie schnappte glucksend nach Luft.
Dann stand der Zug. Quietschend ging ein Klappgitter auf, und ein junger Mann in einer Uniform aus dunkelblauem Tuch und einer Mütze mit Goldlitze und geflügeltem Rad ergriff zwei Reisetaschen und stieg aus. Er sah sich um. Es war eben und sumpfig hier. Der glänzende Schienenstrang verlor sich in einem kümmerlichen Kiefern- und Birkenwäldchen. Zögernd hob er die Hand zum Gruß, den der Stationsvorsteher am Ende des hölzernen Bahnsteigs erwiderte. Nachdem dieser begriffen hatte, daß da soeben der neue Buchhalter angekommen war, ging er ihm entgegen.
Stationsbuchhalter und Freiherr Graf Adolf Cederfalk betrachtete das gelbe Bahnhofsgebäude, dessen Giebelseite von herbstlich dunklem Geißblatt überwuchert war. In einem Fenster erschien kurz ein schwarzglänzender Kopf mit Mittelscheitel. Das war die Frau Stationsvorsteher. Nach einer Weile, wenn ihr Mann dem Zug freie Fahrt gegeben haben würde, würde sie die Katze hinauslassen. Der Septemberhimmel war blau, als Cederfalk hinaufblickte. Siebenundzwanzig Meter über dem Meer. Das ist nicht viel, dachte er genau in dem Moment, da er seinen neuen Vorgesetzten mit einem kräftigen Handschlag begrüßte.
Während er darauf wartete, daß der andere die Signalscheibe in Richtung Lok heben würde, ging er um das Bahnhofsgebäude herum. Der dunkle Scheitel der Frau tauchte in einem Fenster nach dem anderen um das ganze Haus herum kurz auf. Auf dessen Rückseite nahm man den Geruch des Steinkohlerauchs und des fetten Schmieröls nicht wahr. Dort lag der holprige Platz mit den Kühen von Jettersberg, die jetzt bis an das Gattertor herangekommen waren und ihn anglotzten. Und dort stand auch das Haus des Gastwirts mit den drei Wagen davor. Am Querbaum dösten die Pferde mit den Zügeln um die Vorderbeine. Das von Malstuger hatte einen Futtersack um. Ein Weilchen war es in der kühlen Septemberluft so still, daß Cederfalk hören konnte, wie das Tier den Hafer zwischen den Zähnen zermalmte. Drei Männer traten nun auf die Treppe vor dem Laden, spuckten Tabak aus und guckten. Sie drängelten sich ein wenig; hinter ihnen in der Tür stand der Händler. In einem Fliedergebüsch neben dem Gasthaus stand ein graues Weiblein und putzte einem Kind mit dem Ärmel die Nase. Ein zweites Kind klammerte sich an den Rock der Alten und starrte laut schluchzend dem abfahrenden Zug nach. Cederfalk machte nun kehrt und ging zum Bahnhofsgebäude zurück. Auf der Treppe war man mit dem Ausspucken fertig, und Sara Sabina Lans ging hinter den Männern in den Laden hinein. Sie öffnete ihren Kissenbezug, zeigte den Kümmel und verlangte im Tausch dafür Salz, Soda, Kaffee und Brasilholz.
Es heißt, daß Genügsamkeit der wahre Reichtum derer sei, die ständig Armut und Mangel zu Gast hätten, doch die Frau des Soldaten besaß diese Tugend nicht. Sie war vielmehr überall für ihre Beharrlichkeit und Gier bekannt. Isaksson drehte die Handflächen nach oben und erklärte, daß sie unverschämt sei. Doch die Frau gab nicht nach, und die Männer suchten zwischen Tonnen und Fäßchen nach Sitzplätzen, denn nun versprach es hier unterhaltsam zu werden. Sie hatte ein loses Mundwerk, wenn man sie reizte, und konnte dann mit ganzen Tiraden grober Flüche loslegen.
Dieses mal jedoch blieb sie ruhig und meinte, daß Isaksson ihr, wenn der Kümmel abgewogen sei, Salz, Soda und Kaffee nach gemeinsamen Berechnungen geben könne. Das Brasilholz wolle sie dagegen umsonst haben. Er habe sie das letzte Mal geprellt. Als sie es zum Färben der Kettfäden für einen Teppich hernehmen wollte, sei es ihr recht leicht vorgekommen, und sie habe es auf der Küchenwaage nachgewogen. Und richtig, es hätten eineinhalb Pfund gefehlt.
Isaksson setzte ihr auseinander, was es mit dem Brasilholz auf sich habe. Nach dem Wiegen trockne es und verliere an Gewicht. Es müsse ausgeschüttet, eingeweicht, mit frischem Brasilholz aus dem Faß gemischt, ausgepreßt und wieder gewogen werden. Er rief den Ladenburschen herein, der die Sache bestätigen sollte. Das Weib schien endlich nachzugeben, verlangte dann aber ein Pfund der billigsten Kissenfüllung, und als der Junge, nachdem er im Magazin das Seegras abgewogen hatte, struppig wie eine nasse Katze zurückkam, war er überzeugt, daß sie sich nur hatte rächen wollen.
Jetzt ließ Isaksson den Kümmel durch die Finger rieseln und prüfte ihn mit übertriebener Sorgfalt. Er gab ihr zu verstehen, daß er dazwischen sowohl Insekten als auch Steinchen gefunden habe. Doch das Weib ließ sich auch damit nicht aus der Ruhe bringen.
»Die gibt nicht nach«, meinte Malstuger lächelnd, als Isaksson die verlangten Waren abzuwiegen begann.
»Nicht einen Zoll«, setzte der Jungbauer aus Löskebo nach. Abraham Krona stand bei der Tür und drehte und wendete eine gegerbte Ochsenhaut, die ihm Isaksson mit der Hakenstange von der Decke heruntergeholt hatte. Er wollte Sohlenleder kaufen. Krona war ein gutmütiger und begriffsstutziger Kerl, Malstuger das genaue Gegenteil von ihm.
»Ist es wahr, daß du nichts losläßt, was du zu fassen kriegst?« fragte er.
Die Frau schwieg und sah nicht zu ihm hin.
»Krona behauptet das. Sie ist wie eine Füchsin, hat er vorhin gesagt. Se läßt nix los, wenn se mal zubissn hat.«
Jetzt blickte die Frau den Soldaten Krona, der recht verlegen schien, scharf an.
»Das wollen wir doch mal sehen«, stichelte Mastuger. »Sie soll sich mit dir um das Sohlenleder reißen, Krona. Sie kann’s ja wohl behalten, wenn se’s schafft, daß du losläßt.«
»Freilich kann se das«, sagte Krona und hielt ihr das Lederstück hin, das sich die Frau so schnell krallte, daß sie alle vier in Gelächter ausbrachen.
»Nein, nein, Alte«, sagte Malstuger. »Zubeißen sollst du.«
Sie sah im Laden umher, sah Isaksson an und den feixenden jungen Mann aus Löskebo, die Kinder, die eng beieinander neben der Siruptonne standen, und die Frau Isakssons, die durch die Tür, die zum Schankraum führte, hereinschaute. Dann drehte sie sich zu Krona um, der ihr in Höhe seines dicken Wanstes das Sohlenleder hinstreckte, ging in die Hocke und schlug die Zähne in das Leder.
Er war natürlich stärker als sie und begann sie sogleich zum allergrößten Vergnügen der Umstehenden auf dem Fußboden herumzuzerren. Sogar Isakssons unleidliche Frau, die selten den Mund zu einem Lächeln verzog, schnaubte amüsiert durch die Nase, und Malstuger schlug sich auf die Schenkel, wedelte mit seinem Lendenschurz und tanzte um die beiden, die in immer größeren Kreisen zwischen den Fäßchen herumwirbelten. Das Weib gab Laute von sich. Es klang, als knurrte sie vor Wut und Anstrengung. Krona lachte und ruckte mit dem, Leder. Er ruckte mehrmals heftig während dieses Tanzes, doch die Alte folgte dieser Bewegung und ließ nicht los. Ihr entwichen Winde, da sie so zusammengekrümmt war, und bei jedem Furz rief der junge Löskebo: »Salut!« Neben der Siruptonne drückten sich Edla und Frans aneinander und weinten vor Scham.
Jetzt begann Krona allen Ernstes Gefallen daran zu finden, daß sie nicht losließ. Seine großen Hände hielten die Ochsenhaut ordentlich fest, und er schwang sie derartig heftig herum, daß ihre Stiefel auf dem Fußboden nur so schmetterten bei den schnellen Schritten, die sie machen mußte, während er nicht mehr zu tun brauchte, als dazustehen und sie herumzuziehen.
»Die gibt nie nach!« rief Malstuger, und es schien, als hätten sich ihre Zähne im Leder festgebissen. Es an sich zu reißen, würde sie nicht schaffen, die Frage war, ob er sie dazu bringen konnte loszulassen. Krona trat der Schweiß in den Nacken, und jedes Mal, wenn er mit dem Leder ruckte, ächzte er. Der Kampf erreichte jetzt ein neues Stadium, und die Zuschauer verstummten, als Krona versuchte, das Leder dem Kiefer der Frau zu entreißen. Sie ging jedoch bei jedem Ruck mit und ließ auch nicht los, als sie mit ihren schiefgetretenen Stiefeln ausglitt und über den Fußboden rutschte. Es wurde Krona schließlich zum Verhängnis, daß Malstuger in seinem Eifer, mit dem er den Kampf verfolgte, versehentlich neben den Napf gespuckt hatte. Krona glitt jetzt in der Tabaksplempe aus und stürzte hintenüber. Im Fallen schlug er mit dem Kopf gegen ein frisch geöffnetes Seifenfäßchen, ließ das Leder los und war für eine Weile bewußtlos.
»Dacht ich mir’s doch, daß das für irgend jemand dumm ausgehen wird«, schimpfte die Wirtsfrau und stürzte zum Schöpfeimer. Die Lans aber schlug geschwind die Arme um das Sohlenleder und lief rückwärts zur Tür. Als sie es jedoch aus dem Mund nehmen wollte, hatten sich ihre Kiefer verrenkt. Schließlich bekam sie das Leder doch wieder heraus, und ihr Mund sah wieder aus wie ehedem. Wie eine Vogelscheuche huschte sie mit dem Stück Leder im Arm zur Tür hinaus. Frans und Edla ergriffen die Tüten mit dem Salz, dem Soda und dem Kaffee und rannten der Mutter nach.
Der 6.06er war abgefahren, und der neue Stationsbuchhalter hatte bei Stationsvorsteher Hedberg zu Abend gegessen. Jetzt spazierten Hedbergs Tochter Malvina und Postmeisters Charlotte eng umschlungen an der Bahn entlang nach Westen, wo die Sonne im Kiefernwald versank. Sie gingen nicht ganz so weit wie sonst, denn bei Postmeisters erwartete man den Freiherrn Cederfalk, der seine Aufwartung machen wollte, und Frau Postmeister hatte ihre Tochter angewiesen, beizeiten nach Hause zu kommen, damit sie sich noch ein wenig ausruhen könne und nicht mit gar so roten Wangen hereinkomme.
An diesem Abend ging auch Sara Sabina Lans an den Schienen entlang, denn in dem Erlengebüsch im Moor wäre sie mit dem riesigen Sohlenlederstück nur schwer vorangekommen. Mit Frans und Edla, die die Tüten trugen, ging sie dahin, und sie sahen Schellenten auffliegen und die Sonne mächtig und diesigrot über dem Vallmarsee stehen. Da brachte der 7.43er von Göteborg die Gleise zum Dröhnen, und sie mußten schleunigst vom Bahndamm herunter.
Von Edla gibt es ein Bild. Doch wie soll man ein Gesicht beschreiben? Ist es schmal oder breit? Liegen die Augen weit auseinander? Ist der Mund ungewöhnlich klein oder nur fest zusammengekniffen? Je vertrauter ein Gesicht wird, desto schwieriger ist es, etwas darüber zu erzählen. Man erinnert sich daran, als habe man es in einem Traum gesehen, und hinterher kann man unmöglich sagen, wie es ausgesehen hat. Doch die eigentliche Botschaft des Gesichts ist sein Ausdruck, und der ist nicht auszulöschen.
Edlas Gesicht, das Gesicht einer Dreizehnjährigen mit sehr straff nach oben gekämmtem Haar, hat einen ernsten Ausdruck.
Das Bild wurde an einem Markttag im Mai 1876 in der neuen Ortschaft an der Bahnstation aufgenommen. Es ist schwer zu sagen, mit welchen Erwartungen Edla an diesem Vormittag dorthin kam und hinter dem Gasthaus die Schuhe wechselte, bevor sie über die Gleise auf den Marktplatz ging.
»Da gibt’s ’nen Leierkasten und Klamauk«, erzählte Lans. »Da kann man Bären sehn, die tanzn, und einmal hab’ ich da ’n Mensch Harfe spieln sehn.«
Es war jedoch kein großer Markt, nicht so einer, wie er früher jedes Jahr auf dem Gerichtsplatz in Backe abgehalten worden war. Edla wollte nicht ganz bis zu den Tieren hinuntergehen, weil sie fürchtete, die Schuhe der Mutter mit Mist zu beschmutzen. An den Ständen des Korbstuhlmachers und des Kupferschmieds ging sie achtlos vorbei. Als ein altes Weiblein mit schwarzen Krallen hinter Lans herrief, daß sie Butter und Honig zu verkaufen habe, antwortete Edla würdevoll:
»Wir buttern selber.«
Der Uhrenjude hatte seidene Kopftücher ausgebreitet und bot auch mit Blumen bemalte Brauttruhen feil, Edla beachtete sie jedoch kaum. Am Stand des Blechschmieds dagegen blieb sie lange stehen und betrachtete die wenigen Spielsachen.
Ein Fotograf aus Stockholm tat auf einem Schild kund, daß er von den Leuten fotografische Porträtbilder aufnehme. Man brauche nicht mehr als die Hälfte dessen zu bezahlen, was es in der Hauptstadt koste. Zu ihm ging Lans mit seiner Tochter Edla und ließ ein Porträt von ihr machen. Die Mutter, die für einen Marktbesuch keine Kleider hatte, war zu Hause geblieben und konnte die Fotografiererei nicht verhindern.
Edlas Bild ist fahl braungelb, und das Gesicht verblaßt immer noch. Das karierte Muster des Kleiderstoffs ist noch am deutlichsten zu sehen. Doch der ernste Ausdruck ihres Gesichts hat sich erhalten.
Ja glaubst du denn, ich will deine Tochter in meiner Küch haben, du Misttrampel!« versetzte die Wirtsfrau, als Sara Sabina Lans sie nach einer Dienstmädchenstelle für Edla fragte. Da schrieb der Soldat einen Brief an Isaksson.
Bei dem Kaufmann und Gastwirth Isaksson möchte ich ergebenst nachsuchen, daß meine Tochter Edla die bei Euch in der Gastwirthschaft freigewordene Dienstbotenstelle möge antreten dürfen und füge in der gleichen Ergebenheit ihren Taufschein bei.
Äppelrik, den 10.Juni 1876
Johannes Lans
Soldat in der Rotte
Nr.27Skebo
Der Gastwirt stellte Edla ein, allerdings nicht als richtiges Dienstmädchen, da sie erst dreizehneinhalb Jahre alt und noch nicht eingesegnet war. Aber sie konnte gegen freie Kost als Kindermädchen arbeiten.
Braunfleckig wie eine alte Landvermesserkarte machte der Brief des Soldaten in der Wirtsstube die Runde. Der Gastwirt stellte Edla vor und sagte, sie sei das Kindermädchen, das er wie einen Stationsvorsteher oder Pastor auf eine schriftliche Bewerbung hin in Dienst genommen habe. Mit Tränen der Scham und des Verdrusses in den Augen schlich Edla wieder hinaus, hörte aber durch die Küchentür, wie die Bauern lachten, als Isaksson den Brief vorlas.
Sie hatte schon gleich nach Mittsommer anfangen können und war an einem Abend gekommen, der so gewitterschwül und dunkel war, daß man am Küchentisch, wo die Fuhrknechte mit dem Gastwirt zusammen beim Abendbrot saßen, kaum noch Tageslicht hatte.
Als sie eintrat, briet die Wirtsfrau gerade Speck. Hanna und Ida, die beiden Dienstmädchen, standen daneben und aßen. Hanna hatte, um Halt zu finden, ihren runden Hintern auf die Holzkiste gestützt. Als Edla kam, nahm sie den Teller in die linke Hand und streckte ihr die rechte entgegen. Ida, das große Dienstmädchen, tat es ihr gleich, ihre Hand war groß und kantig wie die eines Mannsbilds. Die Männer am Tisch traute sich Edla nicht zu begrüßen. In der Nähe der Speisekammertür erblickte sie einen halbwüchsigen Jungen, doch sie schaute ihn nur aus den Augenwinkeln an und tat, als sähe sie ihn nicht. In der Ofenecke saß eine alte Frau, und in dem Moment, da Edla ihr die Hand reichen wollte, sagte die Wirtsfrau, daß sie ihr Brotkanten zurechtschneiden könne. Edla verstand, daß Skur-Ärna, die sie jetzt in der alten Frau wiedererkannte, keine Person war, um die man sich groß kümmerte. Sie war nun schon so alt, daß sie sich nicht mehr hinknien konnte, obwohl sie noch vor einem Jahr nach den Markttagen den Klubraum und die Wirtsstube gescheuert hatte. Jetzt kam sie weiterhin jeden Tag zu den Wirtsleuten und versuchte, irgendwelche Arbeiten zu finden. Sie spaltete Scheite, obgleich niemand sie darum bat, scheuchte die Katze hinaus, wenn es ans Backen ging, und rührte den Kümmel in der Kiste um, damit er nicht zu warm wurde und zu brennen anfing. Sie war der Ansicht, daß ihr für diese Dienste eine Mahlzeit zustand, und so kam sie zur Winterszeit immerhin in den Genuß der Ofenwärme.
»Du bist ja noch gar nicht ausg’wachsn, wie willst’n das alles schaffn«, lamentierte sie zu Edla, warf jedoch unablässig kurze, schnelle Blicke auf Frau Isaksson, die dazwischenfuhr: »Jetzt is der Wirt mit’m Essen fertig, du kannst jetzt also Aron vom Flur reinholn.«
Edla war verwirrt, doch Hanna zeigte ihr stumm, da sie den Mund voll hatte, daß die Küche zwei Ausgänge hatte, und schließlich fand sie auch den Jungen, dessen Kindermädchen sie nun sein würde, in einem zugigen Flur. Er saß auf dem Topf und verrichtete sein Geschäft. Er sagte kein Wort, und sie war nicht sicher, ob er überhaupt schon groß genug war, um sprechen zu können. Sie vermochte ihn nicht hochzuheben, dick wie der Junge war. Er starrte sie unter fast weißen Augenbrauen an. Als er aber von drinnen den Zug der Ofenwärme spürte, stand er von selbst auf und ging hinein. In dem weißen, noppigen Fleisch am Hintern hatte er einen roten Rand vom Topf.
»Jetzt kannst die Brotkanten zurechtschneiden und hier hineinbrockn«, sagte die Wirtsfrau und rüttelte die Bratpfanne, in der sie das Schmalz der Speckscheiben ausgelassen hatte. Was Edla da tun mußte, war ihr ganz und gar fremd, machte ihr aber deutlich, daß das Essen der beste Teil ihrer Arbeit sein würde. Sie mußte die schimmligen Stellen aus dem Brot schneiden und in den Schweinekübel werfen. Dann sollten die Brotstücke scheibchenweise in das Schweineschmalz geschnitten werden. Die Gastwirtin ließ das Ganze ein wenig ziehen, bevor sie ein paar Tropfen Milch dazugoß und einkochen ließ. Schließlich wurde die Pfanne auf den Tisch gestellt, ohne daß der Speck vorher herausgenommen wurde.
Hinterher wusch Hanna ab, während das Kind, das noch immer keinen Ton von sich gegeben hatte, wie angewachsen auf seinem Pott saß. Edla trocknete das Blechgeschirr mit einem Scheuerlappen, der als Handtuch diente, und das Porzellan der Wirtsleute mit einem fadenscheinig gewordenen Leinenhandtuch. Sie fürchtete ständig, etwas falsch zu machen, etwa mit dem Handtuch den rußigen Boden einer Pfanne zu berühren oder das Leinen mit einer Messerschneide zu durchtrennen. Skur-Ärna warnte sie vor allem möglichen, was passieren könnte, während die Gastwirtin kein Wort sagte. Sie lief hin und her durch die Tür zum Schankraum mit den Tellern mit scharf gebratenen Spiegeleiern und Bratwurstscheiben, nach denen der Gastwirt verlangte.
Das Gasthaus war sehr groß. Es konnte in keinerlei Hinsicht mit einer Soldatenkate verglichen werden. Selbst hier drinnen im Dunkel der Küche spürte und hörte sie dessen Größe um sich herum. Als die vier Fuhrknechte und der Junge die Tür öffneten und gingen, roch man den Kohlenrauch der Rangierlok, und ihr schrilles Pfeifen drang ungehindert in die Wärme herein und erschreckte Edla. Allmählich wurde es von der Bahn her ruhiger. Auch der Gastwirt rief nichts mehr durch die Tür. Schließlich hängte Hanna die Blechschüssel an ihren Haken und sagte, während sie laut gähnte: »Jetzt is doch noch Abend wordn. Gott sei Dank aber auch.«
Ida war merkwürdigerweise zur selben Zeit wie die Fuhrknechte gegangen, doch Skur-Ärna, die noch immer in der Ofenecke saß, wisperte Edla, die ihr dabei so nahe kommen mußte, daß sie den sauren Atem aus ihrem Mund roch, zu, daß dieses Mädchen so schmutzig sei, daß man es in der Küche nicht brauchen könne. Aber ein Arbeitstier sei sie, das ärgste, das man sich vorstellen könne. In der Landwirtschaft des Gastwirts arbeite sie wie ein Mannsbild. Und darum habe sie auch das Privileg, zur selben Zeit wie die Männer Feierabend zu machen. Obwohl das eigentlich mit ihrer Schmutzigkeit zusammenhänge. »Und die andere«, flüsterte Skur-Ärna und sah dem gestreiften, blauen Rock nach, der auf der Bodentreppe verschwand, »die klaut. Das ist so wahr, wie ich hier sitze.«
Die Wirtin schickte die alte Frau nun nach Hause, und Edla durfte sich auf einen Küchenstuhl setzen und warten, bis die Frau den Jungen in der Kammer hinter der Küche zu Bett gebracht hatte. In aller Deutlichkeit wurde ihr gesagt, daß sie dort nicht hineingehen dürfe. Danach führte sie Edla hinauf in den Klubraum, der über der Wirtsstube im Obergeschoß lag.
»Hanna und Ida liegen auf’m Dachboden«, sagte sie, »und die Bäckerin muß ihre Ruh ham in der Küch. Zwischen Ida und Hanna is kein Platz mehr, drum schläfst du hier.«
Es war ein großer Raum. Edla hatte schon von ihm gehört. Die reicheren Bauern hielten hier oben ihre Versammlungen ab, deren Gerüche sich in den Gardinen festgesetzt hatten. Frau Isaksson hatte für Edla ein Glas mit Öl und zündete darin einen kleinen Wachsstock an, damit sie etwas sehen könne, wenn sie dann allein sein würde und sich schlafen legte. Doch in dem spärlichen Licht konnte sie nicht den ganzen Raum erkennen. Als sie hereingekommen waren, hatte sie auf einem Porträt flüchtig ein Gesicht wahrgenommen.
Schlafen sollte sie auf dem Tisch. Der war fast genauso groß wie der Fußboden der Kammer in der Soldatenkate. Sie hatte zwei Pferdedecken als Unterlage bekommen und einen Reisepelz als Zudecke. Ihre Füße ragten jedoch darunter hervor.
Sie wagte nicht, das Licht auszulöschen. In dem Öl schwamm der Wachsstock, der durch ein Stück Pappe gesteckt worden war, damit er an der Oberfläche blieb. Lange lag sie und starrte in die kleine, zaghafte Flamme. Dann kam ihr Skur-Ärnas Stimme und der Geruch aus ihrem Mund in den Sinn, wie sie über die Wirtsfrau geflüstert hatte:
»Se is bösartig, ärger als Schlangengift.«
Da merkte sie, daß der Wachsstock zusammengeschmolzen und das Öl weniger geworden war, und sie getraute sich nicht, das Licht noch länger brennen zu lassen. Sie blies in das Glas, so daß es dunkel wurde, und kroch, den Pelz um sich gewickelt, bis ganz an das andere Ende des Tisches, damit sie das Glas nicht umstieße, wenn sie sich umdrehte. Dann horchte sie auf die Geräusche der Züge und der Menschen, die mit den Türen zu den Schlafräumen schlugen.
Der Donner rollte und der Himmel wurde weiß. Erst gegen vier Uhr, als es in Strömen zu regnen begann, sank Edla in einen Dämmerschlaf. Sie schlief trotz Hannas und Idas Schritten auf der Bodentreppe, als diese in dem herben Licht des frühen Morgens in den Stall gingen. Niemand weckte sie. Sie wurde an diesem ersten Morgen ganz einfach vergessen. Doch das kam nie wieder vor. Nun erwachte sie vom Duft des Brotes und von den Flüchen.
Sie stieg vom Tisch herab und blickte aus dem Fenster. Der Regen hatte den Platz zwischen dem Gasthaus und dem Bahnhof aufgeweicht, und um die Räder der Postkutsche, die eben vorbeifuhr, spritzte der Lehm. Sie blieb stecken, und der Kutscher schrie und fluchte. Sie war mit drei Pferden nebeneinander bespannt, kam aber dennoch erst frei, als die Fuhrknechte auf jeder Seite des Gespanns zupackten. Zur selben Zeit fuhr ein Zug ein, ohne daß irgendein Mensch dort unten sich auch nur danach umsah. Es roch nach Steinkohlenrauch und frischem Brot. In der Ortschaft war es jetzt wie in einer Stadt: man konnte jeden Morgen frisches Brot kaufen. Nun kamen die Dienstmädchen des Postmeisters, des Stationsvorstehers, des Eisenbahnbauinspektors und der Wirtin des Bahnhofsrestaurants, mit ihren Körben. Sie balancierten durch den Lehm bis zur Ladentür, und die Fuhrknechte riefen hinter ihnen her. Edla begann zu schluchzen, als sie begriff, wie spät es war und wie sehr sie verschlafen hatte.
Unten in der Küche war die Bäckerin gerade dabei, sich die Schürze abzubinden und sich fertig zu machen, um nach Hause zu gehen. Edla sah, daß sie der Wirtsfrau ungeniert direkt ins Gesicht gähnte.
Die Bäckerin kam jeden Abend, nachdem die anderen zu Bett gegangen waren. Das letzte, was die Gastwirtin machte, war Mehl für sie abzumessen. Um zwölf Uhr setzte sie den ersten Teig an. Wenn die anderen aus dem Stall kamen, war sie fertig, bekam einen Brotlaib in den Korb gepackt, faltete ihre Schürze zusammen und legte sie obenauf.
Es dauerte keine Woche, bis Edla lernte, daß alles, was an dem ersten Tag so großartig und zufällig ausgesehen hatte, die Postkutsche, die großen Speckstücke und das Gähnen der Bäckerin, sich wiederholte und regelmäßige Vorkommnisse waren. Bald wußte sie, wie die Bahnen der großen, schweren Menschen zu berechnen waren. Was sie jedoch von dem Jungen halten sollte, den sie am ersten Abend kurz in der Küche gesehen hatte, wußte sie nicht.
Oft ging sie unter irgendeinem Vorwand hinter das Magazin oder den Stall, denn zu Hause hatten sie keinen Abtritt, und sie wußte anfangs nicht, wohin sie gehen sollte. Überall, so schien es ihr, tauchte das Gesicht dieses Jungen auf. Blitzschnell hockte sie sich in die Nesseln, um das Notwendigste zu erledigen. Davon bekam sie Bauchschmerzen. Sie fand, daß er sie mit seinem Grinsen verhöhnte. Sie wußte, daß ihr Kleid an den Ellbogen abgewetzt und das Oberleder ihrer Stiefel rissig geworden war. Am zweiten Abend mußte sie die Kühe heimtreiben, die hinter der Villa des Postmeisters weideten, und da tauchte der Junge mit einer Ebereschengerte in der Hand auf und half ihr. Nun sagte er, daß er Valfrid heiße und daß er Isakssons Renngaul sei. Sie wußte nicht, was das war.
»Man wird Ladenbursche, wenn man sich gut macht, und dann kann man Ladengehilfe werden.«
Edla schwieg.
»Wenn man nicht zur Eisenbahn geht, natürlich.«
Er hatte ein kantiges Gesicht und einen großen Mund. Die Zähne wollten sich auch dann gerne zeigen, wenn er nicht lachte. Seine Wangen waren übersät mit großen, braunen Sommersprossen. Sie begriff jetzt auch, daß er nicht höhnisch grinste. Er versuchte, sie zum Lächeln zu bewegen. Der richtige Ladenbursche schikanierte Valfrid und schimpfte ihn aus, daß es zwischen den Wänden des Magazins widerhallte. Doch unter Blinden ist der Einäugige König, wußte Edla, und auch sie konnte nichts anderes erwarten, als daß man sie hart anfaßte. Sie war ja die Jüngste, dachte sie. Es dauerte lange, bis sie erfuhr, daß Valfrid erst vor kurzem zwölf Jahre alt geworden war.
Er aß mit der zweiten Runde, wenn die Fuhrknechte die Küche mit ihrem Gemurmel und Pferdegeruch erfüllten. Der Gastwirt aß meistens mit dem Ladengehilfen und dem Ladenburschen, und deren Mittagessen war eine heikle Angelegenheit für Edla. Sie mußte Aron ruhighalten und das Essen auftragen. Es sprach nur Isaksson. Er gab Anweisungen, welche Fäßchen aufgemacht werden sollten, für welche gröberen Waren sie Tüten verwenden dürften, welche besseren Kunden im Laufe des Nachmittags beliefert werden müßten. Einwände kamen nur von seiner Frau, die sie ihm in schnellen Worten über die Schulter zuwarf. Für diese Frau schien es kein Vor oder Zurück zu geben. Sie war eingebettet im Hier und Jetzt. Sie arbeitete mit verbissener Hast und grübelte nie. Edla sah, daß der dicke Aron mit den wächsernen Orangenblüten ihrer Brautkrone spielte. Nach kurzer Zeit hatte er sie weichgeknetet, und sie kamen als gelbweiße Würstchen zwischen seinen Fingern durch. Als die Mutter ihn dabei erwischte, schob sie schimpfend die Schublade unter dem Kommodenspiegel zu. Aber länger als diesen Augenblick unterbrach sie ihren blutleeren Eifer beim Kochen, das alle ihre Tage ausfüllte, nicht.
Mit einem schmutzigen Dienstmädchen, das in der Küche nicht zu brauchen war, und einem anderen, das klaute und nicht allein gelassen werden konnte, mußte sie natürlich das Kindermädchen zu Hausarbeiten heranziehen. Anfangs kam das nur gelegentlich vor.
»Du kannst das hier schon mal abspüln, wenn ich Eier holen geh’. Das ist gleich gemacht.«
Aron spielte hinter Edlas Rücken. Er gab fast nie einen Laut von sich. Sie stand vor der Spülschüssel, und ihr schwirrte der Kopf von all den Geräuschen rund um sie herum: das Pferdegetrampel und Gepolter der eisenbeschlagenen Karrenräder, das Pfeifen der Züge, die Stimmen und das Gelächter aus dem Schankraum. Sie dachte an ihr Zuhause in Äppelrik, wo man mitten am Tag ganz deutlich das wirbelnde Klopfen des Spechts aus dem Wald hören konnte, selbst wenn man drinnen in der Küche stand und abspülte.
Nach einer Woche waren die gelegentlichen Ausnahmen zur Gewohnheit geworden, und sie wußte genau, was sie zu tun hatte. Sie bemühte sich eifrig, alles recht zu machen, und wollte sich auch groben Arbeiten gewachsen zeigen.
»Wasser reinholen, das schaffst wohl noch nicht.«
Sie wollte beweisen, daß sie es konnte. Als ihr das Kreuz weh tat, wußte sie, daß das nur von dem Faulpelz kam, der sich im Rückgrat regte.
Eines Freitagabends hatten die Bauern oben im Klubraum eine Versammlung, und am nächsten Morgen wußte die Gastwirtin nicht, wer ihr den Fußboden scheuern sollte. Niemand war dafür abkömmlich.
»Wenn du schon mal anfangen könntest«, sagte sie zu Edla. »Ich schick’ dann Hanna hinauf, wenn se hier unten fertig ist.«
Edla bekam Scheuersand und einen Eimer mit abgekühlter Waschlauge.
»Das bleicht so gut«, meinte die Gastwirtin.
Zuerst mußte sie den losen Schmutz auf dem Fußboden zusammenfegen. Stroh und Mist vom Viehmarkt waren an den Stiefelsohlen hängengeblieben und hereingetragen worden. Der nun trockene, feine Mehlsand vom Bahnhofsplatz stand wie Rauch um den Kehrrichthaufen.
Sie fühlte sich bedeutend und erwachsen, als sie über den fleckigen Fußboden hinblickte. Eimer und Gerätschaften standen aufgereiht an der Türschwelle. An den Schmalseiten stand jeweils ein Kachelofen. Weiß und in feierlicher Einäugigkeit starrten sie einander mit ihren Klappen an. Bald lag Edla zwischen ihnen und bearbeitete das Holz mit einer fest zusammengebundenen Wurzelbürste. Sie konnte sie nicht wie eine erfahrene Scheuerfrau mit dem Fuß lenken. Als sie sich den ersten Splitter unter den Daumennagel trieb, stiegen ihr Tränen in die Augen, und sie merkte, daß sie nicht war, was sie sein wollte, nämlich eine ausgewachsene und ordentliche Arbeiterin.
Diele für Diele schrubbte sie den Fußboden mit Bürste und Sand, goß Laugenwasser dazu, schrubbte und spülte mit dem Lumpen, der in einem Eimer mit klarem Wasser lag, nach. Sie wischte sorgfältig alles auf, wie es ihr die Gastwirtin aufgetragen hatte. Es durfte kein Schmutzwasser zwischen den Ritzen zurückbleiben und dort sauer werden. Nach zwei langen Dielen begann sie zu verstehen, was diese Arbeit bedeutete.
Es wurde Abend, bevor sie fertig war. Um sie herum schwand das Licht. Die allerletzte Diele schrubbte sie, ohne etwas zu sehen. Als sie nach unten kam, sagte die Gastwirtin:
»Hör mal, du warst aber lang da oben. Ist Hanna denn nicht hinaufgekommen?«
Als sie keine Antwort erhielt, ging sie schließlich mit dem Eierkorb in die Speisekammer. Sie sah Edla noch einmal scharf und kurz an, als sie zurückkam, und dann meinte sie:
»Ja, das is wohl zuviel gewesn. Iß jetzt was.«
Aber Edla konnte nichts hinunterbringen. Sie wollte nur noch schlafen gehen.
»Ja, morgen kannst du mit Valfrid im Magazin Kaffee verlesen. Sag, daß ich das gesagt hab’. Da kannst du den ganzen Tag sitzen.«
Sie war noch nie so gesprächig gewesen, aber Edla hörte sie kaum. Sie ging wieder nach oben in den Klubraum, doch es war schwer, sich die Treppen hinaufzuschleppen. Alle Muskeln waren steif, und sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben Kopfweh. Trotzdem schlief sie in der vom Putzen feuchten Luft schnell und fest ein. Sie hatte vergessen, das Fenster vorher zu öffnen.
Unten in der Wirtsstube hatte man den Schanktisch beiseite gerückt, um tanzen zu können. Manchmal wachte Edla von den Geräuschen auf. Hannas Stimme übertönte alle anderen. »Fühl mal, wie ich schwitz!« rief sie über die Fiedel und das Getrampel der Füße hinweg.
Edla schlief jedoch wieder ein, und im Schlaf kehrte der gescheuerte Fußboden zu ihr zurück, und ihr war, als prüfe sie ihn Zoll für Zoll samt der Astlöcher und Knorren und der langen, vom Schmutz fetten Ritzen. Erschrocken versuchte sie sich von dem Fußboden in ihrem Schlaf zu befreien, doch nun war es, als schaue sie auf die Tapetenmaschine des wunderlichen Kunstschreiners in Vallmsta. Anstelle der mit feinem Blumenmuster bedruckten Papierrolle kam der gescheuerte Fußboden aus der Walze, die Knorren glotzten sie an, die Ritzen krochen dahin. Hier war um ein Ast herum das Holz abgetreten, dort wellte es sich holprig und grau, weich vom Sand und nach verschüttetem Bier stinkend.
Sie versuchte, dies am nächsten Tag Valfrid zu erzählen, als sie im Magazin saßen und brasilianischen Kaffee verlasen. Es war das erste Mal, daß sie ihm etwas anvertraute, und er war beinahe aufgeregt. Er wollte eine ausführliche Beschreibung der Tapetenmaschine haben und fragte, ob sie ihn einmal dorthin mitnehme, damit er sich das anschauen könne.
Sie wußte bereits, daß Valfrid ein überdrehter Mensch war. Kurz vorher hatte er ihr erzählt, daß er von dem ehemaligen Ladengehilfen Franz Antonsson, der zu Hause bei seiner Mutter an Lungenschwindsucht gestorben war, ein Paar Schuhe geerbt hatte. Franz hatte »Einsam im schattigen Tale« singen können, und Valfrid hatte vorgehabt, das Lied zu lernen. Er kam aber mit seinen Füßen nicht in die Schuhe, und ohne sie konnte er sich nicht vorstellen, diese Sache weiter zu verfolgen. Er weinte beinahe und beklagte sich ganz unmännlich bei Edla: Sein ganzes Leben lang habe er von einem Paar richtiger Schuhe geträumt, und jetzt, da er sie habe, seien die Füße zu groß! Selbst ohne die Frostbeulen an den Fersen und den Knoten an der großen Zehe seien sie noch zu lang, und er sei bereit, zur Axt zu greifen. Er versuchte Edlas Blick aufzufangen, aber sie schaute beharrlich in den Kaffeesack. Es schien, als schäme sie sich dafür, daß er sich gehen ließ.
Ein paar Tage später kam sie am Holzschuppen vorbei, und da hörte sie durch die offene Tür ein kurzes Stöhnen. Es war Valfrid. Sie wollte schnell vorbeigehen.
»Edla!« stieß er hervor.
Er hatte tatsächlich einen Fuß auf dem Hackklotz gestellt und mit beiden Händen die Axt umfaßt. Edla erkannte aber, daß er schon lange über den Moment hinaus war, in dem er hätte zuhauen können. Trotzdem sah es schauerlich aus, wie der nackte Fuß da auf dem Hackklotz stand, die seltsam langen und weißen Zehen mit den gelblichen Nägeln und den feuchten, schwarzen Winkeln dazwischen. Obwohl sie wußte, daß das alles nur Theater war, schrak sie zusammen. Valfrid heulte und schwang die Axt, geriet jedoch ins Taumeln und ließ sie ins Birkenholz fallen. Weinend setzte er sich auf den Hackklotz. Am meisten weinte er aber deswegen, weil Edla nicht eingegriffen hatte, weil sie das Theaterstück durchschaut und es mit vor der Brust verschränkten Armen wie eine ganz alte Frau betrachtet hatte.
»Ich wollt’ bloß warten, bis du kommst«, schniefte er. »Du hättst mich zur Gemeindeschwester bringen solln.«
Und Edla sah, daß er vor dem Holzschuppen einen Warenschlitten für seinen Krankentransport bereitgestellt hatte.
Dies blieb sein einziger Versuch, sich die Füße zu kürzen, und daraufhin entschloß er sich schmollend, die Schuhe nach Hause zu bringen, zur Kate Nasareth, und sie seinem Bruder Ebon zu geben. Der war ein verwirrtes Individuum und nach Valfrids Meinung der Schuhe nicht wert.
»Scheiß Ebon«, jammerte er.
Valfrid ging an einem Sonntag im September mit den Schuhen nach Nasareth. Er bat Edla, ihn zu begleiten, und sie bekam frei, ohne etwas sagen zu müssen. Das hätte sie auf keinen Fall gewagt. Doch es war nach einem arbeitsreichen Markttag, das Gasthaus war voll gewesen, und Frau Isaksson hatte ganz vergessen, wie alt sie erst war, so daß sie einen Teil des Sonntags frei bekam.
Zuerst nahm Valfrid Abschied von den Schuhen. Sein Arbeitstag begann immer damit, daß er das Schuhwerk des Gastwirts und des Ladengehilfen putzte. Zur Winterszeit mußte er außerdem im Kamin des Schankraums Feuer machen und die Tür zum Laden hin öffnen, damit es dort warm wurde. Dann mußte er in das Magazin hinausgehen und das geronnene Baumöl mit einer kleinen Lampe unter der Zisterne erwärmen.
Vor langer Zeit hatte er eines frühen Morgens Franz Antonssons Schuhe geputzt, nachdem er mit den anderen fertig gewesen war. Ihr vollkommen makelloses Leder glänzte herrschaftlich. Bevor er sie nun in graues Packpapier einschlug, stellte er sie im Lager auf eine Zuckerkiste und betrachtete sie genau. Es waren Schuhe des Modells Schnürstiefel, das ein Stück über die Fesseln reichte. Am Schaft war das Leder faltig, und Franz hatte mit seiner Lungenschwindsucht so lange daniedergelegen, daß sich in den Falten Staub ansammeln konnte. Valfrid entfernte ihn mit einem Zipfel seines Hemdes.
Je mehr er von der Welt und vom Schuhwerk der Leute sah, um so überzeugter war er, daß zwischen der Fußbekleidung eines Menschen und seinem Charakter ein Zusammenhang bestand. Jeden Morgen um sechs Uhr ging Petrus Wilhelmsson vorbei, auf dem Weg zu seiner Schreinerei. Er trug einen schwarzen Gehrock und eine karierte Hose, denn er arbeitete im Kontor. Wilhelmsson ward nie im Schankraum des Gasthauses gesehen und niemals in Gesellschaft von Schreihälsen und Trunkenbolden. Valfrid fand, daß man das schon von seinem Schuhwerk ablesen konnte, diesen Boxkalstiefeln, die aussahen, als führten sie ihn unerschütterlich auf den Pfad der Gerechtigkeit und der Pflicht. Sie waren stämmig wie kleine Schleppdampfer, blankpoliert, dickhäutig, kräftig besohlt und immer vorwärts weisend.
Jenseits der Eisenbahn hatte sich ein Bauer namens Magnusson ein städtisches Haus gebaut und nannte sich nun Baumeister. Daß er aber nach wie vor Bauer war, erkannte man an den hohen Fahllederstiefeln, die er trug. Er ging schnurstracks vorwärts, ohne nach links oder rechts zu sehen, über die Gleise, so, als könnten diese kräftigen schwarzen Schaftstiefel, die nicht poliert, sondern mit Fett eingeschmiert wurden, ganz von alleine die heranbrausenden Rangierloks zum Stehen bringen. Bisher war er auch nie der Gefahr eines Unglücks ausgesetzt gewesen, während Valfrid in seinen abgelatschten und zu klein gewordenen, typisch schwedischen Stiefeln immer Seitenstechen bekam, weil er rennen mußte, um mit dem Handkarren hinüberzukommen, bevor eine Lokomotive ihn zerquetschte wie eine Laus an der Tapete.
Wenn bei der Wirtin im Bahnhofshotel alles belegt war, kam es vor, daß auch mal bessere Leute im Gasthaus Quartier nahmen. Man konnte für eine Krone die Nacht ein Einzelzimmer bekommen und brauchte nicht in der Gesellschaft betrunkener Bauern zu schlafen. Der Komfort bestand jedoch nur aus einer Pritsche und einem Stuhl, um darauf den Gehrock abzulegen. Solche Gäste, die eigentlich in das Hotel gehörten, stellten die Schuhe zum Putzen vor die Tür, und da bekam Valfrid Dinge zu sehen, die ihn selig und schrecklich aufgeregt machten. Draußen in der Welt gab es Chevreauxschuhe, die so weich und geschmeidig waren, daß sie sich dem Fuß anschmiegten wie ein Handschuh (natürlich nur, wenn man keine Frostbeulen hatte). Diese Schuhe schienen für einen liebenswerten und elastischen Gang gemacht. Man wagte sich kaum auszumalen, auf welche Pfade solche Schuhe führten und wie deren Träger sich nannten.
Doch nun mußte sich Valfrid von Franz Antonssons Stiefeln trennen, und damit nahm er auch Abschied von einem Traum, den er nicht anders beschreiben konnte als mit den Worten des Liedes »Einsam im schattigen Tale, dicht bei dem kühlenden Strom«. Ebons viehisch schwarze Kätnerfüße und diese Schuhe paßten einfach nicht zusammen, soviel war sicher.
Edla bekam von Hanna ein Tuch geliehen, als sie gehen wollten, denn ihr Kleid war abgetragen und nichts, womit man sich unter den Leuten sehen lassen konnte. Hanna legt die Enden vor der Brust des Mädchens über Kreuz und verknotete sie hinten am Rücken. Dann legte sie ihr eine Hand auf das Hinterteil und schubste sie hinaus. Sie gingen nebeneinander her, Valfrid und sie, und anfangs wußten sie nicht, was sie sagen sollten. man kam einander näher, wenn man draußen spazierenging, und es war ein anderes Gefühl, als wenn man im Magazin eingeschlossen saß und zusammen brasilianischen Kaffee verlas.
Auf dem Bahnhofsplatz, den die ersten herbstlichen Regengüsse aufgeweicht hatten, spazierte Mamsell Winlöf, die Wirtin des Bahnhofsrestaurants, in Samtmantel und schwarzem Rock, der an den Knien zusammengezogen war. Dieser Rock war ein öffentliches Ärgernis. Sie führte ihren kleinen Hund an der Leine, einen Hund, wie es ihn bei normalen Menschen nicht zu sehen gab, allenfalls in einem Wagen des Gutes, der Gäste zur Bahn brachte.
»Se heißt Turlur und is ne Hündin«, sagte Valfrid. »Aber wenn se Junge kriegt, stirbt se.«
Der kleine Hund war schwarz und weiß und hatte Ohren wie Schmetterlingsflügel, die ständig vor Angst zitterten. Die Mamsell führte ihn jetzt auf die Erdwälle, die um die frisch angepflanzten Linden aufgeworfen worden waren. Turlur quetschte mit gekrümmtem Rücken und zitternden Ohren kleine gelbe Würstchen aus sich heraus, während Valfrid und Edla immer noch dastanden und guckten. »Scheints kriegt se bloß Sahne und was zu Saufen«, meinte Valfrid. »So’n Elend.«
Alma Winlöf mußte eilends zurück in ihr Restaurant, denn der Zwölfuhrzug mußte gleich kommen. Sie nahm den kleinen Hund auf den Arm und ging mit ihm hinein. Wenn sie es eilig hatte, war ihr Gang trotz der kurzen Schritte männlich und eckig, und der Rock schwebte einige Zoll über dem lehmigen Matsch.
»Wir schaun uns noch den Zwölfezug an, vor wir gehn«, schlug Valfrid vor.
Sie kamen genau rechtzeitig, um zu sehen, wie der Büfettwagen von zwei Serviermädchen auf den Bahnsteig hinausgeschoben wurde. Edla schaute sich lieber das Essen an als den Zug. Nach kurzer Zeit kam Mamsell Winlöf heraus. Sie hatte sich umgezogen und in die dienende Frau verwandelt, die sie auf dieser Seite des Bahnhofsgebäudes immer war. Sie trug eine gestärkte, weiße Schürze, deren Brusttuch mit einer Nadel auf dem schwarzen Stoff des Kleides festgesteckt war. Die unteren Teile der Ärmel verbarg sie in weißen Ärmelschonern.
Valfrid und Edla drückten sich an die Hauswand, als der Zug aus Göteborg schließlich stand und die Menschen, so schnell es ihre Würde erlaubte, zu dem Büfettwagen liefen oder schritten. Die schnellen Schritte und das muntere Knarren der Stiefel, die zwischen dem Gezische der Lokomotive zu hören waren, bereiteten Edla Herzklopfen. Sie betrachtete die feinen Hände, die sich nach Gläsern und belegten Broten streckten. Hatten alle, die mit der Bahn fuhren, so feine Hände und so feuchte, rote Lippen? Und wohin waren sie unterwegs? Wie konnte es auf der Welt so vieles geben, das sich nicht zu Fuß erledigen ließ?
Einer der letzten Ersteklassepassagiere war ein Mann in einem langen, weiten, ärmellosen Umhang. Sowohl der Umhang als auch die Hose waren aus feinem, neuem Tuch, das einem tiefschwarzen Bahrtuch glich. Sein hoher Hut glänzte wie der runde Kessel der Lok. Aus dem linken Armschlitz ragte ein schwarzes Lederetui mit glänzenden Schnallen hervor, das er kein einziges Mal während der Erfrischungspause aus der Hand legte. Mit seiner klaren, schönen Gesichtsfarbe, seiner glatten Haut, seinem lockigen Backenbart und den kräftigen Augenbrauen glich er den vielen vornehmen Reisenden, die Edla auf dem hölzernen Bahnsteig hatte stehen und essen und trinken sehen. Sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was er war oder was er machte, wenn er nicht mit der Bahn fuhr. Valfrid dagegen war vollgestopft mit Worten, die er auf die Leute, die er bei den Aufenthalten der Züge beobachtete, anzuwenden versuchte.
»Bestimmt ein Zauberer«, sagte er. »Oder ein Oberhofsattler.«
»Sei still«, erwiderte Edla, dem Weinen nahe, »du liest zu viel Schmarrn. Halt doch den Mund.«
Als sie sich den Mann in dem bahrtuchschwarzen Umhang ansah, wünschte sie, Valfrid wäre nicht dabeigewesen. Sie wollte ihn ungestört betrachten. Er breitete plötzlich die Arme aus, so daß sich der Umhang öffnete und gegen die vom Steinkohlenrauch grauschwarze und ölbefleckte Hauswand schlug. Gleichzeitig wurde die Innenseite des Umhangs aus glänzender Futterseide sichtbar, und sie flammte auf wie ein purpurroter Blitz.
Jedesmal, wenn Edla zu der großen Erfrischungspause hatte gehen können, hatte sie einen Menschen gesehen, der genauso denkwürdig war wie dieser hier. Sie fürchtete, daß sie sich, wenn sie öfter dorthin ginge, nicht mehr an jeden einzelnen von ihnen würde erinnern können. Zum ersten Mal spürte sie, daß sich unter die Begeisterung Angst mischte.
Sie gingen nebeneinander zwischen dem Haus des Stationsvorstehers und dem Bahnhofsgebäude hindurch weiter und kreuzten den ausgefahrenen Weg für die Holzfuhrwerke, der vom Norden in den Ort an der Bahnstation herabführte. Es gab keinen Weg direkt nach Nasareth, doch man konnte den Pfad nehmen, auf dem die höheren Bahnbeamten immer promenierten. Er führte hinauf nach Fredriksberg, einem kleinen Hügel im Laubwald, den Stationsvorsteher Fredriksson zu einem bescheidenen Park angelegt hatte. Dort lag seine englische Dogge begraben, und darum wurde dieser Ort von allen Leuten Mulles Grab genannt. Valfrid und Edla sannen über Mulles Grabstein nach, der vom gelben Birkenlaub, das der Nachtregen festgeklebt hatte, hübsch gefleckt war. Er trug Mulles Namen und Jahreszahlen, und sie rechneten aus, daß der Hund dreizehn Jahre alt geworden war. Er sei in einer kleinen Kiste begraben worden und in eine sehr feine Decke aus karierter englischer Wolle eingehüllt gewesen. Valfrid wußte das alles von seinem Bruder Oskar Edvin, der lange vor der Anbindung der Strecke schon bei der Eisenbahn gearbeitet hatte. Edla wollte eine ausführliche Beschreibung der Decke haben, und Valfrid lieferte sie ihr ohne Zögern. Er tat sich leicht, Lücken in seiner oder anderer Leute Erinnerung zu füllen.
»’n Hund«, sagte Edla nachdenklich, nachdem sie gehört hatte, welches Karo die Decke gehabt hatte. »Das ist schon komisch.«
Valfrid wollte, daß sie sich ein Weilchen auf die Bank setzten, die oben auf Fredriksberg stand, doch Edla traute sich nicht. Gleich darauf erwies es sich als klug, daß sie es unterlassen hatte, denn jetzt konnten sie das weiche Aufschlagen von Pferdehufen hören: Der Erste Stationsassistent Cederfalk kam auf seiner braunen Stute geritten. Er trug keine Uniform, sondern einen Reitanzug aus kariertem Wollstoff, und er hatte einen kleinen grünen Hut auf, an dem eine Feder steckte. Als Edla knickste, konnte sie aus den Augenwinkeln beobachten, wie Valfrid seine Mütze abnahm und sie nahezu herausfordernd schwenkte.
Völlig trockenen Fußes gingen sie durch das ehemals große, schwarze Moor. Der Weg nach Nasareth war auch Edlas Heimweg, aber Äppelrik lag noch viel weiter weg. Die Hütten der Kätner und Tagelöhner waren die gleichen geblieben, seit sie hier als kleines Kind gegangen war, doch wohnten jetzt überall mehr Leute, Arbeiter bei der Eisenbahn und in Wilhelmssons Schreinerei.
Je mehr sie sich seinem Zuhause näherten, um so finsterer blickte Valfrid drein. Und schließlich drohte er, das Paket mit den Schuhen in einen Busch zu werfen. Lieber das, als daß Ebon seine Mistpaddel von Füßen in sie steckte. Edla reagierte nicht darauf, und das war auch gar nicht nötig. Er behielt das Paket unter dem Arm.
In Nasareth war es schon voll von Sonntagsgästen. Bis zur Kirche waren es zwei Meilen, und Valfrids Großmutter war die einzige, die sich darüber beklagte, daß sie nicht dorthin kam. Drinnen in der Hütte hatte man sich von vornherein so verteilt, daß die Hausleute auf der einen Seite zum Herd hin saßen und standen und die Sonntagsgäste sich um das Sofa gruppierten. Die Bewohner der Kate waren grau wie die Wand der Hütte. Doch Oskar Edvin Johansson, der früher die Pumpenanlage am Bahnhof bedient hatte, war jetzt Nachtbahnmeister und hatte eine Uniform mit doppelter Knopfleiste, einen Rand um die Mütze und einen weißen Hemdkragen. Seine Frau trug eine Bluse aus gekauftem Stoff und die Kinder hatten Kleider an, die aussahen, als seien sie eigens für sie genäht worden. Valfrid hatte noch einen Bruder, der beträchtlich älter war als er, nämlich Wilhelm, der in der Schreinerei arbeitete. Er trug eine schwarze Jacke und eine Melone. Was zu sagen war, hatten sie einander längst gesagt. Oskar Edvin hatte in einem Korb Semmeln vom Markt mitgebracht, doch bislang hatte niemand irgendwelche Anstalten gemacht, Kaffee aufzusetzen. Als Valfrid mit seinem Schuhpaket und einer kleinen Tüte Kaffeeauslese, die er beiseite geschmuggelt hatte, ankam, wurde mit einem Mal offenbar, daß in der Hütte vorher kein Kaffee dagewesen war, obgleich niemand es sich hatte anmerken lassen wollen. Die Mutter holte geschwind den Kaffeebrenner hervor, und Ebon und seine kleinen Geschwister schafften Späne herbei, um im Herd Feuer zu machen. Schon bald breitete sich der eigenartige Duft stark gebrannter Kaffeebohnen in der Küche aus und überlistete den Armeleutegeruch, den Edla jetzt übel fand, da sie vom Gasthaus kam, wo es jeden Tag nach frischem Brot und gutem Braten roch.
Schließlich wurden auch die Schuhe aus dem Paket ausgewickelt und herumgereicht, damit alle das makellose, feinpolierte Leder befühlen konnten. Valfrid erzählte, daß sie von jenem Schuster gemacht worden seien, der seine Werkstatt in dem Haus mit der Kegelbahn habe. Es dauerte seine Zeit, bis man sich geeinigt hatte, denn es gab zwei Schuster am Ort, von denen einer frömmelte und unmöglich in Klot-Kalles Haus wohnen konnte, da dort doch Bier ausgeschenkt wurde. Valfrid schien seinen Gram darüber, daß seine Füße zu groß waren, inzwischen vergessen zu haben, er war jetzt munter und laut nach seinem Erfolg mit der Kaffeetüte und dem Schuhpaket. Ebon wurde das, was er an den Füßen trug, ausgezogen, und er bekam einen Klacks Seife und einen Eimer und wurde mit der Aufforderung an den Hang hinausgeschickt, daß er versuchen solle, seine Füße wie die manierlichen Leute aussehen zu lassen. Er warf in die versammelte Runde, daß es für alle wohl ein Glück sei, Schuhe anzuhaben, mit dem Resultat, daß Oskar Edvin schnell und reflexartig seine Stiefel unter den Stuhl zog, und auf Ebons Wange eine Ohrfeige klatscht, die sie violett färbte.
Als er mit den Schuhen an den Füßen wieder hereinkam, bekam Valfrids Glaube an einen tieferen Zusammenhang zwischen dem Schuhwerk und dem Charakter eines Menschen einen ernsthaften Knacks. Ebon erschien weder aufrechter noch kultivierter, er war noch genau derselbe.
»Die sind z’ klein«, sagte er.
»Weil du zu große Haxn hast, du Idiot.«
Valfrid war zum Heulen zumute, als er sah, wie sich das Leder über Ebons Beulen spannte. Mit einiger Mühe zog dieser die Schuhe von den Füßen und warf sie ohne Zeremonien zu Valfrids Stuhl hin.
»Du könntst’s doch noch mal probiern«, flehte die Mutter.
»Da pfeif’ ich drauf.«
»Was mit diesem Antonsson wohl verkehrt war, daß er so jämmerliche Füße gehabt hat«, wunderte sich Kätner Johansson.
Merkwürdigerweise hatten Valfrid und Edla auf dem Rückweg die Schuhe wieder dabei. Als sie sich am Abend trennten und Valfrid zu den Fuhrknechten in die Stallkammer gehen wollte, um sich schlafen zu legen, nahm er plötzlich das Paket und drückte es ihr an die Brust. »Nimm du se«, sagte er. »Solche kriegst nie wieder.«
Die Herbstabende kamen, und vor den Fenstern wurde es schwarz. Ida und Hanna saßen in der Nähe des Herdes, die eine mit der Haspel, die andere mit dem Spinnrad. Sie glaubten wohl, daß bei dem Surren und Knacken ihr Geflüster nicht zu verstehen sei, doch in der Ofenecke saß Skur-Ärna und spitzte die Ohren.
Die Alte wollte abends nie nach Hause gehen. Sie wohnte mit ihrer Schwester in einer Bruchbude neben der Villa des Postmeisters; Obdach und Brennholz bekamen sie vom Gut, denn die Schwester hatte sich dort ihr Leben lang verdingt. Der Postmeister hatte zu ihrem Hof hin einen Bretterzaun errichtet und wilden Wein wachsen lassen, dennoch wurde er von den Katzen der alten Weiber belästigt.
Skur-Ärna lauschte, und hinterher redete sie Blech. Sie machte jedem, der es hören wollte, klar, daß die Dienstmädchen des Gastwirts gottlos seien. Bald wußte sogar Edla, daß Hanna, das klauende und fröhliche Mädchen, ein Leiden im Bauch hatte. Edla fragte die Bäckerin, was das für ein Leiden sein könne, und erfuhr, daß diese Art von Leiden daher komme, daß sich betrunkene Fuhrknechte auf Hannas Bauch gelegt hätten.
Hanna wurde blaß und langweilig und wollte samstags abends nicht mehr mitmachen, wenn sie in der Wirtsstube den Schanktisch wegräumten und tanzten. Wenn Ida und sie morgens zum Melken gingen, mußte sie erst hinter den Stall laufen. Mehrere Male geschah es, daß Edlas Gesicht an der Ecke auftauchte und nach ihr sah.
Unmittelbar vor Weihnachten ging sie in aller Heimlichkeit, wie sie glaubte, nach Oxkällan, wo es einen alten Mann gab, der sich auf Schweine verstand und der Mädchenleiden kurieren konnte. Halbwegs draußen aus dem Ort, hörte sie Schritte hinter sich. Als sie sich umdrehte, sah sie Edla, die ihr, in das große karierte Tuch geduckt, das sie gewöhnlich geliehen bekam, nachlief.
Hanna wußte nicht, wozu diese Neugier gut sein sollte, doch sie nahm sie mit, um jemand zu haben, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. Außerdem fürchtete sie sich vor dem Alten in Oxkällan. Während des Besprechens saß Edla die ganze Zeit dicht neben Hanna und zitterte ebenso wie sie. Auf dem Nachhauseweg schwiegen sie, und um sie herum war der Spätherbst vogelstill und trostlos. Nur das Knacken des Nachteises, das sich in den Pfützen auf dem Weg gebildet hatte, war zu hören.
»Fragt sich, wie lang’s dauern wird, bis es wirkt«, sagte Edla plötzlich. Aber da mußte Hanna lachen und das kleine Bündel, das neben ihr ging, tätscheln.
»Darüber solltest du dir keine Sorgen machen«, entgegnete sie.
Hanna wurde lediglich dicker nach dem Besuch beim Oxkäller. Aber auch gereizter und patziger wurde sie und schwor, daß sie das Geld zurückbekommen würde, wenn er nichts ausgerichtet habe. Da Skur-Ärna ihr Geheimnis ohnehin schon im ganzen Ort herumgetragen hatte, kehrte sie die Schande nach außen und redete offen darüber.
Nach ihrer gemeinsamen Wanderung nach Oxkällan freundete sich Edla immer mehr mit der großen und frohsinnigen Hanna an und machte sich Gedanken darüber, was mit dem Kind werden würde, woher Säuglingskleidung zu bekommen wäre und wo sie niederkommen würde.
Es war nun Winter, und am Himmel funkelten klare Morgensterne. Eines Morgens wurde Edla vor vier Uhr geweckt und in den Stall geschickt, wo sie versuchen sollte, so gut sie könne, zur Hand zu gehen, denn Hanna sei krank und könne sich nicht auf den Beinen halten. Erst gegen sieben Uhr kam Edla dort los und konnte in die Kammer hinauflaufen, in der Hanna lag.
Sie teilte das Bett mit Ida, die ihrer beider Decke und darauf noch einen alten Kutschermantel über ihr ausgebreitet hatte. Die Gemeindeschwester, die den ganzen Morgen bei ihr gewesen war, sammelte jetzt ihre Schläuche und Gläser zusammen.
»Setz dich her«, sagte sie zu Edla. »Komm aber auf der Stell runter und sag Bescheid, wenn sich was ändert. Ich brauch’ unbedingt ’n bißchen Kaffee.«
Ende der Leseprobe