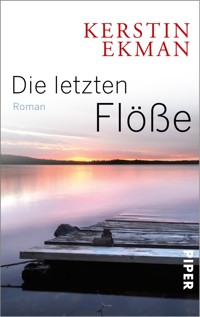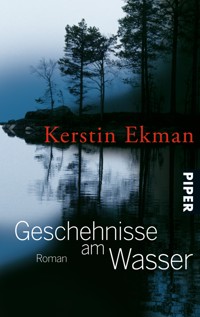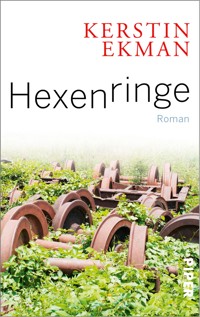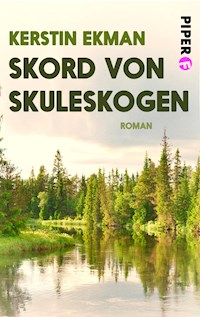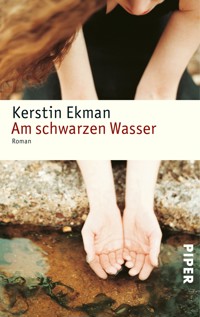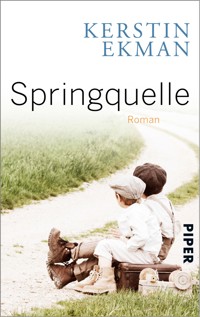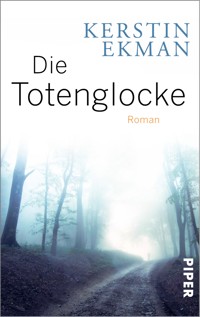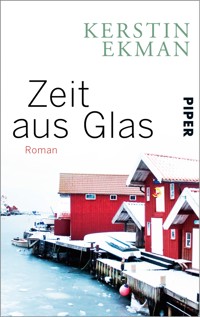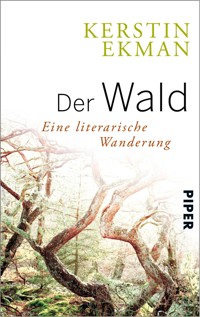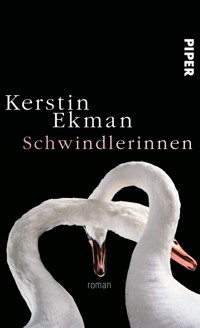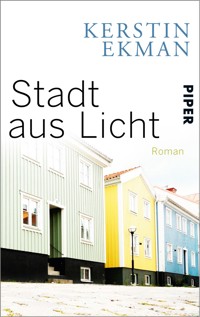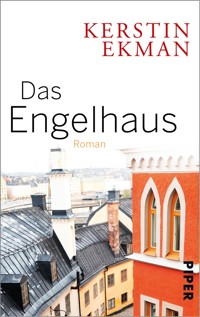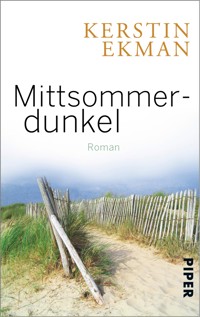
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Helga Wedin den Dorfladen ihres Onkels in dem kleinen nordschwedischen Dorf erbt, macht sie eine Entdeckung: im Lagerraum befinden sich große Mengen an Zucker und Hefe. Mit ihrer Stieftochter Åsa und ihrem Geliebten Edvard hat sie die vielversprechende Idee, illegal Schnaps zu brennen. Doch Neid, Eifersucht und Gier machen allen einen Strich durch die Rechnung. Kerstin Ekman erzählt die spannungsgeladene Geschichte einer ungewöhnlichen Dreiecksbeziehung. »In origineller volkstümlicher Sprache und starken Metaphern ersteht das Bild einer Gemeinschaft, die verunsichert in die Zukunft blickt.« (Ostthüringer Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2003
ISBN 978-3-492-95768-7
© 1972 Kerstin Ekman
Titel der schwedischen Originalausgabe:
»Morker och blåbärsris«, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1972
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2001 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Dorkenwald Design, München
Umschlagfoto: Thea Walstra / Fotolia.com
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Es gibt genug Schnaps in diesem Land, um das Bett eines großen Norrlandstroms zu füllen. Doch das ist reglementierter Schnaps.
Er ist in künstlichen Seen gespeichert und wird nach genauen Bestimmungen abgelassen. Wenn die Schleusentore geöffnet werden und man das Rauschen dieses reglementierten Schnapses hört – das Samstagsrauschen, die Kavalierstarts –, dann verleiht er Kraft. Die Kraft, Kinder zu zeugen und einander totzuschlagen. Die Kraft, eine weitere Woche durchzustehen.
An den Hebeln sitzen Leute und kontrollieren diesen klaren Strom des Lebenswassers, seinen Ablaß. Ungefähr dieselben Leute sammeln auch diejenigen auf, die es an den Rand geschwemmt hat.
Ein mächtiges Rauschen reglementierter Kraft. Mächtige, lässige Pranken am entscheidenden Hebel: So sieht die Kraft heute aus.
Abseits davon gluckst und plätschert all der Schnaps, der nicht im staatlichen Flußbett strömt. Im Wald verborgene Bäche mit frühlingshaft perlenden Fällen, breite Jauchegräben, anschwellende, übelriechende Flüsse –
– ein kleines Rinnsal in feuchtem Sternmoos:
Über der hohen Kommode in Isak Perssons Kammer in der Diamantkate hängt ein Bild mit schwarzem Holzrahmen. Rechts unten in der Ecke steht »Pfingstsamstag 1965«. Gemalt hat es Adana, und Helga hat es, indem sie das Blatt über eine Reproduktion von Nils Jacob Blommérs »Elfenreigen« gesteckt hat, mit einem Rahmen versehen.
»Pfingstsamstag 1965« ist mit Tempera aus dem Materialbestand der Schule gemalt. Die Farbe ist an sich schon dicker als normale Aquarellfarbe, doch Adana hat ihr zusätzliche Fremdstoffe beigemischt, um sie noch pastoser zu machen. Zum Schluß hat sie das ganze Bild mit dünnem Plastiklack gefirnißt.
Jede Familie im Dorf besitzt eine Farbfotografie oder ein Gemälde ihres Hofes. Vera Strömgren hat das ihre in Öl auf dem Hohlgrund eines alten Backtrogs, was dem Bild eine Dimension verleiht, die in aller Regel fehlt. Adanas »Pfingstsamstag« unterscheidet sich von diesen Hofbildern in zweierlei Hinsicht. Es ist größer, und es umfaßt nicht nur einen Hof, sondern das ganze Dorf. Auch hat sie mit einer Ausdauer daran gearbeitet, die für ein solches Motiv sonst niemand aufgebracht hätte.
An diesem Pfingstabend ist der Himmel über dem Dorf zichorienblau. Er ist dicht und undurchdringlich wie eine Zeltleinwand. Hinter dem Rauch aus den Schornsteinen verläuft wie eine Chinesische Mauer der Älgåsen, und dahinter ragt der Tavelberg auf. Man könnte um das ganze Dorf herumgehen, ohne den Standpunkt der Malerin zu finden. Am nächsten käme man ihm vielleicht, wenn man die alte Mühle bestiege und die Luke unterm Dachfirst öffnete. Doch Adana hat sicherlich nie in dem raunenden Halbdämmer dort oben gesessen und gemalt; sie hat Höhenangst. Wahrscheinlicher ist, daß sie aus dem Gedächtnis gemalt hat und vermutlich im Winter. Sie hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis.
Tatsächlich kann man vom Dachboden der alten Mühle aus das ganze Motiv überblicken, bis auf Evert Petterssons Hof und Noréns Villa. Adana hat sie durch einen Trick mit aufs Bild gebracht, indem sie unseren Blickwinkel beiderseits um ungefähr zwanzig Grad erweitert hat. Im übrigen wendet sie die Technik der Meister von Siena an: Sie serviert alles auf einem Tablett mit steil abfallender Perspektive. Diese Technik wird überdies durch die Landschaft gestützt.
Zuvorderst sieht man Onkelchens Laden, sehr weiß und mit heruntergelassenem Rollo an der Tür, und auf dem gelben Viereck steht sorgfältig ausgearbeitet: GESCHLOSSEN. In der Rabatte stehen seine aufrechten weißen Narzissen und darum herum, wie kleine blaue Himbeeren geformt, die Perlhyazinthen.
Die Sorgfalt, die Adana auf die Wirklichkeit verwendet, ist nicht nur der verzweifelte Fleiß der Unkundigen. Es handelt sich dabei auch um eine Wirklichkeitsauffassung und eine Art Kunstanschauung. Man mag es eine Verwechslung nennen: Adana macht keinen Unterschied zwischen einem Gegenstand und dem Abbild, das sie davon schafft. Sie arbeitet, meißelt aus. Am Ende eignet den Gegenständen eine unbestreitbare Realität. Schließlich kann man ihre trockenen, glatten Oberflächen anfassen.
Man sieht die Brücke und das silbrige Wasser, dessen Wellen wie Meringenspitzen hochstehen. Unwirklich hell schlagen zum See hin Espen und Erlen Bogen um Bogen über den Fluß. Wo der See sich weitet, hat das Wasser die Farbe des Himmels, leuchtend zichorienblau. Auf der Brücke steht still ein Mann in brauner Hose und schwarzer Jacke, die Hand auf dem Geländer. Immer.
Am Bahnübergang warnen gelbe Schilder: »Achtung! Stromleitung!«, und die Gleise, glatt wie Aalrücken, verschwinden hinter Wedins Viehstall in dem hellen Wald, der so verheißungsvoll und laubdämmrig ist, daß man meinen könnte, er läge viel weiter im Süden.
Alle Pfingstblumen hat Adana nicht malen können, und sie wollte das Problem nicht dadurch lösen, daß sie auf allen grünen Flächen ein diffuses Getüpfel verteilte. Statt dessen hat sie die Blumen hie und da zu Florenschilden und Sträußen gebündelt: die geneigten Perlenreihen der Maiglöckchen, träge Sumpfdotterblumen am Wasser, Buschwindröschenschnee unter den Bäumen. Adana verabscheut alles Summarische und Allgemeine. Sie nimmt sich der gesamten Wirklichkeit an und formt sie zu einer neuen Substanz, zu konzentrierter Sinnfälligkeit.
Wenn Adana krank und wirr ist, malt sie nicht. Die Person, die Isak Frau Regierungspräsident nennt, hat keine Geduld, und es wäre unvorstellbar, daß sie auf Evert Petterssons Misthaufen Halm an Halm legte oder mit feinstem Pinsel die blauen Pyramiden der Perlhyazinthen baute. Wenn sie böse und rachsüchtig ist, kümmert sie sich nur um den Haushalt und ihre verzwickten Berechnungen. Als sie das Bild malte, war sie ganz normal.
Die Häuser haben Gesichter, doch das haben sie auch in Wirklichkeit. Die Fensteraugen und Türmünder sehen fragend aus, grübelnd, unwissend. Niemals heiter hier. Außer bei ein paar kleinen Gebäuden und Simon Noréns grau-weißer Villa sind alle Dächer im gleichen Winkel gebrochen. In der linken Ecke, bei Evert Petterssons Hof mit seinen sehr dichtstehenden Gebäuden, ist Adana zur Kubistin geworden. Unterhalb der Fliederhecke spielen zwei tote Kinder auf dem Hof, Everts Enkelsöhne, die bei einem Verkehrsunfall im April 1965 ums Leben gekommen sind. Sie haben Bälle geworfen, die unverrückbar im Gras liegen, eine rote und eine blaue Kugel.
Sowohl Evert als auch Ejnar Strömgren haben ihre Kühe hinausgetrieben. Evert hat vierzehn, sie sind alle rundlich und hellbraun. Von Ejnars Kühen sind sechs rotbunt und sieben vom Tieflandschlag. Diese sieben stehen gerade unten an der Bahnlinie, nahe dem stromführenden Draht, der sie einschließt. Sie bilden in ihrem Teil der Lehde ein schwarzweißes Muster. Ihre Hörner sind lyrenförmig, ihre Augen schwarzblau.
Bei Fricks sieht man Bror auf der Drillmaschine und hinter ihm in kleinen goldenen Bogen die Aussaat. Auch Helga sät, oben bei Wedins im Kräutergarten. Ihre Samen liegen dicht und ordentlich wie die Knopfreihe eines langen Handschuhs. Noch hat sie die Erde mit dem Rechen, der daneben steht, nicht über die Furche geschoben. Die Erde ist hellgrau, so als wäre sie sehr warm und trocken. Ansonsten ist das Dorf festlich gekleidet und hat frei. Gej ist unten an der Straße und verharrt, den gekringelten Schwanz auf dem Rücken, in einem Luftsprung. Er hat das Maul zum Bellen geöffnet. Weiter oben, in Richtung Strömgrens und Tabor am Hang, steigt Veras jüngste Tochter in ein Auto. Sie ist weiß gekleidet und soll konfirmiert werden. Das kleine Gesangbuch in ihren Händen ist weithin sichtbar, es ist hart und schwarz.
Auf den hellbraunen Wegen stehen mehrere Leute, die einander das Gesicht zuwenden. Sie stehen nicht fest auf dem Boden, sondern sind auf die Bildfläche geheftet. Doch es mangelt ihnen nicht am Schwerpunkt; sie schwimmen weder noch schweben sie.
Ihre Gesichter sind rund, und sie berühren einander nicht. Sie stehen bei ihren Gegenständen, auf die ihre Blicke gerichtet sind. Ruhend sehen sie nichts an. Man erkennt sie an der Kleidung oder den Utensilien. Ihre Stöcke, Bälle und Maschinen sind schön. Onkelchen geht gerade nach Tabor hinauf, und sein Stock, den er zum Sechzigsten bekommen hat, zeigt vor ihn hin. Helga trägt ihren roten Pullover, den sie eigentlich für Åsa gestrickt hat, aber selbst behalten durfte.
Bei Noréns ist niemand zu sehen. Die Fenster sind gardinenweiß. Adana hat jedoch auf all die Zwiebelgewächse, die auf dem Rasen sprießen, viel Mühe verwendet, besonders auf die kleinen Sterne der Szilla.
Vor Bror Fricks weißem Haus mit der großen Holzveranda steht das alte Häuschen, in dem seine Mutter wohnt. Durchs Fenster kann man die alte Frau dort drinnen sehen. Es stimmt wirklich, daß das Haus wie ein halb durchsichtiges Ei ist, man kann vom Kammerfenster bis zum Küchenfenster hindurchsehen. Wie ein Kükenkeim in einem Ei sitzt die alte Frau stets am Küchentisch. Die leerstehende Schule ist ihr nächster Nachbar. Auf dem »Pfingstsamstag 1965« ist dort geflaggt.
Den Älgåsen und den Tavelberg, die dem undurchdringlichen Himmel am nächsten sind, hat Adana mit Bärten aus Tannenbäumen bemalt. Am Fuß der Hänge ist hellerer Laubwald zu sehen. Die Diamantkate ist nicht mit aufs Bild gekommen, weil sie vom Wald verdeckt wird. Vielleicht wollte Adana sie auch gar nicht malen. Ihr Elternhaus war das von Strömgrens, und dort hat sie die Backstube, in der sie sommers immer gewohnt haben, so rot und mit weißen Ecken gemalt, wie sie einst war. Hinter der Backstube schimmert ein Gesicht durch das Laub und die Himbeerzweige.
Helga hat das Bild zum ersten Mal bei Isak gesehen, als es erst halb fertig war. Trotzdem war sie von seiner Genauigkeit so begeistert, daß ihr die Worte dafür fehlten. Sie selbst könne nicht einmal einen Katzensteiß zeichnen, der auch danach aussehe, behauptete sie. Als das Bild fertig war, bekam sie es.
In ihrer ersten Begeisterung steckte sie es in den Rahmen mit den Elfen und hängte es in der Kammer an die Wand, so daß es zu sehen war, wenn man von der Küche hereinkam, und auch, wenn man auf dem Sofa saß. Nach einiger Zeit mußte sie es umhängen.
Das war in dem Winter, als Egon Wedin rechtsseitig gelähmt im Obergeschoß lag und nicht mehr sprechen konnte. Er starb erst im Winter des folgenden Jahres nach Weihnachten. Das Bild hing in der Stube, und als die Zwangsversteigerung anstand, gab Helga es zur Auktionsmasse, obwohl es eigentlich ihr gehörte. Sie konnte es nicht mehr sehen.
Irgend etwas stimmte nicht mit dem Bild. Auf der Auktion erstand es die Lehrerin. Sie meinte, die Kinder hätten Spaß daran, es anzugucken. Aber dem war nicht so. Als die Schule geschlossen wurde, war das Bild nicht im Inventarverzeichnis aufgeführt, und die Lehrerin hatte es auch nicht in ihrer Wohnung hängen. Isak suchte sie in Adanas Namen auf und fragte, ob es noch vorhanden sei. Sie suchte es hervor, und die beiden bekamen es anstandslos zurück. Adana mochte das Bild, und sie war sich seines Wertes und seiner Eigenart durchaus bewußt.
Die Lehrerin und alle, die es sich öfter als einmal angesehen hatten, stimmten indes darin überein, daß an dem Bild irgend etwas verkehrt war. Doch selbst wenn man näher herantrat, um die Häuser, die runden Gesichter der Leute und die weißen und blauen Frühlingsblumen zu betrachten, konnte man keinen Grund nennen, weshalb es auf die Dauer unmöglich war, es in der Kammer an der Wand hängen zu haben.
Es waren Edvard Evansson und Helga, die Witwe Egon Wedins, sowie Wedins Tochter Åsa, die die im Dorf lange darniederliegende Schnapsbrennerei wiederaufnahmen. Helfeten half mit, weil sie mehr oder minder nicht umhinkamen, seine Hilfe anzunehmen, und erst genießbar machte den Schnaps eigentlich Isak Persson. Adana war natürlich auch mit von der Partie.
Die Ursachen waren mannigfach, die Folgen schwer überschaubar. Der Schnaps wurde schließlich sehr gut und hatte mit dem harten und übelriechenden Sprit, den sie bis dahin für vierundvierzig Kronen und fünfundfünfzig Öre den Liter im staatlichen Alkoholladen gekauft hatten, nichts gemein. Die Brennerei kam erst zu Pfingsten in Gang. Im Nachwinter war Helga allein. Edvard arbeitete dreihundert Kilometer südwärts in der Sulfitfabrik, und Åsa war in Stockholm.
Helgas Tage begannen alle gleich, als fahle Dämmerung in der ausgekühlten Kammer. Das Haus hatte von der nächtlichen Kühle Schmerzen, es knackte und ächzte. Helga blieb liegen, bis der Gråhundmischling in der Küche zu winseln anfing. Wenn sie den Hund hinausließ, kam er gerade noch die Vortreppe hinunter, bevor er einen ätzenden gelben Fleck in den Schnee pinkelte. Sie heizte den Kessel ein, sie machte Kaffee heiß und trank ihn ungesüßt zu zwei Zwiebäcken. Dann ging sie in die Kammer und stellte sich ohne Nachthemd vor den Schrankspiegel, als glaubte sie, eine solche Selbstzucht beim Frühstück würde sich unverzüglich am Bauch und an den Schenkeln bemerkbar machen. Sie trank eine zweite Tasse Kaffee am Küchentisch und saß ganz nahe an der Heizung, die allmählich lauwarm wurde. Auf dem Stuhl neben ihr lag die Katze, funkelte mit den Augen und fuhr die Krallen aus und ein.
Helga war den größten Teil des Dezembers, den ganzen Januar und den Februar bis zu der Woche, die mit dem Fastnachtssonntag beginnt, allein. Sie schlief viel. Die Kälte war meist streng, und es fiel kaum Schnee. Helga tat nichts Besonderes, raffte sich zu keiner Handarbeit auf, langweilte sich. Vormittags machte sie für gewöhnlich sauber, und wenn sie von Zeit zu Zeit die Teppiche hinausschaffte, dann nur wegen Vera Strömgren. Vera, die neben der Schule wohnte, schaffte freitags alle ihre Teppiche hinaus und klopfte sie kräftig. Ihre Füße steckten in Männerbotten und langen, grauen Wollsocken, die ihr fast bis an die Knie reichten, da sie sie nicht umkrempelte. Sie trug einen abgeschnittenen, eingesäumten Wintermantel als Jacke und hatte eine Baskenmütze auf. Diese wurde von einem karierten Wollschal festgehalten, der zugleich die Ohren wärmte. Vera war zweiundfünfzig, genau zehn Jahre älter als Helga.
Vor zwanzig Jahren, als Helga frisch vermählt auf Wedins Hof gekommen war, hatte sie Vera für ein altes Weib gehalten. Sie hatte schon seit der Konfirmation keine eigenen Zähne mehr, und die zehn Jahre zwischen ihnen waren für die gutaussehende Helga eine unüberwindliche Barriere. Nun aber glaubte sie fast zu ersticken, wenn sie Vera durchs Fenster anstarrte. O Gott! In zehn Jahren! Sie scheuchte die Katze vom Stuhl und rumpelte mit dem Staubsauger in die Kammer. So vergingen die Vormittage, und der Angst hielt sie insoweit stand, daß sie immerhin nicht im Bett blieb.
Als Egon Wedin sie einst mit ins Dorf brachte, wurde sie für überaus hübsch befunden: schwarzhaarig, regelmäßige Züge, kleine Nase, dunkelblaue Augen. Sie war klein und hatte seit damals um den Po und die Hüften zugelegt. Ihr Busen war nicht größer geworden. In jungen Jahren hatte sie Lachgrübchen gehabt, doch nun verlief von der Stelle des einen Grübchens zur anderen eine tief eingegrabene Furche unterm Kinn. Unter dieser Furche hatte sich die Haut verändert, sie hatte ihre Elastizität verloren und war leblos geworden. Das Haar war noch immer kräftig und saß tadellos, wenn sie es kämmte. Es war von vielen Silberfäden durchzogen, doch sie war nach wie vor unverkennbar schwarzhaarig. Wie schon im Alter von zwanzig Jahren hatte sie eine Frisur, die man Pagenkopf nannte und die sie dadurch zustande brachte, daß sie ihre Haare auf einen wurstähnlichen Lockenwickler drehte, der mit einem Gummiband auf dem Scheitel festgehalten wurde.
Sie war dreizehn Jahre mit Egon Wedin verheiratet, als er eine Gehirnblutung bekam und aus dem Sulky geworfen wurde. Der frisch erworbene Traber, fünfunddreißigtausend Kronen wert, ging durch und wurde auf der Reichsstraße von einem Lastwagen getötet. Edvard Evansson, der ursprünglich als Knecht auf den Hof gekommen war, mußte diesen in den verbleibenden Monaten bis zum Konkurs und zur Zwangsversteigerung nun allein bewirtschaften. Egon kam nicht mehr auf die Beine, sondern lag einseitig gelähmt darnieder und starrte selbst im Schlaf mit dem einen Auge, das er nicht mehr schließen konnte. Viele Leute glaubten, er sei dem Säuferwahn verfallen, doch das stimmte nicht.
Edvard und Helga schliefen miteinander vom zweiten Jahr an, das er bei ihnen arbeitete, nachdem sie sich angefreundet hatten und es gewohnt waren, sowohl bei der Arbeit als auch am Feierabend zusammenzusein. In den Zeiten, in denen Egon Wedin zu Hause war, war das schwierig für sie.
Hinter dem Waschhaus wuchsen Hopfenranken. Eines Augustabends hatte Helga ein Litermaß voll Hopfenzapfen gepflückt und Egon ins Kopfkissen gestopft. Da war er schon geschlagene drei Wochen zu Hause, und Edvard und Helga waren die ganze Zeit über nicht zusammengekommen. Er war sehr mißtrauisch.
Der Hopfen schläferte ihn ein, und er fiel in so tiefe Bewußtlosigkeit, daß Helga schon glaubte, sie hätten ihn umgebracht. Den ganzen nächsten Tag über hatte er Kopfschmerzen und mußte sich erbrechen. Sie wagte das nie wieder zu tun. Nach dem Unfall freilich brauchten sie keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, als sie selbst wollten, denn Egon konnte sich weder rühren noch sprechen.
Der Hof lag an einer steilen Halde; die Backstube, die Nebengebäude und der Brennholzschuppen waren schief vor Alter und sahen aus, als würden sie gleich den Hang hinunterrutschen. Das Wohnhaus und der Viehstall standen noch einigermaßen aufrecht. Hier hatte man es sich einst leisten können, großzügig mit Bauholz umzugehen – der Viehstall war so angelegt, als hätte man eine Kirche zu bauen begonnen. Nun stand er leer, die Fensterscheiben waren eingeschlagen, und die Türen hingen schief.
Das Wohnhaus war gezimmert und verschalt. Wind und Schnee hatten das Holz bearbeitet, bis es den gleichen milden Glanz angenommen hatte wie der Rücken alter Zibben. In einem gewissen Licht aber, meist im März und November, war das Haus grau wie die leibhaftige Hoffnungslosigkeit. Es war groß, doch hinter der eindrucksvollen Fensterreihe des Obergeschosses gähnte die Leere. Helga wohnte mit Gej und der Katze im Erdgeschoß. Sie benutzten lediglich die Küche und die Ecke der Kammer, in der der Fernseher und das Bett standen.
Die Landwirtschaft gehörte einst zu den größten dieser Gegend, zu Egon Wedins Zeit waren jedoch Veränderungen eingetreten. Es hieß, Wedin sei einer der Pioniere des Dorfes gewesen. Einer der Pioniere, was den Verkauf der Ackerkrume anbelangte. Nunmehr bestand das Wedinsche Anwesen nur noch aus dem Hofgrundstück samt Gebäuden. Helga mietete das Haus vom Forstunternehmen.
Egon Wedin hatte eine Zeitlang acht Pferde im Stall stehen gehabt. Sie trabten in ganz Norrland, und er konnte wochenlang fort sein. Im ersten Jahr ihrer Ehe war Helga manchmal dabei, der Stolz eines alten Mannes.
Jetzt konnte der Hof an der steilen Halde zwischen mehreren Schneefällen so gut wie unberührt daliegen. Katzen und Hermeline bestickten die weiße Decke mit ihren Pfoten, Vogelkrallen steppten rings um die Apfelbäume planlose Stiche. Aus dem Weiß ragten Rainfarn und zierliche Doldengewächse empor, die an feuchten Tagen von Frostkristallen verlängert wurden.
Am Kellerhang wuchsen im Sommer Steinnelken, Stiefmütterchen, Pechnelken und die Borsten der Brunelle. In der Julihitze duftete der Sandthymian, dann kam das Johanniskraut und schließlich der kräftig gelbe Rainfarn, der alle anderen Gerüche verdrängte. Helga hatte ein paar weiße Buschrosen in der Rabatte an der Vortreppe, ein Gestrüpp von Akeleien und vereinzelte brandgelbe Lilien. Der wilde Wein rankte noch immer bis zum Dachgeschoß, niemand hatte ihn beschnitten. Es war nicht mehr alles so wie früher, doch manchmal, wenn es sehr still war, fiel es Helga schwer, zu sagen, worin der Unterschied bestand.
Am elften Montag, an dem sie allein war, fuhr sie mit dem Tretschlitten zweimal zu Onkelchens Laden hinunter. Die Geführigkeit des Schnees war rauh in der Kälte. Als sie die Tür öffnete und es drinnen im Dunkeln bimmelte, wäre sie gern jemand anders gewesen, eine kaufkräftige und nicht verwandte Person. Es dauerte eine Weile, bis er aus dem Lagerraum geschlurft kam. Er trug karierte Filzlatschen gegen die Kälte, hohe Hausschuhe mit Spangen und Schnallen.
»Ach, du bist es«, sagte er.
Er roch wie sein Laden, und dieser Geruch erinnerte an eine alte Gewürzlade, doch war da auch eine Beimischung von etwas Ekligem, so als wäre zwischen Nelkenblüten und Pfefferkörnern versteckt Mäusekot vertrocknet.
Sie kaufte bei ihm Margarine, Frühstückswürstchen, Käse und Bier. Vom Hackfleisch sah sie trotz seines Zuredens ab. Es wurde schon dunkel und schorfig. Sie kaufte noch ein Kastenbrot.
»Und ich dachte, du würdest backen«, sagte Onkelchen.
»Ich brauche für mich allein nicht zu backen. Ich würde nur dasitzen und altes Brot essen.«
»Fünfzehn fünfundneunzig«, sagte Onkelchen gewissenhaft, ehe er die Summe in das braungestreifte Buch eintrug. Es war seine Liebe zu Zahlen und jeglicher Art Exaktheit, die ihn in diese nach Wurst und Waschmittel duftende Welt geführt hatte.
»Jetzt schuldest du mir hundertzweiundachtzig Kronen mehr, als du Rente hast«, sagte er, und als Helga nicht reagierte:
»Wann kommt denn Edvard wieder heim zu dir?«
»Nun, ich weiß nicht.«
Sie spürte, daß ihr Gesicht und ihr Hals fleckig wurden.
»Da ist es wohl recht einsam.«
Auch darauf reagierte sie nicht.
»Nun, ich weiß nicht«, echote Onkelchen schließlich, und damit versandete ihr Gespräch wie schon so oft.
Der Laden lag in der Nähe der alten Mühle, ein weißes, zweigeschossiges Haus mit einem Schaufenster im Parterre. Das hatte Onkelchen vor Jahren mit Jör-Waschmittelpaketen vollgestapelt, und zu Weihnachten hängte er immer bunte Glaskugeln dazwischen. Einige Kugeln waren kaputtgegangen, und die Scherben lagen nach wie vor zwischen den Waschmittelkartons. Es kam oft vor, daß die Leute vorbeifuhren und glaubten, der Laden habe wie der Konsum auch dichtgemacht.
Er hatte die Vortreppe nicht geräumt. Neuschnee lag, und außer Helgas Spuren war auf den Stufen nur ein Muster von Pfoten zu sehen, die nicht größer waren als Zehnörestücke. Er hatte am Vormittag keine Kundschaft gehabt, keine Lieferung. Nur das Hermelin.
Das Quecksilber kroch auf dreiundzwanzig Grad minus. Kein Auto kam den Hang herauf, kein Mensch auf einem Tretschlitten, nichts. Der triste Nachmittag senkte sich herab, das blaue Licht kam, und die Kälte nahm zu. Draußen wurde jegliches Lebenslicht heruntergedreht. Helga saß da und fragte sich, wo die Wasseramsel sei oder der Birkenzeisig. Das arme Helgawürmchen unter dem großen, leeren Himmel, es fürchtete den Nachmittag mehr als die Nacht und die Dunkelheit.
Die Dämmerung brach jetzt rasch herein, und die kleinen Häuser schwebten schwerelos zwischen Himmel und Schnee, das Blau verdichtete sich zu Schwarz. Helga weinte und verachtete sich selbst, weil sie da am Küchentisch saß und schluchzte. Sie spürte schon im voraus den Druck der langen Nacht und die Stille voller leiser Geräusche, voller Gescharr, Gezisch und Geknispel, womöglich Geräusper. Und die künstliche dumpfe Stille, wenn sie den kleinen Finger so weit wie möglich in den Gehörgang steckte und das andere Ohr fest ins Kissen preßte.
Sie wußte sehr wohl, daß bestimmte Arbeiten getan werden mußten, auch wenn einem das Geschick dazu fehlte. Was ihre selbstgebackenen Semmeln manchmal bewiesen hatten, ihre Webarbeiten mit den losen Kanten und gerissenen Kettfäden, dunkelbraunes Apfelmus, eingemachte Himbeeren, die schimmlig und dünnflüssig geworden waren. Sie wußte ebenso, daß etlichen Gefahren auch ohne Mut ins Auge geblickt werden mußte.
Auf jeden Fall aber wollte sie Zigaretten haben. Bevor es richtig dunkel war, nahm sie den Tretschlitten und fuhr noch einmal zu Onkelchen hinunter, um sich ein Päckchen zu kaufen. Sie hatte eigentlich aufgehört zu rauchen, und das wußte er.
Diesmal kam er nicht in den Laden heraus, als die Glocke bimmelte. Sie fand ihn im Lager auf dem Platz, auf dem er immer seinen Nachmittagskaffee trank. Er hatte sich ein Sirupbrot geschmiert, war aber nicht dazu gekommen, hineinzubeißen. Die Knäckebrotscheibe war mit der beschmierten Seite nach unten auf seinem Schoß gelandet, und der Sirup rann ihm zäh am Bein entlang. Ansonsten war alles still. Abrupt verließ Helga rückwärts den Raum und schloß die Tür. Mit zögernden, feierlichen Bewegungen knöpfte sie ihren Mantel auf und setzte sich auf den kunstlederbezogenen Hocker vor der Ladentheke. Sie fühlte sich innerlich so leer wie Onkelchens Körper auf der anderen Seite der Tür.
Als Vera Strömgren kam, um ein wenig Kaffee zu kaufen, fand sie Helga einsam im Laden vor. Sie saß da und rauchte, die Zigarettenpackung hatte sie dem Ständer auf der Ladentheke entnommen. Vera war ihr dabei behilflich, den Bezirksarzt anzurufen, und sie lieh ihr ein schwarzes Kleid.
»Denn eigentlich war er ja dein Onkel«, sagte sie, und das stimmte auch, obwohl alle Welt ihn Onkelchen genannt hatte. Der Doktor sagte, ihn habe der Schlag getroffen, und am Abend kam die Polizei und jagte ihr einen Schrecken ein. Es hatte jedoch alles seine Richtigkeit. Sie erklärten, sich alle Todesfälle, die außerhalb des Krankenhauses einträten, ansehen zu müssen. Helga hatte vom Doktor Beruhigungsmittel bekommen sowie ein Röhrchen mit starken Schlaftabletten. Sie dachte an die vielen Stunden traumlosen Schlafs, die in diesem Röhrchen steckten, und lehnte Veras Einladung, bei ihr zu übernachten, dankend ab. Bevor sie sich trennten, sagte Vera noch, sie solle Edvard anrufen.
Sie telefonierte bei Strömgrens in der Diele. Die Tür zur Küche stand halb offen, und Helga wurde nervös.
Edvard war nicht mehr dort. Er hatte in dem Werk aufgehört, seine Sachen gepackt und sein Zimmer gekündigt. Die Finnin, bei der er gewohnt hatte, wußte nicht, wohin er verschwunden war.
Für Edvard begann der elfte Montag damit, daß sie an einem Rohr ein Leck hatten. Er war umhergerannt und hatte es zu lokalisieren versucht, während die Luft vom Säuregeruch immer stickiger wurde. Der alte Bengtsson kümmerte sich derweilen allein um die Probeentnahme, und dann signalisierte er ihm, daß es Zeit für den Auslaß sei. Sie hatten acht Kocher, die über alle Etagen gingen, und irgendwo ganz weit oben wurden die Holzschnitzel nachgefüllt. Edvard und der alte Bengtsson sahen denjenigen, der die Nachfüllungen besorgte, jedoch nie. Meistens sahen sie die ganze Schicht über nur einander.
Der Alte war schon lange hier und gegen Leckagen fast unempfindlich. Er hatte nur ein Auge, und damit glotzte er Edvard jedesmal an, wenn er hörte, daß dieser hustete, weil ihm der Rachen brannte und stach. Als sie den Zellstoffbrei gerade auslassen wollten, schien sich das Leck plötzlich vergrößert zu haben, und Edvard bekam Nasenbluten, als er rannte, um Gasmasken zu holen.
Daheim in der Zellulosefabrik hatte er in der Putzerei gearbeitet. Das Gepolter war dermaßen laut gewesen, daß es ihm so oft vorgekommen war, als fielen und plumpsten die Stämme auch nach dem Ende der Schicht noch weiter in seinem Kopf. Der Geruch mußte jedoch gut gewesen sein, wenn Edvard damals auch nicht darüber nachgedacht hatte. Daheim war im Halbdunkel das Wasser über rauhe Wände geflossen, es war gesickert und getröpfelt und hatte über dem heiseren Lärm der Stämme in hellerem Ton seine eigene Weise gesungen. Edvard hatte sich, ohne darüber nachzudenken, in der Putzerei wohl gefühlt. Und hätte ihn ein derartiger Gedanke gestreift, dann hätte er angenommen, daß es vor allem an Per-Ola und Blommen liege, beides anständige, lustige Kerle, die in derselben Schicht wie er arbeiteten. Dieser Alte hier dagegen schwieg immer nur, und sein eines Auge sah meistens an Edvard vorbei. Es wirkte gekocht und trübe.
Diesmal mußten sie Hilfe anfordern, um das Leck zu lokalisieren, und es war ein Ingenieur aus dem Betriebsbüro, der Edvard ansah, als sie hinterher in der Kälte standen und ihre Gasmasken abnahmen. Er selbst wußte in dem Moment nicht, daß er blutete. Er hatte das lauwarme Getröpfel auf der Oberlippe vergessen, doch merkte er, daß er sich nur schwer auf den Beinen halten konnte, und er schämte sich vor dem Blick, der auf ihn gerichtet war. Der Ingenieur fragte, ob es ihm nicht gutgehe, und Edvard schüttelte den Kopf, ohne zu antworten. In eben diesem Augenblick kam ihm der Gedanke, daß er aufhören sollte.
Er hatte noch nie einen so schnellen Entschluß gefaßt. Trotzdem war er völlig überzeugt davon. Er lehnte sich zurück und spürte durch das blaue Arbeitshemd die rauhe Ziegelwand im Rücken, und als er die Augen schloß, konnte er die Tage in der Stadt und im Werk wie eine Reihe Bilder vor sich dahinwandern sehen. Auf jedem Bild waren der alte Bengtsson und der Wasserdampf und die ätzende Säure, die die Nase zum Laufen brachte und die Nerven wie eine harte Bohrerschneide im Magen rotieren ließ. Ferner war auf diesen Bildern Tuula Karjalainen, wie sie an der Spüle stand und Salzströmlinge mit Kartoffeln und Schweinefleisch zu diesem Pudding schichtete, den sie Sillakalatikko nannte.
Schweinefleisch mit Hering zu mischen war eine unnatürliche und eklige Verrichtung. Die lange schwarze Strähne, die sich aus Tuulas Scheitel löste und nach vorn über den Rest des Haars fiel, das in fettige Abschnitte unterteilt war, unterstrich dies nur. Diese starre Strähne zitterte nicht weiter als fünf Millimeter vor der Spitze ihrer Zigarette, und nicht viel weiter von dem Hering entfernt, den sie, mit dem Daumen die Rückengräte entlangfahrend, gerade filetierte, wippte manchmal die Aschensäule. So stand Tuula in diesen Bildern der Tage, die Edvard in den Sekunden vor seinem Entschluß vor sich wußte, auf eine eigentümliche, aber dennoch völlig natürliche Weise neben dem alten Bengtsson.
Oben im Betriebsbüro wollte man ihn zum Werksarzt schicken, doch er lehnte ab. Der Arbeitsschutzobmann kam und wollte mit ihm allein sprechen, aber auch das lehnte er ab und blieb stur dabei, daß, nein, kein größeres Unglück passiert sei, die Leckage bereits behoben und er nicht verletzt sei, nein, und er habe auch keinen Schock. Aber er wolle aufhören, und zwar jetzt. Der Ton wurde allmählich schärfer, doch Edvard gab nicht nach, und nach einer halben, dreiviertel Stunde war alles vorbei. Er marschierte mit seiner Proviantbox in der einen und dem Päckchen mit der zusammengelegten Arbeitskluft in der anderen Hand aus dem Betriebsbüro. Das Unternehmen schuldete ihm nicht viel, denn die Woche hatte soeben erst begonnen, und insgesamt besaß er vier Hunderter und ein paar Zehner, das wußte er, ohne nachzählen zu müssen. Nicht eben sonderlich viel, womit man zurückkehrte, nachdem man ausgezogen war, um in fernen Zellulosefabriken sein Glück zu machen, wahrlich nicht!
Er war noch nie während einer Schicht über das Fabrikgelände gegangen, und er war erstaunt, wie still und leer es war. Es erinnerte ihn daran, wie er einmal von der Schule nach Hause geschickt worden war, weil er Fieber bekommen hatte.
Tuula stand wie erwartet am Herd, als er kam, machte sich aber Kaffee, und als sie sich von ihrer Verwunderung erholt hatte, fragte sie, ob er auch einen haben wolle. Doch daß er in der Fabrik aufhören wollte, das verstand sie.
»Es ist kein Leben für einen verheirateten Mann, weit weg von zu Hause in Kost und Logis zu wohnen.«
»Ich bin nicht verheiratet«, sagte Edvard.
»Und die Frau, die dir manchmal Klamotten schickt?«
»Das ist die Frau des Bauern, für den ich früher gearbeitet habe. Ich bin dort wohnen geblieben.«
Tuula stand lässig in der Tür, während er packte. Er würde sie und ihren Kerl nicht vermissen. Der Mann arbeitete an den Entrindungstrommeln und war ein schweigsamer Typ, außer samstags abends, wenn er und Tuula sich eine Flasche Schnaps teilten und einen schwedischen Bürger zeugten.
Ende der Leseprobe