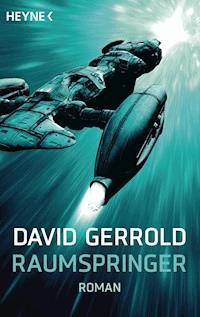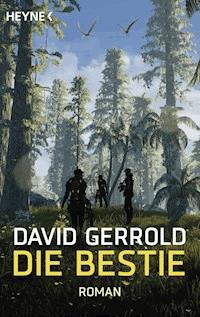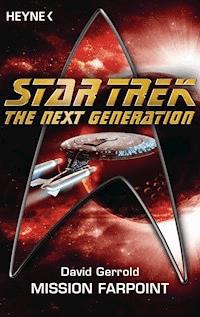5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Krieg gegen die Chtorr hat längst begonnen
Eine ganze Reihe verschiedener Seuchen, die sich über die komplette Erde ausgebreitet haben, hat 90 Prozent der Menschheit ausgelöscht. Die Überlebenden versuchen gerade, aus den Trümmern der Gesellschaft wieder eine funktionierende Zivilisation zu erschaffen, als die Chtorraner auftauchen: Aliens, die wie riesige orangefarbene Würmer aussehen und einen gewaltigen Appetit haben. Sie bringen Tiere und Pflanzen mit, wie sie die Erde noch nie gesehen hat. Die Menschheit begreift, dass die Seuchen kein Zufall waren, sondern die erste Welle einer Invasion aus dem All. Die zweite Welle soll das, was von den Menschen noch übrig ist, auslöschen, um den Planeten zu übernehmen. Doch woher kommen die Invasoren? Und sind die Würmer intelligent? Jim McCarthy, Wissenschaftler im Dienste der Armee, will genau das herausfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Ähnliche
DAVID GERROLD
DIE BIOLOGISCHE
INVASION
Roman
Das Buch
Eine ganze Reihe verschiedener Seuchen, die sich über die komplette Erde ausgebreitet haben, hat 90 Prozent der Menschheit ausgelöscht. Die Überlebenden versuchen gerade, aus den Trümmern der Gesellschaft wieder eine funktionierende Zivilisation zu erschaffen, als die Chtorraner auftauchen: Aliens, die wie riesige orangefarbene Würmer aussehen und einen gewaltigen Appetit haben. Sie bringen Tiere und Pflanzen mit, wie sie die Erde noch nie gesehen hat. Die Menschheit begreift, dass die Seuchen kein Zufall waren, sondern die erste Welle einer Invasion aus dem All. Die zweite Welle soll das, was von den Menschen noch übrig ist, auslöschen, um den Planeten zu übernehmen. Doch woher kommen die Invasoren? Und sind die Würmer intelligent? Jim McCarthy, Wissenschaftler im Dienste der Armee, will genau das herausfinden.
Der Autor
David Gerrold wurde am 24. Januar 1944 als Jerrold David Friedmann in Chicago geboren. Er studierte Theaterwissenschaften in Los Angeles und schloss 1967 mit einem B.A. ab. Am 8. September 1966 sah er die erste Folge der TV-Serie Star Trek im Fernsehen und war so begeistert, dass er Produzent Gene L. Coon einen Entwurf für eine Doppelfolge schickte, die dieser allerdings ablehnte. Coon erkannte jedoch Gerrolds Talent und bat ihn um weitere Ideen. Eine davon war »Kennen Sie Tribbles?«, die für den Hugo Award nominiert wurde und heute eine der beliebtesten Star-Trek-Episoden ist. Nachdem er einige Kurzgeschichten in Magazinen veröffentlicht hatte, schrieb Gerrold zusammen mit Larry Niven seinen ersten Roman, die SF-Humoreske »Die fliegenden Zauberer«. Anfang der Siebzigerjahre folgten die hochgelobten Romane »Ich bin Harlie« und »Zeitmaschinen gehen anders«, die heute zu den Klassikern des Genres gehören. In den Achtzigern begann Gerrold mit seinem Chtorr-Zyklus, an dem er bis heute arbeitet. Daneben schreibt er weiter Drehbücher, unter anderem zu der für den Nebula-Award nominierten
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Titel der Originalausgabe
A MATTER FOR MEN
Aus dem Amerikanischen von Heinz Nagel
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1983 by David Gerrold
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Die nachfolgend genannten Personen haben mich in wertvoller Weise unterstützt und wichtige Beiträge zu diesem Buch geleistet:
Dennis Ahrens
Jack Cohen
Diane Duane
Richard Fontana
Harvey und Johanna Glass
Robert und Ginny Heinlein
Don Hetsko
Rich Sternbach
Chtorr (Ktorr), das: 1. der Planet Chtorr, der vermutlich in einer Distanz von dreißig Lichtjahren existiert. 2. das Sternsystem, in dem sich dieser Planet befindet; ein Stern vom Typ Roter Riese, unbekannter Identität. 3. die herrschende Spezies des Planeten. 4. in formellem Gebrauch entweder ein oder mehrere Angehörige dieser Spezies, ein Chtorr, die Chtorr (s. a.: Chtorraner). 5. der glottale zirpende Ruf eines Chtorr.
Chtorraner (Ktorraner), der: 1. jede auf Chtorr beheimatete Lebensform. 2. im allgemeinen Gebrauch ein Angehöriger der Primärspezies, der (mutmaßlich) intelligenten Lebensform Chtorr.
chtorranisch (ktorranisch), (Adj.): 1. dem Planeten oder dem Sternsystem Chtorr zugehörig. 2. auf Chtorr geboren.
EINS
»McCarthy, druntenbleiben!«
»Ja, Sir.«
»... und Maul halten.«
Ich hielt es. Wir waren insgesamt fünf und kletterten den Hang eines schwach bewaldeten Bergkamms hinauf. Wir arbeiteten uns schräg durch hohes gelbes Gras, das so trocken war, dass es knisterte. Der Juli war in Colorado nicht freundlich gewesen. Ein einziger Funke würde ausreichen, diese Berge in ein flammendes Inferno zu verwandeln.
Unmittelbar bevor jeder einzelne den Kamm erreichte, presste er sich flach gegen den Hang und schob sich dann langsam Zentimeter für Zentimeter nach vorne. Duke hatte die vorderste Position und wand sich wie eine Schlange durch das hohe Gras. Wir hatten heute auf diese Weise bereits fünf Hügel hinter uns gebracht, und die Hitze fing an, ihre Wirkung zu zeigen. Ich dachte an Eiswasser und den Jeep, den wir auf der Straße zurückgelassen hatten.
Duke schob sich nach oben und spähte in das Tal hinunter, das dahinterlag. Jetzt schoben sich Larry, Louis und Shorty, einer nach dem anderen neben ihm herauf. Ich war der letzte – wie gewöhnlich. Die anderen hatten sich das Land schon gründlich betrachtet, als ich sie schließlich eingeholt hatte. Ihre Gesichter wirkten grimmig.
Duke brummte: »Larry, reich mir den Feldstecher.«
Larry wälzte sich auf die linke Seite, um das Etui von seiner rechten Hüfte abzuschnallen. Wortlos reichte er das Glas hinüber.
Duke inspizierte das Land unter uns so sorgfältig wie ein Wolf, der eine Falle beschnuppert. Dann grunzte er wieder, diesmal leiser, und reichte den Feldstecher zurück.
Jetzt sah Larry sich die Szene an. Er warf einen Blick darauf und reichte das Glas dann an Louis weiter.
Was sie nur sahen? Auf mich machte dieses Tal genau denselben Eindruck wie all die anderen. Bäume und Felsen und Gras. Ich konnte sonst nichts sehen. Was sie wohl entdeckt haben mochten?
»Nun?«, fragte Duke.
»Würmer«, sagte Larry.
»Ohne Frage«, fügte Louis hinzu.
Würmer! Endlich! Ich nahm das Glas von Shorty entgegen und sah mir den gegenüberliegenden Abhang an.
Ein Bach schlängelte sich durch spärliches Gehölz, das so aussah, als hätte man es in letzter Zeit abgeholzt. Und zwar ziemlich schlecht. Baumstümpfe und abgebrochene Äste, zersplitterte Stämme, riesige Streifen von Borke und der unvermeidliche Teppich aus abgestorbenen Blättern und Zweigen waren unregelmäßig über die Hügelflanke verteilt. Der Wald sah aus, als hätte ein wandernder, ziemlich wählerischer prähistorischer Pflanzenfresser von gewaltigen Proportionen mit ebensolchem Appetit ihn zerkaut und wieder ausgespuckt.
»Nein, dort unten«, brummte Shorty. Er zeigte.
Ich drückte mir den Feldstecher wieder gegen die Augen. Ich konnte es immer noch nicht sehen; die Talsohle war ungewöhnlich karg und leer – nein, Augenblick, dort war es – fast wäre es mir entgangen – unmittelbar unter uns, in der Nähe einer größeren Baumgruppe, ein klebrig aussehender Iglu und eine größere kreisförmige Umfriedung. Die Wände waren nach innen geneigt. Es sah aus wie eine nicht ganz fertig gestellte Kuppel. War das alles?
Shorty tippte mir auf die Schulter und nahm mir den Feldstecher weg. Er reichte ihn Duke zurück, der den Recorder eingeschaltet hatte. Duke räusperte sich, während er sich das Glas an die Augen hielt, und begann dann mit einer detaillierten Beschreibung der Szene. Er sprach leise und in kurzen Stößen, wie ein Maschinengewehr – ein monotoner, schneller Bericht. Er las Landmarken ab, als würde er Punkte auf einer Liste abhaken. »Nur eine Behausung – und die sieht ziemlich neu aus. Keine Anzeichen von irgendwelchen anderen Aktivitäten – ich schätze, bis jetzt nur eine Familie – aber die müssen mit Ausweitung rechnen. Sie haben eine ziemlich weite Fläche freigemacht. Standardkonstruktion, sowohl was die Kuppel als auch was den Pferch angeht. Pferchwände sind etwa ... zweieinhalb – nein, sagen wir drei – Meter hoch. Ich glaube nicht, dass jetzt schon etwas drinnen ist. Ich ...« Er hielt inne und atmete dann langsam aus. »Verdammt.«
»Was ist denn?«, fragte Larry.
Duke reichte ihm den Feldstecher.
Larry sah durch. Er brauchte einen Augenblick, um das zu finden, was Duke beunruhigte, dann erstarrte er. »Oh, Herrgott nein ...«
Er reichte Louis das Glas. Ich schwitzte ungeduldig. Was hatte er gesehen? Louis studierte den sich ihm bietenden Anblick, ohne etwas zu sagen, aber seine Gesichtsmuskeln spannten sich.
Shorty reichte mir das Glas. »Willst du nicht sehen ...« Ich griff danach, wollte etwas sagen, aber er hatte die Augen geschlossen, als wollte er mich und den Rest der Welt von sich ausschließen.
Neugierig suchte ich wieder die Landschaft ab. Was war mir beim ersten Mal entgangen?
Ich richtete das Glas zuerst auf den Unterstand – dort war nichts. Es war eine schlecht gebaute Kuppel aus Holzsplittern und einem Klebstoff aus gemahlenem Holz. Ich hatte Bilder davon gesehen. Aus der Nähe betrachtet, würde die Oberfläche rau sein und so aussehen, als hätte man sie mit einer Schaufel geglättet. Die Kuppel hier war von einer Art dunkler Vegetation umgeben, Flecken aus schwarzem Zeug, die in Büscheln bis an die Kuppel heranwuchsen. Ich ließ meinen Blick zu der Umfriedung wandern ...
»Hm?«
Sie konnte höchstens fünf oder sechs Jahre alt sein. Sie trug ein zerrissenes, ausgebleichtes braunes Kleid und hatte Schmutzflecken an der linken Wange und Aufschürfungen an beiden Knien und hüpfte an der Mauer entlang, strich mit einer Hand an der unebenen Oberfläche entlang. Ihr Mund bewegte sich – sie sang beim Hüpfen. Als ob sie überhaupt nichts zu befürchten hätte. Sie umkreiste die Mauer, verschwand einen Augenblick lang aus meiner Sicht und tauchte dann an der gegenüberliegenden Krümmung wieder auf. Ich sog die Luft ein. Ich hatte eine Nichte im gleichen Alter.
»Jim – das Glas.« Das war Larry; ich reichte es ihm zurück. Duke legte seinen Tornister ab, behielt nur ein Seil und den Haken.
»Will er sie holen?«, flüsterte ich Shorty zu.
Shorty gab keine Antwort. Er hatte immer noch die Augen geschlossen.
Larrys Blick suchte wieder das Tal ab. »Scheint sauber zu sein«, sagte er, aber sein Tonfall ließ erkennen, dass er Zweifel daran hatte.
Duke band sich den Haken an den Gürtel. Er blickte auf. »Wenn ihr etwas seht, dann schießt.«
Larry senkte das Glas und sah ihn an – dann nickte er.
»Okay«, sagte Duke. »Dann wollen wir's packen.« Er schickte sich an, über den Hügelkamm zu klettern.
»Halt mal!« Das war Louis; Duke hielt inne. »Ich dachte, ich hätte dort eine Bewegung gesehen – bei den Bäumen.«
Larry richtete das Glas darauf. »Mhm«, sagte er und reichte das Glas Duke, der sich etwas zur Seite drehte, um besser sehen zu können. Er studierte die verschwommenen Schatten einen Augenblick lang. Ich tat es ihm gleich, konnte aber nicht sagen, was die eigentlich sahen. Duke glitt wieder den Hügel herunter und presste sich gegen Larry und gegen den Boden.
»Wollen wir Strohhalme ziehen?«, fragte Larry.
Duke ignorierte ihn völlig; er war irgendwo anders. An irgendeinem unangenehmen Ort.
»Boss?«
Duke kam zurück. Er hatte einen eigenartigen Gesichtsausdruck – hart –, und sein Mund war zusammengepresst. »Gib mir die Knarre«, war alles, was er sagte.
Shorty nahm die 7-mm-Weatherby, die er den ganzen Morgen und Nachmittag getragen hatte, von der Schulter, legte sie aber, statt sie Duke zu reichen, sorgfältig ins Gras und schob sich dann rückwärts den Abhang herab. Louis folgte ihm. Ich starrte ihnen nach. »Wo gehen die hin?«
»Shorty musste mal«, fuhr Larry mich an. Er schob die Waffe Duke hinüber.
»Aber Louis ist auch gegangen ...«
»Louis ist mitgegangen, um ihm die Hand zu halten.« Larry griff wieder nach dem Feldstecher und ignorierte mich. Dann sagte er: »Zwei sind's, Boss, vielleicht auch drei.«
Duke grunzte: »Kannst du sehen, was die machen?«
»Nein – aber sie sehen verdammt aktiv aus.«
Duke gab keine Antwort.
Larry legte das Glas hin. »Jetzt muss ich auch pinkeln.« Und entfernte sich in Richtung auf Shorty und Louis, wobei er Dukes Tornister hinter sich herzerrte.
Ich starrte zuerst Larry, dann Duke an. »Hey, was soll ...«
»Sei still«, sagte Duke. Er blickte durch die lange schwarze Röhre der Sony Magna-Sight. Er stellte Windgeschwindigkeit und Entfernungskorrekturen ein; im Kolben war ein Ballistikprozessor eingebaut, der mit der Magna-Sight verbunden war, und die Waffe war auf einem Präzisionsstativ verankert.
Ich streckte mich etwas und griff mir den Feldstecher. Unten hatte das kleine Mädchen jetzt aufgehört, im Kreis zu hüpfen; sie hockte jetzt im Sand und zog mit dem Finger Linien. Ich ließ meinen Blick zu den Bäumen in der Ferne wandern. Etwas von purpurner und roter Farbe bewegte sich zwischen ihnen. Der Feldstecher war elektronisch, mit automatischem Zoom, synchronisierter Fokussierung, Tiefenschärfenkorrektur und Antivibration; aber ich wünschte mir, wir hätten stattdessen einen mit Allwetterbildverstärker. Damit hätte man vielleicht sehen können, was hinter diesen Bäumen vor sich ging.
Neben mir konnte ich hören, wie Duke ein neues Magazin in den Karabiner drückte.
»Jim?«, sagte er.
Ich sah zu ihm hinüber.
Er hatte den Blick immer noch nicht vom Visier gewandt. Seine Finger arbeiteten an den Steuerungsschaltern, während er die Zahlen eingab. Die einzelnen Schalter klickten befriedigend massiv. »Hast du nicht auch Druck auf der Blase?«
»Hm? Nein, ich war, ehe wir weggegangen ...«
»Wie du willst.« Er sagte nichts mehr und spähte in sein Okular. Ich sah wieder durch den Feldstecher auf die purpurfarbenen Geschöpfe im Schatten. Waren das Würmer? Ich war enttäuscht, dass die Bäume sie verbargen. Ich hatte noch nie lebende Chtorraner gesehen.
Mein Blick wanderte über die ganze Fläche, in der Hoffnung, einen auf freiem Feld zu entdecken – aber das Glück blieb mir versagt. Aber ich sah, wo sie angefangen hatten, den Bach zu stauen. Ob sie wohl amphibisch waren? Ich sog die Luft ein und versuchte, den Feldstecher wieder auf den Wald einzustellen. Ein einziger freier Blick, das war alles, was ich wollte ...
Das CRA-A-ACK! des Karabiners ließ mich zusammenzucken. Ich versuchte, den Feldstecher neu einzustellen – die Kreaturen bewegten sich immer noch ungestört. Worauf hatte Duke dann geschossen? Mein Blick wanderte zu der Umfriedung hinüber – wo eine kleine Gestalt blutend im Staub lag. Ihre Arme zuckten.
Ein zweites CRA-A-ACK!, und ihr Kopf blühte wie eine Blume aus flammendem Rot auf ...
Ich riss erschreckt meine Augen von dem Bild los und starrte Duke an. »Was, zum Teufel, machst du da?«
Duke starrte gebannt durch das Teleskopvisier und wartete, ob sie sich noch einmal bewegte. Als sie das nicht tat, hob er den Kopf vom Visier und starrte über das Tal. Starrte die versteckten Chtorraner an. Lange Zeit tat er das. Sein Ausdruck war ... weit entfernt. Einen Augenblick lang dachte ich, er befände sich in Trance. Dann schien er wieder zum Leben zu erwachen und glitt den Hügel hinunter, dort wo Shorty und Louis und Larry warteten. Auch ihr Gesichtsausdruck war eigenartig, und sie konnten oder wollten einander offenbar nicht in die Augen sehen.
»Kommt«, sagte Duke und schob Shorty den Karabiner hin. »Verschwinden wir hier.«
Ich folgte ihnen. Ich muss wohl gemurmelt haben. »Der hat sie erschossen«, sagte ich die ganze Zeit. »Der hat sie erschossen ...«
ZWEI
Am Ende fand ich mich in Dr. Obamas Büro.
»Setzen Sie sich, McCarthy.«
»Ja, Ma'am.«
Ihre Augen waren sanft, und ich kam nicht von ihnen los. Sie erinnerte mich an meinen Großvater; er hatte denselben Trick beherrscht, einen so traurig anzusehen, dass er einem mehr leid tat als man sich selbst. Wenn sie sprach, war ihre Stimme distanziert, fast bewusst ausdruckslos. Mein Großvater hatte auch so gesprochen, wenn er etwas auf dem Herzen gehabt hatte, und er sich darauf hatte hinarbeiten müssen. »Ich höre, Sie hatten gestern Nachmittag ein wenig Ärger.«
»Äh – ja, Ma'am.« Ich schluckte. »Das heißt, wir hatten den Ärger. Duke hat ein kleines Mädchen erschossen.«
Dr. Obama sagte sanft: »Ja, ich habe den Bericht gelesen.« Sie machte eine kleine Pause. »Sie haben ihn nicht unterschrieben, so wie die anderen. Wollen Sie etwas hinzufügen?«
»Ma'am ...«, sagte ich. »Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Wir haben ein kleines Mädchen erschossen.«
Ihre Augen verengten sich nachdenklich. »Ich verstehe. Das beunruhigt Sie.«
»Ob es mich beunruhigt? Ja, Ma'am. Mich beunruhigt das.«
Dr. Obama sah auf ihre Hände. Sie lagen höflich gefaltet vor ihr auf dem Schreibtisch, sorgfältig manikürt, dunkel und von den Jahren runzelig. »Es hat nie jemand gesagt, dass es einfach sein würde.«
»Sie haben auch nie etwas gesagt, dass man Kinder erschießen würde.«
»Ich hatte gehofft, dass das nicht nötig sein würde.«
»Dr. Obama, ich weiß nicht, was es für eine Erklärung dafür gibt, aber ich kann nicht billigen ...«
»Ihre Billigung ist auch nicht erforderlich!« Ihr Gesicht war plötzlich ganz hart. »Duke hat Ihnen den Feldstecher gereicht, oder?«
»Ja, Ma'am. Einige Male.«
»Und was haben Sie gesehen?«
»Zuerst sah ich nur die Kuppel und die Umfriedung. Beim zweiten Mal sah ich dann das kleine Mädchen.«
»Und was hat Duke dann getan?«
»Nun, es sah so aus, als ob er sie befreien würde, aber dann hat er es sich anders überlegt und stattdessen den Karabiner verlangt.«
»Wissen Sie, warum er das getan hat?«
»Louis sagte, er hätte etwas gesehen.«
»Hm. Haben Sie noch einmal durch den Feldstecher gesehen, um das zu überprüfen?«
»Ja, Ma'am – aber das habe ich getan, weil ich neugierig war. Ich hatte noch nie Würmer gesehen ...«
Sie schnitt mir das Wort ab. »Aber als Sie durchsahen, haben Sie sie gesehen, nicht wahr?«
»Ich habe etwas gesehen ...« Ich zögerte. »Ich war mir nicht sicher, was es war.«
»Wie hat es denn ausgesehen?«
»Es war groß, purpurfarben oder rot, das war schwer festzustellen.«
»Die Chtorr haben purpurfarbene Haut und vielfarbigen Pelz. Je nach den Lichtverhältnissen kann der rot, rosa, violett oder orange aussehen. Ist es das, was Sie gesehen haben?«
»Ich sah etwas Purpurfarbenes. Es war im Schatten, und es bewegte sich die ganze Zeit hin und her.«
»Hat es sich schnell bewegt?«
Ich versuchte, mich zu erinnern. Was war schnell für einen Wurm? »Irgendwie schon«, zögerte ich.
»Dann war das, was Sie gesehen haben, ein ausgewachsener Chtorr in der aktiven – und gefährlichsten – Phase. Duke hat ihn erkannt, ebenso Larry, Louis und Shorty. Sie haben den Bericht unterzeichnet.«
»Ich kann das nicht wissen – ich habe noch nie einen Chtorr gesehen. Deshalb bin ich hier.«
»Wenn die gesagt haben, dass es ein Chtorr war, dann können Sie sicher sein, dass es einer war – aber deshalb haben sie ja den Feldstecher herumgereicht, um sicher zu sein; wenn Duke sich geirrt hätte, dann hätte es ganz bestimmt einer der anderen bemerkt.«
»Um die Identifizierung geht es mir auch nicht ...«
»Nun, das sollte es aber«, sagte Dr. Obama. »Das ist der einzige Grund, den Sie dafür vorbringen können, diesen Bericht nicht zu unterzeichnen.« Sie tippte das Papier auf ihrem Schreibtisch an.
Ich warf einen vorsichtigen Blick darauf. Dad hatte mich davor gewarnt, Dinge zu unterschreiben, bei denen ich mir nicht ganz sicher wäre – er hatte auf diese Weise Mutter geheiratet. Wenigstens behauptete er das immer. Ich sagte: »Dieses kleine Mädchen, das wir erschossen haben – ich sehe sie die ganze Zeit in diesem Pferch herumrennen. Sie war nicht in Gefahr; es gab keinen Grund, sie zu erschießen ...«
»Falsch«, sagte Dr. Obama. »Falsch, und zwar zweimal. Das sollten Sie wissen.«
»Ich sollte gar nichts wissen«, sagte ich plötzlich zornig. »Man hat mir nie irgendetwas gesagt. Man hat mich aus einer Landaufbereitungseinheit hierher versetzt, weil jemand herausgefunden hatte, dass ich auf dem College zwei Jahre Biologie studiert hatte. Jemand anderer hat mir eine Uniform und ein Buch mit den Vorschriften gegeben – und das war meine ganze Ausbildung.«
Dr. Obama blickte verblüfft, resigniert und frustriert, und das alles gleichzeitig. Fast im Selbstgespräch – aber laut genug, dass ich es auch hören konnte – sagte sie: »Was, zum Teufel, tun die eigentlich? Die schicken mir Kinder ...«
Ich war immer noch empört. »Duke hätte auf den Chtorr schießen sollen!«, beharrte ich.
»Womit denn?«, fauchte Dr. Obama mich an. »Hatten Sie Artillerie bei sich?«
»Wir hatten einen Hochleistungskarabiner ...«
»Und der Chtorr war mehr als siebenhundert Meter entfernt, und das an einem windigen Tag!«
Ich murmelte irgendetwas von wegen hydrostatischem Schock.
»Was war das?«
»Hydrostatischer Schock. Das passiert, wenn eine Kugel auf Fleisch auftrifft. Sie erzeugt eine Schockwelle. Die Zellen sind wie kleine Wasserballons, sie platzen. Das ist es, was einen tötet, nicht das Loch.«
Dr. Obama atmete tief durch. Ich konnte deutlich sehen, dass sie sich zwang, geduldig zu bleiben. »Ich wusste bereits, was hydrostatischer Schock ist. Das trifft hier nicht zu. Sie gehen von der Annahme aus, dass chtorranisches Fleisch wie menschliches Fleisch ist. Das ist es nicht. Selbst wenn Duke aus zwei Meter Distanz geschossen hätte, so hätte das nichts genützt, wenn er nicht das Glück gehabt hätte, eines ihrer Augen zu treffen – oder wenn er ein Explosivgeschoss gehabt hätte, was nicht der Fall war. Er hatte also keine Wahl; er musste mit der Munition schießen, die er hatte.« Dr. Obama hielt inne. Sie senkte die Stimme. »Hören Sie, junger Mann, es tut mir leid, dass Sie die harten Realitäten dieses Krieges so schnell erleben mussten, aber ...« Sie hob die Hände in einer um Entschuldigung bittenden Geste, die halb ein Achselzucken, halb ein Seufzen war, und ließ sie dann wieder sinken. »Nun, es tut mir einfach leid, das ist alles, was ich sagen kann.«
Und dann fuhr sie mit weicher Stimme fort. »Wir wissen nicht, wie die Chtorr innen aussehen – deshalb wollen wir Sie ja hier haben. Sie sind so etwas wie ein Wissenschaftler. Wir hoffen, dass Sie es uns sagen werden. Die Chtorr scheinen ziemlich gut gepanzert oder segmentiert oder sonst etwas zu sein. Kugeln haben auf sie keine große Wirkung – und um das festzustellen, mussten eine ganze Menge guter Männer sterben. Entweder dringen sie nicht auf dieselbe Weise ein, oder die Chtorraner haben keine lebenswichtigen Organe, die von einer Kugel zerrissen werden können. Und verlangen Sie bloß nicht von mir, dass ich Ihnen erkläre, wie das möglich ist, weil ich es nämlich auch nicht weiß. Ich zitiere nur aus den Berichten.
Aber eines wissen wir – aus höchst unglücklicher Erfahrung –, dass man, wenn man auf einen Chtorraner schießt, Selbstmord begeht. Ob sie nun intelligent sind oder nicht – wie manche Leute denken – macht keinen Unterschied. Sie sind tödlich. Selbst ohne Waffen. Sie bewegen sich schnell und töten voll Wut. Das Schlaueste ist, überhaupt nicht auf sie zu schießen.
Duke wollte dieses Kind retten – wahrscheinlich mehr als Ihnen klar ist – weil er wusste, was die Alternative zur Rettung war. Aber als Louis im Wald Chtorr sah, hatte Duke keine Wahl – er wagte nicht mehr, zu dem Mädchen zu laufen. Die hätten ihn auf halbem Wege den Hügel hinunter erspäht. Und er wäre tot gewesen, ehe er sich noch zehn Meter bewegt hätte. Wahrscheinlich die anderen in Ihrer Gruppe auch. Mir gefällt das auch nicht, aber was er getan hat, war ein Akt der Barmherzigkeit.
Deshalb reichte er den Feldstecher herum; er wollte sicher sein, dass er keinen Fehler machte – er wollte, dass Sie und Shorty und Larry ihn überprüften. Wenn auch nur einer von Ihnen den leisesten Zweifel gehabt hätte, hätte er das nicht getan, was er getan hat; er hätte es nicht zu tun brauchen – und wenn ich glaubte, dass Duke dieses Kind unnötig getötet hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass man ihn so schnell vor ein Erschießungskommando stellt, dass er nicht einmal mehr Zeit hätte, seine Unterwäsche zu wechseln.«
Ich dachte darüber nach. Ziemlich lang sogar.
Dr. Obama wartete. Ihre Augen waren geduldig.
Ich sagte, plötzlich: »Aber Shorty hat gar nicht hingesehen.«
Sie war überrascht. »Hat er das nicht?«
»Nur das erste Mal«, antwortete ich. »Als wir das Kind sahen, hat er nicht hingesehen, und ich auch nicht, um zu bestätigen, dass das Chtorr waren.«
Dr. Obama brummelte etwas. Sie schrieb ein paar Worte auf einen Notizblock. Es erleichterte mich, dass ihre Augen mich auch nur einen Augenblick lang losließen. »Nun, das ist Shortys Vorrecht. Er hat so viele von diesen ... gesehen.« Sie war mit ihrer Notiz fertig und sah mich wieder an. »Für ihn reichte es, die Umfriedung zu sehen. Aber im Augenblick bereiten Sie uns Kopfzerbrechen. Sie haben doch keine Zweifel daran, dass das, was Sie gesehen haben, Chtorr waren?«
»Ich habe nie einen Chtorraner gesehen, Ma'am. Aber ich glaube nicht, dass das etwas anderes hätte sein können.«
»Gut. Dann wollen wir doch mit diesem Unfug aufhören.« Sie schob den Bericht über den Schreibtisch. »Ich hätte Ihre Unterschrift gerne auf der untersten Zeile.«
»Dr. Obama. Bitte – ich hätte gerne gewusst, warum es notwendig war, dieses kleine Mädchen zu töten.«
Wieder blickte Dr. Obama verblüfft, das zweite Mal, seit das Gespräch begonnen hatte. »Ich dachte, Sie wüssten das.«
Ich schüttelte den Kopf. »Darum geht es hier ja. Ich weiß es nicht.«
Sie hielt inne. »Tut mir leid ... es tut mir wirklich leid. Mir war nicht bewusst – kein Wunder, dass ich Sie nicht überzeugen konnte ...« Sie erhob sich hinter ihrem Schreibtisch und ging an einen Aktenschrank. Sie schloss ihn auf, zog einen dünnen Hefter heraus – er trug den roten Stempelaufdruck GEHEIM – und kehrte dann zu ihrem Stuhl zurück. Sie hielt den Hefter nachdenklich in der Hand. »Manchmal vergesse ich, dass das meiste, was wir über die Chtorr wissen, nur einem beschränkten Kreis zugänglich ist.« Sie musterte mich nachdenklich. »Aber Sie sind Wissenschaftler.«
Damit schmeichelte sie mir, und das wussten wir beide. Niemand war mehr irgendetwas. Um es ganz genau zu sagen, ich war Student auf Urlaub, im Augenblick unter Vertrag bei den Bewaffneten Streitkräften der Vereinigten Staaten, Spezialeinsatz, und das als Exobiologe.
»Also sollten Sie auch ein Recht darauf haben, diese Dinge zu sehen.« Aber trotzdem reichte sie mir den Hefter immer noch nicht. »Wo kommen Sie her?«, fragte sie abrupt.
»Santa Cruz, Kalifornien.«
Dr. Obama nickte. »Nette Stadt. Ich hatte einmal Freunde nördlich davon – aber das liegt lange Zeit zurück. Lebt von Ihrer Familie noch jemand?«
»Ja, Mom. Dad war in San Francisco, als es – als es ...«
»Das tut mir leid. Eine Menge guter Leute mussten sterben, als San Francisco unterging. Ist Ihre Mutter noch in Santa Cruz?«
»Ich denke schon. Das letzte, was ich von ihr gehört habe, war, dass sie bei den Flüchtlingen mithilft.«
»Sonstige Verwandte?«
»Eine Schwester, sie wohnt in der Nähe von L.A.«
»Verheiratet?«
»Ja. Sie hat eine fünfjährige Tochter.« Ich grinste bei dem Gedanken an meine Nichte. Das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, hatte sie gerade das Windelstadium hinter sich. Bei dem Gedanken wurde ich wieder traurig. »Sie hatte drei. Die zwei anderen waren Jungs. Die wären jetzt sechs und sieben.«
Dr. Obama nickte. »Trotzdem, sie kann von Glück sagen. Und Sie auch. Es gibt nicht viele Leute, bei denen so viele Familienmitglieder die Seuchen überlebt haben.« Ich musste ihr recht geben.
Ihr Gesicht wurde jetzt finster. »Haben Sie je von einer Stadt mit dem Namen Show Low gehört?«
»Ich glaube nicht.«
»Das ist in Arizona – das war in Arizona. Jetzt ist nicht mehr viel davon übrig. Es war eine nette Stadt; sie hatte ihren Namen von einem Pokerspiel ...« Dr. Obama sprach nicht weiter; sie legte den Aktendeckel vor sich auf den Schreibtisch und klappte ihn auf. »Diese Bilder – das hier sind nur ein paar davon. Es gibt eine ganze Menge mehr – eine halbe Videoplatte voll – aber das sind die besten. Diese Bilder sind letztes Jahr von einem Mr. Kato Nokuri in Show Low aufgenommen worden. Mr. Nokuri betrieb sein Videohobby offensichtlich sehr ernsthaft. Eines Nachmittags sah er zum Fenster hinaus, wahrscheinlich hörte er Lärm von der Straße – und dabei hat er das gesehen.« Dr. Obama reichte die Fotos über den Tisch.
Ich nahm sie etwas zögernd entgegen. Es waren Farbabzüge im Format zwanzig mal vierundzwanzig. Sie zeigten eine Kleinstadtstraße – ein Einkaufszentrum – aus einem Fenster im zweiten Stock. Ich blätterte die Bilder langsam durch; die ersten zeigten einen wurmähnlichen Chtorraner, der sich hochgereckt hatte und in ein Auto spähte; er war riesig groß und rot mit orangefarbenen Markierungen an den Seiten. Auf dem nächsten Foto war die dunkle Silhouette eines anderen Chtorraners zu sehen, der durch das Fenster eines Drugstore stieg; das Glas zersplitterte rings um die Kreatur. Im dritten machte der größte Chtorraner von allen irgendetwas mit einem – es sah wie eine Leiche aus.
»Ich möchte, dass Sie sich ganz besonders das letzte Bild in dem Paket ansehen«, sagte Dr. Obama. Ich holte es mir. »Der Junge dort ist erst dreizehn.«
Ich sah hin. Fast hätte ich das Bild vor Schrecken fallenlassen. Ich sah entsetzt Dr. Obama an und dann wieder das Foto. Ich konnte es nicht verhindern; mein Magen drehte sich um, so übel wurde mir.
»Die Qualität ist ziemlich gut«, bemerkte sie. »Besonders, wenn man den Aufnahmegegenstand bedenkt. Wie dieser Mann so geistesgegenwärtig sein konnte, diese Bilder aufzunehmen, werde ich nie begreifen, aber jedenfalls ist diese Teleaufnahme die beste, die wir von einem Chtorraner beim Fressen haben.«
Fressen! Er riss dem Kind buchstäblich Arme und Beine aus! Sein weit aufgerissenes Maul war von der Kamera eingefroren worden, während er an dem wild um sich schlagenden Kinderkörper riss und fetzte. Die Arme des Chtorraners waren lang und mit doppelten Gelenken versehen. Schwarz und insektenähnlich hielten sie den Jungen in stählernem Griff und schoben ihn auf den scheußlichen Schlund zu. Die Kamera hatte das aus seiner Brust spritzende Blut in der Luft wie einen karminroten Klecks festgehalten.
Ich konnte gerade noch nach Luft schnappen. »Die fressen ihre – ihre Beute lebend?«
Dr. Obama nickte. »Und jetzt möchte ich, dass Sie sich vorstellen, dass das Ihre Mutter ist oder Ihre Schwester. Oder Ihre Nichte.«
O du Ungeheuer – ich versuchte, es zu verdrängen; aber trotzdem zogen die Bilder an meinem geistigen Auge vorbei. Mom. Maggie. Annie – und Tim und Mark auch, obwohl sie schon seit sieben Monaten tot waren. Ich konnte immer noch den paralysierten Ausdruck des Jungen sehen, den Mund, der ein lautloses Warum gerade ich? hinausschrie. Und dann schob sich dieser Ausdruck über das Gesicht meiner Schwester, und ich schauderte.
Ich blickte zu Dr. Obama auf. Meine Kehle schmerzte beim Schlucken. »Ich – das habe ich nicht gewusst.«
»Das wissen nur wenige Leute«, sagte sie.
Ich zitterte und war aufgeregt – ich muss so weiß wie ein Schrei gewesen sein. Ich stieß die Bilder von mir. Dr. Obama schob sie in den Umschlag zurück, ohne sie anzusehen; ihre Augen studierten mich. Jetzt lehnte sie sich über ihren Schreibtisch nach vorne und sagte: »Und jetzt, was dieses kleine Mädchen angeht: Fragen Sie immer noch, warum Duke das getan hat, was er getan hat?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Beten Sie darum, dass Sie nie in diese Lage geraten; aber wenn es dazu kommt, werden Sie dann zögern, das gleiche zu tun? Und wenn Sie das glauben, dann sehen Sie sich die Bilder noch einmal an. Haben Sie keine Angst, mich darum zu bitten; jedes Mal, wenn Sie sich daran erinnern müssen, dann kommen Sie einfach in mein Büro und sehen sich die Bilder an.«
»Ja, Ma'am.« Ich hoffte, dass ich dieses Bedürfnis nie haben würde. Ich rieb mir die Nase. »Äh, Ma'am – was ist Mr. Nokuri, dem Fotografen, passiert?«
»Dasselbe wie dem Jungen auf dem Bild – glauben wir. Alles, was wir gefunden haben, war die Kamera.«
»Sie waren dort?«
»Alles sah schrecklich aus.« Dr. Obamas Blick richtete sich einen Moment lang auf etwas, das in weiter Ferne zu liegen schien. »Eine Menge Blut war dort. Überall. Eine Menge Blut ...« Sie schüttelte traurig den Kopf. »Diese Bilder ...« Sie schob den Aktendeckel auf ihrem Schreibtisch zurecht. »Ein unglaubliches Vermächtnis. Dies war unser erster wirklicher Beweis. Der Mann war ein Held.« Dr. Obama sah mich wieder an und schien plötzlich in die Gegenwart zurückzuschnappen. »Jetzt sollten Sie besser gehen. Ich habe zu arbeiten – oh, der Bericht. Nehmen Sie ihn mit und lesen Sie ihn noch einmal. Bringen Sie ihn wieder, wenn Sie ihn unterschrieben haben.«
Ich ging. Voll Dankbarkeit.
DREI
Ich lag auf meiner Pritsche, als Ted, der andere Typ von der Universität, hereinkam. Er war ein schlaksiger, besserwisserischer Bursche mit dem gedehnten Tonfall des Neu-Engländers. »Hey, Jim, Junge, es gibt Essen.«
»Äh, danke, nein, Ted. Ich hab keinen Hunger.«
»So? Soll ich den Doktor rufen?«
»Nein, schon gut – mir ist bloß nicht nach Essen zumute.«
Teds Augen verengten sich. »Brütest wohl immer noch darüber nach, was gestern passiert ist?«
Ich zuckte im Liegen die Achseln. »Weiß nicht.«
»Hast du schon mit Obie darüber gesprochen?«
»Ja.«
»Ah, dann ist's klar – sie hat dir die Schockbehandlung verpasst.«
»Nun, sie hat gewirkt.« Ich drehte mich zur Seite und sah zur Wand.
Ted setzte sich auf die Pritsche gegenüber. Ich konnte hören, wie die Federn ächzten. »Sie hat dir wohl die Arizonabilder gezeigt, hm?«
Ich gab keine Antwort.
»Du wirst schon drüber wegkommen. Wie jeder andere auch.«
Ich entschied, dass ich Ted nicht mochte. Er wusste immer fast genau das Richtige zu sagen – als ob er seine Weisheiten aus einem Film bezöge. Er war nur immer ein wenig zu fröhlich. Niemand konnte die ganze Zeit so fröhlich sein. Ich zog mir die Decke über den Kopf.
Offenbar wurde es ihm zu langweilig, auf eine Antwort zu warten, denn er stand wieder auf. »Jedenfalls will Duke dich sprechen.« Und dann fügte er hinzu: »Jetzt gleich.«
Ich drehte mich um, aber Ted war bereits durch die Türe verschwunden.
Also setzte ich mich auf und fuhr mir mit der Hand durchs Haar. Nach einem Augenblick schlüpfte ich in meine Schuhe und ging Duke suchen.
Ich fand ihn im Aufenthaltsraum, wo er mit Shorty redete. Sie saßen auf einer der Couches und sahen sich gemeinsam Landkarten an. Auf dem Tisch vor ihnen stand eine Kanne Kaffee. Sie blickten auf, als ich auf sie zuging. »Bin gleich soweit«, sagte Duke.
Ich wartete höflich und sah zur gegenüberliegenden Wand hinüber. Dort hing ein altes Foto, eine ausgebleichte Zeitschriftenaufnahme von Präsident Randolph Hudson McGee; ich studierte das Bild völlig desinteressiert, das kantige Kinn, das glänzende graue Haar und die ganz auf Wahlkampf getrimmten blauen Augen. Schließlich murmelte Duke irgendetwas zu Shorty und entließ ihn. Dann sagte er zu mir: »Setz dich.«
Das tat ich nervös.
»Kaffee?«
»Nein danke.«
»Nimm trotzdem welchen – sei höflich.« Duke goss eine Tasse voll und stellte sie vor mich hin. »Du bist jetzt seit einer Woche hier, stimmt's?«
Ich nickte.
»Du hast mit Obie gesprochen?«
»Ja.«
»Die Bilder gesehen?«
»Ja.«
»Nun, was denkst du?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Was soll ich denn denken?«
»Jedenfalls solltest du nie eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten.«
»Mein Vater pflegte immer zu sagen, das sei die einzige Art, um eine rhetorische Frage zu beantworten.«
Duke schlürfte seinen Kaffee und grinste. »Puuh. Der wird auch jeden Tag schlechter. Aber sag Sergeant Kelly nicht, dass ich das gesagt habe.« Er sah mich prüfend an. »Kannst du einen Flammenwerfer bedienen?«
»Hm?«
»Ich nehme an, das soll nein heißen. Wie schnell kannst du es lernen? Bis Ende der Woche?«
»Ich weiß nicht. Ich denke schon. Warum?«
»Ich brauche einen Ersatzmann. Ich dachte, du würdest den Job vielleicht haben wollen.« Ich wollte protestieren – aber Duke ignorierte es. »Diesmal handelt es sich nicht nur um ein Kundschafterunternehmen; diesmal lautet der Auftrag: Suchen und Zerstören. Wir gehen zurück, um das zu tun, was wir gestern hätten tun sollen, nämlich ein paar Würmer verbrennen.« Er wartete auf meine Antwort.
»Ich weiß nicht«, sagte ich schließlich.
Seine Augen ließen mich nicht los. »Wo liegt denn das Problem?«
»Ich glaube nicht, dass ich ein ausgesprochener Militärtyp bin, sonst nichts.«
»Nein, das ist nicht alles.« Er fixierte mich mit seinen stahlgrauen Augen und wartete.
Ich kam mir vor ihm völlig durchsichtig vor. Ich versuchte wegzusehen, hatte aber das Gefühl, von seinem Gesicht angezogen zu werden. Duke war ergrimmt, aber nicht zornig – nur geduldig.
So sagte ich langsam: »Ich bin hierhergekommen, um die Würmer zu studieren. Das ... entspricht nicht genau meinen Erwartungen. Niemand hat mir gesagt, dass ich Soldat sein müsste.«
»Es wird dir aber doch auf deinen Militärdienst angerechnet, oder?«
»Auf meinen Ersatzdienst«, korrigierte ich ihn. Ich hatte Glück gehabt. Meine Ausbildung in Biologie war als ›wichtig‹ eingestuft worden – aber nur gerade eben.
Duke schnitt ein Gesicht. »So? Hier draußen sehen wir das nicht so engstirnig. Ich sehe da keinen Unterschied.«
»Entschuldige, Duke. Aber der Unterschied ist ziemlich groß.«
»Was? Wieso?«
»Es steht in meinem Vertrag. Ich bin als Wissenschaftler eingesetzt. Da steht nirgends, dass ich Soldat sein muss.«
Duke lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Du solltest dir diesen Vertrag besser noch einmal ansehen, Junge – die Klausel mit den ›Sonderpflichten‹.«
Ich zitierte aus dem Gedächtnis – wir hatten den Vertrag auf der Schule studiert; Duke hob die Augenbrauen, ließ mich aber weiterreden. »›Darüber hinaus kann an den Angestellten von seinem Auftraggeber, vertreten durch seine unmittelbaren oder sonstigen Vorgesetzten, die Anforderung gestellt werden, Sonder- oder einmalige Aufgaben zu erfüllen, für die er entsprechend ausgestattet und vorbereitet ist, sei es durch Ausbildung, die Natur oder sonst wie, und die sich auf die grundlegenden Verpflichtungen, wie im folgenden dargelegt, beziehen.‹« Duke lächelte. Ich fuhr fort: »›... ausgenommen wo solche Pflichten in direktem Widerspruch zu der Zielsetzung dieses Vertrages stehen.‹«
Duke lächelte immer noch. »Das stimmt, McCarthy – und die Pflichten, die ich von dir verlange, stehen nicht in direktem Widerspruch. Du hast doch nicht etwa eine ›friedliche Intention‹-Klausel, oder?«
»Äh, ich weiß nicht.«
»Hast du nicht. Wenn das der Fall wäre, hätte man dich nie hierhergeschickt. Jedermann hier hat zwei Jobs – seinen eigenen und den, Würmer zu töten. Brauche ich noch zu sagen, wo die Priorität liegt?«
Ich sagte langsam: »Was bedeutet das?«
»Das bedeutet«, sagte Duke, »dass jedermann dann Soldat ist, wenn der Auftrag militärischer Natur ist. Wir können es uns nicht leisten, auf Mitläufer aufzupassen. Ich brauche einen Ersatzmann. Wenn du Würmer studieren willst, dann musst du lernen, wie man einen Flammenwerfer bedient.«
»Das verstehst du wohl unter ›Sonderpflichten‹, wie?«
Er sagte ruhig: »Das stimmt. Du weißt, dass ich dir nicht befehlen kann, McCarthy. Jede Operation, die das Risiko von Lebensgefahr einschließt, muss völlig freiwillig sein. Und auch nicht die altmodische Art von Freiwilligmeldung à la ›Ich nehme dich, dich und dich‹.« Duke stellte seine Kaffeetasse hin. »Aber ich will es dir leicht machen. Du hast bis morgen Zeit, es dir zu überlegen. Wenn du mitmachst, gehst du zu Shorty. Andernfalls fliegst du mit dem Chopper am Donnerstag. Ist das klar?«
Ich gab keine Antwort.
»Hast du das kapiert?«
»Ich hab's kapiert!«, knurrte ich.
»Gut.« Duke stand auf. »Du weißt schon, was du wählen willst, Jim – da gibt es gar keine Frage. Hör also auf, dich damit zu quälen und geh an die Arbeit. Wir haben hier keine Zeit zu vergeuden.«
Er hatte recht, und ich wusste es, aber es war nicht fair, dass er mich so unter Druck setzte.
Er begriff, was mein Schweigen ausdrücken sollte, und schüttelte den Kopf. »Hör schon auf, Jim. Du wirst nie bereiter sein als du es jetzt bist.«
»Aber ich bin überhaupt nicht bereit!«
»Das habe ich ja gemeint. Wenn du das wärest, hätten wir dieses Gespräch nicht führen müssen. Also ... wie steht's?«
Ich blickte zu ihm auf.
»Ja ...?«
»Äh – ich habe Angst«, gab ich zu. »Was ist, wenn ich ... Mist baue?«
Duke grinste. »Es gibt einen ganz einfachen Test, um festzustellen, ob du Mist gebaut hast. In dem Fall bist du nämlich bereits aufgefressen. Alles andere ist Erfolg. Merk dir das.«
Er nahm seine Kaffeetasse, um sie in die Küche zurückzutragen. »Ich sag Shorty Bescheid, dass er auf dich warten soll. Zieh dir frische Unterwäsche an.« Dann drehte er sich um und ging hinaus. Und ich starrte hinter ihm her.
VIER
Im juristischen Sinne gehörte ich der Army bereits an.
Seit drei Jahren schon. Quasi.
Man wurde automatisch eingezogen, wenn man seine erste Stunde Globale Ethik nahm, das einzige Pflichtfach an der High School. Ohne den Kurs abzuschließen, bekam man seinen Abschlussschein nicht. Und – das erfuhr man freilich erst nachher – man hatte den Kurs erst dann abgeschlossen, wenn man eine ehrenhafte Entlassung bekommen hatte. Das gehörte alles zur universellen Dienstverpflichtung. Pah.
Der Ausbilder nannte sich Whitlaw. Niemand wusste viel über ihn. Es war das erste Semester, das er hier gab. Aber Gerüchte hatten wir einige gehört – dass er einmal einen Jungen geschlagen hatte, weil der nachgemault hatte, und dass er ihm dabei die Kinnlade zerschmettert hatte. Dass man ihn nicht feuern konnte. Dass er in Pakistan aktiven Dienst getan hatte – und immer noch die Ohren der Männer und Frauen besaß, die er getötet hatte. Dass er immer noch mit irgendeiner supergeheimen Operation zu tun hatte, und dass sein Job als Lehrer nur Tarnung war. Und so weiter.
Als ich ihn das erste Mal sah, glaubte ich das alles. Er stampfte ins Klassenzimmer und knallte seine Bücher auf das Pult und sah uns an. »Also! Ich habe genauso wenig Lust, hier zu sein wie ihr! Aber das hier ist ein Pflichtfach – für uns alle – also sollten wir das Beste aus einer schlimmen Situation machen!«
Er war ein vierschrötiger Bär von einem Mann, finster blickend und ungeduldig. Er hatte auffällig weißes Haar und Augen so grau wie das Metall, aus dem man Pistolen macht und die einen wie ein Laser durchbohren konnten. Seine Nase war dick; sie sah so aus, als ob sie ein paar Mal gebrochen gewesen wäre. Er sah aus wie ein Tank, und wenn er sich bewegte, dann mit einem eigenartigen, rollenden Schritt. Er schwang bei jedem Schritt aus, aber trotzdem wirkte er erstaunlich elegant.
Da stand er jetzt vor der Klasse, wie eine nicht detonierte Bombe, und musterte uns mit offensichtlichem Widerwillen. Er funkelte uns an – ein Ausdruck, von dem wir bald wissen sollten, dass es sich dabei um eine Art Allzweckeinschüchterungsblick handelte, der keinem von uns speziell, sondern der ganzen Klasse galt.
»Mein Namen ist Whitlaw!«, bellte er. »Und ich bin alles andere als ein netter Mann!«
Hm?
»Wenn ihr euch also einbildet, ihr könntet diese Klasse schaffen, indem ihr euch mit mir anfreundet, dann könnt ihr das vergessen!«
Er funkelte uns an, als wollte er uns herausfordern zurückzufunkeln. »Ich will nicht euer Freund sein. Spart euch die Zeit also. Es ist ganz einfach: Ich habe hier einen Job zu erledigen! Und ihr habt auch einen Job zu erledigen. Ihr könnt es euch leicht machen und euch der Verantwortung stellen – oder ihr könnt dagegen ankämpfen; dann – das verspreche ich euch – wird dieser Kurs schlimmer als die Hölle sein! Ist das klar?«
Er schritt in den hinteren Teil des Raums, riss Joe Bangs ein Comicheft aus der Hand, zerfetzte es und warf die Stücke in den Papierkorb. »Diejenigen von euch, die sich einbilden, ich würde hier Witze machen – nun, von dem Gedanken sollten Sie sich trennen. Wir können einander zwei Wochen des Herumtanzens sparen, in denen wir einander abtasten, wenn ihr einfach vom Schlimmsten ausgeht. Ich bin ein Drache. Ich bin ein Hai. Ich bin ein Ungeheuer. Ich werd euch zerkauen und eure Knochen ausspucken.«
Er war dauernd in Bewegung, glitt von einer Seite des Raums zur anderen, deutete, gestikulierte und stach beim Reden mit der Hand in die Luft. »Die nächsten zwei Semester gehört ihr mir. Dies hier ist kein Kurs, den man entweder besteht oder bei dem man durchfällt. Jeder besteht, wenn ich lehre. Weil ich euch dabei keine Wahl lasse. Die meisten von euch wollen nämlich gar nicht gewinnen, wenn sie die Wahl haben. Das garantiert den Misserfolg. Hier drinnen habt ihr keine Wahl. Und je schneller euch das klar ist, desto schneller kommt ihr hier raus.« Er hielt inne und sah sich um, sah jeden einzelnen von uns an. Seine Augen waren hart und klein. Dann sagte er: »Ich bin ein sehr hässlicher Mann. Das weiß ich. Ich hab nichts darin investiert, das Gegenteil zu beweisen. Erwartet also gar nicht, dass ich etwa anders bin. Wenn hier in diesem Klassenzimmer etwas angepasst wird, dann erwarte ich, dass ihr das seid! Irgendwelche Fragen?«
»Äh, yeah ...« Das war einer der Clowns da hinten. »Wie komm ich raus?«
»Gar nicht. Noch Fragen?«
Keiner fragte mehr. Die meisten von uns waren viel zu benommen.
»Gut.« Whitlaw kehrte in die vordere Hälfte des Raumes zurück. »Ich erwarte hundertprozentige Teilnahme. Und zwar zu jeder Zeit. Entschuldigungen gibt es keine. In diesem Kurs geht es um Ergebnisse. Die meisten von euch benutzen die Umstände bloß als Gründe, um keine Ergebnisse zu haben.« Er blickte in unsere Augen, als könnte er dabei in unsere Seelen sehen. »Und das ist jetzt mit sofortiger Wirkung vorbei! Von nun an sind eure Lebensumstände einzig und allein das, womit ihr arbeiten müsst, um Ergebnisse zu bekommen.«
Eines der Mädchen hob die Hand. »Und wenn wir krank werden?«
»Haben Sie das vor?«
»Nein.«
»Dann brauchen Sie sich ja deswegen keine Sorgen zu machen.«
Ein anderes Mädchen: »Und wenn wir ...«
»Halt!« Whitlaw hob die Hand. »Seht ihr? Ihr versucht bereits, euch ein Mauseloch zu buddeln. ›Und was wenn ...?‹ ›Was, wenn ich krank werde?‹ Die Antwort darauf heißt ganz einfach: ›Sorgt dafür, dass es nicht dazu kommt.‹ ›Was ist, wenn mein Wagen versagt?‹ ›Sorgt dafür, dass er nicht versagt – oder sorgt dafür, dass euch ein anderes Transportmittel zur Verfügung steht.‹ Vergesst die Mauselöcher. Es gibt keine! Das Universum gibt einem keine zweite Chance. Und ich auch nicht. Seid einfach hier. Ihr habt keine Wahl. So funktioniert dieser Kurs. Geht einfach davon aus, dass ich euch eine Pistole an den Kopf halte. Denn das tue ich – ihr wisst nicht, was für eine Art von Pistole es ist, aber tatsächlich halte ich wirklich eine Pistole an euren Kopf. Entweder seid ihr hier, oder ich drücke ab, und dann fliegt euer wertloses Gehirn an die hintere Wand.« Er deutete hin. Jemand schauderte. Ich drehte mich tatsächlich um und konnte mir einen hässlichen rotgrauen Klecks an der Vertäfelung vorstellen.
»Ist das klar?« Er wertete unser Schweigen als Zustimmung. »Gut. Vielleicht kommen wir doch miteinander aus.«
Whitlaw lehnte sich lässig gegen die Vorderkante seines Pults. Er faltete die Arme über der Brust und blickte in den Raum.
Er lächelte. Die Wirkung war erschreckend.
»So«, sagte er ruhig, »und jetzt werde ich euch sagen, was die einzige Wahl ist, die ihr habt. Die einzige Wahl. Der Rest sind alles Illusionen –, oder bestenfalls Reflexionen dieser einen. Seid ihr soweit? Schön – hier sind die Optionen: Ihr könnt frei sein oder ein Stück Vieh. Das ist es.«
Er wartete auf unsere Reaktionen. Einige im Saal blickten verwirrt.
»Ihr wartet auf den Rest, nicht wahr? Ihr meint, da muss mehr sein. Nun, es gibt keinen Rest. Das ist alles, was es gibt. Was ihr euch als Rest vorstellt, sind nur Definitionen – oder Anwendungsbeispiele. Wir werden den Rest dieses Kurses damit verbringen, darüber zu reden. Klingt ganz einfach, wie? Aber das wird es nicht sein – weil ihr darauf bestehen werdet, es schwer zu machen; weil es bei diesem Kurs nicht um die Definitionen dieser Wahl geht, sondern um die Erfahrung. Den meisten von euch wird das nicht gefallen. Schade. Aber hier geht es nicht darum, was ihr mögt. Was ihr mögt oder nicht mögt, ist in dieser Welt keine ausreichende Basis dafür, eine Wahl zu treffen. Und das werdet ihr hier lernen.«
So fing er an.
Von da ab ging's bergab – oder bergauf, je nachdem, wie man es sah.
Whitlaw betrat das Klassenzimmer nie, so lange nicht alle saßen und bereit waren. Er sagte, es sei unsere Verantwortung, den Kurs zu führen, er kannte den Stoff ja schließlich schon; dieser Kurs diente uns, nicht ihm.
Er fing immer auf dieselbe Art an. Wenn er der Ansicht war, dass wir bereit waren, kam er herein – und jedes Mal, wenn er hereinkam, sagte er: »Also, wer will anfangen? Wer will Freiheit definieren?« Und schon ging es los ...
Eines der Mädchen bot an: »Das ist das Recht, das zu tun, was man will, nicht wahr?«
»Zu simpel«, konterte er. »Ich will Ihnen jetzt alle Kleider herunterreißen und dort auf dem Boden mit Ihnen leidenschaftlichen Verkehr haben.« Er sagte das völlig ausdruckslos und starrte sie dabei an. Das Mädchen riss den Mund auf; die Klasse lachte verlegen, und sie wurde rot. »Was hindert mich daran, es zu tun?«, fragte Whitlaw. »Weiß es jemand?«
»Das Gesetz«, rief jemand. »Man würde Sie verhaften.« Wieder Gelächter.
»Dann bin ich nicht völlig frei, oder?«
»Äh, nun ... Freiheit ist das Recht, alles das zu tun, was man tun will, so lange man damit nicht die Rechte anderer beeinträchtigt.«
»Klingt ganz gut – aber wie stelle ich fest, was das für Rechte sind? Ich möchte gerne in meinem Garten zu Hause Atombomben bauen. Warum darf ich das nicht?«
»Sie würden andere gefährden.«
»Wer sagt das?«
»Nun, wenn ich Ihr Nachbar wäre, dann würde es mir nicht gefallen.«
»Warum sind Sie so kleinlich? Bis jetzt ist noch keine losgegangen.«
»Aber die Chance besteht immer. Wir müssen uns schützen.«
»Aha!«, sagte Whitlaw und schob sich das weiße Haar aus der Stirn und ging auf den unglücklichen Studenten zu. »Aber jetzt beeinträchtigen Sie meine Rechte, wenn Sie sagen, dass ich mir nicht meine eigenen Atombomben bauen darf.«
»Sir, jetzt machen Sie sich aber lächerlich. Jeder weiß, dass sie nicht in Ihrem Hinterhof Atombomben bauen können.«
»Oh? Ich weiß nicht. Tatsächlich könnte ich eine bauen, wenn ich Zugang zu den richtigen Materialien und genügend Zeit und Geld hätte. Die Prinzipien sind wohlbekannt. Sie verlassen sich nur darauf, dass ich nicht entschlossen genug bin, es durchzuführen.«
»Äh – also gut. Aber selbst wenn Sie es täten, müsste man immer noch die Rechte des Individuums gegen die Sicherheit der allgemeinen Öffentlichkeit abwägen.«
»Wie war das noch einmal? Wollen Sie mir sagen, die Rechte einer Person seien wichtiger als die einer anderen?«
»Nein, ich ...«
»Hat aber so geklungen. Sie sagten, meine Rechte müssten gegen die aller anderen aufgewogen werden. Ich möchte gerne wissen, wie Sie das feststellen wollen. Denken Sie daran, wir alle sind angeblich vor dem Gesetz gleich. Und was werden Sie tun, wenn ich der Ansicht bin, Ihre Methode sei nicht fair? Wie werden Sie Ihre Entscheidung durchsetzen?« Whitlaw sah den jungen Mann scharf an. »Probieren Sie das mal – das ist wahrscheinlicher: Ich bin ein Seuchenopfer. Ich möchte in ein Krankenhaus, um mich dort behandeln zu lassen. Aber wenn ich mich Ihrer Stadt auch nur nähere, werden Sie anfangen, auf mich zu schießen. Ich behaupte, mein Recht auf medizinische Behandlung garantiere mir den Zugang zu diesem Krankenhaus, aber Sie behaupten, Ihr Recht, frei von Ansteckungsgefahr zu sein, würde Ihnen die Befugnis geben, mich zu töten. Wessen Rechte werden jetzt am meisten beeinträchtigt?«
»Das ist kein faires Beispiel!«
»So? Warum denn nicht? In Südafrika passiert das jetzt gerade – und mir ist völlig egal, was die südafrikanische Regierung dazu sagt. Wir sprechen hier von Rechten. Warum ist das kein faires Beispiel? Das ist Ihre Definition. Mir scheint eher, dass an Ihrer Definition der Freiheit etwas nicht stimmt.« Whitlaw sah den verlegenen jungen Mann an. »Hm?«
Der schüttelte den Kopf. Er gab auf.
»Ich will Ihnen einen Tipp geben.« Whitlaw wandte sich wieder uns anderen zu. »Bei der Freiheit geht es nicht um das, was Sie wollen. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht haben dürfen, was Sie wollen – wahrscheinlich dürfen Sie das. Aber ich möchte, dass Sie begreifen: Wenn Sie etwas wollen, dann geht es nur darum, sonst gar nichts. Mit Freiheit hat das sehr wenig zu tun.« Er setzte sich wieder auf sein Pult und sah sich um. »Hat jemand einen anderen Begriff?«
Schweigen. Peinliches Schweigen.
Dann eine Stimme: »Verantwortung.«
»Äh? Wer hat das gesagt?«
»Ich.« Ein chinesischer Junge ganz hinten.
»Wer ist das? Stehen Sie auf. Die anderen sollen sehen, wie ein Genie aussieht. Wie heißen Sie, Sohn?«
»Chen. Louis Chen.«
»Gut, Louis. Wiederholen Sie Ihre Definition der Freiheit für den Rest dieser Tölpel.«
»Freiheit heißt, für seine eigenen Handlungen verantwortlich sein.«
»Richtig. Sie haben für heute Ihre Eins. Sie können sich jetzt ausruhen – nein, können Sie nicht; sagen Sie mir, was es bedeutet.«
»Es bedeutet, dass Sie Ihre Atombomben bauen dürfen. Aber wenn Sie nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dann hat die Regierung im Auftrag des Volkes das Recht einzuschreiten, um zu garantieren, dass Sie das tun, oder Sie am weiteren Bau zu hindern, wenn Sie es nicht tun.«
»Ja – und nein. Jetzt haben wir etwas anderes zu definieren. Rechte. Setzen Sie sich, Louis. Lassen wir einen anderen ran. Ich will Hände sehen.«
Wieder ein Junge hinten. »›Rechte: das was einer Partei durch gerechten Anspruch, gesetzliche Garantien oder moralisches Prinzip zukommt.‹«
»Hm«, sagte Whitlaw. »Sie überraschen mich – das ist richtig. Und jetzt machen Sie das Buch zu und sagen mir, was es bedeutet. Mit Ihren Worten.«
»Äh ...« Der junge Mann fing zu stottern an. »Das was einem rechtmäßig gehört. Das Recht ... das Recht zu ... ich meine, es ist das, worauf Sie ein Anrecht haben ...« Weiter kam er nicht.
Whitlaw sah ihn an, als empfände er körperlichen Schmerz. »Zunächst einmal dürfen Sie einen Begriff nicht zu seiner eigenen Definition gebrauchen. Und zum Zweiten, nichts gehört rechtmäßig irgendjemandem. Das haben wir schon behandelt, erinnern Sie sich? So etwas wie Besitz gibt es nicht; nur Kontrolle über etwas. Besitz ist nur eine temporäre Illusion. Wie kann es also so etwas wie Rechte geben? Ebenso gut könnten Sie darauf bestehen, dass das Universum Ihnen Ihren Lebensunterhalt schuldig ist.« Whitlaw grinste plötzlich. »Nebenbei gesagt, tut es das – aber Sie sind Ihr ganzes Leben lang beschäftigt, ihn sich zu holen.«
Er setzte seinen Maschinengewehrangriff fort. »Hören Sie, ich will es Ihnen leicht machen. All das Zeug, das wir Rechte nennen – das ist nur eine Menge Unfug, den die Politiker uns verkaufen wollen, weil es gut klingt, damit die Leute ihnen ihre Stimme geben. Tatsächlich beschummeln die euch aber, weil sie alles durcheinanderbringen, indem sie nämlich zwischen der Herkunft all dieser Rechte und euch eine Menge Zeug legen. Also möchte ich, dass ihr einen Augenblick lang all diesen Quatsch vergesst, den ihr euch in Bezug auf Rechte bisher eingebildet habt. In Wahrheit funktioniert das nämlich nicht. Tatsächlich sollten Sie sogar vergessen, dass das Wort Rechte im Plural steht. Es gibt nur ein einziges Recht – und selbst das ist in der traditionellen Bedeutung des Wortes kein Recht.«
Er stand jetzt mitten im Raum. Er drehte sich langsam um und suchte unser aller Augen, während er redete. »Der definierende Zustand des Erwachsenseins ist Verantwortung. Was braucht ihr also, um jene Verantwortlichkeit zu erleben? Es ist zu einfach, dass ihr es sicher nicht herausbekommen werdet – die Gelegenheit.« Er machte eine kurze Pause, um es einsinken zu lassen, und wiederholte dann: »Die Gelegenheit, für euch selbst verantwortlich zu sein, das ist es. Wenn man euch diese Gelegenheit verwehrt, dann seid ihr nicht frei, und alle anderen sogenannten Rechte sind redundant. Rechte sind Gelegenheiten – das ist die Definition. Und Gelegenheit fordert Verantwortlichkeit.«
Eine Hand hob sich. »Und was ist mit Leuten, die nicht für sich selbst sorgen können?«
»Sie sprechen jetzt von Leuten, die geistig gestört oder unreif sind. Deshalb haben wir Vormünder und Eltern – um auf sie aufzupassen, um hinter ihnen sauber zu machen und ihnen gelegentlich einen Klaps hinten drauf zu geben und ihnen beizubringen, nicht wieder Unordnung zu machen – und dafür zu sorgen, dass sie erst dann auf die Welt losgelassen werden, wenn sie es gelernt haben. Ein Teil der Verantwortung des Erwachsenseins besteht darin, dass man sieht, dass andere ebenfalls die Gelegenheit haben, erwachsen zu werden und ebenfalls für sich verantwortlich zu sein. Im geistigen ebenso wie im physischen Sinne.«
»Aber das ist doch Aufgabe der Regierung ...«
»Was? Jemand soll die Irrenanstalt anrufen! Einer der Verrückten ist ausgebrochen. Das ist doch sicher nicht Ihr Ernst, Sohn.«
Der junge Mann blickte finster. »Doch, das ist es.«
»Hm, okay«, sagte Whitlaw. »Dann erklären Sie es mir.«
»Es ist die Verantwortung der Regierung«, sagte er. »Nach Ihrer Definition.«
»Eh? Nein. Ich sagte, es sei die Verantwortung des Volkes.«
»Die Regierung ist das Volk.«
»So? Als ich das letzte Mal hinsah, war es das nicht – im Buch steht, die Regierung sei der Vertreter des Volkes.«
»Das ist nicht fair, Sir – Sie haben das Buch geschrieben.«
»Habe ich das?« Whitlaw warf einen Blick auf das Buch, das er in der Hand hielt. »Hm, ja, das habe ich wohl. Schön. Ein Punkt für Sie. Da haben Sie mich jetzt reingelegt.«
Der junge Mann blickte selbstzufrieden.
»Trotzdem haben Sie unrecht. Nein, nur halb unrecht. Der Zweck einer Regierung – der einzige zu rechtfertigende Grund für ihre Existenz – ist es, in einem delegierten Bereich spezifischer Verantwortlichkeit für die Mitgliedsbevölkerung tätig zu sein. So, und was ist ein ›delegierter Bereich spezifischer Verantwortlichkeit‹?« Whitlaw wartete nicht ab, bis jemand eine Mutmaßung äußerte, sondern walzte weiter. »Das kann alles sein, wofür sich genügend Leute verpflichten – ob es nun recht oder unrecht ist. Aufpassen jetzt! Eine Regierung, die für die Mitgliedsbevölkerung – und in ihrem Namen – handelt, wird alles tun, wozu man sie delegiert, gleichgültig, wie in dieser Angelegenheit die Moral definiert wird. Wenn ihr dafür Beweise wollt, dann lest ein gutes Geschichtsbuch.« Er griff sich eines von seinem Pult. »Ein gutes Geschichtsbuch ist eines, das euch sagt, was geschehen ist. Sonst nichts. Vergesst diejenigen, die euch Geschichte erklären – die berauben euch der Chance, das ganze Bild zu sehen.«
Er setzte sich wieder auf seinen Pultrand. »Hört zu: Die Regierung tut das, was ihr wollt, dass sie tut. Wenn ihr sagt, ihr würdet da keinen Unterschied machen, dann garantiert ihr genau das. Tatsächlich ist es so, dass jedermann, der irgendeiner Sache genügend Bedeutung beimisst, um andere Leute zu seinen Anhängern zu gewinnen, einen Unterschied macht. Ich möchte, dass ihr begreift, dass dazu keine Mehrheit notwendig ist. Einige der Spielchen, zu denen spezifische Segmente der Bevölkerung dieser Nation den Rest von uns verpflichtet haben, schließen eine umfangreiche militärische Organisation ein, eine Agentur zur Weltraumforschung, ein System von Schnellstraßen zwischen den einzelnen Bundesstaaten, einen Postdienst, eine Agentur gegen Umweltverschmutzung, ein Büro für wirtschaftliches Management, einen nationalen Erziehungsstandard, einen Krankenversicherungsdienst, ein nationales Versorgungswerk für alte Leute und selbst ein umfangreiches, kompliziertes Steuersystem, damit jeder von uns für einen fairen Anteil jener Dienstleistungen bezahlen kann – ob wir sie nun ursprünglich wollten oder nicht.« Whitlaw stieß mit seinem langen, knochigen Finger nach uns und brachte jedes einzelne Argument vor, als wollte er jemanden damit aufspießen. »Der daraus zu ziehende Schluss ist unausweichlich. Ihr seid für die Handlungen eurer Regierung verantwortlich. Sie handelt in eurem Namen. Sie ist euer Angestellter. Wenn ihr die Handlungen eures Angestellten nicht angemessen überwacht, stellt ihr euch eurer Verantwortlichkeit nicht. Dann verdient ihr das, was ihr bekommt. Wisst ihr, weshalb die Regierung heute in einem so traurigen Zustand ist? Weil ihr eure Aufgabe nicht erfüllt. Wer sonst könnte denn verantwortlich sein? Ich meine, könnt ihr euch jemanden vorstellen, der bei klarem Verstand bewusst und absichtlich ein solches System entwickelt? Nein – niemand würde das tun, wenn er auch nur einen Funken Verstand besitzt! Das System fällt beständig jenen in die Hände, die bereit sind, es um kurzfristiger Vorteile willen zu manipulieren – weil wir es zulassen.«
Jemand hob die Hand. Whitlaw winkte sie weg. »Nein, jetzt nicht.« Er grinste. »Ich bin mit meiner ›Gehirnwäsche‹ noch nicht fertig. Ich weiß, dass manche von euch glauben, dass es das sei – schließlich habe ich die Leitartikel in den Zeitungen auch gelesen, diejenigen, die verlangen, dass endlich die ›politischen Indoktrinierungskurse‹ aufhören. Lasst mich dazu nur dies sagen. Ihr werdet feststellen, dass ich euch nicht sage, was ihr tun sollt, weil ich es nämlich nicht weiß. Es ist eure Verantwortung, das für euch selbst zu bestimmen – ihr könnt eure eigene Form der Teilhabe schaffen. Denn das ist die einzige echte Wahl, die ihr je in eurem ganzen Leben haben werdet – ob ihr teilhaben werdet oder nicht. Ihr wollt vielleicht feststellen, dass nicht teilzuhaben ebenfalls eine Entscheidung ist – das ist eine Entscheidung, ein Opfer der Konsequenzen zu sein. Weigert euch, euch eurer eigenen Verantwortung zu stellen, und ihr werdet die Konsequenzen zu spüren bekommen. Jedes Mal. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Und jetzt kommt der Satz, auf den es ankommt – passt auf. ›Lasst George es tun‹ ist nicht einfach nur das Schlagwort des Faulen – es ist das Glaubensbekenntnis des Sklaven. Wenn ihr wollt, dass man sich um euch kümmert und ihr euch selbst keine Sorgen machen wollt, dann ist das schön; dann könnt ihr euch dem Rest des Viehs anschließen. Vieh