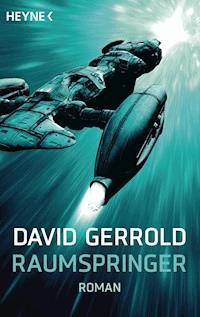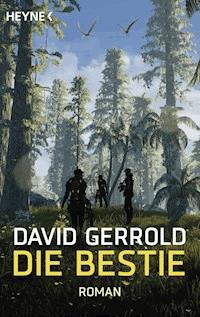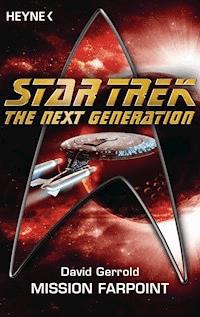3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mann oder Frau?
Als die Zeit der Wahl kommt, kann Jobe sich nicht entscheiden: soll sie als Frau weiterleben und Reethe, der Mutter der Welt, dienen, oder zu einem Mann werden und Dakka, Vater, Sohn und Liebhaber, folgen? Für alle anderen Bewohner des Mondsterns, eines terrageformten kleinen Planeten, war diese Wahl nicht schwer, aber Jobe ist anders, schon von Geburt an. Sie wird auf die Insel des Lernens geschickt, wo sie entscheiden soll, was aus ihr wird. Doch dann wird Jobes Welt von einer Katastrophe heimgesucht: einer der Plasmaschutzschilde, die den Mondstern und alles, was die Menschen auf ihm aufgebaut haben, vor dem Vakuum schützt, versagt. Das Leben aller Menschen auf dem Mondstern steht auf dem Spiel – und Jobe kann sich endlich entschließen, ihr Schicksal anzunehmen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
DAVID GERROLD
UNTER
DEM
MONDSTERN
Roman
Das Buch
Als die Zeit der Wahl kommt, kann Jobe sich nicht entscheiden: soll sie als Frau weiterleben und Reethe, der Mutter der Welt, dienen, oder zu einem Mann werden und Dakka, Vater, Sohn und Liebhaber, folgen? Für alle anderen Bewohner des Mondsterns, eines terrageformten kleinen Planeten, war diese Wahl nicht schwer, aber Jobe ist anders, schon von Geburt an. Sie wird auf die Insel des Lernens geschickt, wo sie entscheiden soll, was aus ihr wird. Doch dann wird Jobes Welt von einer Katastrophe heimgesucht: einer der Plasmaschutzschilde, die den Mondstern und alles, was die Menschen auf ihm aufgebaut haben, vor dem Vakuum schützt, versagt. Das Leben aller Menschen auf dem Mondstern steht auf dem Spiel – und Jobe kann sich endlich entschließen, ihr Schicksal anzunehmen …
Der Autor
David Gerrold wurde am 24. Januar 1944 als Jerrold David Friedmann in Chicago geboren. Er studierte Theaterwissenschaften in Los Angeles und schloss 1967 mit einem B.A. ab. Am 8. September 1966 sah er die erste Folge der TV-Serie Star Trek im Fernsehen und war so begeistert, dass er Produzent Gene L. Coon einen Entwurf für eine Doppelfolge schickte, die dieser allerdings ablehnte. Coon erkannte jedoch Gerrolds Talent und bat ihn um weitere Ideen. Eine davon war »Kennen Sie Tribbles?«, die für den Hugo Award nominiert wurde und heute eine der beliebtesten Star-Trek-Episoden ist. Nachdem er einige Kurzgeschichten in Magazinen veröffentlicht hatte, schrieb Gerrold zusammen mit Larry Niven seinen ersten Roman, die SF-Humoreske »Die fliegenden Zauberer«. Anfang der Siebzigerjahre folgten die hochgelobten Romane »Ich bin Harlie« und »Zeitmaschinen gehen anders«, die heute zu den Klassikern des Genres gehören. In den Achtzigern begann Gerrold mit seinem Chtorr-Zyklus, an dem er bis heute arbeitet. Daneben schreibt er weiter Drehbücher, unter anderem zu der für den Nebula-Award nominierten Star-Trek-Fan-Serie »New Voyages«.
Titel der Originalausgabe
MOONSTAR ODYSSEY
Aus dem Amerikanischen von Bernd W. Holzrichter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1977 by David Gerrold
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
»Ich wurde geboren ...«
Jedes Mal, wenn eine neue Person auf die Welt kommt, halten die Götter – Reethe und Dakka – den Atem an. Sie haben Angst vor denen, die nicht wissen, wer sie werden sollen; denn jedes Mal, wenn eine von ihnen geboren wird, rücken die Götter dem Tode nahe. Es handelt sich um die Personen, die sich höchstwahrscheinlich für keine der beiden Möglichkeiten entscheiden, wenn ihnen die Wahl zwischen Reethe und Dakka, zwischen weiblich und männlich, angeboten wird; und jedes Mal, wenn jemand in seinem Innersten die Götter nicht anerkennt, sterben die Götter ein bisschen. Darum halten die Götter bei jeder Geburt den Atem an: Wie wird die nächste Person sein?
Schaut sie an: Der Säugling – ein Erwachsener in der Entwicklung. Das Kind – eine Lektion, die der künftige Mensch lernt. Als Kind benötigt sie nicht so viel Pflege wie jener Erwachsene, zu dem sie werden wird. Versucht den Menschen zu erkennen, der sie einmal sein wird.
Beginnt mit Achtung vor dem Augenblick ihrer Geburt. Lasst sie behutsam in diese Welt treten, so dass sie nicht geängstigt wird von dem neuen Ort, an dem sie sich wiederfindet. Das schafft ein Beispiel fürs Leben: Wenn sie geboren wird, ohne Furcht zu erfahren, wird sie später im Leben von all den neuen Dingen, denen sie begegnet, nicht geängstigt.
Die Geburt ist nicht der Moment der Mutter – das mag so scheinen, aber es ist nicht ihr Erfolg –, sondern der einer neuen Person. Wir sind ihr noch nicht begegnet, aber ihre Bedürfnisse haben den Vorrang. Denkt über sie nach: Sie existiert nur in der Gegenwart, sie hat keine Vergangenheit und kennt keine Zukunft, sie ist zeitlos, sie ist Glied einer Kette, die irgendein wundervolles, unbekanntes Geschöpf darstellt – Erlöser oder Dieb, wir können es nicht wissen. Der Weg dorthin dauert zahllose Jahre, aber in diesem Augenblick, jetzt, ist sie bloß klein und schutzlos – den Ereignissen ausgeliefert. Geburt – das ist ihr Universum, zugleich eine Explosion ihres Universums; das passiert ihr, passiert ringsum, und die Grenzen zwischen dem, was Ich und was Nicht-Ich ist, beginnen allmählich, feste Konturen anzunehmen. Wir dürfen diese Person nicht zu abrupt aus ihrer Einheit mit ihrem Universum reißen, sonst wird sie sich niemals wieder als dessen Bestandteil fühlen – und doch kann gerade das viel zu leicht geschehen. Sie existiert nur als ein Moment von Gefühl und ist leicht in Angst zu versetzen, da sie keine Erinnerungen hat, an denen sie das Jetzt messen kann. Jegliche Empfindung ist neu – und wenn sie zu heftig ist, fällt die Anpassung schwer; sie wird sich als Schmerz einprägen, und alle späteren Empfindungen, die ähnlich sind, werden mit dieser Erinnerung übereinstimmen. Man kann diesen kleinen Kern der Vergangenheit einer zukünftigen Person nicht vor dem warnen, was sich anbahnt. Man kann sie nicht vorbereiten, es sei denn durch die natürlichen Methoden Mutter Reethes. Doch die allein sollten eigentlich genügen – falls wir auf die Anleitungen hören, welche die Gottheit in unsere Herzen gesenkt hat.
Vielleicht sollte es eine bessere Methode geben, auf die Welt zu kommen, als diese eine, die so viel erdenklichen Schmerz, so viel Angst und Schrecken beinhaltet; doch vielleicht gibt es auch gar keine bessere Art der Geburt für eine Person als die, aus dem Bauch einer anderen zu kommen. Das ist die engste aller Verbindungen, und sie schafft zwischen den beiden eine Beziehung von Fürsorge und gegenseitiger Abhängigkeit, die ein Leben lang bestehen wird. Die neue Person braucht jemanden, der ihr Sicherheit gibt, während sie erforscht, wie sie am besten sie selbst wird; jemanden, der ihr immer wieder bestätigt, dass alle ihre Entscheidungen tatsächlich berechtigt sind und dass alle Versuche, auch die fehlgeschlagenen, notwendig sind, wenn sie die Erfahrungen des Lernens und Entdeckens macht. Die Geburt-Mutter ist mit dieser Aufgabe betraut, einer Aufgabe, die nicht zu leicht genommen werden darf. Wir dürfen die Verantwortung für das Leben einer anderen Person nicht übernehmen, es sei denn, wir sind willens, auch die Last ihres Schmerzes zu ertragen; sonst kränken wir nicht nur den Erwachsenen, den wir als Kind in unserem Körper tragen, sondern auch die Götter.
Wir umhegen unsere Kleinen, weil wir glauben möchten, dass sie ein Teil unserer selbst sind; doch wir sollten im Augenblick unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und zuerst ihre Bedürfnisse betrachten – lasst das Neugeborene eine selbstständige Person sein, ehe es Teil der Identität einer anderen sein muss. Diese kleinen, unschuldigen Menschen sind leichtgläubig – sie nehmen mit begieriger Bereitwilligkeit an, was wir ihnen vorsetzen. Sie glauben, dass das, was sie von uns hören und sehen, das Verhalten der ganzen Welt ist, das einzige Verhalten; sie glauben daran, weil sie noch nicht erfahren haben, dass es auch etwas anderes gibt. Wir sollten darauf achten, dass wir ihnen nicht Schaden durch die Sicherheit zufügen, die aus ihrer Vertrauensseligkeit herrührt; denn in Wahrheit schaden wir damit nur unserem künftigen Ich.
Wir wollen also von unseren Kindern lernen und unserer Wahrheit nicht zu sicher sein – wir wollen sie immer in Zweifel ziehen, denn nur der Zweifel lässt die Weisheit wachsen. Lasst uns die Geburt durch die Augen dessen betrachten, der geboren wird; und wir wollen in diesem Augenblick vor allem seine Ängste lindern. Diese kleine, nackte Person möchte mit uns zusammenkommen – wir wollen ihrem Wunsch entsprechen. Diese Wahrheit wird jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, auf die Probe gestellt – und jedes Mal wird sie bestätigt, wenn ein Säugling lächelt.
Eine Mutter soll in hockender Position gebären, nicht nur, weil es für sie die leichteste Stellung ist, sondern auch, weil das neue Geschöpf so am leichtesten den Gebärmutterhals hinuntergleiten kann. Der Heilkundige und die übrigen Eltern sollen ganz nahe dabei sein, doch es obliegt dem Segens-Vater des Neugeborenen, ihre Hände bereit zu halten, um die Kleine in Empfang zu nehmen. Das Zimmer soll dunkel und ruhig sein, die wartenden Hände warm, zart und darauf vorbereitet, das Rückgrat der Kleinen zu stützen – es wird am Anfang gewölbt sein; sie soll es strecken, wenn sie dazu bereit ist; es besteht kein Grund zur Eile. Und jetzt, wenn sie in unsere Welt kommt, soll die Mutter sich zurücklegen und die kleine Kreatur ihr – wie ein Geliebter – behutsam auf den Bauch gelegt werden; so können beide durch ihre Berührungen einander liebkosen, sich nahe kommen, sich wiederentdecken. Sie sind tatsächlich Liebende: Sie waren es monatelang, aber erst jetzt begegnen sie sich wirklich, während sie sich in der Dunkelheit still umarmen. Die kleine Geliebte soll beim Eintritt in die Welt liebkost und voll Freundlichkeit empfangen werden.
Und wenn das richtig gemacht wird, wird die neue Person weder verwirrt noch geängstigt, und sie wird nicht weinen – Weinen bei der Geburt ist ein schlechtes Omen, es zeugt von Schrecken und Schmerz: Hier ist jemand, dem durch die Geburt Schmerzen zugefügt wurden – und genauso können ihm in seinem weiteren Leben Schmerzen zugefügt werden. Leise Seufzer dagegen zeugen von Liebe. Jetzt soll Stille herrschen, während die Geburt-Mutter ihre kleine Geliebte flüsternd und sanft beruhigt. Die Neugeborene hat gerade angefangen zu lernen, und auf diese Weise wird es ein freudiges Lernen sein. Der erste Seufzer soll der des Kindes sein, es soll sanft atmen; seine Lungen sollen die Luft schmecken, weil sie wollen – nicht weil sie müssen, nicht weil sie dazu gezwungen werden. Die Nabelschnur soll bleiben, bis die Neugeborene sicher und gleichmäßig atmet. Sie soll diese Verbindung zu ihrer Mutter behalten, bis sie ihrer nicht mehr bedarf. Erst dann soll sie durchtrennt werden; es besteht kein Grund zur Eile, die Kleine hat eine Menge Zeit, eine ganze Lebensspanne Zeit, um zu lernen und aufzuwachsen.
Und das Lächeln der Mutter soll immer der hellste Schein im Zimmer sein, die sanften Atemzüge des Kindes das lauteste Geräusch. Die zwei sollen so lange immer näher zusammenwachsen, bis beide sich entspannt haben. Wenn die Mutter die neue Person ganz nah bei sich hält, wenn die kleine Geliebte sanft auf ihrer Brust liegt, soll sie spüren, dass sie nicht die Besitzerin ist – so als handele es sich um einen Gegenstand. Sie soll sich als Führer, als Lehrer fühlen; ein gleichberechtigter Partner beim Erforschen, einer, der den Weg vielleicht schon ein wenig weiter beschritten hat, aber dennoch ein ahnungsloser Mensch in den Augen von Reethe und Dakka ist. Beide, Mutter und Kind, sollen auf dieser Reise Partner sein, keiner soll dem anderen Bestie oder Bürde sein; keiner gehört dem anderen, denn an erster Stelle gehören wir alle den Göttern.
Lasst die neue Person in gekrümmter Haltung verharren, Arme und Beine an den Körper gezogen. Erst wenn sie dazu bereit ist, soll sie den Rücken aufrichten. Sobald sie es wünscht, wird sie sich strecken; tastend zuerst, denn sie ist im Begriff, einen so großen Bereich zu erforschen, wie sie ihn sich bis dahin nie vorgestellt hat. Die Hände der Mutter sollen sich langsam über sie hinweg bewegen, nicht wie bei einer Massage, sondern liebkosend, ein Austausch von Berührung, Sprache von Geliebten, die einander Sicherheit geben. Die Mutter teilt dieser winzigen Person durch ihre Berührung Liebe mit. Und genau so sollte es sein, denn das ist die einzige Sprache, die das Baby versteht, aber dafür versteht es sie vollkommen. Die Sicherheit spendende Sprache der Berührung, des Streicheins, des Liebkosens und der behaglichen Wärme. Sie waren inniger beieinander, als alle anderen Liebespaare es jemals gewesen sind oder jemals hoffen könnten zu sein. Eine hat im Leib der anderen gelebt, und jetzt, wenn diese innige Vertrautheit in eine weiter geöffnete verwandelt worden ist, in eine Vertrautheit, die mit der übrigen Welt geteilt wird, jetzt soll die Geliebte, die die andere getragen hat, deren Weg in diese Welt ebnen – indem sie diese vertraute Sprache benutzt, die ihr den Übergang erleichtert. Der neuen Person soll damit Gewissheit gegeben werden, dass dieser neue Ort ein guter Ort ist.
Und jetzt soll die Watichi ein leises Gebet anstimmen – damit die neue Person den Schmerzensweg des Lebens ebenso gut zurücklegt, wie sie den Weg der Geburt bewältigt hat – mit Liebe und Beistand; damit sie an die andere Seite kommt, wie sie durch die Geburt gekommen ist – mit einem Lächeln. Es ist ein glückbringendes Omen, wenn die neue Person bei der Geburt lächelt – und zudem ist es üblich; wir können stolz darauf sein, dass unsere Neugeborenen für gewöhnlich so leicht lächeln.
Jetzt soll das Kind von seinem Segens-Vater gebadet, behutsam in warmes Öl getaucht werden, eine Beinahe-Rückkehr in die behagliche Welt des Embryos, die seit noch nicht einmal zehn Minuten verloren ist; immer wieder eingetaucht, eine warme Rückkehr ins Meer der Mutter Reethe, bis es entspannt ist und bereit, ja, bereit, mehr von seiner neuen Umgebung zu erforschen; eingetaucht und vorsichtig hochgehoben, so dass es allmählich sein eigenes Gewicht erfährt; eingetaucht und hochgehoben, so dass es allmählich das Gewicht der übrigen Welt erfährt. Dann schließlich wird es in wärmende Decken gehüllt und seiner Mutter zurückgegeben, die vom Kreis der Gratulanten ebenfalls gereinigt und gekleidet worden ist. Nun ist die neue Person wieder bei der Person, die ihr einen ersten Platz zum Heranwachsen gegeben hat und die ihr den Aufenthalt an manchen Plätzen der Zukunft erleichtern wird. Jetzt sollen sie sich lächelnd ausruhen, wie ein Liebespaar nach dem Liebesakt. Sie sind jetzt und für immer die innigsten Geliebten – die Erinnerung daran wird nie völlig verschwinden; so wie Reethe für Dakka beides – Mutter und Geliebte – ist, so ist es auch beim Eintritt einer jeden neuen Person in die Welt: wir erschaffen mit jedem Leben, das wir gebären, das Wesen unserer Götter aufs neue.
Und wie unsere Götter halten auch wir den Atem an bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir und die neue Person entdecken, wer sie sein wird.
... inmitten eines Hurrikans
»Winde heulten und grelle Blitze leuchteten auf; man erzählte mir, dass ich noch Stunden später vor Angst und Schmerzen schrie. Das war vier Monate, bevor ich zum ersten Mal lächelte.
Natürlich erinnere ich mich nicht an diese Dinge; ich erfuhr erst viele Jahre später davon, ein besonderer Vertrauensbeweis von Sola, der Abweichenden. Meine Geburt war ein Tag der Stürme und anderer schlechter Omen, und ich glaube, dass mein Leben nicht nur durch meine eigenen Schmerzen in dunkle Farben getaucht wurde, sondern auch durch das Wissen meiner Familie um meinen bewegten und disharmonischen Start.
Ich wurde zu früh geboren – meine Mutter stolperte, als sie zur Unterkunft rannte. Bei ihr war keine Watichi, um zu singen und zu beten. Der Segens-Vater war bei einem Bootsunglück umgekommen, und ich wurde im Freien, ohne jeglichen Schutz, geboren, während ringsum laute Blitze tobten.
Hojanna musste auf dem Rücken liegen, während Großvater Kuvig mich aus ihrem Leib zerrte. Sie zog einen Schleier von meinem Gesicht und gab mir einen Klaps, damit ich nach Luft schnappte – für etwas anderes war keine Zeit, weil das Wetter um uns herum wütete; sie zerschnitt die Nabelschnur fast sofort und wickelte mich in ihre grobe Windjacke, ohne mich vorher vom Blut meiner Mutter zu säubern. Dann strauchelten und rannten sie den letzten halben Kilometer zu unserer Hütte, während die Bäume um uns herum ohne Unterlass krachten.
Es gibt keinen Weg, dorthin zurückzukehren und den Schaden ungeschehen zu machen, der sich bei meiner Geburt ereignete. Ich wurde geboren, und hier war ich. Es gab keine Lieder, keine Gebete, keinerlei Beruhigungsversuche – erst lange nachdem ich schon erfahren hatte, dass dieser neue Ort grausam, kalt und unwirtlich sein konnte. Dann war es zu spät für Beruhigungsversuche.
Eine Zeitlang wurde ich ›das dunkle Kind‹ genannt. Ich wusste das nicht, bis Sola es mir sagte; und doch wusste ich irgendwie, dass es etwas gab, das mich von den anderen unterschied. Nach dem Willen der Familie sollte ich niemals erfahren, dass mit mir etwas nicht stimmte; aber das ist eines der Dinge, die man vor einer Person nicht geheim halten kann. Ich wusste einfach, dass ich auf irgendeine Art etwas Besonderes war. Ich spürte irgendwie eine wahrnehmbare ›Minderwertigkeit‹, und ich hütete dieses Wissen, da es mich zugleich den anderen gegenüber irgendwie überlegen erscheinen ließ – indem es mich anders machte.
Ich war anders als meine Geschwister. Ich wusste es aufgrund ihrer Weigerung, dies zuzugeben, weitaus deutlicher, als wenn sie mir diese Tatsache tausendmal am Tag ins Gesicht geschrien hätten. Wie das Kind, das im Märchen durch das Meer verändert wird, fühlte ich mich als eine neue Art von Person – anders als jede, die je zuvor gelebt hatte. Vielleicht eine normale Kindheits-Einbildung, aber in meinem Fall eine mit einem Kern von Wahrheit, die sowohl innerlich als auch äußerlich zu spüren war.
Es war ein unbestimmter Unterschied, keiner, den ich definieren oder beschreiben konnte. Und vielleicht wurde ich ihn nicht einmal bewusst gewahr, bis ich mein eigenes Ich verlassen und zurückblicken konnte. Es dauerte bis zur Zeit des ersten Errötens und noch länger, bis ich bemerkte, was mich anders machte als meine kleinen Mitgefangenen der Entropie: Sie bewegten sich zumindest mit dem Wissen, dass sie eines Tages jemand sein würden; nicht einmal die Entropie konnte eine einmal verankerte Identität zerstören. Aber ich, ich bewegte mich tastend, behutsam, unsicher, ob ich überhaupt jemals irgendjemand sein würde. Wo andere Seelen sein konnten, war ich vielleicht nur ein kleines, glimmendes Fünkchen Angst, leicht ausgelöscht und vergessen.
Als Sola mir die Tatsachen über meine Geburt erzählte, war es folglich weniger eine Neuentdeckung als eine Bestätigung dessen, was ich schon mein ganzes Leben lang gewusst hatte: dass ich mich in einem Vakuum bewegte, das die Götter dadurch geschaffen hatten, indem sie den Atem anhielten.
Und doch – selbst mit diesem schrecklichen Wissen – war mein junges Leben ausgefüllt mit Freude – nachdenklich vielleicht, sehnsuchtsvoll wie die endlosen Akkorde aus den Flöten Dakkas –, aber all diese Tage waren Wegweiser zur unausweichlichen WAHL. Wenn ich wirklich einzigartig war, dann nicht durch die WAHL, sondern dadurch, dass ich lernte, damit zurechtzukommen.
Ich wurde geboren, hier war ich, und ich musste das Beste daraus machen.«
Drei Tage nach dem Sturm wurde das Segel einer Watichi am Horizont gesichtet. Großonkel Kossar hisste eine Willkommensflagge, und das Schiff wendete und steuerte auf die Insel zu.
Eine Watichi ist eine heilige Person, eine Stimme von Reethe und Dakka in der Welt der gemeinen Menschen; sie besitzt nichts Eigenes, sie benötigt kein Eigentum – da sie den Göttern angehört, vertraut sie ihr Leben deren Winden an; sie werden für sie sorgen. Und in der Tat ist es eine Gnade, einer Gottstimme Nahrung und Unterkunft zu gewähren – es ist ebenso eine Sünde, ihr die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu verweigern. (Es hat Watichi gegeben, die manchmal ihr Gottgefühl verloren haben; deshalb ist es den Watichi verboten, ohne Erlaubnis länger als drei Tage am gleichen Ort zu bleiben.)
Diese Watichi war auf dem Weg von irgendwo in der Vergangenheit nach irgendwo in der Zukunft. Sie war auf Pilgerfahrt mit einem Ziel, das nur für Watichi bestimmt war und jenseits des simplen Verständnisses der gemeinen Menschen lag.
Sie war groß und knochig, ihre Haut war hell wie gebleichtes Pergament. Ihr Haar war weiß und schwebte in einer dünnen Wolke um ihren Kopf. War sie alt? Oder ein Albino? Ihre Augen waren rot und lagen tief in ihren Höhlen – sie sah gehetzt aus und zwitscherte wie ein Vogel. Ihre Hände flatterten vor ihr in der Luft, wenn sie sprach. Ihre Stimme glich dem hellen Pfeifen eines Kindes. Ihr Kleid war mit braunen und gelben Flecken gesprenkelt, und sie roch nicht nach dem Meer, sondern nach Fäulnis und Krankheit. Sie sprach von den Omen, die sie gesehen hatte, aber allein ihre Anwesenheit war Omen genug.
Sie steckte drei Stangen in den Sand und breitete über deren Spitzen eine seidene Stoffbahn aus, um Schatten zu haben; dann legte sie eine geflochtene Matte in den Schatten und setzte sich darauf. Sie wartete.
Die Familie begann schon bald, ihre Geschenke vor ihr auf die Matte zu legen. Es spielte keine Rolle, dass Kuvig und Suko das legalisierte Betteln der Watichi ablehnten (sie nannten es »religiöse Erpressung«). Großonkel Kossar glaubte immer noch daran, und sie bestand auf den heiligen Handlungen – die Überlieferung muss geachtet werden. Sie breiteten vor der Watichi einen Querschnitt aus dem erlesensten Familienbesitz aus; die weichsten Kleidungsstücke, die süßesten Weine, die wertvollsten Geschirrstücke im Haushalt – ein mit Opfergaben wohlgedeckter Tisch. Die Watichi wies das meiste zurück, und Suko wusste nicht, ob sie darüber erleichtert oder doch eher beleidigt sein sollte. Die Freude an schönen Dingen schien jenseits der Verständniskraft dieser Watichi zu liegen, Reichtum bedeutete ihr nicht mehr als Sand. Sie probierte von dem, was ihr behagte, aber der einzige Gegenstand, den sie annahm, war das hauchdünne, scharlachfarbene Halstuch, das die kleine Dida, ihre Eltern nachahmend, vor sie hingelegt hatte. (»Huch, eine bescheidene Watichi!«, murmelte William hinter vorgehaltener Hand. »Wunder geschehen immer wieder.«)
Schließlich sprach die Watichi von Reethe und Dakka und den Münzen, die ihre Gesichter tragen. »Wir schütteln ihre Gesichter und werfen mit ihren Gesichtszügen die Runen. Wir erfahren nichts über die Vergangenheit und nichts über die Zukunft, sondern nur über diesen Moment – jetzt –, in dem sich ihre Linien überschneiden. Vor drei Tagen sah ich ein Omen.« Die Gottstimme schwankte, ihre Hände krochen zu ihrem Herzen und zu ihrer Kehle. »Ich verstand es damals nicht, aber eine Otter kletterte auf mein Floß und wies mich an, nach Westen zu segeln. Ich kam hierher. Und jetzt verstehe ich, dass es nicht wichtig für mich ist, dieses Omen zu verstehen, sondern über es zu berichten. Dieses Omen war für euch bestimmt, und ich diene nur als Bote.«
Sie senkte den Kopf und verstummte. Die Familie, im Sand kreisförmig um sie herumsitzend, wartete. Kuvig legte drei Münzen vor der Watichi nieder. Zwei davon zeigten das lächelnde Gesicht Reethes, auf der dritten zog das grimmige Gesicht Dakkas Grimassen. »Wir hatten eine Geburt«, sagte Suko. »Und einen Sturm.«
»Ein Geburtsomen also, dennoch, ein merkwürdiges. Ich sah ein Boot, ein leeres Floß mit zerbrochenem Mast, zerfetzten Segeln, völlig verwüstet und verlassen. Es war alt und grau und hing schief in der spiegelglatten See. Es sah aus wie ein Todesboot, das aus den Seuchenjahren übriggeblieben war. Als ich meine Segel in seine Richtung drehte, tauchte plötzlich ein Vogel auf – groß und weiß, wie ich vorher noch nie einen gesehen hatte; zu groß für eine Möwe und mit zu sanfter Stimme. Ihr Schrei hatte irgendetwas Fröhliches. Sie kam von Osten, so als wäre sie aus dem Monduntergang der Nona entstanden; sie kam aus ihr herausgeflogen, als ich mich in ihre Richtung wandte. Sie flog über das Boot und zum Mondstern über mir. Sie kreiste einmal unter der Bundt, wandte sich dann nach Westen zur Lagin und weiter hinaus. Sie verschwand unter dem Monduntergang der Lagin. Der letzte Schrei, der zu mir herübertönte, war weder fröhlich noch verzweifelt – nur noch fragend. Ich sah sie immer noch fliegen – und ich sah Hoffnung. Als ich wieder nach unten aufs Meer schaute, war das Geisterboot verschwunden.« Sie kicherte. »Was bedeutet das?« Sie blickte umher und sah ihre Zuschauer an. »Nichts? Alles? Vielleicht ist es ein Symbol für WAHL. Die neue Person kann in ihrem Leben hoffnungslos auf einem Meer von Trostlosigkeit treiben. Oder sie kann fliegen. Es ist kein fröhliches Omen, aber genauso wenig ist es traurig. Es spricht zugleich von Untergang und Freude. Eines Tages wird unsere Luft dick genug sein, und wir alle können fliegen wie die Vögel.« Ihre Stimme überschlug sich, sie keuchte und flüsterte in die Stille hinein. Ihr Atem ging pfeifend. »Dieses Omen habe ich gesehen, drei Tage bevor ich an diesem Strand stand. Wenn es für euch gedacht ist, habe ich es überbracht und meine Pflicht getan.« Sie ließ den Kopf in den Schoß sinken und schwieg lange. Suko fragte sich, ob sie vielleicht eingeschlafen war – oder bewusstlos, vielleicht sogar gestorben. Man hörte gelegentlich von Watichi, die auf ungewöhnliche Art starben.
Aber sie hob den Kopf und sprach ein Gebet zu Reethe und Dakka. Sie nahm die Münzen von der Matte, küsste jede einzelne und legte sie wieder hin. Sie stand auf und berührte der Reihe nach die Kinder und empfahl sie der Obhut der Götter; sie sagte freundliche Worte über die Insel, ihre Bewohner und ihre Pflanzen; sie vergab allen Ungläubigen, denn sie seien selbst in ihrem Unglauben Diener der Ströme Reethes und Dakkas. Und als sie das sagte, lächelte sie Kuvig und Suko wissend an. Dann packte sie ihre geflochtene Matte zusammen, ihr Seidenzelt, die Zeltstangen, Didas Halstuch und segelte in Richtung Nordosten davon.
Suko schnaufte skeptisch, während sie ihr Segel zum rosafarbenen Ende der Welt treiben sah: »Eine aufwendige Pantomime, eine Bettelschau, eine Maskerade – alles, um uns zu erzählen, was wir schon längst wissen. Ein Baby wird für die WAHL geboren. Wir brauchen keine Watichi, damit sie uns das erzählt.«
Aber Onkel Kossar berührte sie beim Arm und sprach von Toleranz: »Sei vorsichtig, Suko. Ich fühle, dass dieser Besuch seine ganz besondere Bedeutung hat.«
Vielleicht stimmte das. Hörte Onkel Kossar eine andere Botschaft aus dem Schauspiel am Strand heraus? Drei Tage später legte sie sich zu Bett, und drei weitere Tage danach war sie zum Meer zurückgekehrt, um bei ihren Müttern zu schlafen.
»Das erste, an das ich mich erinnere: Wie ich nachts von einer meiner Kusinen in meine Krippe gelegt wurde. Dida war es, und obwohl Dida damals noch keine WAHL getroffen hatte, hatte sie sich nach meiner Meinung lange vor dem ersten Erröten entschieden: Sie wollte eine Geburt-Mutter werden, und der erste Ausdruck dieses Wunsches war die Fürsorge, die sie mir und den anderen Kindern zukommen ließ. Dida machte sich gut als Mutter und stellte später auch ihre anderen Qualitäten unter Beweis. Während der Hungersnöte nach der Schirm-Katastrophe hielt sie ihre Eheverbindung zusammen, während überall Familien in Anarchie auseinanderbrachen, die unsere eingeschlossen.
Die erste Erinnerung, die überhaupt eines der Familienmitglieder an mich hat – also der erste Zeitpunkt, an dem ich so etwas wie Individualität entwickelte, die in ihren Gedächtnissen haften blieb –, betrifft den ›Essemäppchen‹-Vorfall. Keine Geschichte habe ich so oft gehört wie diese, und allmählich begann sie mich anzuwidern; aber ihre Beliebtheit bei Familientreffen muss etwas bedeuten, und ich vermute, ihre Bedeutung liegt in der Tatsache, dass ich bis dahin nur ein weiterer rosa Fleischklumpen war, in dessen eines Ende man Nahrung hineinstopfen und dessen anderes Ende man von Scheiße reinigen muss.
Es geschah bei einem Familientreffen, das aus irgendeinem Anlass stattfand, keiner erinnert sich mehr daran – die Familie hat jahrelang über den Grund für das Treffen gestritten, aber keiner von ihnen hat jemals die eigentliche Geschichte vergessen. Ich saß in einem hohen Stuhl. Meine Theorie ist, dass es sich um das Fest zur Meeresernte im Jahr 288 handelte; ich war damals etwa zwei Jahre alt, das richtige Alter für diese Geschichte. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich gemeinsam mit der Familie essen durfte; folglich musste ich schon einige Erfahrung mit fester Nahrung gehabt haben.
Mitglieder der Großfamilie waren von der ganzen Sichel gekommen, einschließlich vieler aus der angeheirateten Familie. Mitten bei der Mahlzeit, so erzählen sie mir, fing ich an, ›Essemäppchen‹ zu verlangen, und ich wollte mit Weinen und Quengeln nicht aufhören. Ich fuhr einfach fort mit Knatschen und Jammern, aber keiner konnte sich unter ›Essemäppchen‹ etwas vorstellen. Meine älteren Geschwister (ich war die Jüngste am Tisch) konnten nicht verstehen, was ich wollte, Dida konnte es nicht, Hojanna nicht und auch keine meiner anderen Mütter. Nicht einmal Großmutter Thoma, die als Kindererfahrenste von allen galt. Meine Tanten – meine Eltern hatten geradezu verzweifelt versucht, Eindruck auf sie zu machen – waren verärgert, weil die Familie ihre Jüngste weder bändigen noch besänftigen konnte. Die Anwesenden schmücken die Erzählung immer mit lebhaften Beschreibungen von Tante William aus, die so genervt wurde, dass sie anfing, meinen Vater anzuschreien: ›Um Dakkas willen, gib der kleinen Ratte doch ein „Essemäppchen“!‹ (Wahrscheinlich ist das Grund für die Verwirrung über das Wo und Wann des Vorfalls. Tante Williams Ausbruch gab noch Monate später, immer wenn ein paar Familienmitglieder zusammenkamen, Stoff für ausgelassene Unterhaltungen; je häufiger davon erzählt wurde, desto verschwommener wurde die Erinnerung an den eigentlichen Grund des Treffens.)
Ganz gleich, ich quengelte und weinte ohne Unterlass, wie sie mir erzählen. Es gab würzige Fleischbrote am Spieß und appetitliche süße Kartoffeln, eingemachten Mais, süße Zwiebeln, gebackene Entchen in saurer Soße, jede Menge Schüsseln mit rohem Fisch und kleine Happen zum Tunken. Die Verwandten boten mir alles an, was auf dem Tisch war, um herauszufinden, was ich wollte. Und erst als einer meiner Onkel – niemand scheint sich zu erinnern, welcher es genau war, es muss wohl ein entfernter Verwandter gewesen sein – ihren Ess-Spieß nahm, mit dem man Fischstückchen in die Soße tunkt, begann ich wieder zu drängen und zu schreien ›Essemäppchen! Essemäppchen!‹
Essensstäbchen! Nur konnte ich das ›St‹ noch nicht so richtig aussprechen. Natürlich war ich nicht in der Lage, sie richtig zu benutzen, aber in meinem Kopf hatte ich die Verbindung zwischen Essen und Stäbchen hergestellt – und ich wollte sie haben.
Die Geschichte hat keine wirkliche Pointe, keine Quintessenz, auf die man bei späteren Ereignissen hinweisen und sagen kann: ›Hier, hier ist die Ursache.‹ Die Geschichte beweist nicht einmal, dass ich ein Frühentwickler war; nur selbstsüchtig, wie jedes Baby. Aber jedes Mal, wenn sich Verwandte von mir trafen, vor allem solche, die mich eine Zeitlang nicht gesehen hatten, wurde ich immer wieder als das ›Essemäppchen-Baby‹ vorgestellt. Oder irgendeine sagte: ›Sieh mal, wie groß unser kleines Essemäppchen geworden ist.‹
Ich selbst habe keinerlei Erinnerung an diesen Vorfall, und so fühlte ich mich immer, als würde ich das Gepäckstück eines anderen mit mir herumtragen. Ich entwickelte regelrecht Angst vor Familientreffen, weil die Geschichte unter Garantie immer wieder erzählt wurde; wenn nicht für Besucher, die sie noch nicht kannten, dann mir zuliebe. Denn ich machte andauernd den Fehler, darauf zu bestehen, dass ich mich an rein gar nichts erinnerte. Irgendwie machte mich das verschieden (zumindest in meinen eigenen Gedanken) von den anderen Kindern.
Zum Glück fanden sie schließlich die Geschichte genauso fade wie ich, und niemand dachte mehr daran, mich wegen der ›Essemäppchen‹ aufzuziehen – dafür bin ich dankbar. Stattdessen zogen sie mich wegen einer Menge anderer Sachen auf.«
Nach dem Heiligen Kalender war Jobe vier Jahre alt, als sie zum ersten Mal erfuhr, dass Erwachsene in zwei Arten aufgeteilt waren – es gab welche mit hängenden Brüsten und welche, die überhaupt keine Brüste hatten.
Sie ging zum Meeresfest mit Hojanna, die ihre Geburt-Mutter war, mit Dida, einer älteren, nicht blutsverwandten Schwester, und natürlich mit ihrem Großvater Kuvig, die alle Feste verabscheute. Kuvig stolzierte mit grimmiger Miene auf ihrem gelbledernen Gesicht über den Festplatz – immer in Sorge, jemand könnte sie dabei ertappen, dass sie es heimlich doch genoss.
Die hellen Bambuspavillons sahen prächtig aus, die bunten Seidenbänder, mit denen sie geschmückt waren, bewegten sich träge und flatterten ab und zu im Wind. Blau und Gelb, Schattierungen von Grün; die Farben sangen von Sand und Sonnenschein, von Wind und Moos. Die wirbelnden Drachen und die Purpurbanner der Kaufleute ließen am Himmel ein geheimnisvolles und wundererfülltes Prachtbild entstehen. Heute waren die Westwolken ziemlich früh gekommen. Von Sommerwinden getrieben, wurden sie von der langsam aufgehenden Sonne mit roten und gelben Streifen markiert und formten einen silbrig-aufgelösten Hintergrund für die Geheimnisse des Tages.
Und die Gerüche – ungeheuer verführerisch waren sie! Weihrauch, Blumen, kandierte Farnkräuter, in Butter gebackene Reiskuchen, Geleekuchen, würziger Fischbraten, frischer Fisch und Seetangsalz; Eingemachtes, Geräuchertes, süße Säfte und Eiskrem, Sirup, Früchte, dunkles Bier und Wein, rosa Zuckerwolken, die viel zu leicht auf der Zunge zergingen; und phantastische Parfüms! Süßlich riechende und saure, Moschusduft und Bittergeruch, alle Sorten von Kräutern; Aromapflanzen, Wurzeln, gute und böse Zaubermittel: um eine Geliebte zu finden, ein Kind zu machen, eine Ehe zu stiften oder den Tod zu bringen. Und Krüge der Verheißung, Salben der Freude, Fetische, die in geflochtenen Körben steckten, Träume aus Papier (und auch ein oder zwei Albträume) – und über allem eine Aura der Stärke, ein Aroma, das zu gleichen Teilen aus Schweiß, Lust und Lachen bestand; über allem der schwache, warme Geruch von uns.
Erregung summte, Insekten gleich, in der gefühlsgeladenen Luft. Sie kreiste und schnellte plötzlich irgendwohin, entsprechend dem An- und Abschwellen und den Bewegungen der Menschenmengen.
Rings umher, in der Hitze des Tages (künstliche Schwüle kam durch Fontänen, Wasserfälle und verspielte Türme mit mechanischen Vorrichtungen, die kreiselnd Nebel erzeugten und ausbreiteten), sah man Erwachsene, die sich ihrer Halstücher und Tageshemden entledigten, die mit nackter Brust die breiten Straßen entlangschlenderten, hier und da stehenblieben und einzelne Waren näher in Augenschein nahmen. Die Alleen, die sich schlangengleich krümmten und wanden, waren allesamt mit Verkaufsständen gesäumt, die dicht an dicht standen. Die Warenangebote waren auf Zeltbahnen, gewebten und geflochtenen Matten ausgebreitet. Da waren die Bildhauer, die Handwerker, die Weber mit ihren Webstühlen, Krämer, Schneider und auch Spieler, Drucker und Maler, Töpfer und Schauspieler; eine jede Bude stand ganz eng an der nächsten, und überall wurden alle möglichen Kunstfertigkeiten angeboten. Bootsbauer mit Schiffsmodellen und Tuchnäher mit Segeln und großen Fahnen – im Himmel über uns explodierten pfeifend und krachend Feuerwerkskörper, es war wie ein Orgasmus. Dann waren da die Vorleser, die Taschenspieler, die Lehrer und die Clowns. Da gab es Glas und Seide, Silber und Gold, Eisen und Leder und Kerzen und Lampen, Körbe und Eimer, Koffer, Kisten und Truhen, Käsekräuter und Puppen, allerlei Nippes und Flitterkram, Blumen – getrocknete oder frische –, Biere und Weine, Schnäpse von weit entfernten Inseln, Zauberkräuter, Teegewürze und Zucker und Nähnadeln, Modellkleider und Minis und Kinos und Irrgärten. Und Tiere! Kriecher und Krabbler und Kletterer und Kreischer – Flieger und Springer und Quaker und Schreier. Alle Farben auf Federn, Horn und Pelz – angeleint, in Käfigen, hinter Zäunen oder Glas – Jobes Augen waren geblendet von all dem, was sie hier sah. Da gab es massenhaft technische Geräte – sogar eine Bildschirmstation, Modell Mark IV, über Kabel direkt mit den Datenbanken der höchsten Instanzen verbunden. Und dann gab es kleinere Geräte, Denker und Spielzeuge, die auf Bildschirmen aller Größen verwirrende Muster aufblitzen ließen. Sie lockten das Auge und narrten den Verstand. Jobe wollte herumstreifen, aber ...
Kuvig und Hojanna schenkten den Buden kaum Beachtung. Ganz gleich, ob Jobe laut zum Verweilen drängte: Sie durchquerten die Straße mit all ihren Illusionen und Wundern ohne Zögern. Sie hielten sich auch nicht am Pavillon der Gesichter auf – Kuvig konnte professionelle Wahrsager nicht leiden. Sie stellten sich trennend zwischen die Menschen und deren Götter, sagte sie. Und überhaupt wollten sie nicht auf dem Markt herumtrödeln, da sie wegen ernsthafter Angelegenheiten zum Meeresfest gekommen waren. Nur Dida und Jobe hatten vor Erregung gerötete Gesichter, aber bei Dida hatte es nichts mit dem Jahrmarkt zu tun.
Jobe war verwirrt, wie es nur ein Kind sein konnte – man hatte sie zu einem Volksfest mitgenommen, aber dieses Fest verlor jetzt all seine Reize. Denn nun hatte sie gar keine Zeit für die Vergnügungen, die überall geboten wurden. Keine Zeit für die Schwärme tanzender Seidenfische; weder für Pantomimen noch für Akrobaten; weder für Gaukler noch für Theaterspiele; nicht einmal für die komischen Posen der Bettler mit dem aufgeschminkten Lachen, den lustigen Pappnasen und den großen, flachen Füßen. »Als du gefragt hast, ob du mitkommen darfst, Jobe, haben wir dir gleich gesagt, dass es kein reines Vergnügen wird. Zuerst gehen wir zur Markthalle, um Stoffe einzukaufen, dann muss sich Großvater um das Schulgeld kümmern; und nach dem Essen geht's zur Plaza, um den Vertrag auszuhandeln, damit Dida verheiratet werden kann. Es haben sich sehr viele Familien beworben – die Auswahl wird sehr schwer sein. Aber bei solchen Dingen wie Verheiratungen soll man nichts übereilen. Wenn es sich um deine Heirat handelte, hättest du auch etwas gegen zu große Hast, Jobe. Wenn wir danach noch Zeit haben, gehen wir vielleicht zum Spielzeughändler.«
»Spielzeug kann ich auch zu Hause sehen«, murrte Jobe. Aber nicht allzu laut, denn wenn Hojanna sich umstimmen ließe, würde Großvater um so strenger werden.