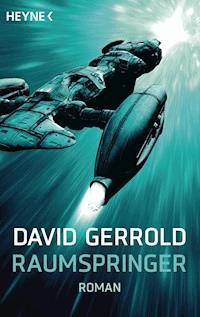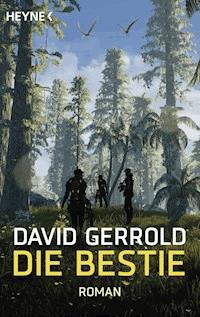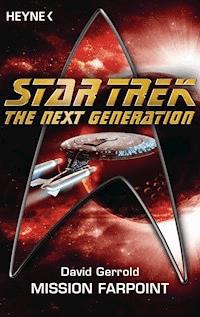8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Geheimnis der Zeit
Daniel Eakins, ein Collegestudent im Jahr 1974, bekommt eines Tages Besuch von seinem Onkel Jim. Doch dieser stirbt schon bald und hinterlässt Daniel ein einzigartiges Erbstück – einen Zeitgürtel. Damit ist Daniel in der Lage, in der Zeit hin und her zu reisen. Schon bald begegnet er in der Zukunft einer weiteren Version seiner selbst, gewinnt Geld bei Pferdewetten und wird reich. Aber das wahre Geheimnis der Zeit kennt er noch nicht, und es wird ihn alles kosten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Ähnliche
Das Buch
Als der junge Daniel Eakins das Paket mit der Erbschaft seines Onkels Jim öffnet, traut er seinen Augen nicht: Denn darin befindet sich eine Apparatur, die Zeitreisen möglich macht. Nach reiflichem Überlegen und Studieren der Gebrauchsanweisung, beschließt Daniel, es einmal auszuprobieren, und springt in Vergangenheit und Zukunft. Und er entdeckt dabei, dass Zeitmaschinen ganz anders funktionieren, als sich das H. G. Wells und viele andere vorgestellt haben. Man reist zwar tatsächlich durch die Zeit und kann weltgeschichtlichen Ereignissen früherer Tage beiwohnen oder eine Zukunft besuchen, die aus Sicht der Gegenwart erst noch geschrieben werden muss. Aber jedes Mal, wenn man das tut, erschafft man eine neue Welt, die von der vorherigen abweicht, und sei es nur ein kleines bisschen. Und in dieser jeweiligen neuen Welt gibt es auch einen jeweiligen neuen Daniel Eakins, der womöglich ganz andere Absichten hat als der ursprüngliche – und seinerseits wieder eine neue Welt mit einem neuen Daniel Eakins erschafft. Und so wird, was als atemberaubendes Zeitreise-Abenteuer begonnen hat, für Daniel mehr und mehr zu einem existenziellen Albtraum, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint.
Der Autor
David Gerrold, 1944 in Chicago geboren, studierte Theaterwissenschaft und begann seine Karriere in der Science-Fiction als Drehbuchautor. Sein erster großer Erfolg war die legendäre Episode »The Trouble with Tribbles« (»Kennen Sie Tribbles?«) aus der Kultserie Star Trek. Später widmete er sich vor allem dem Schreiben von Romanen. Für Zeitmaschinen gehen anders von 1973 wurde er für den begehrten Nebula Award nominiert. Im Heyne-Verlag sind von David Gerrold lieferbar: Die biologische Invasion, Der Tag der Verdammnis, Sternenjagd, Inmitten der Unendlichkeit, Die Reise der Jona.
Mehr zu David Gerrold und seinen Romanen auf:
DAVID GERROLD
ZEIT-
MASCHINEN
GEHEN
ANDERS
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
THE MAN WHO FOLDED HIMSELF
Deutsche Übersetzung von Mary Hammer
Neu durchgesehen und vollständig überarbeitet von Alexander Martin
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen
unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung
sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglich-
machung, insbesondere in elektronischer Form, ist
untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter
enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine
Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe 10/2017
Copyright © 1973 by David Gerrold
Copyright © 2017 des Vorworts by Sascha Mamczak
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-20992-6V001
www.diezukunft.de
Vorwort
Der Mensch ist das Tier, das es nicht ertragen kann, etwas zu ertragen. Also hat es die Science-Fiction erfunden. Wir nehmen es nicht hin, dass wir nur zusammengeballter Sternenstaub auf einem Felsen am Rande einer unbedeutenden Galaxis sind; wir bauen gigantische Weltraumschiffe und erobern das Universum. Wir finden uns nicht damit ab, dass die Entfernungen zwischen den Planetensystemen letztlich unüberwindbar sind; wir gehen auf Warp-Geschwindigkeit oder nehmen gleich die Abkürzung durch den Hyperraum. Wir akzeptieren nicht, dass wir Geschöpfe sind, die jeden Moment zerbrechen und sterben können; wir rüsten unsere Körper cybertechnisch auf oder laden unseren Geist in eine Maschine.
Und dann ist da noch die Zeit, die ultimative Demütigung. »Des Menschen Herrscher«, wie es bei Shakespeare heißt. »Sie ist ihm Vater und Mutter zugleich, und sie ist sein Grab.« Was aber, wenn die Zeit doch gar kein so übermächtiger Herrscher des Menschen ist? Wenn Wissenschaftler herausfinden, dass auch die Zeit zu jenen Naturfundstücken gehört, die wir verändern, manipulieren, ja unsererseits beherrschen können? Warum sollte der Mensch dann nicht hoffen, »eines Tages in der Lage zu sein, dass er seinen Lauf in der Richtung der Zeit anhalten oder beschleunigen kann oder dass er sogar umkehren und in der Gegenrichtung fahren kann«?
Dieser Hoffnung hat H. G. Wells in »Die Zeitmaschine«, dem berühmtesten Zeitreiseroman aller, nun ja, Zeiten, erstmals einen angemessenen fiktionalen Raum eröffnet. Schon vor diesem großen Werk gab es reichlich Zeitreisegeschichten, aber Wells war der erste, der seinen Helden in die Zukunft (dazu noch in eine sehr weit entfernte Zukunft) schickte. Und er war der erste, der das Zeitreisen zu einer Sache der Techniker, der Ingenieure, der Maschinenbauer machte. Die Zeit also – einfach nur eine weitere Dimension, die wir uns früher oder später untertan machen werden?
Nun, es scheint, als ließe sich die Zeit trotz aller Bemühungen, was das naturwissenschaftliche Verständnis des Phänomens betrifft, trotz Planck und Einstein, trotz Penrose und Hawking, nicht einfach so beherrschen; jedenfalls ist die Möglichkeit, eine Zeitreise zu unternehmen, über hundert Jahre nach Wells’ Anregung immer noch so fern wie eh und je. Und die Tatsache, dass bisher kein Besucher aus der Zukunft bei uns aufgetaucht ist, könnte sogar darauf hindeuten, dass uns diese Möglichkeit für immer verwehrt bleiben wird.
Das können wir natürlich nicht hinnehmen. Und so hat die Science-Fiction in den Jahrzehnten nach Wells den von ihm etablierten fiktionalen Raum in alle nur denkbaren Richtungen ausgebaut. Inzwischen reisen wir nicht einfach nur in die Vergangenheit und Zukunft, sind Zeuge historischer Ereignisse oder erleben Abenteuer in kommenden Epochen, nein, wir verändern historische Ereignisse und erzeugen ganz neue Epochen. Längst häufen wir auch die sich bereits aus der Vorstellung einer Zeitreise ergebenden Paradoxa aufeinander, verknoten sie miteinander, machen aus Geschichte Escher’sche Architektur. Und längst ist die Zeit in unserer Fantasie keine starre Linie mehr, sondern ein unerschöpfliches Panoptikum von Möglichkeiten, ein Vexierspiel aus Alternativen. Denn eine Reise durch die Zeit ist die Begegnung mit einer Welt, in der wir einmal – war es vorher oder nachher? – beschlossen haben, durch die Zeit zu reisen. Eine Welt also, die gar nicht die Vergangenheit oder Zukunft jener Welt sein kann, die wir verlassen haben. Etwas ist anders, etwas ist neu. Wir sind neu.
Eine solche Geschichte erzählt auch der Roman, den Sie gerade in Händen halten. Und er erzählt sie mit einem besonderen Twist. David Gerrolds »Zeitmaschinen gehen anders« ragt aus der Flut an Erzählungen, die Wells’ grundlegende Idee zu schwindelerregenden Gedankenexperimenten gesteigert haben, dadurch heraus, dass der Autor den ganzen, wie Harry Harrison es einmal so schön nannte, »Chronokokolores« in einigen wenigen Szenen abhandelt. Natürlich verändert jede Zeitreise die Geschichte; natürlich führt jede Zeitreise zu Paradoxa; natürlich erzeugt jede Zeitreise eine neue Zeitlinie. Warum sich also den Kopf darüber zerbrechen? Warum sich groß mit »Logik« beschäftigen? Gerrolds Thema – auch wenn sich sein Zeitreisender immer wieder an »Logik« abarbeitet – ist ein anderes, und es ist philosophisch und literarisch fruchtbarer als die Frage, wer oder was irgendwann einmal wessen Ursache oder Folge war. »Zeitmaschinen gehen anders« handelt davon, was in jenem Moment geschieht, in dem wir die Entscheidung treffen, die Zeitmaschine in Gang zu setzen: In jenem Moment kommt uns die Welt für immer abhanden. (Um genau zu sein: Die Welt ist uns schon abhandengekommen, wenn Sie den ersten Satz des Buches lesen.)
Das sagt sich recht leicht, aber wir sollten nie vergessen, dass die Welt, in der wir uns befinden, alles ist, was wir haben. Oder waren Sie schon einmal in einer anderen? Ernsthaft? Selbst wenn uns das Raum-Zeit-Kontinuum, in das wir geboren oder, so Sartre, »geworfen« wurden, nicht gefällt; es ist unser Zuhause. Und hier ist die Pointe, die David Gerrold im ontologischen Kern einer Zeitreise entdeckt: Wenn wir meinen, die Demütigung der Zeit dadurch überwinden zu können, dass wir ihre Fesseln abwerfen, täuschen wir uns grundsätzlich. Wir brauchen die Zeit. Wir sollten ihr dankbar sein.
Gerrolds Zeitreisender begreift das ziemlich bald, und auch wenn das, was auf seine Entscheidung, die Zeitmaschine in Gang zu setzen, folgt, einer der verrücktesten und intensivsten Zeitreisetrips ist, die je geschrieben wurden, bleibt er ein »ordinary guy«, der verzweifelt an etwas festzuhalten versucht, was ihm für immer abhandengekommen ist. »Ich habe mein Leben zusammengefaltet und in den Zeitraum von ein paar Monaten gepresst«, heißt es an der Stelle, die den Originaltitel des Romans aufgreift, aber wissen wir an diesem Punkt noch, welcher Erzähler zu uns spricht oder auf welcher Zeitebene wir uns befinden? Oder geht es nur noch darum, einen Ort zu finden – einen Ort zu erschaffen –, wo so etwas wie ein normales Leben möglich ist? Es ist nicht möglich. Es hat ja auch niemand behauptet, dass die Science-Fiction es uns leicht machen würde.
David Gerrolds Roman braucht nicht viele Seiten, um diesen existenziellen Schock zu erzeugen, der noch lange nachwirkt, wenn wir das Buch zu Ende gelesen haben. Und es spielt auch keine Rolle, dass »Zeitmaschinen gehen anders«, 1973 erstveröffentlicht, die Reise von einer Ära aus beginnt, in der es in Badezimmern Höhensonnen gab und die Musik aus Kassettenrekordern kam: Indem Gerrold die britische Inner-Space-Science-Fiction der späten Sechziger und frühen Siebziger für seine Zwecke adaptierte, gelang ihm eine universelle Parabel auf die Situation eines (menschlichen) Bewusstseins in einem diesem Bewusstsein prinzipiell unverständlichen Kosmos.
Eine Parabel wohlgemerkt; keine solipsistische Metapher und auch keine Allegorie auf die unterschiedlichen Ichs, die wir in einem Leben so durchlaufen. David Gerrold, ein Science-Fiction-Autor, der nie zu jenen Vertretern seines Fachs gehörte, die das Label als etwas Lästiges empfunden haben, hat mit »Zeitmaschinen gehen anders« einen waschechten Zeitreiseroman geschrieben. Nur eben einen Roman darüber, was wirklich geschieht (was wir zumindest annehmen können, dass wirklich geschieht), wenn wir irgendwann einmal beschließen, durch die Zeit zu reisen. Ja, vielleicht können wir dann tatsächlich am lebenden Objekt Dinosaurierforschung betreiben oder Hitler in jungen Jahren aus dem Verkehr ziehen. Und vielleicht können wir auch unserem früheren Ich einflüstern, im Lotto auf eine bestimmte Zahlenkombination zu setzen. Aber was wirklich geschieht, ist: Wir fallen aus der Welt und werden selbst zu einer Welt. Wir werden zu allem, was wir noch haben.
»Was wirklich geschieht« ist keineswegs eine Sache, die nur sogenannte Realisten oder gar Wissenschaftler angeht. Ganz im Gegenteil: Was wirklich geschieht, ist – so liegen die Dinge in diesem Universum, in dem wir leben und sterben und auch sonst einiges ertragen müssen – eine Sache der Kunst.
Sascha Mamczak
ZEITMASCHINEN GEHEN ANDERS
Dieses Buch ist für Larry Niven, einen guten Freund,
der glaubt, dass Zeitreisen unmöglich sind.
Vermutlich hat er recht.
Ach gäb’ uns eine höh’re Macht im Leben
Uns selbst zu sehen wie uns andre sehen!
Wir würden vielen Torheiten entgehen,
Und törichter Ahnung.
ROBERT BURNS
In der Schachtel war ein Gürtel. Und dieses Manuskript.
Ich hatte Onkel Jim seit Monaten nicht mehr gesehen.
Er sah schrecklich aus. Seine Haut war schlaff und runzlig, sein Teint grau, er war ganz mager und wirkte erschöpft. Er schien um zehn Jahre gealtert zu sein. Oder um zwanzig. Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, waren wir fast gleich groß gewesen. Nun stellte ich fest, dass ich größer war als er.
»Onkel Jim!«, sagte ich. »Geht es dir gut?«
Er schüttelte meinen Arm ab. »Ja, mir geht’s gut, Danny. Ich bin nur ein bisschen müde, das ist alles.« Er betrat mein Apartment. Auch sein Gang war nicht mehr so schwungvoll wie früher, eher schleppend. Mit einem Seufzer ließ er sich auf die Couch sinken.
»Kann ich dir etwas anbieten?«
»Nein, ich hab nicht viel Zeit. Wir müssen eine wichtige Sache besprechen … Wie alt bist du, Junge?« Er sah mich prüfend an.
»Wie? Ich bin neunzehn. Das weißt du doch.«
»Ah.« Die Antwort schien ihn zufriedenzustellen. »Gut. Ich hatte Angst, ich käme zu früh. Du siehst so jung aus …« Er hielt kurz inne. Dann fragte er: »Wie läuft’s an der Uni?«
»Gut«, sagte ich mit neutraler Stimme. Die Universität war langweilig, aber Onkel Jim bezahlte nun mal mein Studium. Dreihundert Dollar die Woche, dazu mein Apartment und meinen Wagen. Und hundert Dollar Taschengeld pro Woche extra, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme.
»Es gefällt dir da also nicht besonders, stimmt’s?«
»Nein, tut es nicht.« Warum sollte ich ihm sagen, dass es mir gefiel? Er würde es ohnehin merken, wenn ich log.
»Willst du lieber was anderes machen?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Ich könnte ohne die Uni leben.«
»Ja, könntest du«, stimmte er mir zu. »Weißt du eigentlich, wie viel Vermögen du gerade besitzt?«
»Nein. Wie viel?«
Er spitzte gedankenvoll die Lippen; die runzlige Haut straffte sich für einen Moment. »Einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar.«
Ich pfiff durch die Zähne. »Du machst Witze.«
»Nein, ich mache keine Witze.«
»Das ist ein ziemlicher Haufen Geld.«
»Es wurde gut angelegt.«
Einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar … »Und wo ist dieses Geld jetzt?«, fragte ich. Dumme Frage.
»In Aktien, Schuldverschreibungen, Anlagen. Solche Sachen.«
»Ich kann also nicht darüber verfügen, oder doch?«
Er sah mich an und lächelte. »Ich vergesse immer wieder, Dan, wie ungeduldig du warst … bist«, korrigierte er sich und warf mir dabei einen nervösen Blick zu. »Du brauchst es doch nicht jetzt sofort, oder?«
Ich dachte darüber nach. Einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar. Selbst wenn es in Fünfzigdollarscheinen angeliefert worden wäre – mein Apartment wäre zu klein dafür gewesen. »Nein«, sagte ich. »Ich glaube nicht.«
»Dann lassen wir’s, wo es ist. Aber es ist dein Geld. Wenn du es brauchst, kannst du es haben.«
Einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar. Was könnte ich damit machen? Was könnte ich damit nicht machen? Ich wusste, dass mir meine Eltern ein wenig Geld hinterlassen hatten, aber …
Einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar!
Auf einmal hatte ich Mühe zu schlucken.
»Ich dachte, ich könnte erst über das Geld verfügen, wenn ich fünfundzwanzig bin«, sagte ich dann.
»Nein«, erwiderte Onkel Jim. »Ich verwalte es für dich, aber du kannst es jederzeit haben.«
»Ich bin gar nicht sicher, ob ich es überhaupt will«, sagte ich zögerlich. »Nein, versteh mich nicht falsch – natürlich will ich es. Es ist nur …« Wie sollte ich es erklären? Ich sah mich schon in einer großen Villa wie in einer Falle sitzen, umgeben von Dienern und Leibwächtern, deren einzige Pflicht darin bestand, mich daran zu erinnern, jeden Morgen die riesigen Haufen Banknoten abzustauben. Einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar. Sogar in Hunderterscheinen würde es einige Wandschränke füllen. »Vierhundert Dollar pro Woche reichen mir wirklich«, sagte ich. »Alles, was mehr ist …«
»Vierhundert pro Woche?« Onkel Jim runzelte die Stirn, dann sagte er: »Ach ja, ich vergesse immer wieder … Es war ein bisschen viel in letzter Zeit … Also, Dan, ich werde dein wöchentliches Taschengeld auf tausend Dollar erhöhen, aber ich möchte, dass du etwas tust, um es dir zu verdienen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte ich erfreut. Das war eine Summe, unter der ich mir etwas vorstellen konnte. (Einhundertdreiundvierzig Millionen – ich war nicht sicher, ob es auf der ganzen Welt überhaupt so viel Geld gab. Aber tausend Dollar – bis tausend konnte ich mühelos zählen.) »Was soll ich dafür tun?«
»Ein Tagebuch führen.«
»Ein Tagebuch?«
»Ganz richtig.«
»Du meinst, jeden Tag etwas in ein schwarzes Buch schreiben? Liebes Tagebuch, heute küsste ich ein Mädchen – und solches Zeug?«
»So natürlich nicht. Ich möchte, dass du aufschreibst, was dir wichtig erscheint. Jeden Tag ein paar Seiten, das ist alles. Du kannst spezielle Ereignisse notieren oder einfach einige allgemeine Bemerkungen machen. Ich möchte nur, dass du mir versprichst, jeden Tag … oder sagen wir, mindestens einmal in der Woche … etwas aufzuschreiben.«
»Und du willst es dann lesen?«, fragte ich vorsichtig.
»Nein, nein«, sagte er hastig. »Ich will nur, dass du es tust. Du brauchst es mir nicht zu zeigen. Es ist dein Tagebuch. Was du damit – oder daraus – machst, liegt allein bei dir.«
Ich dachte nach. Tausend Dollar die Woche … »Kann ich ein Diktiergerät verwenden? Oder eine Sekretärin anstellen?«
Er schüttelte den Kopf. »Es muss ein persönliches Tagebuch sein, Dan. Das ist sein eigentlicher Zweck. Wenn jemand anders es zu sehen bekäme, könnte dich das hemmen. Und ich will, dass du wirklich ehrlich bist.« Er setzte sich aufrecht hin, und für einen Moment sah er wie der Onkel Jim aus, an den ich mich erinnerte: groß und kräftig. »Spiel kein Spiel, Dan, bleib in deinem Tagebuch bei der Wahrheit. Wenn du das nicht tust, wirst du nur dich selbst betrügen. Und schreib alles auf – alles, was dir wichtig erscheint.«
»Alles«, wiederholte ich wie betäubt.
Er nickte. Das Wort hatte für ihn offenbar eine große Bedeutung.
»Also gut«, sagte ich schließlich. »Aber wofür das Ganze?«
»Wofür?« Onkel Jim sah mich an. »Das wirst du beim Schreiben herausfinden.«
Wie gewöhnlich hatte er recht.
Ab einem gewissen Grad von Reichtum ist Geld überflüssig.
Das hatte ich nicht erst letzte Woche entdeckt, ich hatte schon lange den Verdacht.
Vierhundert Dollar »Taschengeld« pro Woche gibt einem ein beträchtliches Maß an Freiheit, das zu tun, worauf man Lust hat. Innerhalb gewisser Grenzen natürlich – aber diese Grenzen sind so weit gesteckt, dass sie einen kaum einschränken. Erhöht sich dieser Betrag nun auf tausend Dollar pro Woche, spürt man das eigentlich gar nicht. Es macht praktisch keinen Unterschied. Das stimmt wirklich.
Na schön, ich kaufte mir etwas Neues zum Anziehen und einige Schallplatten und ein paar andere unnötige Dinge, auf die ich schon länger ein Auge geworfen hatte. Aber ich war ohnehin daran gewöhnt, so viel Geld zu haben, wie ich brauchte (oder wollte) – mehr Geld in der Tasche war also keine wirklich große Sache.
Meine Taschen wurden nur etwas größer. Das war alles.
Ich reise gern. Gewöhnlich fliege ich ein- oder zweimal im Monat fürs Wochenende nach San Francisco oder woandershin: Palm Springs, Santa Barbara, Newport, San Diego. Immer der Sonne nach, ist meine Devise.
Seit Onkel Jim mein Taschengeld erhöht hatte, war ich in Acapulco, in New York und auf den Bahamas. Und ich überlege, einmal nach Europa zu reisen. Aber immer allein unterwegs zu sein, macht nicht allzu viel Spaß – und niemand, den ich kenne, kann es sich leisten, mich zu begleiten.
Also bin ich eigentlich genauso oft zu Hause wie vorher.
Ich könnte mir jede Menge Dinge kaufen, aber ich war noch nie besonders scharf darauf, Dinge zu besitzen. Die müssen ständig abgestaubt werden. Außerdem habe ich ja alles, was ich brauche.
Zum Teufel, ich habe, was ich will – und das ist mehr, als ich brauche. Ja, ich habe jetzt alles, was ich will.
Ein großes Stück vom Kuchen.
Und ich finde, das ist ganz schön langweilig.
Ich brach mein Studium nicht direkt ab, ich ließ es gewissermaßen ausklingen.
Es war ja auch ziemlich langweilig.
Ich merkte, dass ich meinen Kommilitonen immer weniger zu sagen hatte. Ich nenne sie meine Kommilitonen, weil ich nicht sicher bin, ob sie jemals meine Freunde waren. Wir sprachen einfach nicht dieselbe Sprache.
Typische Konversation: »… kannst du mir fünf Scheine borgen, ist sie leicht zu vernaschen, meinst du, ich kann bei ihr landen, hast du ein paar Groschen, mein Auto ist kaputt, kennst du jemanden, der ’s schon mit ihr gemacht hat, die Vorlesung um zehn ist stinklangweilig, leih mir bitte etwas Geld, was machen wir am Wochenende …«
Sie hatten auch kein Verständnis für meine Probleme.
»Probleme? Mit tausend Dollar pro Woche, wer kann da noch Probleme haben?«
Ich.
Glaube ich jedenfalls.
Ich weiß, da stimmt etwas nicht. Ich bin nicht glücklich, und ich wünschte, ich wüsste, warum nicht.
Ich frage mich, ob Onkel Jim versucht, mir irgendetwas beizubringen.
Ich denke, ich werde das Ganze genau so erzählen, wie es passierte, und ich werde versuchen, dabei nicht zu weinen. Wenn ich das schaffe.
Onkel Jim ist tot.
Der Anruf kam heute Morgen um elf. Es war einer der Anwälte seiner Firma, Biggs oder Briggs oder so ähnlich. Er sagte: »Daniel Eakins?«
Ich sagte: »Ja?«
Er sagte: »Hier spricht Jonathan Biggs-oder-Briggs-oder-so-ähnlich. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Es betrifft Ihren Onkel.«
»Meinen … Onkel?« Ich muss gezittert haben. Alles schien plötzlich aus Eis zu sein.
Der Mann versuchte, rücksichtsvoll zu sein, aber es gelang ihm nicht allzu gut. Er sagte: »Er wurde heute Morgen von seiner Hausangestellten gefunden …«
»Er ist … tot?«
»Es tut mir leid. Ja.«
Tot? Onkel Jim?
»Wie … Ich meine …«
»Er ist eingeschlafen und einfach nicht mehr aufgewacht. Immerhin war er ein sehr alter Mann …«
Alt?
Nein! Das konnte nicht sein. Ich konnte das nicht akzeptieren. Onkel Jim war unsterblich.
»Wir dachten, dass Sie – als nächster Verwandter – persönlich die Arrangements für die Beerdigung treffen möchten …«
Beerdigung? Arrangements?
»Andererseits ist uns bewusst, dass der Verlust Sie womöglich sehr mitnimmt. Wir haben uns also die Freiheit genommen und …«
Tot? Onkel Jim?
Aus dem Telefon kamen immer noch Worte. Ich legte auf.
Die Beerdigung war ein Albtraum. Irgendein Idiot hatte entschieden, den Sarg geöffnet zu lassen, »damit Familie und Freunde von dem Verblichenen gebührend Abschied nehmen können«.
Familie und Freunde – das war ich. Und die Anwälte. Sonst niemand.
Das überraschte mich. Und enttäuschte mich auch etwas. Ich hatte immer gedacht, Onkel Jim wäre ein bekannter und angesehener Mann. Aber niemand war hier; offenbar war ich der Einzige, dem Onkel Jim etwas bedeutet hatte.
Onkel Jim sah fürchterlich aus. Sie hatten ihn geschminkt, damit es so aussah, als würde er nur schlafen. Es war ihnen nicht gelungen; es konnte die Tatsache nicht verbergen, dass hier der zusammengeschrumpfte Leichnam eines Greises lag. Ich muss ihn entsetzt angestarrt haben. Hatte er noch eingefallen ausgesehen, als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, so wirkte er nun als Toter geradezu ausgezehrt. Verbraucht.
Nein, das hier in diesem Sarg war nicht Onkel Jim. Das war nur ein Stück totes Fleisch. Was auch immer diesen Körper zu Onkel Jim gemacht hatte, es war fort – diese leere Hülle bedeutete mir nichts. Trotzdem heulte ich wie ein kleines Kind.
Die Anwälte brachten mich nach Hause. Ich bewegte mich dabei wie eine Marionette.
Alles schien unverändert – es war viel zu schnell gegangen, ich hatte keine Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was Onkel Jims Tod für mich bedeuten könnte, und nun saßen ein paar schwarz gekleidete Fremde in meinem Wohnzimmer und versuchten mir zu erklären, dass sich doch einiges ändern würde.
Ändern? Wie könnte ohne Onkel Jim alles noch so sein, wie es war?
Biggs-oder-Briggs-oder-so-ähnlich schob ein paar Papiere hin und her und schaffte es, dabei gleichzeitig verlegen und besorgt auszusehen.
»Ich glaube, ich weiß, um was es sich handelt«, sagte ich. »Ich habe vor einigen Wochen mit Onkel Jim gesprochen.«
»Ah, gut«, erwiderte er erleichtert. »Dann lässt sich das ja alles viel einfacher erledigen.« Er hielt kurz inne. »Dan … Daniel … Ihr Onkel hinterlässt Ihnen nichts.« Ich muss in diesem Moment einigermaßen verwirrt ausgesehen haben. »Das bedeutet, Sie sind arm«, fügte er mit einem Seufzer hinzu.
»Wie bitte?«, platzte ich heraus. »Da hat er mir aber etwas ganz anderes erzählt …«
»Hm? Was hat er Ihnen erzählt?«
Ich versuchte, mich zu erinnern. Nein, der Typ hatte recht – Onkel Jim hatte kein Wort über sein eigenes Vermögen verloren. Deshalb sagte ich vorsichtig: »Onkel Jim sagte mir, dass ich ein wenig Geld besitze … und dass er es verwaltet. Ich nahm an, dass auch er selbst einiges hatte – oder dass er einen Anteil davon bekam …«
Biggs-oder-Briggs schüttelte den Kopf. »Ihr Onkel erhielt tatsächlich einen Anteil. Aber es war nur ein sehr geringer Betrag. Sie haben ja selbst nicht allzu viel.«
»Wie viel?«
»Knapp sechstausend Dollar.«
»Wie bitte?«
»Fünftausendneunhundert und ein bisschen was. Ich kann mich gerade nicht an den genauen Betrag erinnern.« Er schob die Papiere zurück in seine Aktentasche.
Ich starrte ihn verwirrt an. »Was ist mit den hundertdreiundvierzig Millionen Dollar passiert?«
Nun blinzelte er verwirrt. »Entschuldigen Sie, aber …«
Ich kam mir zwar ziemlich idiotisch vor, trotzdem wiederholte ich: »Die einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar. Was ist damit passiert?«
»Einhundertdreiundvierzig Mill…« Er setzte sich die Brille auf. »Nun, Mr. Eakins, Sie besitzen sechstausend Dollar. Das ist alles. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, Sie hätten eine Summe von …«
Ich atmete tief ein und sagte: »Mein Onkel Jim saß hier – genau da, wo Sie jetzt sitzen – und erzählte mir, dass ich einhundertdreiundvierzig Millionen Dollar besitze und dass ich sie jederzeit haben könne, wann immer ich wolle.« Ich fixierte den Anwalt mit einem grimmigen Blick. »Also, wo ist das Geld?«
Er schien nicht sehr beeindruckt. Stattdessen lächelte er etwas gequält. »Nun, Daniel … Dan… ich denke, Sie werden verstehen, wenn ein Mensch alt wird, wird er manchmal ein wenig … na ja, wunderlich. Ihr Onkel mag Ihnen erzählt haben, Sie wären reich, er mag es sogar selbst geglaubt haben, aber …«
»Onkel Jim war nicht senil«, erwiderte ich eisig. »Er war vielleicht krank, aber als ich ihn das letzte Mal sah, war sein Geist so klar wie … wie meiner.«