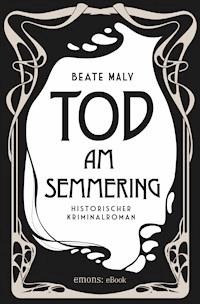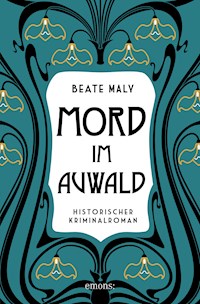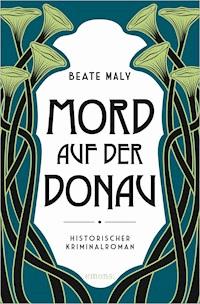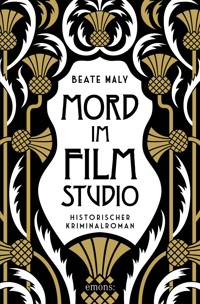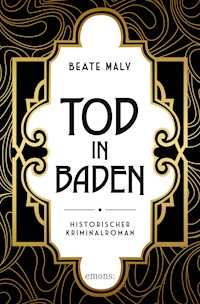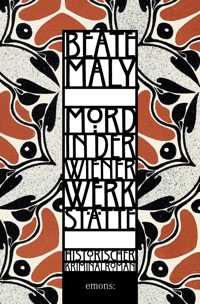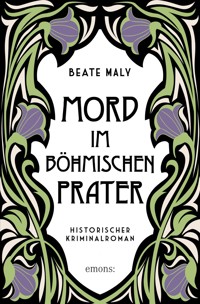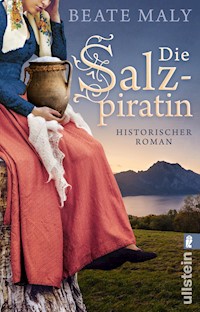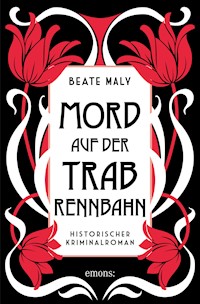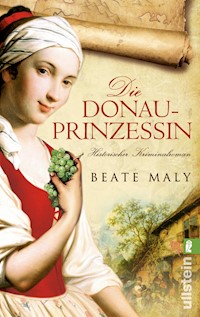
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord im Winzerhaus Wien im Herbst 1530: Winzertochter Fanny ist nach dem frühen Tod ihres Mannes wieder bei ihrem Vater eingezogen. Das geordnete Leben der jungen Winzerin gerät ganz kräftig durcheinander, als eine Leiche hinter dem Wirtshaus gefunden wird. Der tote Stadtrat war in dunkle Machenschaften verwickelt. Ausgerechnet der schweigsame Mathematiker Sebastian soll den Mörder finden – die Zusammenarbeit mit ihm ist eine Herausforderung für die zupackende und sehr direkte Fanny. Aber jeder weiß: Was sich streitet, das liebt sich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Donauprinzessin
BEATE MALY, geboren in Wien, ist Bestsellerautorin zahlreicher Kinderbücher, Krimis und historischer Romane. Ihr Herz schlägt neben Büchern für Frauen, die entgegen aller Widerstände um ihr Glück kämpfen.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Hebamme von WienDie Hebamme und der GauklerDer Fluch des SündenbuchsDie DonauprinzessinDer Raub der StephanskroneDie SalzpiratinDie KräuterhändlerinFräulein Mozart und der Klang der LiebeDie Frauen von SchönbrunnDie Bildweberin
Mord im Winzerhaus
Wien im Herbst 1530: Winzertochter Fanny ist nach dem frühen Tod ihres Mannes wieder bei ihrem Vater eingezogen. Das geordnete Leben der jungen Winzerin gerät ganz kräftig durcheinander, als eine Leiche hinter dem Wirtshaus gefunden wird. Der tote Stadtrat war in dunkle Machenschaften verwickelt. Ausgerechnet der schweigsame Mathematiker Sebastian soll den Mörder finden – die Zusammenarbeit mit ihm ist eine Herausforderung für die zupackende und sehr direkte Fanny. Aber jeder weiß: Was sich streitet, das liebt sich ...
Beate Maly
Die Donauprinzessin
Historischer Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Oktober 2014© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Adriaen Jansz van Ostade/The Bridgeman Art Library (Taverne); © Superstock/Getty Images (Frau); © FinePic®, München (Hintergrund)Autorenfoto: © Fabian Kasper E-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-0987-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Nachwort
Leseprobe: Die Bildweberin
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
27. September 1529
Mit zusammengekniffenen Augen versuchte Franz, die tiefe Fleischwunde am rechten Oberschenkel zu ignorieren, aber es gelang ihm nicht, denn bei jedem Schritt durchdrang ein stechender Schmerz seinen Körper. Ein Janitschar hatte ihm die Verletzung mit einem Yatagan zugeführt, jenem gefürchteten Dolch mit geschwungener Klinge, den die Krieger der Elitetruppe des Sultans im Kampf bei sich trugen.
Der einzige Trost, den Franz im Moment finden konnte, war die Tatsache, dass der Osmane nun nicht mehr lebte. Franz hatte sich mit seiner Pike revanchiert und den Feind aufgespießt, bevor er selbst sich durch die Bresche beim Kärntnertor hatte schlagen können. Zwei Tiroler Bergleute, die gekommen waren, um die Wiener im Kampf gegen die Osmanen zu unterstützen, hatten ihm Deckung gegeben. Was passiert wäre, wenn sie ihn im Getümmel nicht erkannt hätten, wollte er sich lieber nicht ausmalen.
Rasch war er hinter die dichte Reihe der Verteidiger geschlüpft, und jetzt befand er sich innerhalb der Stadtmauern, auf dem Weg von der Kärntnerstraße zur Weihburggasse, wo der Ratsherr Nikolaus Rötzer in einem prächtigen Patrizierhaus wohnte. Kaum, dass Franz in die enge Gasse mit den hohen Häusern aus Stein einbog, umgab ihn eine merkwürdige Stille. Nach den Gefechten der letzten Stunden wirkte diese Gasse wie ein Ort des Friedens. Eine Oase der Ruhe inmitten von Kampf und Gewalt.
Die Schüsse der Arkebusen und Schreie der Verletzten drangen nur von fern an Franz’ Ohr. Auch die riesigen Bottiche, die vor den Häusern standen, sahen nicht aus, als hätten sie etwas mit den Kriegshandlungen zu tun. Dabei sollte der Wellenschlag des Wassers anzeigen, wie weit die Osmanen mit ihren Grabungen unterhalb der Stadtmauer gekommen waren. Niemand in dieser Gasse kümmerte sich um Wasser, Wellenschlag oder Grabungen. Die Fensterläden waren geschlossen, und dahinter schienen die Menschen zu schlafen, so, als ginge sie der Krieg nichts an.
Irritiert ob dieser Ignoranz, schleppte sich Franz zum Haus des Ratsherren. Der Stoff seiner Hose war mittlerweile blutdurchtränkt. In seinen Ohren rauschte es. Er brauchte dringend einen Bader oder besser noch einen Medikus, der die Wunde nähte und verband. Aber zuvor musste er noch seinen Auftrag erfüllen, schließlich hatte Rötzer ihm bloß einen Teil seines Lohnes bezahlt. Den Rest sollte er jetzt erhalten. Franz wollte sich die Summe auf keinen Fall entgehen lassen. So kraftvoll wie möglich klopfte er mit der Faust gegen die solide Tür aus dunklem Eichenholz.
Schon wenige Augenblicke später wurde sie geöffnet. Ein dünner alter Mann mit grauem Haar und milchig trüben Augen stand mit gebeugtem Rücken vor ihm. Neugierig musterte er Franz. Sein Blick blieb an dem verletzten Oberschenkel hängen.
»Was wollt Ihr?«, fragte er misstrauisch.
»Mein Name ist Franz Sollinger, ich bin Bote und habe dringende Nachrichten für den Ratsherren Rötzer. Es geht um die Vororte Dornbach und Hernals.«
Der alte Mann schien wenig beeindruckt. Nur zögerlich machte er einen Schritt zur Seite, öffnete die Tür ein Stück weiter und ließ Franz ins Haus. Angenehm warm war es hier, und der Geruch nach frischem Braten lag in der Luft. Ob der Ratsherr wusste, dass andere Bewohner hungerten und froren und die Menschen, die tapfer vor den Stadtmauern kämpften, schon seit Wochen kein Brot mehr hatten? Ihre Kinder schrien nachts vor Hunger und Angst. Die Mütter beruhigten sie mit lauwarmem Wasser statt mit Milch.
»Folgt mir«, sagte der Alte. Dann drehte er sich um und blickte erneut auf Franz’ Bein. »Könnt Ihr die Treppe hochsteigen?«
Franz nickte.
»Mir soll’s recht sein.« Der Alte zuckte mit den Schultern. »Aber eins sag ich gleich. Ich kann Euch mit meinen alten Händen nicht auffangen. Wenn Ihr stürzt, purzelt Ihr die Treppe runter und brecht Euch das Genick. Dann kann kein Bader der Welt Euch mehr helfen.«
Er stieg über eine schmale Holztreppe in den ersten Stock, Franz folgte ihm. Bei jedem Schritt klammerte er sich am hölzernen Treppenlauf fest, drückte die Finger schmerzhaft ins Holz und zog möglichst steif sein verletztes Bein nach. Vor einer niedrigen Tür machte der Alte halt, klopfte an und wartete auf Antwort. Als eine Stimme: »Herein!« rief, öffnete er die Tür. Der warme Schein flackernder Kerzen drang aus dem Raum. Franz vernahm leises Murmeln, das mit dem Öffnen der Tür aber rasch verstummte.
»Ein Bote will Euch sprechen, mein Herr!«, sagte der Diener. Er richtete seine Worte an einen der drei Männer, die auf Stühlen rund um einen massiven Tisch saßen.
»Er soll hereinkommen!«
Zögerlich humpelte Franz in den niedrigen Raum, der einen wegen der dunklen Täfelung regelrecht zu erdrücken schien. Er erkannte zuerst die Stimme des Ratsherren, dann sein kantiges Gesicht. Letzten Sommer hatte Rötzer Franz zum ersten Mal mit einem wichtigen Botengang beauftragt. Seither stand er regelmäßig in seinem Dienst. Rötzer war groß und kräftig gebaut. Sein blondes Haar fiel ihm in modernen, mit dem Haareisen gedrehten Locken über die Schultern. Ein sorgfältig gestutzter Bart zeigte, dass der Mann auf sein Äußeres großen Wert legte.
Die beiden anderen Anwesenden kannte Franz bloß vom Sehen. Es waren ebenfalls Ratsherren. Einer war beinahe doppelt so breit wie Rötzer, mit einem riesigen Bauch und einem glänzenden roten Gesicht. Er zuckte nervös mit kleinen Augen und fuhr sich immer fort mit seiner Zunge über die fleischigen Lippen. Der andere sah aus, als hätte ein böser Illustrator ein lebendes Gegenteil des Dicken erschaffen. Hager, dürr und mit eingefallenen Wangen saß er kerzengerade auf seinem Stuhl, ohne mit dem Rücken die Lehne zu berühren. Der graue Vollbart konnte nicht verhindern, dass seine Lippen so dünn aussahen, als wären sie nicht mehr als ein feiner Strich. Dunkelbraune Augen musterten Franz kalt und blieben abweisend auf dem verletzten Bein hängen.
Verunsichert griff Franz nach der Wunde und bereute es sofort. Ein stechender Schmerz fuhr durch seinen Körper. Das Rauschen in seinen Ohren wurde lauter. Er geriet ins Wanken.
»Was ist mit Euch?«, fragte Rötzer ungehalten.
»Der Mann ist verletzt«, quiekte der Dicke neben ihm. Seine Stimme klang merkwürdig hoch, aber das Mitgefühl darin war nicht zu überhören. »Er braucht Hilfe. Wir sollten den Bader Peter Potz rufen lassen.«
Rötzer sah seinen Diener fragend an. Doch der schüttelte den Kopf. »Potz ist gestern in den Gefechten am Stubentor gefallen. Wir müssen einen Medikus rufen.«
Rötzer schnaufte empört: »Ein Medikus verlangt doppelt so viel Geld wie ein Bader.«
Mit zusammengekniffenen Augen musterte er Franz’ Bein, verzog angewidert den Mund und meinte verärgert: »Meinetwegen, ein Medikus soll kommen.«
Er richtete seinen Zeigefinger auf Franz. »Ich werde die Summe von Eurem Lohn abziehen.« Der Ratsherr stand auf, nahm einen der Stühle vom Tisch und stellte ihn neben Franz. »Setzt Euch«, befahl er.
Franz schleppte sich zum Stuhl und ließ sich erleichtert auf den gepolsterten Sitz fallen. Augenblicklich ließ das heftige Rauschen in den Ohren nach und wurde zu einem leisen Summen. Er wischte seine feuchte Hand an seinem Wams ab und blinzelte. Nach und nach gewöhnten seine Augen sich an das Halbdunkel im Raum. An den Wänden hingen kleine, gerahmte Ölgemälde, Zeichen des Wohlstandes und des Reichtums, die hier herrschten. Ein Bild zeigte das Profil einer Frau, das andere das eines Mannes. Es hatte deutliche Ähnlichkeit mit Rötzer. Entweder war es der Ratsherr selbst oder dessen Vater. Franz konnte es aus der Entfernung nicht erkennen.
»Nun redet. Wir haben noch wichtige Dinge zu besprechen und können uns nicht ewig Zeit für Euch nehmen. Was habt Ihr zu berichten?«, fragte Rötzer ungeduldig. Er war ein Mann, der es gewohnt war, nicht lange zu warten.
Auf dem Tisch standen ein Krug voll Wein, mehrere Becher, Käse und Obst. Offenbar der Nachtisch. Aber der Ratsherr bot Franz weder Trinken noch Essen an, vielleicht würde er später in der Küche einen Happen bekommen.
Franz befeuchtete seine trockenen, aufgesprungenen Lippen mit der Zunge und sagte: »Hernals und Dornbach sind gefallen!«
»Damit haben wir gerechnet«, antwortete Rötzer wenig beeindruckt. »Gibt es Überlebende?«
Traurig schüttelte Franz den Kopf. »Ich glaube nicht. Beide Dörfer sind in Flammen gestanden, in Dornbach ist sogar die Kirche abgebrannt.«
Der dürre Mann mit den kalten Augen schnaufte verächtlich: »Der Verlust der Kirche ist zu verkraften. Der Priester hat sich im letzten Monat auf die Seite seiner protestantischen Gemeinde gestellt und ist ebenfalls Anhänger dieses Ketzers Luther aus Eisleben geworden. Man hätte dem Pack ohnehin Einhalt gebieten müssen. Auf diese Weise ersparen wir uns die Arbeit.«
Überrascht ob der Heftigkeit der Worte, machte Franz eine Pause, bevor er weitersprach. »Eine Horde Janitscharen köpfte die Männer und vergewaltigte die Frauen. Kinder wurden vor den Augen ihrer Eltern auf riesige Stangen gespießt. Ein Mann bei lebendigem Leib gehäutet …«
Franz Stimme brach ab. Sobald er von den Gräueltaten erzählte, entstanden die Bilder dazu in seinem Kopf. Bilder, die er nie vergessen würde. Von Frauen, die mit angsterfüllten Gesichtern wegliefen, aber ihren Peinigern nicht entkamen, von Müttern, die sich schützend über ihre Kinder warfen und sie dennoch nicht retten konnten, und von Männern, die hilflos dabei zusehen mussten, wie alles, was sie aufgebaut hatten, mutwillig zerstört wurde. Franz wusste, dass die Erinnerungen an diesen unglückseligen 27. September im Jahr 1529 ihn für den Rest seines Lebens begleiten würden. Doch bis auf den Dicken, dessen Gesichtsfarbe fahl geworden war, schien niemand von seinen Beschreibungen beeindruckt.
»Sind die Osmanen noch im Dorf?«, fragte Rötzer.
»Nein, sie nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war. Zurückgeblieben sind bloß Leichen und verkohlte Häuser.«
»Steht der Gutshof der Herren von Als noch?«
»Der Gutshof Wendelstein der Familie Moser?«
»Genau der.«
Franz schüttelte bedauernd den Kopf. »Nein, die Feinde haben alles, wirklich alles vernichtet. Selbst die Weinstöcke haben sie abgefackelt.«
»Was für ein Jammer!«, sagte Rötzer, »es wird Jahre dauern, bis frische Reben neuen Wein liefern.« Er schnalzte mit der Zunge. »Was ist mit den Besitzern des Gutshofs?«
»Ich habe doch schon gesagt, dass …«
» … alle tot sind.« Bildete Franz es sich nur ein, oder wirkte Rötzer zufrieden über das, was er gehört hatte?
»Ich danke Euch für den Bericht, Franz …«, Rötzer hatte seinen Namen vergessen.
»Franz Sollinger!«
»Richtig, Sollinger. Ihr habt Eure Aufgabe brav erfüllt. Deshalb sollt Ihr auch den vereinbarten Lohn erhalten. In der Küche bekommt Ihr zu essen und zu trinken, mein Diener wird Euch Euren Lohn zahlen, abzüglich der Kosten für den Medikus, der gleich kommen sollte.«
Als der Ratsherr seine Wunde ansprach, wurde Franz wieder übel. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er wollte aufstehen, aber plötzlich drehte sich der Raum, und die dunklen, getäfelten Wände drohten samt Ölbilder auf ihn zu stürzen. Franz kippte von seinem Stuhl und landete unsanft auf dem sauberen Boden aus massiven Holzbrettern. Der dicke Ratsherr kreischte auf wie ein junges Mädchen.
Der Dürre sagte trocken: »Der Medikus muss sich nicht mehr bemühen, der Mann stirbt.«
Die nächsten Worte stammten von Rötzer, sie drangen nur noch aus weiter Ferne an Franz’ Ohr. Es war aber auch möglich, dass der Ratsherr seine Stimme senkte. Franz war zu sehr auf sich selbst konzentriert.
»Es ist höchste Zeit, dass wir unseren Freund Richard Pernfuß informieren. Bestimmte Unterlagen müssen verschwinden, und Laurentius kann ans Werk gehen.«
»Ich weiß nicht, ob ich das kann.« Das war mit Sicherheit der dicke Mann, die Stimme klang aufgeregt und verängstigt.
»Natürlich kannst du. Der Gutshof Wendelstein braucht dringend neue Besitzer, auch wenn es derzeit keine lehnsrechtliche Zusage gibt. Die Zeit wird alles regeln.«
»Aber was ist mit den Osmanen?«
»Wenn uns das Wetter weiterhin wohl gesonnen ist, wird Süleyman in spätestens zwei Wochen abziehen müssen. Er ist auf einen frühen Wintereinbruch nicht vorbereitet. Und sobald er weg ist …«
Einer der Männer lachte: »Dann müssen Weingärten neu bepflanzt und Steinbrüche bearbeitet werden. Die Stadt braucht eine solide Befestigungsanlage, und dazu bedarf es vieler Ziegel und Steine. Schließlich muss Wien sich gegen zukünftige Angreifer verteidigen können.«
Zufriedenes Lachen folgte.
Franz hatte das Gefühl, als befänden sich die Männer in einem anderen Raum. Sie schienen ihn nicht mehr wahrzunehmen. Vielleicht glaubten sie, er sei schon tot. Mit einem Mal war er selbst nicht mehr sicher, ob er noch lebte. Mit jedem Atemzug entfernte er sich weiter von ihnen und ihren Stimmen. Fühlte sich so das Sterben an?
Die letzten Worte, an die er sich später erinnern sollte, waren: »Darauf trinken wir!«
Franz’ Kehle war ausgetrocknet, aber die Aufforderung galt nicht ihm. Die Tür wurde geöffnet, kühle Luft streifte seine Wangen. Kurz darauf packte ihn jemand unsanft am Oberkörper. Als sein Oberschenkel bewegt wurde, stockte ihm der Atem. Er wollte schreien, hatte aber keine Kraft, wollte die Augen öffnen, doch es gelang ihm nicht mehr. Vielleicht lag es daran, dass er schon tot war. Als man ihn hochzerrte und versuchte aufzurichten, tauchte er in sanfte, erlösende Dunkelheit. Je tiefer er sank, umso deutlicher ließ der Schmerz nach. Franz ließ sich bedenkenlos fallen.
Nussberg, Ende Juni 1530
Laut zischend spritzte das Fett auf die dunkle Herdplatte. Fanny machte einen Schritt zurück, fluchte und entschuldigte sich augenblicklich bei Gott für ihre bösen Worte.
Stattdessen schimpfte sie: »Rosa, du hast wieder zu viel Fett in die Pfanne gegeben!« Aber das Mädchen, dem der Tadel galt, hörte die Worte nicht. Es war seit einiger Zeit wie vom Erdboden verschluckt.
Fanny schob die Bratpfanne mit den frischen Würsten zur Seite und wischte sich mit dem Handrücken die kastanienbraunen Strähnen aus der Stirn, die sich unter der Haube gelöst hatten. Sie schloss für einen Moment die Augen, atmete kurz durch, bevor sie beide Hände in ihrer nicht mehr ganz sauberen Schürze abwischte und sich erneut den Würsten in der Pfanne widmete. An Abenden wie heute wünschte sie, ihr Vater würde eine zusätzliche Magd oder einen zweiten Knecht einstellen. Aber es gab in dem kleinen Winzerhäuschen nicht genug Platz für weitere Bewohner. Ihr Vater war dagegen, dass Dienstboten in der Scheune oder am Fußboden des Schankraums schliefen, wie es in anderen Wirtshäusern und Bauernhöfen der Fall war. Grundsätzlich teilte Fanny seine Meinung, aber was sprach dagegen, einen Teil des Schankraums abzutrennen? Dann würden auch nicht jeden Abend so viele Männer hier Platz finden.
Eigentlich sollte zu dieser Jahreszeit der Ausschank im Garten stattfinden, aber es war einer der kältesten Junimonate, die Wien je erlebt hatte. Nach einem endlos langen Winter, der letztes Jahr schon im September eingesetzt und die Stadt vor dem Sieg der Osmanen bewahrt hatte, folgten ein erbarmungslos kalter Frühling und nun auch ein eisiger Sommerbeginn. Es nieselte, Mitte Mai hatte es in der Nacht sogar gefroren. Zum Glück hatten die Reben die Kälte bis jetzt problemlos überstanden.
Statt unter saftigen Nussbäumen zu sitzen, hockten die Gäste dicht gedrängt in der Schankstube, wo die Luft zum Schneiden dick war. Dampf aus der Küche sammelte sich unter den massiven, dunklen Balken an der Decke und mischte sich mit dem Geruch von Wein, Schweiß und dem Rauch der Öllampen. Die Männer schien es nicht zu stören, ganz im Gegenteil. Sie unterhielten sich prächtig. Aus dem Schankraum drang lautes Stimmengewirr, das Rücken von Stühlen auf den abgetretenen Bodenholzbrettern und hin und wieder lautes Grölen. Fanny nahm es nicht richtig wahr. Ihre Aufmerksamkeit galt dem Zischen und Brutzeln vom Fett vor ihr. Sie musste sich konzentrieren und blinzelte. Die Beleuchtung in der Küche war nur spärlich. Die beiden Öllampen am Tisch gaben mehr Ruß ab als Licht. Erst morgen, wenn Tageslicht durch die Fenster drang, würde sie das wahre Ausmaß des Schadens sehen, den das Fett eben angerichtet hatte. Sicher würde es Stunden kosten, das klebrige Zeug mit Seife und Bürste wieder wegzuputzen.
Max, der Knecht im Haus der Steiner, kam in die Küche und füllte vier Tonkrüge mit Wein aus einem großen Fass.
»Draußen sitzen die drei Ratsherren Schacht, Rötzer und Pilhamer. Wir sollten heute keine Würste mehr servieren«, sagte er stirnrunzelnd.
Max war etwas älter als Fanny, einen Kopf größer als sie, hatte dichtes rotes Haar, das immer kurz geschnitten war, einen breiten Nacken und noch viel breitere Schultern. Er lebte bei Fanny und ihrem Vater, seit sie sich zurückerinnern konnte. Offiziell hatte ihr Vater Max bei sich aufgenommen, weil dessen Eltern bei einem Brand ums Leben gekommen waren. In Wahrheit war der Knecht das Kind einer Dirne, die gesoffen und ihn für einen Kreuzer verkauft hatte. Der verwitwete Hans Steiner hatte ganz sicher nicht vorgehabt, einen kleinen Jungen zu kaufen, und wollte auch nicht, dass andere davon erfuhren, aber Max, der sonst auf der Straße gelandet wäre, hatte sein Mitleid erweckt, so dass er eine Lüge erfunden und ihn bei sich aufgenommen hatte. Seither lebte er im Winzerhaus »Zur Donauprinzessin« am Nussberg. Max konnte kräftig zupacken und verfügte über einen gesunden Menschenverstand. Aus diesem Grund warnte er Fanny jetzt wegen der Würste.
»Der Fleischer Knotter hat sie selbst mitgebracht«, verteidigte sich Fanny, wohlwissend, dass sie keine Würste servieren sollte, denn eine Verordnung der Stadt verbot es Winzern, warme Speisen zu verkaufen. Ihr Vater hatte in weinseliger Stimmung für diese unangenehme Situation gesorgt.
Als letzte Woche der Schuster Riem ein Paar Schweinswürste vom Fleischer Knotter mitgebracht und darum gebeten hatte, sie für ihn anzubraten, hatte ihr Vater zugestimmt. Nicht zuletzt deshalb, weil er selbst den köstlichen Würsten nie widerstehen konnte. Seither verlangten nicht nur der Schuster und seine Freunde, sondern auch andere Gäste nach den Knotter Würsten. Neulich hatte der Fleischer angeboten, die Würste in großen Mengen zu günstigem Preis zu liefern. Fanny hoffte inständig, dass ihr Vater das Angebot ablehnen würde. Sie wollte keine Schwierigkeiten mit der Stadtverwaltung bekommen. Außerdem hatte sie keine Lust, sich jeden Abend mit spritzendem Fett herumzuärgern.
»Geh raus und schau, ob die Ratsherren beschäftigt sind. Sobald sie in ein Gespräch vertieft sind, serviere ich die Würste. Vielleicht sehen sie mich nicht«, sagte Fanny.
Max schüttelte missbilligend den Kopf: »Die Würste riechen so stark nach Majoran, Knoblauch und Fett, dass man sie nicht sehen muss.« Dennoch tat er, worum Fanny ihn bat, und ging in den Schankraum, um nachzusehen. Schon nach wenigen Augenblicken kam er zurück.
»Die Gelegenheit könnte nicht besser sein«, sagte er. »Zwei der Ratsherren streiten heftig. Vielleicht achten sie jetzt nicht auf gebratene Würste.«
»Das ist gut!«
Fanny kippte die Würste in eine große Holzschüssel und lief los. Im Schankraum war die Luft noch dichter als in der Küche. Eine Rauchwolke umgab die Besucher. Mit etwas Glück würden die Ratsherren tatsächlich nichts von den Würsten mitbekommen. Zum ersten Mal war Fanny froh, dass ihr Vater auch in der Gaststube die rußenden Öllampen noch nicht gegen teure Kerzen eingetauscht hatte.
Aus den Augenwinkeln schaute Fanny zum Tisch der Ratsherren. Im dichten Dunst erkannte sie die drei hochrangigen Männer, die am besten Tisch in einer kleinen abgetrennten Nische saßen. Max hatte recht, der dicke Laurentius Pilhamer war in ein heftiges Gespräch mit dem dürren Philipp Schacht verwickelt. Nikolaus Rötzer schien unbeteiligt danebenzusitzen.
Fanny konnte nicht verstehen, worum es in dem Gespräch ging, die Stimmen der Ratsherren gingen im allgemeinen Lärm unter. Es interessierte sie auch nicht. Im Moment hatte sie andere Sorgen. Direkt neben der Eingangstür hatte einer der Bäckergesellen offensichtlich mehr vom Wein ihres Vaters erwischt, als gut für ihn war. Der kräftige Bursche schlug grölend mit der Faust auf den Tisch, so dass die Tonkrüge zu wackeln begannen. Die anderen Burschen lachten, und er sprang auf, schnappte seinen leeren Weinbecher und hielt ihn drohend über den Kopf eines seiner Trinkkumpane. Der war jedoch schnell genug, um dem Schlag auszuweichen. Flink setzte er sich auf den leeren Stuhl daneben. Für einen Moment wirkte der Angreifer verwirrt.
»Nicht die auch noch!«, stöhnte Fanny. Sie stellte die Holzschüssel schwungvoll vor dem Schuster und dem Fleischer auf den Tisch, so dass eine der Würste aus der Schüssel rutschte.
»Nicht so stürmisch, Prinzessin«, sagte dieser und fing die Wurst auf, bevor sie auf dem Boden landen konnte.
»Ich bin keine Prinzessin«, konterte Fanny verärgert. Jeden Abend nannten einige Männer sie so. Fanny hasste den Namen und fragte sich nicht zum ersten Mal, was ihr Vater sich dabei gedacht hatte, seine Schankstube »Zur Donauprinzessin« zu nennen.
Es folgte ein derber Witz über Würste, junge Frauen und Prinzessinnen, die der Schuster zum Besten gab, aber Fanny reagierte nicht. Ihre Aufmerksamkeit galt den Bäckergesellen. Sie sah sich hilfesuchend nach ihrem Vater um, doch der war wieder einmal nirgends zu finden. Sicher hockte er mit einem der Gäste im Weinkeller und kostete sich durch den Inhalt der verschiedenen Weinfässer. Auch Rosa, die Magd, war noch immer verschwunden, inzwischen seit Stunden. Als Fanny sie das letzte Mal gesehen hatte, hatte sie heulend herumgestanden, statt tatkräftig in der Küche mitzuhelfen. Gewiss hatte Rosa wieder einmal Liebeskummer. Sobald Fanny die Magd sah, musste sie ein ernstes Wort mit ihr reden. Zum Glück war Max wie immer zur Stelle.
»Lass nur, ich mach schon«, sagte er, klopfte mit seiner tellergroßen Hand beruhigend auf ihre Schulter und ging auf den Unruhestifter zu. Fanny blieb dicht hinter ihm, hatte aber nicht vor, die sichere Deckung zu verlassen.
»Siegfried, du hast genug für heute!«, sagte Max leise, aber bestimmt. Er überragte den Bäckergesellen um einen halben Kopf.
»Wer sagt das?«, lallte der junge Mann.
»Ich sag das, und wenn du nicht hörst, muss ich dich vor den Augen aller Gäste vor die Tür setzen und dafür sorgen, dass du die Stube in den nächsten Wochen nicht betreten wirst.«
»Du kannscht mir gar nischts –« Der Bursche stockte. Mitten im Satz hatte er vergessen, was er sagen wollte. Benommen schwankte er nach vorne und wieder zurück. Seine Augenlider waren halb geschlossen, auf seiner Stirn standen Schweißperlen. Für einen Moment fürchtete Fanny, dass der junge Mann krachend auf dem Boden landen würde. Aber trotz des Wankens schienen seine Füße wie Wurzeln fest im Boden verankert zu sein.
Der Bursche neben ihm hatte ebenfalls getrunken, war aber weitaus nüchterner. Umständlich stand er auf und brachte den Stuhl gefährlich ins Kippen, fing ihn rechtzeitig auf und schob ihn krachend zum Tisch zurück.
»Lass gut sein, Siegfried«, sagte er zu seinem Freund. »Max hat recht, du solltest nach Hause in dein Bett.«
»Will awer nisch!«, jammerte Siegfried und klang nun gar nicht mehr aggressiv.
»Komm, ich bring dich heim«, sagte der Freund. Er kramte drei Münzen aus dem Beutel, der an seinem Gürtel hing, und legte sie auf den Tisch. Dann trat er auf den Gesellen zu, packte ihn unterm Arm und versuchte, ihn zum Ausgang zu zerren. Für einen Moment zögerte dieser noch, doch schließlich torkelte er mit. Als die Tür sich hinter den beiden schloss, atmete Fanny erleichtert auf.
Die anderen Gäste hatten nur kurz die Köpfe gehoben und dem Zwischenfall kaum Beachtung geschenkt. Szenen wie diese gehörten zum Alltag in einer Gaststube.
»Hast du meinen Vater gesehen?«, fragte Fanny Max.
»Der hat vorhin mit einem der Ratsherren gestritten.«
»Wie bitte?« Fanny glaubte, sich verhört zu haben. »Was ist denn heute bloß los?«
»Vollmond ist!«, sagte Rosa, die plötzlich wieder aufgetaucht war. Wo hatte sie bloß gesteckt? »Die alte Liese behauptet, dass manche Menschen davon verrückt werden.«
Die Augen der Magd waren immer noch rot vom Weinen, aber sonst wirkte sie frisch und erholt. Ihre rosigen Wangen glänzten, und ein paar blonde Strähnen hingen ihr keck in die Stirn.
Wie immer, wenn Rosa in der Nähe war, wurde Max nervös. Er errötete und suchte rasch das Weite. »Muss in die Küche«, murmelte er undeutlich und verschwand.
»Wo warst du?«, fragte Fanny vorwurfsvoll.
»Euer Vater hat mich in den Vorratsschuppen geschickt, um einen Sack voll Nüsse zu holen. Ich musste auf die Leiter klettern, dabei ist einer der Säcke vom Regal gefallen und aufgeplatzt. Es hat eine Zeitlang gedauert, bis ich alle wieder eingesammelt hatte.«
»Und wo ist mein Vater?«
»Im Weinkeller. Er hat mit dem Ratsherrn Schacht gestritten. Dann ist er in den Keller gegangen. Er wollte nachdenken!« Rosa zog das letzte Wort bedeutungsvoll in die Länge.
Fanny verdrehte die Augen und seufzte laut. Sie wusste, dass ihr Vater heute zu nichts mehr zu gebrauchen sein würde. Wenn er erst mal allein im Keller verschwand, würde er erst im Laufe des nächsten Vormittags wieder nach oben kommen.
Vielleicht lag es wirklich am Vollmond, dass heute nichts nach Plan lief, dabei war der Himmel mit Wolken verhangen, und niemand konnte den Mond sehen.
»Worüber hat Vater mit dem Ratsherrn gestritten?«, wollte Fanny wissen.
Rosa zog die Lippen kraus und zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung! Er hat es mir nicht verraten.«
Natürlich nicht, warum auch, dachte Fanny. Sie hatte gehofft, dass Rosa den Streit gehört hatte und ihr deshalb etwas über den Grund verraten konnte.
»Nun gut. Wir werden es morgen erfahren«, sagte sie. »Da Vater uns heute nicht mehr helfen wird, müssen wir den Abend allein über die Runden bringen.«
Sie stemmte die Hände in die Hüften und sah sich in der Wirtsstube um. Drei Gäste hoben zeitgleich die Hände und riefen nach weiteren Weinkrügen. Am Tisch der Ratsherren hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Einer schien gerade am Abort zu sein. Die Schüssel mit den Würsten am Tisch des Schusters war leer, und mit etwas Glück hatten die drei nichts davon bemerkt. Fanny würde heute ganz sicher für keinen Wurstnachschub mehr sorgen. Aber der Abend würde auch ohne Bratwürste lang werden.
Es war weit nach Mitternacht, als Fanny endlich die schmale, steile Treppe zu ihrer kleinen Kammer unter dem Dach hochstieg. Das Holz knarrte unter ihren Füßen, die sich anfühlten wie Blei, und ihre Augen brannten vor Müdigkeit und vom Rauch. Es kostete Fanny Überwindung, sich auszuziehen. Am liebsten hätte sie sich einfach mit Kleid und Schürze auf die Matratze plumpsen lassen. Aber sie schlüpfte in ihr Nachthemd und kniete sich wie jeden Abend vors Bett, um rasch ein kurzes Gebet zu formulieren. Sie faltete die Hände und neigte den Kopf, so wie ihre Mutter es ihr als kleines Mädchen beigebracht hatte. Ein Ritual, das ihr Sicherheit und Halt gab, und das Einzige, was ihr an Erinnerungen an ihre Mutter geblieben war.
Fanny wusste nicht mehr, wie das Gesicht ihrer Mutter ausgesehen oder ihre Stimme sich angehört hatte. Sie war bei ihrem Tod erst vier Jahre alt gewesen. Ihr Vater behauptete, dass sie das kastanienbraune volle Haar, die dunkelbraunen Augen und die helle Haut von Constanze geerbt hätte. Die Figur hatte sie ganz sicher nicht von ihr. Angeblich war Constanze Steiner eine große, sehr zarte Frau gewesen, Fanny hingegen war klein und verfügte über hübsche weibliche Rundungen, deretwegen ihr die Männer nachstarrten.
Der Gedanke, dass sie alles über ihre Mutter vergessen hatte, machte Fanny auch heute noch, zweiundzwanzig Jahre nach ihrem Tod, sehr traurig. Das tägliche Gebet hatte ihr stets etwas Trost verschafft. Auch wenn Fanny nicht sicher war, ob ein Priester mit der Art ihrer Gebete einverstanden wäre. Ihr Vater hatte es mit dem Besuch des Gottesdienstes und der Beichte nie so ernst genommen. Die Arbeit im Weingarten war immer wichtiger gewesen. Deshalb hatte Fanny eine eigene Weise entwickelt, sich mit Gott zu unterhalten.
»Lieber Gott, ich will mich nicht beschweren, denn mein Leben ist deutlich besser, seit ich wieder bei Vater lebe. Dennoch kann ich nicht glauben, dass es dein Wille ist, dass ich jeden Tag betrunkenen Männern Wein ausschenke. Manche trinken so viel, dass sie die Qualität des Rebsafts gar nicht mehr erkennen. Wein ist wundervoll, du selbst hast ihn auserwählt, damit die Priester ihn jeden Sonntag in das Blut deines Sohnes verwandeln, und du hättest ganz sicher nicht den Wein genommen, wenn er nicht ein so edles Getränk wäre.«
Fanny senkte den Kopf ein Stück tiefer und überlegte, wie sie die nächsten Worte wählen sollte, ohne überheblich, undankbar oder unbescheiden zu klingen. Sie fand keine passende Lösung, deshalb sprach sie einfach weiter.
»Du weißt, dass ich unsere Weingärten liebe. Mein Wissen über den Rebschnitt, die Weinlese und das Reifen des Weins ist reicher als das vieler Winzer. Ich kann winzige Geschmacksnuancen erkennen und nicht bloß sauren von süßem Wein unterscheiden. Wenn ich dürfte, würde ich den besten Wein der Stadt keltern. Vater will mir nicht glauben, dass durch das Vermischen von zwei unterschiedlichen Rebsorten ein noch besserer Wein entstünde. Verlange ich zu viel, wenn ich dich darum bitte, Winzerin werden zu dürfen? Ich weiß, dass ich dazu wieder heiraten muss, aber solange Vater noch lebt, und ich hoffe, du bescherst ihm noch ein langes Leben, kann ich auch ohne Ehemann auf dem Hof arbeiten. Ich verspreche dir, als Winzerin einen Wein zu keltern, mit dem die Priester jeden Sonntag deine Herrlichkeit preisen werden wie nie zuvor.«
Fanny machte eine kurze Pause. War sie eben zu weit gegangen? Vielleicht. Aber es war zu spät, die Worte waren gesagt. Etwas leiser und ehrfurchtsvoller fügte sie hinzu: »Danke, lieber Gott. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.«
Dann bekreuzigte sie sich, bevor sie ins Bett kletterte und sich die Decke bis zum Kinn zog. Sie hörte die schwarzweiße Katze nicht mehr, die leise übers Dach schlich und durch den Spalt des offenen Fensters zu ihr auf die Decke sprang. Das Tier putzte sich ausgiebig das nasse Fell, bevor es sich schnurrend am Fußende einrollte und zufrieden einschlief.
Es waren nicht die immer noch gegen die Fensterläden prasselnden Regentropfen, die Fanny aufweckten. Ein markerschütternder Schrei ließ sie hochschrecken.
Hatte sie geträumt? Fanny konnte sich an nichts erinnern. Sie drehte sich um und zog die Decke über den Kopf, dabei stießen ihre Füße gegen die Katze. Empört miaute das Tier. Fanny schloss erneut die Augen, um noch eine Weile vor sich hin zu dösen.
Aber daraus wurde nichts.
»Zu Hilfe, hört mich denn keiner!« Die Stimme gehörte Rosa, und sie klang völlig aufgelöst.
Mit einem Mal munter, kletterte Fanny aus dem Bett und stieß die Fensterläden vollständig auf. Kühle, saubere Regenluft drang in ihre Kammer. Fanny zog die Decke eng um ihren Körper, denn sie fror. Beleidigt sprang die Katze nun vom Bett und auf das Fensterbrett. Ohne Fanny eines Blickes zu würdigen, stolzierte sie auf das nasse, vom Regen glänzende Dach. Fanny sah ihr kurz nach, dann lehnte sie sich selbst so weit es ging aus dem Fenster. Doch sie konnte bloß den äußersten Teil des Innenhofes sehen. Rosa war nicht zu entdecken. Trotzdem rief Fanny: »Was ist denn los?«
»Schnell, kommt. Da liegt einer!«
»Wie bitte? Wer liegt wo?«
Aber Rosa antwortete nicht mehr. Stattdessen heulte sie laut auf, so dass Fanny nichts anderes übrigblieb, als sich anzuziehen und selbst nachzusehen. Manchmal mochte sie ob Rosas Umständlichkeit verzweifeln. Warum konnte die Magd einen übriggebliebenen Gast nicht einfach wach rütteln und wegschicken?
Ohne ihr Haar mit der Haube, die sich für eine Witwe ziemte, aufzusetzen, kletterte Fanny barfuß die Treppe hinunter, lief durch die Küche und stürzte in den Hof. Zeitgleich mit ihr kam Max aus dem Haus, im Gehen schnürte er seine Hose und schlüpfte geschickt in seine Stiefel.
»Schnell, kommt!«, rief Rosa. Die Magd winkte die beiden heran. Sie stand neben dem Abort, einem kleinen Holzhäuschen, aus dem ein unangenehmer Geruch drang. Mit einer ihrer Hände bedeckte Rosa ihr eigenes Gesicht, um sich entweder vor dem Gestank oder vor dem Anblick auf dem Boden zu schützen.
Fanny bereute es, keine Schuhe anzuhaben. Ihre Füße versanken im nasskalten Schlamm. Sie fror noch immer, da half es auch nicht, das Tuch enger um die Schultern zu binden. Erst als sie direkt beim Abort war, sah sie, was dahinterlag: der leblose Körper eines Mannes. Das feine Tuch des Mantels und der weiße Spitzenkragen bewiesen, dass es sich um keinen Handwerker handelte. Als Fanny sich über den Körper beugte, erkannte sie den dürren Ratsherrn Philipp Schacht wieder. Schon wollte sie ihn wach rütteln. Er war nicht der erste Mann, der seinen Heimweg erst am nächsten Tag antrat, auch wenn selten jemand so betrunken war, dass er eine Nacht im Regen durchschlief. Aber mitten in ihrer Bewegung hielt Fanny inne. Sie erkannte, dass sie diesmal das Problem nicht mit einem Eimer voll kaltem Wasser lösen konnte.
»Vater im Himmel!«, flüsterte sie und bekreuzigte sich.
Philipp Schacht würde nirgendwo mehr hingehen. Er hatte seine letzte Reise bereits angetreten.
Max schien dasselbe zu denken, leise sagte er: »Wir werden den Stadtrichter holen müssen.«
»Nimm Linda, Vaters Stute, und reite in die Stadt«, antwortete Fanny tonlos. Ihr wurde plötzlich furchtbar übel, und das lag nicht an dem schrecklichen Gestank, der aus dem Abort drang.
Sie geriet ins Wanken. Haltsuchend lehnte sie sich gegen die Tür des stillen Örtchens, zum Glück war sie fest verschlossen, sonst wäre Fanny direkt hineingestolpert. Trotz der Hässlichkeit des Bildes, das sich ihr bot, war sie nicht in der Lage, ihren Blick abzuwenden.
»Was soll ich dem Richter sagen?«, fragte Max.
»Dass der Ratsherr Schacht bei uns im Hof liegt.« Sie zögerte, bevor sie hinzufügte: »Und dass ihn jemand erschlagen hat.«
1
Seit über einer Stunde starrte Sebastian auf die komplizierte Skizze, die ausgebreitet auf seinem Schreibtisch lag, doch er kam auf keinen grünen Zweig. Trotz der frühen Morgenstunde benötigte er eine Kerze, um die Kopie von Leonardo da Vincis Pariser Manuskripten genau zu studieren, denn die dicke Wolkendecke über Wien riss auch an diesem Junimorgen nicht auf. Es war, als wollte Gott der Stadt heuer keinen Sommer bescheren.
Sebastian hatte das Manuskript letztes Jahr für viel Geld von einem fahrenden Buchhändler erstanden. Es bestand kein Zweifel an der Echtheit der Abschrift, auch wenn der Händler Gabriel Doufon ein abenteuerlicher Draufgänger war, der seit Jahren zwischen Paris, Bordeaux und Rom hin- und herreiste und nur ungern preisgab, woher er seine Ware bezog. Sebastian vermutete, dass Doufon nicht immer auf legalem Weg an die Manuskripte gelangte, die er verkaufte. Doch das war ihm egal. Leider hatte Doufon ihm diesmal nur einen Teil des Manuskripts anbieten können. Sebastian hatte sich dennoch begeistert darauf gestürzt, schließlich handelte es sich um eine Abschrift, in der da Vinci sich mit Flugobjekten auseinandersetzte, jenem Thema, dem Sebastian jede freie Minute schenkte. Er war fest davon überzeugt, dass der Mensch eines Tages Geräte bauen würde, mit denen er sich in der Luft bewegen konnte. Am liebsten wäre ihm natürlich, wenn er selbst dieser Mann wäre.
Im Moment zweifelte er jedoch daran, dass er seinen Traum mit da Vincis Plan verwirklichen konnte. Der große toskanische Meister, der sich wie kein anderer mit den Gesetzen der Natur auseinandersetzte, musste sich bei der Wahl des Materials geirrt haben. Die Konstruktion der Luftschraube schien perfekt. Bloß waren Schilfholz und Leinentuch schlicht zu schwer, um mit dem Prinzip des Auftriebs in Wendelform in die Luft zu steigen.
Sebastian vermutete, dass Da Vinci im anderen Teil der Schrift, in jenem Teil des Manuskripts, den er leider nicht besaß, Änderungen bezüglich des Materials und vielleicht auch der Konstruktion vorgenommen hatte. Die Frage war bloß: welche?
Verzweifelt fuhr er sich mit beiden Händen durch sein dichtes blondes Haar, das ihm wirr in die Stirn hing. Hätte er doch bloß mehr Zeit, um sich dem Bau seiner Flugmaschine zu widmen. Doch als Mathematiker und Bauingenieur Wiens musste er sich ein Jahr nach der großen Belagerung um Brücken, einsturzgefährdete Türme und Häuser kümmern, die ohne Bewilligung der Stadt wiedererrichtet worden waren. Sein kreativer Geist war damit schlicht unterfordert. Leider erkannten die Ratsherren das nicht.
Gedankenversunken klappte er seinen Zirkel aus edlem Kirschholz zusammen, legte ihn neben die Skizze und ließ sich auf den Schreibtischstuhl sinken. Er hörte den Lärm an der Haustür nicht. Deshalb fuhr er erschrocken hoch, als seine Schwester Margarethe, ohne anzuklopfen, sein Arbeitszimmer betrat und ihn ansprach. »Der Bürgermeister will, dass du augenblicklich zu ihm kommst. Es gibt einen Notfall, in dem er deine Hilfe benötigt.«
»Warum klopfst du nie an?«, murrte Sebastian verärgert.
»Du würdest mich ohnehin nicht hören, wenn du über deinen Plänen brütest », meinte Margarethe mit einem Schulterzucken.
Sie war um einige Jahre älter als Sebastian, hatte dasselbe dichte blonde Haar und die gleichen hellblauen Augen wie ihr Bruder. Ihre fast weiße Haut war von unzähligen Sommersprossen übersät, und sie wäre eine äußerst attraktive Frau, wären ihre rechte Gesichtshälfte, ihre Schulter und ihr rechter Oberarm nicht von hässlichen Brandnarben entstellt. Das Ergebnis eines schrecklichen Unfalls. Wenn Margarethe das Haus verließ, achtete sie darauf, dass ihre Narben von einem Schleier bedeckt waren. Zu Hause jedoch verzichtete sie auf ein Tuch, auch wenn sie wusste, dass es ihrem Bruder nach all den Jahren immer noch schwerfiel, sich mit ihrer Entstellung abzufinden. Regelmäßig tauchten Traurigkeit und Ärger in seinem Blick auf, wenn er die rosige, faltige Haut sah.
Heute jedoch war keines davon zu erkennen. »Was will Treu von mir?«, fragte Sebastian. »Ist einer der Stadttürme eingestürzt, oder wackelt gar das Rathaus?«
»Das hat der Bote nicht gesagt. Aber es scheint sich um eine dringende Angelegenheit zu handeln. Du sollst unverzüglich aufbrechen.«
Margarethe trat zu einem der Haken, die sich neben Sebastians Schreibtisch befanden, nahm den Mantel und hielt ihn ihrem Bruder entgegen. Früher hatte das kleine, weiß gestrichene Arbeitszimmer mit dem hübschen Kachelofen und dem großen Erkerfenster ihrem Vater gehört, doch seit seinem Tod nahm Sebastian es für sich in Anspruch. Er hatte seine Bücher, Manuskripte und Schriften in den schweren Regalen verstaut und die wenigen Dinge, die ihr Vater zurückgelassen hatte, auf den Dachboden geräumt.
»Sicher geht es wieder um irgendeine Streiterei zwischen den Ratsherren«, sagte Sebastian. »Ich habe die Diskussionen mittlerweile satt.« Er ignorierte den Mantel und rollte stattdessen die Pläne auf seinem Schreibtisch sorgfältig ein.
»Ständig liegen sie sich in den Haaren. Einer will, dass der beschädigte Turm beim Kärntnertor abgerissen wird, ein anderer möchte ihn ausbessern lassen, und ein Dritter verlangt einen völlig neuen Turm. Wie Kinder, die um Bausteine streiten, bloß dass es bei diesem Streit um unheimlich viel Geld geht.«
Margarethe machte einen Schritt auf Sebastian zu. Sie spähte über seine Schulter und erhaschte einen letzten Blick auf die Skizze in dem aufgeschlagenen Buch.
»Hör auf zu jammern, und mach dich auf den Weg. Dein Flugobjekt und dein erster Probeflug müssen warten.« Die Belustigung in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
»Mach dich nicht über meinen Helix Pteron lustig. Die Luftschraube wird fliegen«, fuhr Sebastian sie an. Es war die Art scharfer Worte, die zwischen Geschwistern selbstverständlich war, ohne dass jemand beleidigt sein musste.
»Ich würde mich nie über dich lustig machen«, sagte Margarethe. »Ich weiß gar nicht, was ein Helix ist.«
»Der Spott tropft aus deiner Stimme wie flüssiger Honig.« Sebastian war nun doch beleidigt.
Versöhnlich legte Margarethe ihrem Bruder den Mantel um die Schultern, denn er machte immer noch keine Anstalten, ihn entgegenzunehmen: »Ich habe nichts gegen deine Flugträume. Aber manchmal mache ich mir Sorgen. Du bist ein junger Mann und solltest ausgehen, dich amüsieren, Leute kennenlernen.«
»Das sagst ausgerechnet du mir?« Sebastian blickte in Margarethes Augen, bemüht, die Narben nicht zu beachten, die der Grund dafür waren, dass sie so viel Zeit im Haus verbrachte. Vergeblich suchte er nach Traurigkeit darin. Margarethe hatte sich mit ihrem zurückgezogenen Leben längst arrangiert. Sie schien zufrieden, wenn auch nicht wirklich glücklich.
»Wenn du heimkommst, steht das Abendessen auf dem Tisch. Frau Bloch hat uns zwei Hühner gebracht, die fülle ich mit frischen Kräutern aus dem Garten.«
Frau Bloch war ihre kinderlose Nachbarin, die sich seit dem Tod von Matthias und Sophia Grün für die Geschwister verantwortlich fühlte. Immer wieder brachte sie ihnen Hühner oder Eier aus dem eigenen Stall.
Sebastian hätte es vorgezogen, wenn Frau Bloch die Hühner auch zubereitet hätte, die Aussicht auf ein Abendessen aus der Küche seiner Schwester konnte Sebastian nicht wirklich das Herz erwärmen. Margarethe war eine großartige Gärtnerin, aber eine lausige Köchin.
»Also was ist nun, gehst du endlich?« Margarethe wurde zunehmend ungeduldig.
»Hühner mit Kräuterfüllung?«, fragte Sebastian vorsichtig.
»Wenn Marie die Kräuter nicht aufgefressen hat.«
»Ich drehe dem Vieh irgendwann den Hals um!«
»Dazu bist du gar nicht im Stande. Du kannst ja nicht einmal eine Maus erschlagen«, erwiderte Margarethe grinsend.
»Das nicht, aber einer alten Ziege den Hals umdrehen, das würde mir schon gelingen.«
»Untersteh dich!«, sagte Margarethe. Natürlich wusste sie, dass ihr Bruder nie im Leben dem alten Vieh, das ihnen letzten Winter zugelaufen war und immer noch darauf wartete, dass sein rechtmäßiger Besitzer sich meldete, etwas zuleide tun würde.
»Also gut, dann mach ich mich auf den Weg«, sagte Sebastian lustlos.
Als er bei der Tür war, rief Margarethe ihm nach: »Vergiss deine Mütze nicht!« Sie warf ihm die Kopfbedeckung entgegen, und Sebastian fing sie geschickt auf.
»Irgendwann vergisst du deinen Kopf«, stöhnte sie.
Sebastian hörte sie nicht mehr. Er überlegte erneut, welches Material sich wohl am besten für seinen Helix Pteron eignen würde. Ob der Stoff seiner Mütze leicht genug wäre?
Der Regen der letzten Tage war in ein feines Nieseln übergegangen. Sebastian lief einen eigenartigen Zickzackweg, um all den großen Regenlachen und Schlammlöchern auszuweichen. Selbst auf den gepflasterten Straßen der Stadt sammelte sich das Regenwasser in den Unebenheiten, und sobald man unachtsam war, landete man knöcheltief darin.
Auf der Kärntnerstraße herrschte um diese Uhrzeit reger Betrieb. Hausfrauen waren unterwegs zu den Märkten, wo Bäuerinnen aus dem Umland frisches Obst und Gemüse anpriesen. Reiche Bürgerinnen dagegen strebten zu den feinen Kaufläden in der Tuchlauben. Dort boten Kaufleute aus aller Welt kostbare Waren an. Männer mit großen Körben liefen neben Burschen mit Handkarren. Sogar ein paar Pferdefuhrwerke ratterten über die Pflastersteine und spritzen die Vorbeigehenden mit stinkendem Schlamm an. Sebastian beachtete eines davon eine Spur zu spät und sprang fluchend zur Seite, als es ihm beinahe über die Ferse fuhr.
»Hast du keine Augen im Kopf?«, schimpfte ein zahnloser Alter vom Kutschbock und streckte ihm die Faust wütend entgegen.
»Ich schon, aber Ihr offensichtlich nicht«, knurrte Sebastian verärgert. Seinen Bemühungen zum Trotz war er jetzt knöcheltief in einer Regenschlammpfütze gelandet. Es würde ihn Stunden kosten, das feine Leder wieder sauber zu bekommen, und was noch schlimmer war: Er würde den ganzen Tag mit kaltnassen Füßen herumlaufen und im unangenehmsten Fall einen Schnupfen bekommen, und das Ende Juni. Die Welt stand kopf und das Wetter mit ihr.
Deutlich schneller, um rasch in einen warmen, trockenen Raum zu gelangen, lief er weiter, vorbei an der Himmelpfortgasse und der Johannesgasse, bevor er an der nächsten Ecke nach links in die Annagasse einbog. Hier reihte sich ein herrschaftliches Haus an das andere. Vor einem besonders prächtigen Gebäude aus Stein blieb er stehen. Im ersten Stock sprangen zwei kleine Erker mit großen verglasten Fenstern aus der Fassade. Wilder Wein wuchs rechts von der Eingangstür bis unters Dach und rankte sich um die hölzernen Fensterläden.
Sebastian ergriff den glänzenden Metallring an der schweren Holztür und klopfte. Es dauerte eine Weile, bis der Diener des Bürgermeisters, ein hagerer Mann mit kahlem Kopf, öffnete. Sebastian kannte ihn, schließlich war er nicht zum ersten Mal hier.
»Herr Treu wartet schon auf Euch«, sagte der Diener und ging schnell über die breite Treppe in den ersten Stock, so als könne er die verlorene Zeit auf diese Weise wieder einholen. Sebastian folgte ihm. Vor dem Arbeitszimmer des Bürgermeisters machten beide halt. Ohne anzuklopfen, öffnete der Diener die Tür für Sebastian und ließ ihn eintreten. Sebastian fragte sich, ob nun alle Menschen die Unart seiner Schwester angenommen hatten.
»Der Bauingenieur Sebastian Grün ist hier«, sagte er, wartete keine Antwort ab und schloss die Tür hinter sich wieder.
»Na endlich!« Der Bürgermeister klang vorwurfsvoll.
»Wenn ich mehr Zeit für mein Flugobjekt hätte, könnten wir alle in Zukunft unsere Wege schneller, nämlich fliegend, zurücklegen«, entgegnete Sebastian.
»Ach, Grün. Träumt Ihr immer noch davon, dass der Mensch eines Tages die Luft erobern wird?«, fragte der Bürgermeister amüsiert. Er saß hinter einem hohen, schweren Schreibtisch aus dunklem Kirschholz und schüttelte milde lächelnd den Kopf. Die Einlegearbeit auf der Tischplatte war ein kleines Vermögen wert und passte zu der prachtvollen Gesamtausstattung des Raums.
An allen Wänden standen Regale, die schwer beladen mit Büchern waren. Religiöse Schriften befanden sich neben den neuesten Werken berühmter Astronomen und Physiker. Sebastian hätte hier Tage verbringen können, ohne Gefahr zu laufen, sich auch nur einen Moment zu langweilen.
Im Kamin hinter dem Bürgermeister brannte ein kleines Feuer. Wolfgang Treu litt an Rheuma, er konnte Kälte nicht ausstehen und ließ sein Haus bis auf ein paar Tage im Hochsommer immer beheizen. Leider stieg warme Luft bekanntlich auf, und so war es von der Hüfte aufwärts viel zu warm im Raum, während der Boden, auf dem sich Sebastians nasse Füße befanden, kalt war.
»Nehmt Platz«, sagte der Bürgermeister. Er war ein kleiner Mann mit einem enormen Bauch, einem imposanten Schnurrbart und außergewöhnlich dunklen Augen.
Sebastian kam der Aufforderung nach und setzte sich.
»Wollt Ihr eine Erfrischung?«, fragte Treu.
Sebastian lehnte dankend ab. Er kannte die Erfrischungen des Bürgermeisters. Der Mann trank ausschließlich schweren Rotwein, Sebastian dagegen mied den Rebsaft.
»Trinkt Ihr immer noch keinen Wein?«, fragte der Bürgermeister missbilligend.
»Ich habe schon zu oft miterlebt, wie der Wein Männer in Ungeheuer verwandelt hat. Ich trinke lieber Wasser.«
»Unsinn!«, sagte Treu und machte eine ungeduldige Handbewegung. Dann seufzte er schwer und sagte: »Ich will nicht lang um den heißen Brei herumreden. Heute Morgen hat man im Innenhof des Winzers Hans Steiner den Ratsherrn Philipp Schacht tot aufgefunden. Er wurde ermordet. Jemand hat ihm den Kopf eingeschlagen.«
Der Bürgermeister griff nach der Weinkaraffe, die auf einem silbernen Tablett vor ihm auf dem Tisch stand, und füllte beide Becher randvoll mit Wein, dann schob er einen über die Tischplatte zu Sebastian. Offensichtlich ignorierte er dessen Wunsch nach Wasser.
Sebastian ließ den Becher unberührt stehen. »Weiß man, wer der Mörder war?«
»Die Ratsherren Pilhamer und Rötzer behaupten, dass es Steiner gewesen sein muss. Angeblich hat es einen schlimmen Streit zwischen Schacht und Steiner gegeben, bevor Schacht ermordet wurde. Aber es gibt keine Beweise, und selbst Richter Pernfuß hat es noch nicht gewagt, den Winzer einzusperren und zu befragen. Auch wenn er es gerne gemacht hätte. Eine rasche Lösung ist bequem, aber nicht immer richtig.«
Sebastian ließ die letzte Bemerkung des Bürgermeisters unkommentiert. Es war kein Geheimnis, dass der Bürgermeister und der Stadtrichter einander nicht ausstehen konnten. »Wo befindet sich der Winzerhof?«, fragte er.
»Der Hof liegt am Nussberg und die dazugehörende Gaststube »Zur Donauprinzessin« ebenfalls.«
»Warum ist dann Richter Pernfuß zuständig? Der Nussberg liegt außerhalb der Stadtmauern.«
»Das stimmt, aber Steiner hat auch Weingärten innerhalb der Stadtmauern. Sein Gut ist ein heikler Fall. Er ist Eigentümer seiner Weingärten und nicht nur Pächter. Er zahlt Steuern an die Stadt Wien und unterliegt als freier Mann unserer Gerichtsbarkeit.«
Verwirrt ob der vielen Ausnahmen, die es in der Verwaltung zu geben schien, schüttelte Sebastian den Kopf. Er hatte längst aufgegeben, ein System dahinter zu erkennen. Wenn es denn eines gab, so war es darauf ausgerichtet, dem, der es erstellt hatte, möglichst viele Vorteile zu verschaffen.
»Die Angelegenheit ist äußerst unangenehm«, sagte Treu. »Ihr wisst, dass wir mitten in den Verhandlungen wegen des Ausbaus der Befestigungsanlagen der Stadt sind. Die Belagerung der Türken hat gezeigt, dass unsere Stadtmauer veraltet ist. Wir brauchen Bastionen, Wehrtürme, moderne Anlagen, und zwar rasch, damit wir für einen neuen Angriff der Osmanen gerüstet sind.«
Sebastian konnte ein leises Seufzen nicht unterdrücken. Er wusste nur zu gut über den geplanten Ausbau und die dazugehörenden Streitereien bezüglich Auftragsvergaben Bescheid. Wenn er sich richtig erinnerte, hatte auch Schacht sich um einen der Aufträge beworben. Der tote Ratsherr war Besitzer einer Ziegelei im Vorort Hernals gewesen.
»Der Mord muss rasch aufgeklärt werden, denn im Moment sind Baumeister aus dem Norden und aus dem Süden in der Stadt, gestern sind zwei Ingenieure aus der Hansestadt Hamburg und einer aus Florenz angereist. Sobald sich der ungeklärte Mord an einem Ziegeleibesitzer herumspricht, könnten die Männer das Verbrechen mit dem Umbau in Zusammenhang bringen und sich allesamt bedroht fühlen.« Treu wischte sich die schweißnasse Stirn mit dem Handrücken ab. »Die Preise würden in atemberaubende Höhe getrieben werden, und die Stadt wäre nicht mehr in der Lage, den dringend notwendigen Umbau zu finanzieren.«
Das Reden schien den Bürgermeister durstig zu machen. Er griff nach seinem Wein und nahm einen weiteren kräftigen Schluck. Dann stellte er den Becher zurück und wischte mit dem Ärmel seines teuren Hemdes über die vollen Lippen. Ein dunkelroter Fleck blieb auf dem weißen Stoff zurück. Eine arme Dienstmagd würde sich später damit herumärgern müssen.
Der Wein hatte auf den kleinen Mann nicht die übliche beruhigende Wirkung. Nervös biss sich der Bürgermeister auf seine Lippen und trommelte mit den Fingern der linken Hand auf der Tischplatte. »Das alles ist sehr, sehr unangenehm«, sagte er.
»Das verstehe ich«, erwiderte Sebastian, »aber was habe ich mit der Sache zu tun?«
Treu richtete seine dunklen Augen fragend auf Sebastian. »Ich dachte, das sei völlig klar«, sagte er irritiert.
Ahnungslos wartete Sebastian auf eine Erklärung. Seine Augenbrauen rutschten fragend nach oben.
»Ihr sollt den Fall aufklären.« Treu sprach, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt.
»Ich … bin … Bauingenieur.«
»Das stimmt«, pflichtete ihm Treu bei. »Außerdem seid Ihr einer der hellsten Köpfe der Stadt, verschwiegen und loyal, was in dieser delikaten Angelegenheit besonders wichtig sein wird.«
»Ich habe keine Erfahrung in diesen Dingen«, sagte Sebastian. Er bemühte sich, seine Stimme weiterhin ruhig klingen zu lassen, auch wenn er das nicht mehr war. Wie eine ansteckende Krankheit ergriff Treus Nervosität auch von ihm Besitz.
»Natürlich habt Ihr Erfahrung mit der Verbrechensbekämpfung. Erinnert Euch nur an den Raub an dem Florentiner Kaufmann Morzini. Ihr habt den Täter gefunden.«
»Das war purer Zufall«, entgegnete Sebastian verlegen. Bis heute war es ihm unangenehm, dass die ganze Stadt glaubte, er wäre an der Aufklärung beteiligt gewesen. In Wirklichkeit hatte ein unerwarteter Umstand ihm den Täter in die Hände gespielt. Der Mann war ihm regelrecht in die Arme gelaufen und bei dem Zusammenprall bewusstlos am Boden liegen geblieben. Dabei hatte sich seine Tasche geöffnet, und die gestohlenen Juwelen waren herausgefallen. Sebastian hatte nur noch nach den Stadtwachen rufen und die Juwelen einsammeln müssen. Er hatte sich wahrlich bemüht, hinterher allen zu erklären, dass es sich bloß um einen Zufall gehandelt hatte. Aber die Stadt hatte nach einem Helden gesucht und ihn für kurze Zeit in Sebastian gefunden.
»Ich glaube nicht, dass ich der geeignete Mann für diese Aufgabe bin«, sagte er entschieden. »Wenn Ihr dem Richter misstraut, könnt Ihr Hilfe vom König anfordern.«
»Pah!«, schnaufte Treu verächtlich. »Das wäre genau die Gelegenheit, auf die Ferdinand wartet. Der König will ein starkes, zentralistisch regiertes Reich, in dem Stadtregierungen bloß untergeordnete Rollen spielen. Denkt nur an seinen Bruder Karl, der versucht von Madrid aus, die halbe Welt zu regieren. Ferdinand ist ein Habsburger, er denkt genauso. Wir dürfen ihm unsere Stadt nicht auf dem Silbertablett servieren. Wenn wir ihn um Hilfe bitten, weil wir allein keine Lösung finden, wird er nicht lange fackeln und derart helfen, indem er die Stadt ihrer Rechte beschneidet. Er giert nach Macht und Einfluss. Dann wäre die Zeit vorbei, in der wir eigenständige Entscheidungen treffen könnten.«
Vor Aufregung – oder war es die Wirkung des Weins und die Wärme aus dem Kamin – waren Treus Wangen dunkelrot geworden. Sebastian war klar, dass Treu mit »wir« nicht alle Wiener meinte, sondern ein ausgesuchtes Grüppchen von reichen Männern, die die Stadtregierung bildeten und an deren Spitze er selbst thronte.
Es entstand eine kurze Pause, in der Treu erneut einen tiefen Schluck aus seinem Becher nahm. Als er ihn wieder auf den Tisch setzte, schaute er Sebastian direkt an. Die dunkelbraunen Augen hatten nun eine Härte angenommen, die so manchem Gegenüber Angst eingeflößt hätte. Sebastian hingegen blieb unbeeindruckt.
»Es liegt in Eurem eigenen Interesse, dass Ihr den Auftrag annehmt. Denn es ist fraglich, ob der König sich einen eigenen Bauingenieur für die Stadt leisten würde, der hin und wieder einen Blick auf baufällige Gebäude richtet und den Rest seiner Zeit mit obskuren Flugobjekten verbringt.«
»Ihr droht mir?«, fragte Sebastian ruhig.
»Ich würde es nicht als Drohung bezeichnen, sondern vielmehr als Versuch, Euch zu überzeugen«, sagte Treu nun wieder deutlich freundlicher. Er schien gerade einzusehen, dass er seine Taktik ändern musste, denn Sebastian wirkte weder eingeschüchtert noch verunsichert. Ganz im Gegenteil, als er antwortete, klang seine Stimme belustigt. »Ich glaube, dass es im Moment genug Arbeitsaufträge für Bauingenieure in der Stadt gibt.«
Sichtlich genervt stieß Treu laut Luft aus. »Nun ziert Euch nicht so, Grün. Ihr könnt doch auch kein Interesse daran haben, dass ein Mörder ungestraft in unserer Stadt sein Unwesen treibt.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: