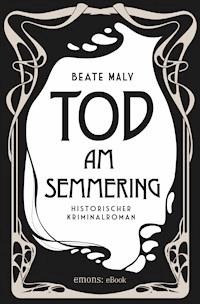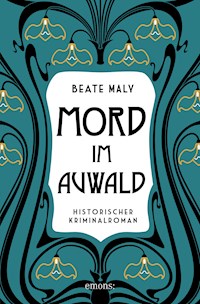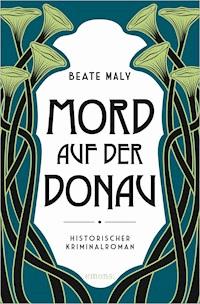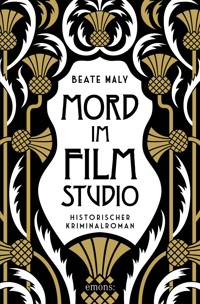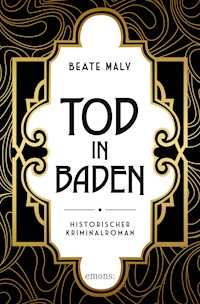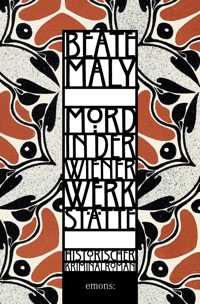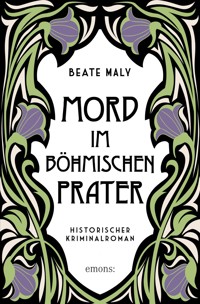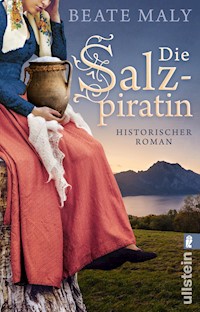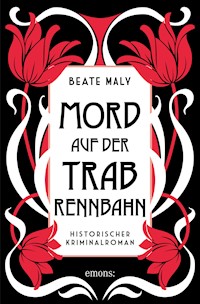8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wien, 1531: Die türkische Belagerung ist vorüber, und doch kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Der Mathematiker Sebastian Grün wird beauftragt, eine Reihe rätselhafter Todesfälle aufzuklären, tatkräftig unterstützt von seiner Freundin, der Winzertochter Fanny Roth. Alle Morde weisen auf Verbindungen zu den osmanischen Belagerern hin und versetzen die Bürger Wiens in Angst und Schrecken. Doch welche Rolle spielt die mysteriöse Schatulle, die das erste Mordopfer ausgegraben hat und die jetzt verschwunden ist? Mit jeder neuen Leiche wird die Panik der Wiener größer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Wien, 1531: Auf dem ehemaligen Zeltplatz der osmanischen Belagerer wird ein Mann mit einem Pfeil aus einer Armbrust getötet, als er gerade eine alte Kiste ausgraben will. Bei diesem einen Toten soll es nicht bleiben – weitere Morde geschehen und bringen die Stadt in Aufruhr. Alle Mordopfer scheint etwas zu verbinden: die geheimnisvolle Schatulle vom Zeltplatz. Nur was hat es damit auf sich, und vor allem: Was befindet sich darin?
Während die Winzertochter Fanny noch immer auf ihren Heiratsantrag wartet, hat ihr Liebster, Mathematiker und Bauingenieur Sebastian Grün, kalte Füße bekommen und stürzt sich lieber in die Arbeit. Er wurde vom Bürgermeister damit beauftragt, einen berühmten Kanonengießer für die Stadt zu gewinnen. Schon bald entpuppt sich der Auftrag jedoch als viel gefährlicher als gedacht, und unversehens stecken Sebastian und Fanny selbst mitten in den Nachforschungen zu den Morden.
Haben etwa die Osmanen etwas mit der Mordserie zu tun, und kann es in Wien jemals wieder sicher sein? Die Panik in der Stadt wächst stetig an …
Die Autorin
Beate Maly, geboren in Wien, ist Autorin zahlreicher Kinderbücher, Sachbücher und historischer Romane. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Wien.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Hebamme von Wien ∙ Die Hebamme und der Gaukler
Das Sündenbuch ∙ Der Fluch des Sündenbuchs
Die Zeichenkünstlerin von WienDer Raub der Stephanskrone ∙ Die Donauprinzessin
Beate Maly
Die Donauprinzessin
und die Toten von Wien
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1385-6
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Dezember 2016© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © »Eine Aussicht im Prater gegen die Vorstadt Landstraße«. Gemälde, um 1780, von Joseph Heideloff Wien, Akademie der Bildenden Künste/AKG Images (Stadt); © Francis G. Mayer/Corbis (Frau); © FinePic®, München (Hintergrundstruktur, Rahmen und Kiste); Getty Images/© Peter Willi (Weintrauben)
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Kaiserebersdorf, Ende Oktober 1531
Dichter, nasskalter Nebel stieg vom Boden auf und hing nun in satten Schwaden über dem abgeernteten Feld. Nur hier und da kämpfte sich das kalte Licht des Vollmondes durch die Schleier und tauchte die Welt in ein abweisendes, milchiges Grau, in dem Büsche und Bäume ebenso verschwanden wie Lebewesen. Die Luft war feucht und eisig zugleich. Noch roch es nach vergorenen Früchten und modrigen Blättern, aber dahinter lauerte bereits der Geruch vom ersten Frost, der in diesem Jahr viel zu früh einsetzte. Jeder vernünftige Mensch saß jetzt vor einem behaglich knisternden Feuer in einer warmen Stube, statt in eisiger Dunkelheit über ein Feld zu laufen, das vor zwei Jahren den Osmanen als Zeltplatz gedient hatte. Von hier aus hatte Süleyman I. Wien angegriffen und drei Wochen lang belagert. Aber auch vor zwei Jahren hatte der Winter überraschend und unerwartet heftig eingesetzt, so dass die Osmanen frühzeitig ihre Belagerung abgebrochen hatten und überhastet zurück in den Osten gezogen waren.
Es war ein unwirtliches, kaltes Land, und nur Allah, der Allerhabene wusste, warum Süleyman es hatte erobern wollen. Omar würde keinen Tag länger als unbedingt notwendig hier verbringen. Sobald er seine Aufgabe erfüllt hatte, würde er die Stadt der Ungläubigen wieder verlassen. Es war ein Ort der Sünde und der Barbarei. Die Giauren kelterten Wein auf den Berghängen vor den Stadtmauern und tranken ihn in rauen Mengen. Männer wie Frauen trafen sich in Weinschenken und berauschten sich an dem Getränk. In ihren Kirchen beteten sie zu einem Gekreuzigten, der eine Dornenkrone trug. Allah hingegen verhöhnten sie, sie kannten auch seine 99 schönsten Namen nicht. Die Ungläubigen fertigten Bilder und Statuen von Heiligen an, die sie um Hilfe anflehten und verehrten. Aber das Schlimmste von allem: Die Giauren aßen das Fleisch von Schweinen. Tiere, die sie mit ihrem eigenen Mist fütterten. Bei diesem Gedanken schüttelte sich Omar, und diesmal war es nicht die Kälte, die ihn erzittern ließ, sondern der Ekel, der ihn unweigerlich überfiel. Je schneller er fand, was er suchte, desto rascher konnte er diesen gottlosen Ort wieder verlassen.
Mit jedem Schritt versank er im dunklen, klumpigen Erdreich. Irgendwo verlief ein kleiner Bach. Es würde Tage dauern, bis seine teuren Lederstiefel wieder sauber waren. Nirgendwo in seiner Heimat gab es Erde, die so dick und lehmig zugleich war. Sie klebte an seinen Stiefeln und hinterließ heimtückische Flecken. Alles hier war schlecht, selbst der Boden, über den er gerade lief. Fröstelnd zog er mit der rechten Hand seinen feingewobenen Mantel enger um den frierenden Körper. Mit der linken hielt er den Sack fest, der über seiner Schulter hing. Der Inhalt drückte schwer gegen seinen Rücken. Werkzeug, das er aus dem Schuppen seiner Vermieterin entwendet hatte. Eine Schaufel und einen Spaten. Das alte Weib würde den Verlust nicht bemerken. Der Schuppen war so unordentlich und verwahrlost gewesen wie ihr ganzes Haus. Omar bezweifelte, dass die Alte die Bettlaken im letzten Jahr auch nur ein einziges Mal gewechselt hatte. Niemand in Konstantinopel hätte es gewagt, Geld für ein derart heruntergekommenes Loch zu verlangen. Aber hier schien es ganz normal zu sein. Die Menschen legten weder auf die Reinheit ihrer Kleidung und Häuser noch auf die ihrer Körper besonders viel Wert.
Omar blieb stehen und sah sich um. Irgendwo hier musste es sein. Er suchte nach einer Eiche, die vor Jahren von einem Blitzschlag gespalten worden war. Dennoch lebte der Baum weiter, mit zwei Stämmen, wie ein Ungeheuer, dem man den Kopf abgeschlagen hatte und dem zwei neue gewachsen waren. Ein Baum, der in dieses Land passte wie die Kirchen, deren Spitzen Kreuze statt Halbmonde zierten. Angestrengt lauschte Omar und starrte in den dichten Nebel. Doch er hörte nur seinen Atem. Es war, als schluckte der Nebel die Geräusche der Nacht. Wie sollte er jemals die Stelle finden, an der er graben musste? Wenn er nicht zufällig gegen den Baum stieß, würde er bis zum Morgengrauen über das Feld laufen. Aber sein Vorhaben konnte er nur im Schutz der Dunkelheit durchführen, denn niemand durfte erfahren, wonach er neben der Eiche suchte.
Der Schrei eines Uhus zerriss die Stille. Der unerwartete Laut ließ Omar erschrocken zusammenfahren. Sein Herz schlug schneller, seine Muskeln spannten sich an, und sein Kiefer verkrampfte sich. Das Tier flog direkt über ihm, dann stürzte es rasch zu Boden. Flügelschläge waren keine zu hören, eine Maus fiepte. Ein kurzer, ungleicher Kampf fand direkt neben ihm statt, aber er konnte nichts davon sehen. Abgestorbene Blätter raschelten, dann kurz das Schlagen von Flügeln, und es war wieder still. Wie zuvor hörte Omar nur noch seinen Atem und den raschen Schlag seines Herzens. Woher war der Vogel gekommen? Hatte er auf einem Strauch, einem Mauerrest oder einem Baum auf seine Beute gelauert? Omar verengte die Augen zu schmalen Schlitzen. Aber der Nebel war einfach zu dicht, und anders als die Augen des Vogels waren seine nicht dazu bestimmt, die Dunkelheit zu durchdringen.
Ein kalter Lufthauch streifte ihn von hinten. Er fröstelte. Aber für einen Moment lichtete der Windstoß die Nebelschleier. Direkt neben Omar reckte eine riesige Eiche mit zwei dicken Baumstämmen ihre kahlen, schwarzen Äste anklagend in den sternenlosen Himmel. Er hatte sich die ganze Zeit in unmittelbarer Nähe seines Ziels befunden. Rasch, bevor der Nebel erneut die Sicht auf den Baum verhüllte, schritt er darauf zu. Mit ausgestrecktem Arm tastete er nach dem nasskalten Stamm. Er schauderte. Die Rinde fühlte sich wie die schuppige Haut eines toten Tieres an. Vielleicht war der Baum tatsächlich ein verwunschenes Ungeheuer. Die Schöpfung eines Teufels, die in diesem gottlosen Land voller Ungläubiger nach Belieben ihr Unwesen treiben konnte. Würde das verwunschene Wesen seine knorrigen Äste nach ihm ausstrecken und ihn damit erwürgen, sobald er den Spaten in die Erde rammte? Omar schluckte hart. Er dachte an den Lohn, der ihm winkte, wenn er seinen Auftrag erfüllte. Mit dem versprochenen Geld konnte er für sich und seine Familie ein wunderschönes Haus mit prächtigem Garten in Konstantinopel kaufen. Aber was, wenn er gleich von einem Ast aufgespießt wurde? Im Paradies würde Allah ihn mit zweiundsiebzig wunderschönen Jungfrauen belohnen. Aber Omar brauchte keine Jungfrauen, er liebte seine Frau Basma. Ihre Zuneigung reichte ihm völlig aus.
Vor seinem inneren Auge tauchte ihr makelloses Gesicht auf. Der Gedanke an sie lenkte ihn von seiner Angst ab. Er ließ den Sack von seiner Schulter gleiten, holte den Spaten heraus und rammte ihn in die dicke, lehmige Erde, deren oberste Schicht leicht angefroren war. Offenbar war es hier kälter als am Rand des Feldes, wo Gebüsch den Boden schützte. Wie die Zuckerkruste eines Feigenkekses durchbrach er die Schicht. Er schwitzte vor Anstrengung, und das Ungeheuer der Ungläubigen griff ihn nicht an. Die kahlen Äste blieben steif. Omar stöhnte, mit dem Handrücken wischte er über seine nasse Stirn. Schweiß tropfte in seine Augen, die salzige Flüssigkeit brannte. Mit jedem Spatenstich wurde das Loch tiefer. Was, wenn schon jemand die Schatulle gefunden hatte? Oder die Eiche nicht die richtige war? Vielleicht gab es zwei verzauberte Ungeheuer. Hastig griff er nach der Schaufel, um die lockere Erde zu entfernen.
Gerade als er darüber nachdachte, wie groß die Gefahr war, dass jemand vor ihm schneller gewesen war, traf die Spitze seines Werkzeugs auf Widerstand. Metall stieß auf Metall. Am liebsten hätte er einen Freudenschrei ausgestoßen. Stattdessen seufzte er laut. Er war seinem Ziel ganz nahe. Gleich würde er die Schatulle mit ihrem unermesslich wertvollen Inhalt in seinen Händen halten. Dann würde er nach Hause zurückkehren und nie wieder einen Fuß in das Land der weintrinkenden Giauren setzen. Gemeinsam mit Basma würde er Orangenbäume in seinem Garten pflanzen. Das Bild der zweistämmigen Eiche würde er für immer aus seinem Gedächtnis verbannen. Erneut rammte er die Schaufel in die Erde, kniete sich auf den eisigen Boden und griff in das dunkle Loch. Er konnte die glatte Oberfläche der Metallschatulle ertasten. Sie war kalt, Erdklumpen klebten an ihren Rändern. Die Freude machte ihn unvorsichtig. Er war glücklich und unglaublich erleichtert. Seine Gedanken waren bei dem Haus, das er kaufen wollte, deshalb schenkte er dem leisen Knacken neben sich keine Beachtung. Dabei kannte er das Geräusch nur allzu gut. Als Soldat hatte er es schon Tausende Male gehört. Es war der Laut eines Bolzens, der in eine Armbrust gelegt wurde. Der hölzerne Bogen quietschte leise, als die Sehne gespannt wurde, dann schnellte die Sehne zurück, und das tödliche Geschoss surrte durch den nächtlichen Nebel.
Mit voller Wucht traf der Bolzen ihn von hinten, durchdrang seinen Mantel, sein Hemd, sein Fleisch und seinen linken Lungenflügel. Es dauerte einen Moment, bis der Schmerz sein Gehirn erreichte. Omar war überrascht. Langsam sackte er zu Boden. Zuerst ging er in die Knie, dann kippte er nach vorne. Er landete mit dem Gesicht direkt in der dunklen Erde, die er so hasste. Das Atmen fiel ihm schwer, in seinen Ohren rauschte es, er sah bunte Kreise. Immer noch hielt er die Schatulle mit beiden Händen umklammert. Er hörte Schritte näherkommen. Schwere Lederstiefel, die Schuhe eines Soldaten. Eine Klinge wurde aus einer Scheide gezogen. Vielleicht ein Messer oder ein Yatagan, ein Dolch mit geschwungener Klinge. Omar konnte die Waffe nicht sehen. Er spürte, wie sich jemand über ihn beugte und mit der Hand in sein dunkles, dichtes Haar griff. Basma liebte sein Haar, sie streichelte und liebkoste es oft. Aber die Hand, die sich jetzt darin festgekrallt hatte, bog seinen Kopf brutal nach hinten. Die Klinge der todbringenden Waffe wurde mit kräftigem Druck über seinen Hals gezogen. Omar nahm den Geruch von Wein wahr. Sein Mörder hatte getrunken. Er schmeckte Blut. Das letzte Bild, das er sah, bevor endgültige Dunkelheit ihn umgab, war Basmas Gesicht. Wenn Allah, der Allerhabene gütig war, würde Omar sie im Paradies wiedertreffen und nicht die 72 Jungfrauen, die er weder kannte noch liebte.
Nussberg, Oktober 1531
Fanny hatte die Küche, die vom Vorabend noch verwüstet gewesen war, gründlich gereinigt, alle Fettspritzer beseitigt, das Geschirr abgewaschen, die Stube gekehrt und die Wäsche im Garten zum Trocknen aufgehängt. Als sie nun auf den Hof trat, lichtete sich gerade der letzte Rest des Nebels über den Weinhängen, und die orangegoldene Sonne tauchte die noch hängenden Blätter in ein fast unwirklich glänzendes Gold. Wie jedes Mal blieb ihr schier die Luft weg ob der Schönheit, die sich ihr bot, und sie schätzte sich glücklich, dass sie nicht nur auf diesem Berg wohnen durfte, sondern dass er auch im Besitz ihrer Familie war. Sie konnte sich keinen besseren Ort auf der Welt zum Leben vorstellen. Zu ihrer Linken schlängelte sich am Fuße des Nussbergs träge der breite Strom der Donau durch die üppig grüne Auenlandschaft, und in der Ferne ragten die Dächer und Kirchturmspitzen der Stadt Wien in den wolkenlosen Himmel.
Es waren die letzten milden Herbststunden, in denen die Sonne zum längeren Verweilen im Freien einlud, bevor der Winter mit Schnee, Eis und Kälte die Arbeit im Weingarten unmöglich machte. Dann kam die Zeit, in der sich auch die Rebstöcke ausruhten und auf den neuen Frühling vorbereiteten. Aber bevor es so weit war, hatte Fanny noch tausend Aufgaben zu erledigen. Was machte Rosa, ihre Magd, nur schon wieder? Fanny hatte sie vor Stunden in den Stall geschickt. Mittlerweile musste der Hühnerstall vor Sauberkeit glänzen und das Federvieh eimerweise gefüttert worden sein. Auch Max, den Knecht, hatte Fanny seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber sie konnte sein Hämmern hören. Er besserte ein Loch im Dach des Schuppens aus. Im Gegensatz zu Rosa war Max ein verlässlicher Bursche, der seine Aufgaben gewissenhaft ausführte und sich auch vor unangenehmer Arbeit nicht drückte. Und Hans Steiner, Fannys Vater? Wo war er? Sie hatten gemeinsam gefrühstückt. Aber seither war er von der Bildfläche verschwunden. Seit dem unglücklichen Unfall im Sommer, als er die Leiter im Schuppen heruntergefallen und stundenlang unentdeckt am Boden gelegen hatte, war er nicht mehr der Alte. Er veränderte sich zunehmend. An manchen Tagen vergaß er Namen und Ereignisse, die nur wenige Wochen zurücklagen, einmal hatte es sogar den Anschein gehabt, als hätte er Fanny nicht erkannt. Außerdem kippte seine Stimmung oft, er wurde aggressiv, schimpfte minutenlang und konnte sich hinterher nicht mehr daran erinnern. Sein Appetit nahm ab, und er hatte in den letzten Monaten deutlich an Gewicht verloren. Nur an seinem Wein hielt er weiterhin fest. Sollte er eines Tages auch den verweigern, dann war es Zeit, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Aber bis dahin versuchte Fanny sich einzureden, dass alles nur halb so schlimm war.
Falls er im Weinkeller war, sollte sie besser nach ihm sehen. Denn der Keller war gerade im Herbst ein Ort großer Gefahren. Solange der Wein noch jung war und in den riesigen Eichenfässern reifte, entstanden giftige Dämpfe, die schon so manchen Winzer das Leben gekostet hatten.
Fanny trat wieder ins Haus und kehrte in die Küche zurück. Dort nahm sie die nicht mehr ganz saubere Schürze ab, legte sich stattdessen einen Wollumhang über die Schultern, griff nach einer Kerze und entzündete den Docht im Feuer des Küchenherds, auf dem schon die Linsensuppe fürs Mittagessen köchelte.
Mit der Kerze in der Hand lief sie über den Hof zum Weinkeller. Max kniete immer noch auf dem Dach, und Rosa stand bei ihm, um ihm das passende Werkzeug zu reichen. Das Mädchen kicherte bei jeder Bemerkung von Max. Hatte sie endlich bemerkt, dass der Knecht seit Jahren ein Auge auf sie geworfen hatte? Fanny wandte ihren Blick von den beiden ab und öffnete die Tür zum Weinkeller.
Modriger Kellergeruch, gemischt mit dem von vergorenen Trauben, schlug ihr entgegen. Fanny kannte diese Mischung. Sie begleitete sie schon ihr ganzes Leben. Sie war die Tochter eines Winzers. Vielleicht des besten Winzers der Stadt. Hans Steiners Weinstube »Zur Donauprinzessin« war weit über die Stadtgrenzen hinweg bekannt. Die Gäste kamen aus Nussdorf, Wien, Klosterneuburg und dem Umland. Der Ruf des guten Weins hatte sich sogar bis in die Hansestädte weit im Norden herumgesprochen. Seit letztem Jahr schickte Hans Steiner Fässer nach Hamburg, Bremen und Rostock. Der Wein war sein Leben, und er hatte all sein Wissen an seine Tochter Fanny weitergegeben.
»Vater?«, rief sie in den Keller. Ihre Kerze war die einzige Lichtquelle. Ansonsten war es stockdunkel. Nirgendwo konnte sie den Schein einer Laterne oder den einer weiteren Kerze sehen. Fanny erhielt keine Antwort.
»Vater, bist du im Keller?«, versuchte sie es noch einmal.
Ein Rascheln war zu hören. Ein kleiner, dunkler Schatten huschte seitlich an ihr vorbei und verschwand hinter einem der Fässer. Eine Maus. Fanny sollte Felix, den jungen Kater, wieder einmal in den Keller lassen, damit er den lästigen Nagern den Garaus machte.
Fanny ging weiter. Der Boden unter ihr war festgetretene lehmige Erde, die auch im tiefsten Winter nicht fror. Hier im vorderen Teil lagerte alter Wein in kleineren Fässern. Der neue Wein befand sich in einem Extragang. Hoffentlich war ihr Vater nicht dort. Erst letzten Herbst war Heribert Schachner, ein Winzer im Süden der Stadt, in seinem Keller zusammengebrochen. Hätte sein Sohn ihn nicht rechtzeitig gefunden, wäre er an den giftigen Dämpfen gestorben. Aber vielleicht war Hans gar nicht im Keller, sondern in Nussdorf. Seit der neue Priester, Vater Anselm, die Dorfpfarrei übernommen hatte, ritt ihr Vater regelmäßig ins Dorf und holte sich in der Kirche Trost und Rat. Diese Besuche waren neu und wurden seit seinem Sturz von der Leiter häufiger. Bis vor Kurzem war Hans sein Wein wichtiger gewesen als seine Beziehung zu Gott. Nicht bloß einmal hatte er einen Sonntagsgottesdienst ausgelassen, um Rebläuse zu bekämpfen oder Unkraut zu jäten. Doch damit war seit einiger Zeit Schluss. Hans schien vermehrt auf Gott zu setzen und ließ keine Sonntagspredigt mehr aus. Doch bevor Fanny weiter über ihren Vater und sein verändertes Verhältnis zur Kirche nachdenken konnte, hörte sie seine vertraute Stimme.
»Ich bin bei den Weinen vom Vorjahr!«
Erleichtert atmete Fanny auf. Sie zog den Wollumhang etwas fester um die Schultern. Hier im Erdkeller herrschte immer die gleiche Temperatur. Sommers wie winters. Der ideale Ort für den Wein, um in Ruhe zu reifen.
Sie bog um die Ecke, und schon sah sie im Kerzenschein den Umriss ihres Vaters. Er stand bei einem kleinen Tisch, hielt einen Becher in der Hand und schwenkte ihn, bevor er daran schnupperte. Als Fanny zu ihm trat, hob er den Kopf und sah sie mit Begeisterung aus den schon etwas glasigen Augen an.
»Du hattest völlig recht!«
»Womit?«, wollte sie wissen.
»Dein Wein, mein Kind. Er ist ein Gedicht!«
Jetzt erst sah Fanny, dass Hans mit dem Glaskolben eine Probe ihres gemischten Weins aus dem Fass genommen hatte. Die Flüssigkeit glänzte nun in seinem Becher. Ein betörender fruchtiger Geruch entströmte ihm. Fanny erkannte die pfeffrige Note, auf die sie so stolz war. Es hatte sie Jahre der Überredungskunst gekostet, bis ihr Vater dem Mischen verschiedener Rebsorten zugestimmt hatte.
»Darf ich?«, fragte sie und nahm Hans den Becher ab.
»Etwas mehr Gehalt braucht der Wein noch«, sagte er. »Im Moment ist er noch nicht kräftig genug. Du brauchst einen südländischen Rebstock, der schweren, berauschenden Wein hergibt.«
Fanny lächelte. Zufriedenheit breitete sich in ihr aus. Ihr Plan war aufgegangen. Sie hatte gehofft, dass ihr Vater begeistert sein würde. Als nächsten Schritt wollte sie die Rebstöcke im richtigen Mischverhältnis anbauen und die Reben gemeinsam ernten. Sie war davon überzeugt, dass die Rebstöcke eine perfekte Harmonie entwickeln würden, wenn sie gemeinsam wuchsen. Jetzt, da ihr Vater gesehen hatte, dass sie in der Lage war, auch ohne seine Hilfe guten Wein herzustellen, konnte er nichts mehr dagegen einwenden.
»Ich sehe ganz genau, woran du denkst!«, sagte er streng. Mahnend hob er den Zeigefinger. »Werde nicht übermütig. Das gehört sich für eine junge Frau nicht. Sei zufrieden mit dem, was du gerade erreicht hast.«
Genervt verdrehte Fanny die Augen zur gewölbten Lehmdecke über sich. Warum war ihr Vater so träge, wenn es darum ging, Neues auszuprobieren? Noch vor einem Jahr war er davon überzeugt gewesen, dass man mit dem Mischen mehrerer Rebsorten bloß sauren Essig erzeugte. Jetzt hielt er das Ergebnis in seinen Händen und war begeistert. Er leerte den Becher, den er Fanny abgenommen hatte, in einem Zug. Mit dem Handrücken fuhr er sich über den Mund und schmatzte.
»Ein gelungener Tropfen. Aber es kann auch ein Zufall gewesen sein. Anfängerglück. Manchmal passiert das.«
»Ja, natürlich!«, sagte Fanny gekränkt. Würde sie es je erleben, dass Hans Steiner sie lobte, ohne einen Zusatz mit dem Wort »aber« einzuleiten? Sie stellte die Kerze auf dem kleinen Tischchen neben ihrem Vater ab und sah ihn enttäuscht an. Er war im letzten Jahr alt geworden. Tiefe Furchen zogen sich durch sein Gesicht. Aus seinen Lachfältchen rund um die Augen waren strenge Sorgenfalten geworden. Wo war der großzügige, sanfte Hans Steiner, der sie großgezogen hatte?
»Hat dir der Mathematiker endlich einen Heiratsantrag gemacht?«, fragte Hans geradeheraus.
Fanny hatte diese Frage befürchtet. Die Worte lagen ihrem Vater seit Tagen auf der Zunge. Aber jedes Mal, wenn er sie aussprechen wollte, war Fanny ihm ausgewichen. Hier im engen Weinkeller gab es kein Entkommen.
Sie biss sich auf die Unterlippe, dann sagte sie bitter: »Nein, es gibt noch keinen Hochzeitstermin.« Dabei starrte sie auf die Spitzen ihrer Holzpantoffeln. Sie waren alt und abgetragen, irgendwann musste sie sich neue besorgen. Aber das Schuhwerk war nicht ihr eigentliches Problem. Seit über einem Jahr war sie nun mit dem Mathematiker und Bauingenieur Sebastian Grün befreundet. Im Sommer hatten sie sich regelmäßig gesehen, und Fanny hatte gedacht, dass er ihr endlich den langersehnten Heiratsantrag machen würde, aber dann hatte seine Schwester Margarethe den Medikus Matthias Zotter geheiratet, und Sebastian hatte kalte Füße bekommen. Statt endlich die Frage der Fragen zu stellen, schien es fast, als würde er Fanny meiden. In den letzten Wochen war er nur selten auf den Nussberg gekommen. Es war Tage her, dass Fanny ihn gesehen hatte. Dabei mochte er sie, dessen war sie sich sicher. Noch vor einem Jahr hatte sie gedacht, dass er sie liebte, aber aus irgendeinem Grund schienen seine Gefühle abgekühlt zu sein. Jetzt reichte seine Zuneigung nicht mehr für den Bund fürs Leben.
Hans Steiner runzelte sorgenvoll die Stirn. »Du weißt, dass du rasch heiraten musst. Die Menschen zerreißen sich schon das Maul. Sie reden über dich. Als ehrbare Witwe ziemt es sich nicht, dass du dich regelmäßig und offen mit einem unverheirateten Mann triffst.«
Fanny machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das Gerede ist mir egal!«
Hans schnalzte unzufrieden mit der Zunge.
»Das mag schon sein. Aber mir ist es nicht egal. Jedes Mal, wenn ich ins Dorf reite, will Vater Anselm wissen, wann du endlich heiratest, und jedes Mal muss ich ihm sagen, dass du dich noch nicht entschieden hast.«
Fanny fragte sich, was den Pfarrer ihre Heiratspläne angingen. Doch sie behielt ihre Gedanken für sich.
»Ich werde nicht jünger«, sagte Hans. »Im Grunde kann Gott mich jeden Tag zu sich holen, und du weißt, was passiert, wenn du dann immer noch nicht verheiratet bist. Du verlierst die Weinberge an den Landesfürsten, und alles wofür ich je gearbeitet habe, ist dahin.«
Diese Tatsache war nicht neu für Fanny. Sie wusste genau, dass der gesamte Besitz, der sich außerhalb der Wiener Stadtmauern befand, an den zuständigen Landesfürsten zurückgehen würde, sollte ihr Vater sterben, bevor sie wieder geheiratet hatte. Hans Steiner war einer der wenigen Grundbesitzer, die keine Adeligen waren. Dieses besondere Privileg hatte er sich hart erkämpft. Oder ehrlicher gesagt, er hatte vor vielen Jahren die Gunst der Stunde richtig erkannt und den nicht mehr ganz nüchternen Zustand des Landesfürsten für sich genutzt. Wie auch immer, er konnte seinen Weinberg nur an einen Sohn oder eine verheiratete Tochter weitergeben.
Fanny wusste immer noch nicht, warum sich Vater Anselm in die Angelegenheit einmischte. Er war der Dorfpfarrer von Nussdorf. Ihr Blick fiel auf eines der Fässer, die ihren Wein enthielten. Hans Steiner hatte ein rotes Kreuz darauf gemalt.
»Was ist das?«, wollte Fanny wissen.
»Das Fass geht an die Kirche. Ich habe Vater Anselm versprochen, dass wir der Kirche den Messwein spenden.«
Mit einem Mal ging Fanny ein Licht auf. Der gute Pfarrer wollte, dass die Weinberge im Besitz der Familie blieben, damit er weiterhin seinen Wein bekam. Sollte sie ihm deshalb gram sein? Noch bevor sie eine Antwort finden konnte, hatte ihr Vater einen neuen Vorschlag.
»Der Schweizer Uhrenmacher. Wie war doch sein Name?« Er kratzte sich am Kopf. Der leere Ausdruck der Verwirrung und des Vergessens, den Fanny mittlerweile fürchten gelernt hat, schlich sich in seine Augen. Rasch half sie ihrem Vater auf die Sprünge und ergänzte seine Gedanken: »Kasper Liechti.«
»Ja, richtig!«, rief Hans. Das Verstehen kehrte in seine Augen zurück.
»Der Mann ist in Klosterneuburg. Was hältst du davon, ihn einzuladen?«
Fanny fiel ihm ins Wort. »Vater, ich habe Liechtis Heiratsantrag vor einem Jahr abgelehnt. Denkst du wirklich, der Mann hätte diese Kränkung vergessen und würde seinen Antrag wiederholen?«
Hans Steiner zuckte mit den Schultern. »Warum denn nicht? Er hätte viel zu gewinnen, den schönsten Weinberg der Gegend.«
Fanny wollte davon nichts wissen. Sie würde mit Liechti nicht glücklich werden. Der Mann war charmant, keine Frage. Aber ein Frauenheld und Weltenbummler, der es nicht lange an einem Ort aushalten konnte. Fanny hatte bereits eine schreckliche Ehe hinter sich, sie wollte keine weitere unglückliche Beziehung eingehen. Zumindest nicht, solange sie auf Sebastians Entscheidung hoffte. Nur zu gerne hätte sie das Gespräch beendet, aber Hans Steiner gab noch nicht auf. Er hatte eine weitere Idee für ihre Zukunft: »Außerdem hat Peter Geiger wiederholt bei mir um deine Hand angehalten.« Seine Worte trafen Fanny völlig unerwartet. Erstaunt starrte sie ihren Vater an.
»Der Winzer, der seine Weinberge durch die Ehe mit der Witwe Hofer bekommen hat und Wein keltert, der so sauer ist, dass man tagelang Sodbrennen davon hat?«, fragte sie. Fanny konnte nicht glauben, dass ihr Vater eine Eheschließung mit diesem Mann auch nur in Erwägung zog.
»Geiger ist ein Winzer. Er ist Mitglied der Innung, Vater Anselm hält große Stücke auf ihn. Er wäre eine gute Partie. Seit letztem Sommer ist er wieder Witwer.«
»Und jetzt will er seine Besitzungen durch eine weitere Ehe vergrößern. Denn durch den Verkauf seines armseligen Weines kann er nicht reich werden.« Fanny konnte den überheblichen, selbstverliebten Mann nicht ausstehen.
»Du übertreibst«, sagte Hans Steiner streng. »Geiger ist ein guter Mann und eine wunderbare Partie. Auch du könntest von einer Ehe profitieren. Im Grunde wäre mit ihm alles einfacher als mit einem Baumeister oder fahrenden Händler, die nichts vom Wein verstehen.«
»Sebastian ist Bauingenieur und Kasper Liechti Uhrenmacher«, korrigierte Fanny ihren Vater. Sie war sich nicht sicher, ob wieder seine Gedächtnislücken zuschlugen oder ob er absichtlich falsche Berufsbezeichnungen verwendet hatte. »Außerdem versteht Geiger auch nichts vom Wein!«, fügte sie verächtlich hinzu.
»Er hatte in den letzten Jahren Pech mit der Ernte«, entschuldigte Hans ihn.
»Vater, vergiss es. Ich werde Geiger nicht heiraten. Aber ich werde mit Master Grün reden«, unterbrach Fanny ihren Vater ungeduldig.
»Was willst du ihm sagen?«, fragte Hans.
Das wusste Fanny noch nicht. Wahrscheinlich würde sie der Mut verlassen, sobald sie Sebastian gegenüberstand und seine Unentschlossenheit spürte, die sie verletzte und kränkte. Aber darüber konnte und wollte sie nicht mit ihrem Vater reden.
Wien, Obere Bäckerstraße,Oktober 1531
Ohne anzuklopfen, öffnete Margarethe die Tür zum Arbeitszimmer ihres Bruders. Sebastian fuhr zusammen und ließ einen ganzen Stapel loser Blätter fallen. Die kostbaren Aufzeichnungen segelten auf den abgetretenen Holzboden und landeten dort in wildem Durcheinander.
»Himmel, hast du mich erschreckt!«, schimpfte er. »Wirst du nie lernen anzuklopfen?« Sein Haar stand wie immer unfrisiert von seinem Kopf ab, sein Hemd war zerknittert und zeigte Tintenspuren an den Ärmeln.
»Ich freue mich auch von ganzem Herzen, dich zu sehen, Bruderherz«, antwortete Margarethe mit einem schiefen Grinsen. Genau wie Sebastian hatte sie außergewöhnlich hellblaue Augen und dichtes, blondes Haar, das sie jedoch seit ihrer Hochzeit unter einer Haube verbarg. Sie trug die Haube mit Stolz, aber leider konnte sie jetzt die hässlichen Brandnarben, die ihr Gesicht seit einem tragischen Ereignis in ihrer Kindheit entstellten, nicht mehr mit ihren dichten Locken verbergen.
»Was willst du hier?«, fragte Sebastian immer noch verärgert. Er kniete sich auf den Boden und begann die Aufzeichnungen über seine Flugmaschine, an der er seit Jahren bastelte, wieder einzusammeln. Sicher waren sie jetzt ungeordnet, er hätte die Blätter nummerieren sollen.
Margarethe machte einen Schritt auf ihn zu, beugte sich zu ihm und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn.
»Ich war beim Bäcker Reuz, er macht die besten Kipferl der Stadt, seit Neuestem füllt er sie nicht nur mit Nüssen, sondern auch mit Topfen und Mohn, und da dachte ich, ich überrasche dich mit einem Besuch.«
»Das ist dir gelungen.«
Gerade als Sebastian alle Blätter wieder zu einem Stoß zusammengesammelt hatte, sauste ein dreifarbiges Wollknäuel ins Zimmer, schlitterte über den Holzboden und sprang an Sebastians Bein hoch. Vor Schreck ließ er erneut die Blätter fallen, was den Hund aber nicht weiter störte. Er schleckte schwanzwedelnd über Sebastians Hand.
»Verdammt, Herkules«, schimpfte Sebastian ungehalten. »Hör auf damit.« Entschieden schob er das Tier beiseite. Immer noch aufgeregt, setzte sich Herkules neben ihn, wedelte aber weiter mit dem Schwanz und wirbelte die Blätter noch weiter auf.
»Sebastian. Der Herrgott hört alles. Also bitte unterlass das Fluchen«, ermahnte Margarethe.
Statt einer Antwort schnaufte ihr Bruder laut. Wieder machte er sich daran, seine Blätter einzusammeln, was Herkules offenbar als Spiel interpretierte, und voller Freude sprang er in den Blätterhaufen.
»Herkules«, herrschte ihn Sebastian ungehalten an, worauf der Hund seine viel zu langen Ohren anlegte und sichtlich beleidigt wieder Platz nahm.
»Wenn man bedenkt, dass Herkules dir letztes Jahr das Leben gerettet hat, bist du unangemessen streng mit ihm.«
»Margarethe!« Sebastian räusperte sich. »Seit drei Jahren arbeite ich an diesen Plänen. Ich stehe knapp davor, die perfekte Luftschraube zu konstruieren. Einen Helix Pteron, der es Menschen ermöglichen wird, sich in die Lüfte zu erheben und frei wie ein Vogel über die Dächer der Stadt zu segeln. Du und dein struppiger Straßenköter seid gerade dabei, die größte Erfindung der Menschheit seit der Errungenschaft des Rades zu sabotieren.«
So als hätte Herkules Sebastians Worte verstanden, schnaubte er leise.
Margarethe war direkter. »Mach dich nicht lächerlich, Bruderherz«, sagte sie. »Statt über irgendwelchen Plänen zu brüten, solltest du dich lieber um Fanny kümmern. Sicher hast du sie seit Tagen nicht gesehen, und statt mit ihr ein Picknick zu machen, hockst du in deiner Stube und ruinierst dein bestes Hemd mit Tinte.« Ihr Blick fiel auf die dunklen Flecken, die auf ewig im hellen Leinen bleiben würden.
»Es ist längst zu kalt für ein Picknick«, murmelte Sebastian leise. Er war nun rot angelaufen und senkte den Kopf, damit seine Schwester seine Verlegenheit nicht sehen konnte, doch sie hatte sie längst bemerkt.
Bevor Margarethe weitere Vorschläge machen konnte, womit Sebastian Fanny überraschen könnte, betrat Grete, Sebastians Haushälterin, die Arbeitsstube.
»Margarethe, wie schön, dass Ihr hier seid«, rief sie aufgeregt und umarmte die junge Frau. Grete war um einen ganzen Kopf kleiner, dafür doppelt so breit wie Margarethe. Als sie letztes Jahr die Stelle als Haushälterin angenommen hatte, war sofort klar gewesen, dass sie nicht nur für eine saubere Stube und das kulinarische Wohl sorgen, sondern auch die Rolle der viel zu früh verstorbenen Mutter im Haus einnehmen würde. Sie selbst hatte keine Kinder, aber ein großes Herz. Grete zählte zu den Menschen, die nur zufrieden waren, wenn sie sich um andere kümmern durften. Margarethe hatte sich nicht dagegen gewehrt.
»Gut schaut Ihr aus«, sagte Grete stolz. Sie schob Margarethe auf Armeslänge von sich weg und musterte sie mit zusammengekniffenen Augen, ihre roten Apfelbacken glühten vor Freude. »Kann es sein, dass Ihr zugenommen habt?«
Blut schoss in Margarethes Wangen. Wie eben noch ihr Bruder errötete jetzt sie.
»Wart Ihr gerade bei Heide?« Grete hob die Augenbrauen und musterte Margarethe wissend. »Ich habe Euch aus dem Haus der Hebamme kommen sehen«, gab sie mit erhobenem Zeigefinger zu.
»Nun, ich …«, Margarethe kaute auf ihrer Unterlippe, blickte verlegen zu ihrem Bruder, so als könne er ihr aus der Situation helfen. Aber Sebastian kniete über seinen Aufzeichnungen und ordnete sie erneut.
»… ich bin schwanger!«, platzte Margarethe heraus.
»Ich wusste es!« Voller Begeisterung klatschte Grete in ihre prallen Hände. Dann umarmte sie Margarethe noch einmal. Zum dritten Mal ließ Sebastian seine Blätter fallen. Diesmal entglitten sie ihm langsam und unspektakulär und ohne fremde Einwirkung. Beinahe elegant segelten sie auf den Boden und breiteten sich malerisch als weißer Teppich auf dem dunklen Holzfußboden aus. Nun war die Reihenfolge endgültig zerstört. Es würde ihn Stunden kosten, alle Blätter wieder zu ordnen.
»Wie … Wie kann das sein …?«, fragte er.
Mit einem amüsierten Lächeln in den Augen drehte sich Grete zu ihm um: »Also bitte. Master Sebastian. Eure Schwester ist verheiratet, da ist es ganz natürlich, dass sie schwanger ist. Ich freue mich riesig. Endlich kommt etwas Leben ins Haus. Es gibt so viel vorzubereiten. Wir müssen Windeln nähen, einen Stubenkorb besorgen, ein Taufkleid nähen …«
»Nicht so schnell«, unterbrach Margarethe Gretes Redefluss. »Das Kind kommt nicht vor Maria Lichtmess. Wir haben also noch alle Zeit der Welt, um uns vorzubereiten.«
Aber Grete ließ diesen Einwand nicht gelten. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Die Zeit vergeht schneller, als man ›Quak, ein Frosch ist grün‹ sagen kann, und schon ist der zweite Februar da. Ich werde gleich morgen nach einer Wiege Ausschau halten, und ein Kleidchen für den Säugling werde ich auch nähen und …«
Sebastian beobachtete die kleine Frau und fragte sich, warum irgendjemand »Quak, ein Frosch ist grün« sagen sollte, aber er behielt die Frage für sich. Die Gedankengänge seiner Haushälterin waren für ihn häufig ein Buch mit sieben Siegeln. Unterdessen fasste Margarethe Grete an den Oberarmen.
»Halt!«, sagte sie bestimmt. »Bis Weihnachten machen wir gar nichts, und danach, wenn alles so verläuft, wie wir uns das wünschen, kannst du anfangen Windeln zu nähen.«
Nur widerwillig nickte Grete, doch dann besann sie sich auf eine andere Sache. »Wollt Ihr ein Stück Apfelkuchen? Ich habe den Teig ganz dünn ausgerollt, mit Nüssen und einer Prise Zimt verfeinert und dann eingeschlagen. Der Kuchen sieht jetzt aus wie eine dicke Raupe oder wie ein Wickelkind.« Sie kicherte.
»Mit Zimt?«, fragte Sebastian streng. Ein Säckchen der exotischen Rinde war so teuer wie die Kopien seiner Schriften von Leonardo da Vinci. Aber Sebastian wusste, dass in Wien niemand besseren Apfelkuchen machte als Grete, und er selbst aß reichlich davon. Es fiel ihm daher schwer, klare Prioritäten zu setzen. Auch wenn sein wissenschaftlicher Geist nach neuen Schriften verlangte, sobald Gretes Kuchenduft durchs Haus wehte, verlor dieser Wunsch an Gewicht. Zum Glück konnte man Bücher und Schriften auch ausleihen. Die Zwetschgen, Haselnüsse und Quitten aus seinem Garten schmeckten aber nicht halb so gut, wenn sie nicht verarbeitet wurden.
»Ja, mit Zimt und Honig!«, sagte Grete stolz. »Ich richte in der Stube alles für eine Jause her.« Schon war sie auf dem Weg in die Küche. Herkules, der ahnte, dass etwas für ihn abfallen würde, folgte ihr.
Nun waren die Geschwister allein. Vorsichtig musterte Sebastian seine Schwester. Ihre Gesichtszüge waren weicher, die Wangen rosig, und ihre Augen strahlten so viel Lebensfreude aus wie nie zuvor. Es war schön, sie so glücklich zu sehen. Er hatte geahnt, dass sie irgendwann schwanger werden würde. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geschehen würde.
»Die Ehe mit Matthias tut dir sichtlich gut«, sagte er.
»Matthias ist ein wundervoller Ehemann. Ich hätte keinen besseren finden können. Wir freuen uns beide auf das Kind.« Margarethe legte die Hand auf ihren Bauch. Nun bemerkte Sebastian, dass er leicht gewölbt war.
Noch vor einem Jahr hatte Margarethe hier bei ihrem Bruder gewohnt und sich um verwaiste Tiere gekümmert. Jetzt würde sie bald Mutter werden.
Nur zu gut konnte er sich an das endlose Werben seines Freundes Matthias Zotter erinnern. Vielleicht lag es in der Familie, dass sich beide Geschwister nur zögerlich zur Ehe durchringen konnten. So als könnte Margarethe seine Gedanken lesen, sagte sie: »Du weißt, warum ich so lange gehadert habe. Das lag einzig und allein daran!« Sie zeigte auf ihre Wange. Margarethe hatte sich nicht vorstellen können, dass Matthias ihr entstelltes Gesicht gleichgültig war. Sebastians Zögern in Bezug auf die Ehe hatte ebenfalls mit Margarethes Verletzung zu tun, aber es war weitaus komplizierter und hing mit einer schier unüberwindbaren Angst zusammen. Statt sich mit den Gespenstern der Vergangenheit auseinanderzusetzen, fragte er: »Was sagt Matthias dazu, dass er so schnell Vater wird?«
»Ich habe dir doch schon gesagt, dass er sich freut«, antwortete Margarethe, als sei es das Selbstverständlichste der Welt.
»Aber ein Kind, das ist doch eine einschneidende Veränderung im Leben. Es bedeutet Verzicht und Verantwortung und …«
»… Freude«, ergänzte Margarethe die Worte ihres Bruders.
Sebastian schluckte einen dicken Kloß hinunter. Bald würde Margarethes Kind zu ihm »Onkel Sebastian« sagen. Das klang nicht nur fremd, sondern irgendwie auch bedrohlich. Es implizierte Verantwortung, die er vielleicht nie übernehmen konnte.
»Letzten Monat habe ich die ersten Kräuter im Garten geerntet.« Margarethe wechselte das Thema und holte Sebastian aus seinen Überlegungen zurück in die Arbeitsstube.
»Stell dir nur vor. Matthias ist Medikus und hat weder Salbei noch Spitzwegerich, Majoran oder Kerbel im Garten.«
»Jetzt gibt es reichlich von allem.«
Sebastian dachte an seinen eigenen Garten, den seine Schwester in all den Jahren in ein kleines Paradies verwandelt hatte. Zum Glück hatte nun Grete die Pflege der Oase übernommen. Ohne die Hilfe der Haushälterin wäre die Pracht innerhalb kürzester Zeit verkommen.
Sebastian widmete sich wieder seinen Aufzeichnungen. Einige der Blätter hatten gelitten. Er strich die Eselsohren glatt.
»Danach hat Matthias im Garten für Marie, die alte Ziege, einen Stall gebaut und einen weiteren für die Hühner«, erklärte Margarethe. Sie hatte nach wie vor ein Herz für Tiere und nahm herrenlose Katzen ebenso auf wie streunende Hunde, altersschwache Ziegen und verwaiste Igelkinder. Herkules hatte sie vor dem Hundefänger gerettet. Der Hund war wieder zurück aus der Küche gekommen und beobachtete Sebastian beim Glattstreichen der Blätter.
»Herkules mag dich«, sagte Margarethe sanft. »Er war ganz außer sich, als wir zuvor in die Straße eingebogen sind.« Sebastian hätte an ihrer veränderten Tonlage erkennen müssen, dass gleich eine Bitte folgte, die er nur ausschlagen konnte, wenn er schnell genug reagierte. Aber er war so sehr auf seine Blätter konzentriert, dass er nur mit einem Ohr zuhörte.
»Du magst den Hund doch auch. Oder?«
»Ja, natürlich mag ich ihn.«
»Herkules ist der friedlichste und gutmütigste Hund auf Gottes Erdboden.«
»Ich weiß.« Gerade hatte Sebastian ein weiteres Blatt mit einem unschönen Eselsohr aus dem Stapel gefischt. Sorgfältig strich er mit dem Daumen darüber.
»Leider sieht der Hund unseres Nachbarn das anders.«
»Hm!«
»Jedes Mal, wenn Herkules in den Garten läuft, bellt der Hund vom Apotheker Randel so laut, dass alle anderen Nachbarn sich mittlerweile aufregen. Einmal ist Randels Hund in unseren Garten gekommen und hat Herkules ins Ohr gebissen. Der Arme hatte eine schreckliche Wunde, die tagelang nicht heilen wollte.«
»Dann soll Randel sein Vieh an die Leine nehmen.«
»Das ist nicht so einfach, schließlich hat Randel seinen Hund schon seit vielen Jahren. Das Tier ist alt, sicher wird es nicht mehr lange leben. Herkules ist der Neuling.«
»Ihr werdet eine Lösung finden«, sagte Sebastian, den der Hundestreit nur mäßig interessierte. Er suchte nach einem ganz bestimmten Blatt, auf dem er verschiedene Größen der Propellerblätter vorgeschlagen hatte. Wo zum Kuckuck war es nur? Konnte es unter das Schreibpult gerutscht sein? Sebastian beugte sich noch tiefer, um einen Blick darunter zu werfen. Herkules hielt den Kopf schräg und beobachtete ihn interessiert.
»Wir haben schon eine gefunden«, sagte Margarethe und zögerte.
»Das ist doch wundervoll.«
Eine Pause entstand, Margarethe knetete verlegen ihre Hände, aber Sebastian reagierte immer noch nicht. Er hatte das Blatt gefunden. Es lag tatsächlich unter dem Schreibpult. So ein Glück. Zufrieden kroch er auf allen vieren darauf zu. Arglos schob er nun alle Blätter zu einem möglichst exakten Stapel zusammen.
»Wir dachten uns, es wäre das Beste, wenn du Herkules nimmst.«
Sebastian hielt in seiner Bewegung abrupt inne. Sicher hatte er sich eben verhört und den letzten Satz seiner Schwester nicht richtig verstanden.
»Wie bitte?«
Es konnte unmöglich sein, dass Margarethe von ihm verlangte, das zerfledderte, struppige Wollknäuel auf vier Pfoten zu sich zu nehmen.
»Herkules mag dich. Er hat sich für dich ins Wadel von Frau Pilhamer verbissen. Er wäre glücklich bei dir, und du wärst nicht so allein.«
Sebastians Kinnlade sackte nach unten, bevor er laut und aufgebracht antwortete: »Ich bin nicht allein. Grete wohnt hier, und glaube mir, ich wäre nicht glücklich mit Herkules.«
»Bitte«, flehte Margarethe. »Es wäre ja nicht für immer. Nur so lange, bis Randels Hund das Zeitliche gesegnet hat. Er ist wirklich alt. Rund um die Schnauze ist er schon ganz grau.« Sie fuhr sich mit der Hand an den Mund, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen.
»Margarethe, ich will keinen Hund. Ich will auch keine Katze, kein Schaf, keinen Vogel. Ich will gar kein Tier. Sie bedeuten bloß Arbeit und Verantwortung. Ich will weder das eine noch das andere.«
»Aber es wird Zeit, dass du endlich mal Verantwortung übernimmst«, sagte Margarethe.
Sebastian zwinkerte. Wohin führte dieses Gespräch gerade? Wollte Margarethe ihm etwa vorschreiben, wie er zu leben hatte?
»Warum?«, fuhr er sie ungehalten an. »Nur weil du geheiratet hast und ein Kind bekommst? Deshalb muss ich dasselbe tun? Ich bin mit meiner Lebenssituation, wie sie ist, sehr glücklich.«
Empört stemmte Margarethe ihre Hände in die Hüften. »Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Leben für dich bequem ist. Du lässt dir von Grete den Haushalt führen, arbeitest ein paar Stunden als Bauingenieur für die Stadt, und den Rest deines Tages verbringst du mit Plänen irgendwelcher Flugmaschinen, deren Einsatzfähigkeit angezweifelt werden darf. Und wenn es dir gerade mal in den Kram passt, dann triffst du dich mit Fanny. Wie lange glaubst du, dass sie dieses Spiel noch mitmachen wird? Sie ist eine Witwe und will wieder heiraten. Sie wird nicht ewig auf dich warten.«
Betroffen starrte Sebastian Margarethe an. Seine sonst so sanfte Schwester hatte einen ungewohnt harschen Ton angeschlagen. Aber es war sein Leben, über das gerade gesprochen wurde, und das ging allein ihn etwas an.
»Ich glaube nicht, dass du dich um meine Beziehung zu Fanny Roth kümmern musst«, sagte Sebastian leise.
Versöhnlich trat Margarethe auf ihren Bruder zu. Sie ergriff seine Hände.
»Wahrscheinlich hast du recht, und die Sache geht mich nichts an. Aber du bist mein kleiner Bruder, und ich mache mir Sorgen um dich. Ich fürchte, dass du als Eigenbrötler in deiner Stube versauerst. Außerdem ist Fanny meine Freundin geworden, und ich will nicht, dass ihr jemand wehtut. Zu allerletzt mein Bruder.«
»Hm«, Sebastian verzog seinen Mund.
»Nimmst du jetzt Herkules?« Sie ließ seine Hände los. Ihre Augen waren geweitet, sie bettelten Sebastian förmlich an. Die Narbe auf ihrer rechten Gesichtshälfte färbte sich dunkelrot, das tat sie immer, wenn Margarethe sich aufregte, und Sebastian musste seinen Blick von ihr abwenden. Die Erinnerungen daran, wie diese Narbe entstanden war, nämlich durch die Hand des betrunkenen, gewalttätigen Vaters, waren so schmerzhaft, dass er sie auch nach all den Jahren nicht ertrug. Und wie immer, wenn Margarethe ihn unfreiwillig an diesen unglücklichen Tag erinnerte, konnte er ihr keinen Wunsch abschlagen. Ihre gemeinsame Kindheit war von Gewalt und Willkür geprägt gewesen. Als Sebastian und Margarethe im Haus Fangen gespielt hatten, hatte der Vater den Kindern Einhalt geboten, indem er Margarethe mit heißem Fett übergossen hatte. Nie würde Sebastian diese Szene vergessen können, in der er sich hilflos und schuldig zugleich gefühlt hatte. Margarethes Schreien und ihr Wimmern, auch noch Tage nach dem Vorfall, verfolgten ihn nach wie vor in seinen Albträumen. Auch wenn sein Verstand wusste, dass er nicht das Geringste hätte tun können, um die Gewalttat zu verhindern, so gab es irgendwo in seinem Inneren eine leise Stimme, die etwas anderes behauptete. Diese Stimme war es auch, die ihm in regelmäßigen Abständen zuflüsterte, dass er niemals Vater werden durfte. Die Verantwortung war zu groß. Vielleicht würde er in einem Moment des Wahnsinns ebenso handeln, wie sein Vater es getan hatte, und sein eigen Fleisch und Blut misshandeln. Die Kirche behauptete, dass Geisteskrankheiten in den Sünden der Menschen wurzelten. Als Wissenschaftler glaubte Sebastian nicht an diese Theorien. Namhafte Philosophen vertraten die Meinung, dass Geisteskrankheiten vererbbar waren. Im Unterschied zur Kirchenlehre ängstigte Sebastian diese Vorstellung.
Er schüttelte seine Überlegungen ab und seufzte resigniert. »Dann lass den Hund eben hier«, gab er ihrer Bitte nach. »Vorausgesetzt, Grete ist damit einverstanden. Schließlich wird sie die meiste Zeit am Tag mit dem Köter verbringen.«
Margarethe umarmte ihn.
»Du bist der beste Bruder, den ich habe.«
»Ich bin dein einziger.« Sebastian verzog seinen Mund. »Aber nur so lange, bis der alte Hund des Apothekers tot ist.«
»Ja, natürlich!«, sagte Margarethe leichthin. Sebastian wurde das Gefühl nicht los, dass Herkules für immer bei ihm einziehen würde. Und der Gedanke gefiel ihm ganz und gar nicht, daran konnten auch der treuherzige Blick und das ständige Schwanzwedeln des Hundes nichts ändern.
Kaiserebersdorf, Oktober 1531
Als Maria Dunst auf den Hof trat, war es so kalt, dass sie ihren Atem sehen konnte. Der Winter rückte mit jedem Tag näher und mit ihm die Zeit des Frierens und des Hungerns. Sie zog ihren alten Wollumhang enger um die schmalen Schultern. Der Stoff war dünn und voller Löcher, genau wie das Dach ihres Hauses. Aber sie konnte sich weder einen neuen Umhang noch die Reparatur des Daches leisten. Jeden Tag wachte sie mit der Angst auf, dass eines ihrer drei Kinder abends hungrig schlafen gehen musste. Noch waren alle drei gesund. Im Sommer war es nicht schwer gewesen, satt zu werden. Der Garten hatte Obst und Gemüse hergegeben. Die Früchte hatte sie bei den Nachbarn gegen Käse und Eier eintauschen können. Aber was sollte sie ihnen im Winter anbieten? Die Tage würden kurz und bitterkalt werden, und sie würde wie im Vorjahr in Dunkelheit mit ihren Kindern hungern und frieren. Noch vor zwei Jahren war sie eine wohlhabende Bäuerin gewesen, die gemeinsam mit ihrem Mann die gepachteten Felder bestellt hatte. Jedes Jahr hatten sie ihren Zehnten abgegeben, und jedes Jahr war mehr für die Familie übrig geblieben. Sie hatten einen neuen Stall angebaut. Das Geld hatte sogar für eine Kuh und einen Esel gereicht. Von all dem war jetzt nichts mehr übrig. Der Türkenkrieg hatte ihr alles genommen. Den Mann, die zwei ältesten Söhne, die Hühner, die Kuh, den Esel und die Ernte. Ihren Mann hatten die Osmanen vor ihren Augen geköpft und ihre beiden ältesten Söhne aufgespießt wie Hühner auf einem Grill. Nachts konnte sie nicht schlafen, weil die Bilder ihres Todes und ihre Schmerzensschreie sie verfolgten. Zwei ihrer Bekannten waren verrückt geworden, weil sie Ähnliches erlebt hatten. An manchen Tagen wünschte Maria, auch sie könnte ihren Verstand verlieren. Dann bräuchte sie sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Sie könnte singend und sabbernd über die Felder irren und bräuchte sich um niemanden zu kümmern. Aber noch konnte sie es sich nicht leisten, dem Irrsinn anheimzufallen. Drei ihrer Kinder lebten, und solange sie bei ihr wohnten, war sie für die Mädchen verantwortlich. Sie musste für sie sorgen, Essen beschaffen, sie in den Schlaf wiegen und versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen.
Maria trat hinter ihr baufälliges Haus. Bei einem der dunklen, verkohlten Mauerreste des Schuppens stand die Milchkanne, auch sie war alt und verbeult. Außerdem war sie leer, denn auf dem Hof gab es kein Tier, das man hätte melken können. Aber ihre Nachbarin hatte eine Kuh, und sie gab ihr einmal in der Woche Milch. Im Gegenzug flocht Maria der Frau einen neuen Stubenwagen. Maria hatte das Korbflechten von ihrer Mutter gelernt. Eine Fertigkeit, die ihr jetzt beim Überleben half. Zumindest solange bis der Stubenwagen fertig war. Die Nachbarin hatte ihr zwei alte Hühner versprochen, wenn der Wagen besonders schön wurde. Maria gab ihr Bestes.
Sie nahm die verbeulte Milchkanne und ging los. Die feste Erde knirschte unter ihren schweren Holzpantoffeln. Ein Rabe krächzte in einem Baum. Wann waren die schwarzen Vögel gekommen? Hatten nicht gerade noch die Lerchen gesungen, als sie den Weg zu ihrer Nachbarin angetreten hatte? Sie musste sich beeilen, denn sie wollte die Milch nach Hause bringen, bevor sich ihre beiden älteren Töchter auf den Weg in die Stadt machten, um dort Schlehen und Hagebutten zu verkaufen. Die Frauen in der Stadt zerstachen sich nicht gerne die Hände bei der Ernte der begehrten Herbstfrüchte, die in eingekochtem Zustand durch den kargen Winter halfen.
Während Maria darüber nachdachte, wie viele der Früchte sie Anna und Helene in die Stadt mitgeben und wie viele davon sie für sich selbst behalten sollte, lief sie unbeirrt weiter und hätte dabei fast über das schwarze Bündel hinweggesehen, das unter der Eiche mit den zwei Stämmen lag. Sie hob die Hand an die Stirn, um die Augen vor der Sonne abzuschirmen. Was konnte es sein? Hatte jemand einen Sack liegengelassen? Der Baum wurde seit Jahren von den Menschen mit Ehrfurcht betrachtet. Früher hatten Gläubige Blumen und andere Opfergaben liegenlassen. Man sprach dem Baum Heiligkeit zu. Gott hatte seine schützende Hand über die Eiche gehalten. Statt ihn mit dem Blitz zu töten, hatte er dem Baum zwei Stämme gewährt. Aber das Bündel war zu groß für eine Opfergabe, viel eher sah es aus, als hätte jemand etwas verloren. War etwa ein mit Nahrungsmitteln vollbeladener Wagen vorbeigerattert und hatte kostbare Fracht abgeworfen? Neugierig und in der Hoffnung, einen wertvollen Fund zu machen, lief Maria los. Je näher sie der Eiche kam, umso mehr sanken ihre Erwartungen. Der vermeintliche Sack voll Hafer oder Getreide erinnerte sie an einen menschlichen Körper. Vielleicht ein Wanderer, der im Schutz der Eiche übernachtet hatte. Aber die Art und Weise, wie der Körper ausgestreckt am Boden lag, verriet ihr, dass der Mensch sich nicht freiwillig dort befand.
Ihre Nackenhaare stellten sich auf, und ein eisiger Schauer lief über ihren Rücken. Die Bilder, die sie sonst nur nachts heimsuchten, tauchten nun auch bei Tageslicht vor ihrem inneren Auge auf. Sie wollte keine weitere Leiche sehen. Nicht hier, nicht auf dem Feld, das sie einst bestellt hatte und auf dem vor zwei Jahren die Osmanen reihenweise Gefangene geköpft hatten, Männer, Frauen und Kinder, bis der Boden rot mit ihrem Blut getränkt gewesen war. Maria hatte während des Türkenkriegs so viele Tote gesehen, dass es für ein ganzes Leben reichte. Aber vielleicht war der Mensch unter der Eiche bloß verletzt oder krank. Und jetzt brauchte er Unterstützung. Es war ihre Christenpflicht zu helfen. Sie konnte und durfte nicht weitergehen, ohne nachzuschauen. Gott würde sie für die Sünde der unterlassenen Hilfe ewig im Fegefeuer schmoren lassen. Es reichte die Hölle auf Erden zu erleben, nach dem Tod wollte Maria mit ihren Kindern im Paradies landen. Also ging sie auf das Bündel zu. Zwei Schritte davor machte sie Halt. Die leere Milchkanne glitt ihr aus der Hand und fiel scheppernd zu Boden. Der Mann, der vor ihr lag, war ein Fremder. Sein dunkler Umhang war zur Seite geschlagen und gab den Blick frei auf eine Kleidung, für die er in Wien sofort verjagt worden wäre. Seine seidene Pluderhose passte zu seiner dunklen Hautfarbe und dem merkwürdig gestutzten Bart. Es bestand kein Zweifel, der Mann auf dem Boden war ein Osmane. Maria Dunsts Herz schlug schneller. Wie viele dieser Männer hatte sie während des Krieges gesehen? Sie hatten mit Krummsäbeln auf unschuldige Kinder eingeschlagen und ihre eigenen Söhne aufgespießt. Obwohl Maria wusste, dass sie vor diesem Türken keine Angst mehr zu haben brauchte, denn er konnte niemandem mehr Schaden zufügen, drohte ihr Herz aus ihrer Brust zu springen. Sie war wie gelähmt. Starrte in die dunkelbraunen Augen, die weit aufgerissen und von dichten, langen Wimpern umgeben waren. Die Herbstsonne spiegelte sich darin wider. Sie waren leblos in den Himmel gerichtet, so als erwartete der Türke Hilfe von dort oben. In seiner Brust steckte der Bolzen einer Armbrust. Seine Kehle war durchgeschnitten. Eine tiefe, dunkelrote Spur zog sich über den Hals. Haut und Fleisch klafften weit auseinander. Seine Arme waren unnatürlich abgewinkelt, so als hätte er bis zuletzt einen Gegenstand fest an seine Brust gedrückt.
Langsam erwachte Maria aus ihrer Starre. Sie bekreuzigte sich dreimal. Heute würde sie keine Milch holen. Zumindest nicht gleich. Jetzt musste sie zur Stadtwache, und zwar schnell. Vielleicht hatte dieser Türke bloß zur Vorhut gehört? Hatten die Osmanen einen weiteren Angriff geplant? Kam es zu einer neuen Belagerung? Marias Herz begann zu rasen. Sie ließ ihre Milchkanne achtlos am Boden liegen, raffte ihre Röcke und lief so schnell sie konnte Richtung Stadttor.
Wien, Annagasse, November 1531
Sebastian löffelte gerade seinen Frühstückshirsebrei mit getrockneten Äpfeln, als Grete einen schmutzigen Botenjungen zu ihm in die Stube führte. Der Junge stand barfuß auf dem Holzdielenboden. Seine Hose war ihm seit Monaten zu kurz und reichte nicht über seine Knöchel, sein Hemd war zerschlissen und hatte zwei unübersehbare Löcher am Ärmel. Er knetete seine Stoffmütze in beiden Händen und starrte gierig auf die frischen Semmeln, die in einem Korb ebenfalls auf dem Tisch standen.
»Der Bürgermeister Treu will, dass Ihr unverzüglich zu ihm in die Annagasse kommt«, sagte er und konnte seine Augen nicht vom Brotkorb lassen.
»Hast du schon gefrühstückt?«, fragte Sebastian.
Der Junge schüttelte den Kopf. »Dann nimm dir eine Semmel«, sagte Sebastian. »Und richte dem Bürgermeister aus, dass ich mich auf den Weg machen werde.«
Gierig wollte der Junge mit seinen schmutzigen Fingern in den Brotkorb greifen, aber Grete, die neben ihm stand, hielt ihn missbilligend davon ab. »Geh dir die Hände beim Brunnen im Hinterhof waschen, dann kriegst du auch noch einen Becher voll Milch.«
Die Augen des Jungen leuchteten vor Freude. So viel Glück hatte er selten. Eine warme Semmel und einen Becher voll Milch. Damit würde sein Magen eine ganze Weile nicht knurren. Schnell lief er durch die Hintertür, die Grete ihm wies.
»Was kann der Bürgermeister von Euch wollen?«, fragte die Haushälterin neugierig.
Sebastian zuckte mit den Schultern und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Er ist letzte Woche wieder zum Bürgermeister gewählt worden. Offenbar ist genug Gras über die Sache mit seinem Schwiegersohn gewachsen.«
»Welche Sache mit seinem Schwiegersohn?«
»Er hat vor eineinhalb Jahren seinem Schwiegersohn zu ein paar Aufträgen der Stadt verholfen, die zwar für seine Familie von Nutzen waren, die Stadt aber viel Geld gekostet haben«, erklärte Sebastian.
»Er hat Steuergeld veruntreut?«, fragte Grete entsetzt.
»Nicht mehr als alle anderen Ratsherren auch«, sagte Sebastian. »Aber auf Grund anderer Ermittlungen und eines Konflikts mit dem Stadtrichter konnte er seine Geschäfte nicht mehr verbergen. Treu hat ein Jahr pausiert und sich erst jetzt der Wiederwahl gestellt. Ich fürchte, dass viele der Männer im Rathaus sich oder nahen Verwandten zu lukrativen Verträgen verhelfen. Denk nur an deinen früheren Dienstgeber und seine Freunde.«
Entschieden schüttelte Grete den Kopf. Dieses Kapitel ihres Lebens hatte sie hinter sich gelassen. Jetzt war sie Sebastians Haushälterin und wollte nicht an den unglücklichen Ratsherrn und seine Frau erinnert werden.
Stattdessen fragte sie: »Werdet Ihr Herkules mitnehmen?«
Kaum hatte der Hund seinen Namen gehört, saß er auch schon schwanzwedelnd neben Sebastian und beobachtete ihn erwartungsvoll. Seit Margarethe ihn hier gelassen hatte, wich er Sebastian nicht von der Seite. Egal wohin er auch ging, Herkules versuchte ihm auf Schritt und Tritt zu folgen.
»Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben«, stöhnte Sebastian. Die Erleichterung in Gretes Gesicht war nicht zu übersehen.
»Gestern hat er eine Stunde lang hinter der Eingangstür gehockt, nachdem Ihr gegangen seid. Er hat so laut geheult, dass die Bäckerin Reuz vom Ende der Straße gekommen ist und nachgefragt hat, ob ich ein Tier schlachte oder irgendjemandem ein Leid zufüge. Das Vieh hat einen Narren an Euch gefressen.«
Wie zur Bestätigung legte Herkules seinen zotteligen Kopf auf Sebastians Knie. Die langen Ohren hingen rechts und links davon herab. Mit treuherzigen Augen sah er Sebastian so lange an, bis dieser sich erbarmte und seinen Kopf kraulte. Es war, als grinse der Hund zufrieden.
»Ich nehme dich mit«, sagte Sebastian. »Aber ich kann nicht versprechen, dass sie dich ins herrschaftliche Haus des Bürgermeisters reinlassen. Vielleicht musst du auf der Straße warten.«
»Redet Ihr mit Eurem Hund?« Der Botenjunge war zurückgekommen und wirkte irritiert. Seine Hände waren jetzt zwar nass, aber längst noch nicht sauber.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.