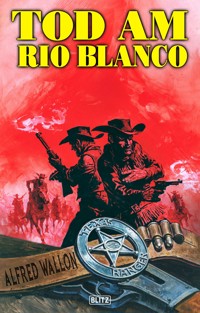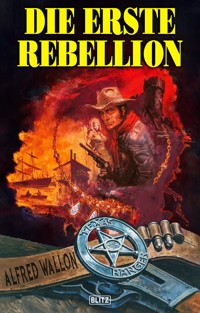Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Forts am Bozeman Trail
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dies ist das erste Buch in der Serie Die Forts am Bozeman Trail Die Nachricht von den Goldfunden in Montana hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Aus allen Himmelsrichtungen zieht es abenteuerlustige Pioniere, Goldsucher und Halunken in die Alder Gulch bei Virginia City. Der kürzeste Weg nach Montana führt von Laramie über den Bozeman Trail, mitten durch das Land der Sioux und Cheyennes am Powder River und durch die Black Hills. Die ersten blutigen Auseinandersetzungen haben bereits begonnen. Als der Oglala-Häuptling Red Cloud davon erfährt, dass die Soldaten ein Fort bauen, um die Goldsucher auf ihrem Weg nach Montana zu beschützen, eskaliert die Situation. Ein Treck, der von einer Armeepatrouille auf dem Weg nach Montana begleitet wird, gerät in einen Hinterhalt. Die Sioux und Cheyennes wollen ihr Land mit allen Mitteln gegen die weißen Eindringlinge verteidigen. Es wird Blut fließen. Die Printausgabe umfasst 228 Buchseiten Eine Exklusive Sammlerausgabe des Titels als Taschenbuch können Sie nur direkt über den Versabdshop des Blitz-Verlages beziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Forts am Bozeman Trail
In dieser Reihe bisher erschienen
3201 Alfred Wallon Blaurock-Patrouille
3202 Alfred Wallon Der Sioux-Killer
Alfred Wallon
Blaurock-Patrouille
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerIllustrationen: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-331-5Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Kapitel 1: General Connors Befehl
„... Wessen Stimme ertönte als erste im Land? Die Stimme des roten Volkes, das nichts als Bogen und Pfeile besaß. Was in meinem Land geschehen ist, habe ich nicht gewollt und habe ich nicht gewünscht. Weiße Menschen ziehen durch mein Land. Wenn der weiße Mann in mein Land kommt, lässt er eine Spur von Blut hinter sich. Es gibt zwei Gebirge in meinem Land – die Black Hills und den Big Horn Mountain. Ich will nicht, dass der Große Vater Straßen durch sie baut. Ich habe diese Dinge dreimal gesagt, und jetzt bin ich gekommen, um sie zum vierten Mal zu sagen ...“
Mahpiua Luta (Red Cloud) von den Oglala-Sioux
14. Juli 1865
Zehn Meilen nordwestlich von Fort Laramie
Buckskin-Charly Weatherford wusste, dass etwas nicht stimmte, noch bevor er die kreisenden Vögel am Himmel sah. Der einsetzende Wind hatte ihm und den beiden Pawnee-Scouts einen Geruch zugetragen, den der graubärtige Scout kannte. Es war der Geruch von kaltem Rauch – und von Tod und Verwesung!
Er zog seinen Revolver aus dem Holster. Auch die drei Pawnee hatten ihre Waffen griffbereit. Ganz langsam ritten sie weiter. Das Gelände wurde allmählich unübersichtlich. Links und rechts des schmalen Pfades erstreckten sich zerklüftete Felsen, die immer wieder von dichten Büschen und einigen Bäumen umsäumt wurden.
„Da drüben ist der Tod“, sagte einer der Pawnee, dessen Miene ungewöhnlich angespannt wirkte. „Wir werden ihm begegnen, wenn wir weiterreiten – und wir werden kämpfen müssen!“
„Wir werden gar nichts!“, brummte Buckskin-Charly. „Wir sind Scouts, die das Gelände erkunden sollen. Kämpfen werdet ihr erst, wenn ihr den Befehl dazu bekommt. Ist das klar?“
Der Pawnee erwiderte nichts daraufhin. Aber Buckskin-Charly kannte die drei Männer, die mit ihm ritten, zur Genüge. Sie waren kaum zurückzuhalten, wenn ihre Todfeinde – die Sioux-Indianer – in der Nähe waren. Umso mehr musste er jetzt aufpassen und für Disziplin sorgen!
Der Pfad machte wenige Minuten später eine Biegung. Vor Buckskin-Charlys Augen öffnete sich eine weite Lichtung, über der immer noch die Vögel kreisten. Kurz darauf begriff der Scout auch, warum das so war. Er entdeckte die Gerippe von verkohlten Planwagen und sah die aufgeblähten Kadaver von Pferden, die die Läufe in den Nachmittagshimmel streckten. Nicht weit davon entfernt lagen die nackten und grässlich zugerichteten Leichen von Männern.
„Scheiße!“, murmelte Buckskin-Charly und musste unwillkürlich schlucken, als er seinen Blick auf die blutigen und entstellten Körper der Toten richtete. Währenddessen sicherten die Pawnee-Scouts das Gelände und achteten höllisch wachsam darauf, dass ja kein Feind in der Nähe weilte. Denn wenn dem so war, dann würden sie verdammt viel Ärger bekommen!
„Sioux!“, sagte einer der Pawnee, der sich aus dem Sattel gebeugt und einen Pfeil aus dem Kadaver eines Pferdes gezogen hatte. „Oglala-Sioux!“, fuhr er fort, während es in seinen Augen wütend aufblitzte.
Buckskin-Charly erwiderte nichts darauf, sondern ließ ebenfalls seine Blicke in die Runde schweifen. Es bedurfte keiner großen Phantasie, um sich vorzustellen, was hier vor nicht allzu langer Zeit geschehen war. Diese Idioten waren wie Anfänger in eine Falle getappt – weil sie nicht auf die Warnungen von außerhalb gehört und stattdessen versucht hatten, auf eigene Faust nach Montana zu kommen. Trotz der Tatsache, dass Red Cloud und die anderen Häuptlinge dieser Region mittlerweile jeden Weißen angriffen, der es wagte, ihr Land zu durchqueren.
„Wir reiten zurück!“, entschied der Scout nach kurzem Überlegen. „Captain North muss so schnell wie möglich davon erfahren ...“
Er hatte eigentlich noch mehr sagen wollen. Aber genau in diesem Augenblick kam einer der Pawnee zurückgeritten und gestikulierte ganz aufgeregt mit der linken Hand. Hart zügelte er sein Pferd vor Buckskin-Charly und zeigte in die Richtung, aus der er gekommen war.
„Sioux!“, rief er. „Sie kommen hierher!“
Mehr brauchte er nicht zu sagen, damit Buckskin-Charly die richtige Entscheidung treffen konnte. Er winkte den anderen beiden Pawnee zu, mit ihm zu kommen. Sie hatten es jetzt eilig, die Lichtung zu verlassen und weiter oben zwischen den Felsen unterzutauchen, bevor sie gesehen werden konnten.
Die nächsten Minuten waren entscheidend. Auch wenn Buckskin-Charly wusste, was er jetzt riskierte, so hielt er dennoch an, stieg aus dem Sattel und kletterte weiter oben hinauf in die Felsen. Er wusste, dass der Captain das von ihm erwartete. Also dachte er nicht weiter daran, dass er jetzt auch sein eigenes Leben bedenkenlos aufs Spiel setzte. Stattdessen verhielt er sich ganz ruhig und beobachtete die Lichtung.
Er zuckte zusammen, als er die vielen Reiter zwischen den Bäumen und Büschen hervorkommen sah. Sie schienen das Gelände zu durchkämmen und nach Spuren zu suchen, während ein Teil der Krieger weiter ausschwärmte. Es waren verdammt viele, und Buckskin-Charly begriff, was das bedeutete.
Wieselflink kletterte er wieder hinunter zu den drei Pawnee-Scouts und schwang sich in den Sattel.
„Weg hier!“, keuchte er. „Und zwar so schnell wie möglich!“
Captain Frank North hob die rechte Hand, als er die Reiter oben auf dem Hügel bemerkte. Der Trupp von zwanzig Soldaten und zehn Pawnee-Indianern befolgte sofort diesen Befehl. Die Männer in den blauen Uniformen warteten ab, was weiter geschah.
North zog ein Fernglas aus der Satteltasche, setzte es an die Augen und spähte hindurch. Die Anspannung, die während der letzten halben Stunde von ihm Besitz ergriffen hatte, legte sich ein wenig, als er die Reiter erkannte. Es war Buckskin-Charly Weatherford, dem zwei Pawnee-Scouts folgten.
„Ist es Buckskin-Charly?“, fragte ihn Sergeant Ed Martin, der sein Pferd neben seinem Captain gezügelt hatte.
„Ja“, nickte North stirnrunzelnd, während er das Fernglas wieder herunternahm. „Er und die Pawnee scheinen es verdammt eilig zu haben. Das gefällt mir nicht. Die Männer sollen sich bereithalten, Sergeant.“
„Geht in Ordnung, Sir“, erwiderte der schottische Sergeant, drehte sich im Sattel um und rief den Soldaten zwei kurze Befehle zu. Währenddessen beobachtete North nicht nur die näherkommenden Reiter, sondern auch die Kuppen der Hügel in nächster Nähe. Nach wie vor blieb dort alles ruhig. Nichts wies darauf hin, dass Indianer in der Nähe waren. Aber warum zum Teufel hatten es Buckskin-Charly und die Pawnee-Scouts so eilig? Sie ritten ja, als wäre der Leibhaftige persönlich hinter ihnen her!
Eine gute Minute später zügelte der graubärtige Scout sein Pferd direkt vor dem Captain. In Weatherfords Augen flackerte es unruhig. North kannte ihn lange genug, um zu wissen, dass ihn etwas völlig aus der Fassung gebracht hatte.
„Sioux!“, stieß Buckskin-Charly ganz aufgeregt hervor und wischte sich dabei einige Schweißtropfen aus der Stirn. „Verdammt viele, Captain. Ich schätze, es sind mehr als hundert.“
„Wo?“, fragte North sofort, während er hinter sich einige beunruhigte Stimmen vernahm.
„Gar nicht weit von hier, Captain“, erwiderte der Scout. „Sie kontrollieren den Bozeman Trail auch an dieser Stelle. Dieser verdammte Hurensohn Red Cloud ist schlauer, als ich dachte. Er scheint zu spüren, was wir vorhaben. Und er wird unberechenbarer, weil ...“
Seine Stimme geriet für einen Augenblick ins Stocken.
„Was ist los, Mr. Weatherford?“, hakte North sofort nach, weil er natürlich spürte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war.
„Wir haben nicht nur Sioux gesehen, Captain“, sagte Buckskin-Charly und spuckte wütend aus, „sondern auch die Reste von vier verkohlten Planwagen. Und nicht nur das. Das, was von den Fahrern übrig geblieben ist, stinkt zum Himmel. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.“
„Wie viele Tote?“
„Zehn bestimmt, Captain“, fuhr der Scout fort. „Diese Idioten hätten sich besser einem größeren Treck anschließen sollen. Vermutlich hätten den die Sioux nicht so rasch überfallen. Aber nachdem ich das jetzt gesehen habe, bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, Sir – aber hier explodiert bald ein ganzes Pulverfass. Und die Lunte brennt schon ...“
„Glauben Sie, das wüsste ich nicht?“, erwiderte North mit leicht gereizter Stimme. „Aber ich glaube, das ist General Connors Entscheidung, und nicht mehr unsere.“
„Sie sollten versuchen, persönlich mit ihm darüber zu sprechen, Captain“, schlug Buckskin-Charly vor und drehte sich dabei kurz im Sattel um, als befürchte er, dass jeden Augenblick Sioux-Krieger auf einer der Hügelkuppen auftauchen würden. „Auf einen erfahrenen Mann wie Sie hört er vielleicht.“
North wollte gerade etwas darauf erwidern, unterließ es dann aber, als tatsächlich die Silhouetten von vier Reitern auf den Hügeln auftauchten. Statuen gleich zeichneten sich ihre Konturen vor der grellen Mittagssonne ab, sodass North unwillkürlich blinzeln musste, weil er genau in die Sonne schaute.
„Nicht schießen!“, hörte er Sergeant Martins raue Stimme. „Ihr Grünschnäbel schießt erst dann, wenn der Captain oder ich euch das befehlen. Ist das klar?“
„Wir ziehen uns zurück nach Fort Laramie“, entschied der Captain schließlich nach kurzem Überlegen. „General Connor soll entscheiden, was jetzt zu tun ist. Ich möchte nicht daran schuld sein, wenn es vorschnell zu einem Kampf kommt. Los, reiten wir!“
Der schottische Sergeant schnaufte, zog sich das Käppi tief in die Stirn und wendete dann sein Pferd. Er sah die Blicke der Pawnee-Scouts, die nicht verstanden, warum die Blaurock-Soldaten auf einmal den Rückzug antraten. Wäre es nach ihnen gegangen, dann wären sie hinauf zum Hügel geritten und hätten ehrenvoll gegen die Sioux gekämpft.
Aber das, was sich hier schon seit einigen Wochen zusammenbraute, hatte nichts mehr mit Ruhm und Ehre zu tun, sondern vielmehr mit dem Durchsetzen von rigorosen Expansionsplänen, die man im fernen Washington geschmiedet hatte. Es hatte damit zu tun, dass man in der Alder Gulch in der Nähe von Virginia City, Montana, Gold gefunden hatte. So viel, dass sich mittlerweile ganze Scharen von Abenteurern und Glücksrittern auf den Weg gemacht hatten, um in Montana reich zu werden. Dass sie auf dem Weg dorthin das Land der Sioux-Indianer durchqueren mussten, kümmerte sie jedoch einen feuchten Dreck!
Bis jetzt hatten Häuptlinge wie Red Cloud und Dull Knife stillgehalten und abgewartet, was weiter geschah. Aber die Zeit des Schweigens und Abwartens schien vorbei zu sein. Die Indianer hatten mittlerweile begriffen, dass die Weißen keine Rücksicht mehr darauf nahmen und auch nicht davor zurückschreckten, ihr Land zu durchqueren wie ein Heer von Heuschrecken!
Auch Captain North gab jetzt seinem Pferd die Zügel frei. Das Tier setzte sich rasch in Bewegung. Die anderen Soldaten und Pawnee-Scouts folgten unverzüglich. Währenddessen waren auf den Hügeln weitere Reiter aufgetaucht, die immer noch stumm und abwartend den Rückzug der Blaurock-Patrouille beobachteten.
„Warum greifen die nicht an, verdammt noch mal?“, fragte Sergeant Martin, der sich immer wieder im Sattel umdrehte und es nicht fassen konnte, dass sie immer noch unbehelligt blieben. Denn wenn er Buckskin-Charlys Worte richtig in Erinnerung hatte, dann waren es über einhundert Sioux-Krieger, auf die er gestoßen war.
„Weil sie genau wissen, dass sie diesen Kampf gewinnen würden, Sergeant“, erwiderte Captain North. „Sie wollen, dass wir das begreifen.“
„Verstehe einer die Roten, wer will“, brummte der schottische Sergeant. „Mir ist das zu hoch ...“
„Red Cloud ist ein schlauer Fuchs, Sergeant“, meinte North. „Er weiß genau, was er tut. Dieser überfallene Wagenzug sollte nichts anderes als eine Warnung für uns sein. Er will, dass wir erkennen, dass er niemanden mehr durch das Sioux-Land ziehen lassen wird. Und er schert sich einen Dreck um unsere blauen Uniformen.“
„Das wird General Connor höchstwahrscheinlich nicht interessieren, Captain“, fügte Martin hinzu. „Wahrscheinlich hat er schon längst seine eigenen Maßnahmen beschlossen.“
„Das denke ich auch“, sagte North. Weder er noch sein Sergeant konnten ahnen, wie konkret die Pläne des Generals bereits waren. Das würden sie sehr bald erfahren – falls es ihnen gelang, unbeschadet nach Fort Laramie zurückzukehren. Und je weiter der Captain und seine Soldaten sich von dieser Gegend entfernten, umso größer wurde die Hoffnung, dass ihnen das auch gelang. Denn keiner der Sioux-Krieger unternahm irgendetwas, um die verhassten Blaurock-Soldaten aufzuhalten!
14. Juli 1865
Fort Laramie, am späten Nachmittag
„Gentlemen, es kann und darf so nicht weitergehen“, richtete General Patrick E. Connor das Wort an die Offiziere, die sich in der Kommandantur von Fort Laramie auf seinen Befehl eingefunden hatten. „Wir müssen sehr kurzfristig einschneidende Maßnahmen beschließen – je früher, desto besser. Ihre Meinung dazu bitte!“
Er schaute in die Runde und wartete die Stellungnahmen seiner Offiziere ab. Colonel Nelson Cole war der Erste, der das Wort ergriff. Er erhob sich von seinem Stuhl, ging nach vorn zu der Karte, die an der Wand hing, und deutete auf eine bestimmte Stelle nordwestlich von Fort Laramie.
„Wir wissen alle, was geschehen ist, seit sich die Nachricht von den Goldfunden in der Alder Gulch wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Die Menschen, die in Scharen nach Montana aufbrechen, wird niemand mehr aufhalten können. Die Gier nach Gold ist stärker. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir die Sioux-Stämme mit Gewalt in ihre Schranken verweisen müssen.“
Zustimmendes Nicken machte die Runde, während General Connor lächelte. Colonel Cole hatte genau das ausgesprochen, was er selbst schon längst beschlossen hatte. Denn Connor hatte seine eigenen, sehr erfolgreichen Erfahrungen mit der Bekämpfung von aufständischen Indianern gemacht. Vor zwei Jahren hatte man ihn aus Utah in diese Region beordert und ihn damit betraut, gegen die Indianerstämme am Platte River zu kämpfen. Unmittelbar danach hatte er ein Lager der Paiute-Indianer am Bear River umzingelt und in einem kurzen, aber heftigen Kampf 278 von ihnen getötet. Seitdem priesen ihn die großen Zeitungen im Osten als „einen tapferen Verteidiger des Pioniergebietes vor dem roten Feind“.
Diesen Vorteil nutzte Connor auch weiterhin für sich aus, weil er ganz genau wusste, dass er für fast alle seine Pläne Rückendeckung aus Washington bekam.
„Man muss die Roten jagen wie Wölfe“, ergriff er nun selbst das Wort. „Und das geht nur, wenn wir sie in die Enge treiben und dann umso erbarmungsloser zuschlagen, Gentlemen. Ich werde Ihnen sagen, wie wir das erreichen können ...“
Er trat einen Schritt nach vorn und zeigte auf die Karte.
„Colonel Cole, Sie werden mit Ihrer Truppe direkt in Richtung Black Hills in Dakota ziehen. Dort warten Sie auf die Truppen von Colonel Samuel Walker,“ – sein Blick richtete sich auf den ebenfalls anwesenden Offizier – „der direkt nach Norden vorstoßen wird. Ich werde mit meinen Soldaten auf der Bozeman Road in Richtung Montana marschieren. Das Ziel ist es, bis zum kommenden Jahr weitere Forts und Außenposten entlang des Bozeman Trail zu errichten. Auf diese Weise wird es uns gelingen, diese roten Kriegerbanden unweigerlich in die Zange zu nehmen.“
„Was glauben Sie, was Red Cloud und die anderen Häuptlinge dagegen tun werden?“, erkundigte sich jetzt Colonel Walker.
„Nichts, was noch von Bedeutung ist, Colonel“, antwortete Connor. „Natürlich werden sie sehr bald erkennen, dass unsere Streitkräfte diesen wilden Heiden deutlich überlegen sind. Also werden sie versuchen, uns um Frieden zu bitten.“
„Und dann?“, fragte Colonel Cole.
„Na was wohl?“, fügte Connor mit einem süffisanten Grinsen hinzu. „Wir werden diese Friedensbitten natürlich ablehnen. Um es ganz deutlich zu formulieren: Jeder Indianer, der älter als zwölf Jahre ist, wird angegriffen und sofort getötet!“
„Sie verzeihen, Sir – ich gebe zu bedenken, dass das eine sehr direkte Maßnahme ist“, meinte Colonel Cole. „Vielleicht wäre es sinnvoll, zuvor noch einmal alle Anstrengungen zu unternehmen, um Verhandlungen mit Red Cloud und den anderen Häuptlingen in die Wege zu leiten, bevor ...“
„Ich befürchte, Sie haben den Ernst der Lage nicht ganz verstanden, Colonel!“, gab ihm General Connor in einem eindeutigen Tonfall zu verstehen. Coles Meinung wurde von ihm weder geduldet noch akzeptiert. „Ich habe Informationen erhalten, dass ein weiterer Treck von Zivilisten unterwegs nach Montana ist. Angeführt von einem Zivilisten namens James A. Sawyer. Er hat offiziell Begleitschutz angefordert für die fast achtzig Goldgräber, die mit diesem Treck Montana erreichen wollen. Natürlich habe ich dieser Bitte zugestimmt und werde auch dafür Truppen abstellen. Denn spätestens wenn dieser Treck die Grenze des Indianerlandes erreicht hat und auf der Bozeman Road seinen Weg in Richtung Montana fortsetzt, wird dort Blut fließen, und dann ...“
Eigentlich hatte er noch fortfahren wollen, hielt aber einen kurzen Augenblick inne, als er draußen vor dem Besprechungsraum plötzlich laute Stimmen vernahm. Sekunden später wurde die Tür aufgerissen, während ein Ordonnanzoffizier mit lauter Stimme protestierte.
„Captain – Sie können jetzt nicht einfach ...“
„Und ob ich das kann“, lautete die Antwort von Captain Frank North, der zusammen mit Buckskin-Charly Weatherford den Raum betrat. „Was ich General Connor zu berichten habe, duldet keinen Aufschub!“
General Connor runzelte die Stirn, als er die beiden Eindringlinge hereinkommen sah. Er kannte Captain Frank North natürlich und wusste, dass er ein guter Offizier war. Den älteren Scout musterte er dagegen abfällig. Was mehr oder weniger damit zu tun hatte, dass Buckskin-Charly schon des Öfteren negativ in Fort Laramie aufgefallen war. Weil er sich bei passenden Gelegenheiten immer ordentlich betrunken und dann eine Schlägerei mit mehreren Soldaten begonnen hatte. Die zwangsläufig dazu geführt hatten, dass man ihm meistens einige Tage Arrest aufbrummte.
„Ich bitte um Entschuldigung, dass wir Ihre Besprechung stören, Sir“, sagte North und grüßte sowohl General Connor als auch die anderen anwesenden Offiziere vorschriftsmäßig. „Aber wir möchten Ihnen etwas Wichtiges melden. Wir haben auf unserem Kontrollritt einen Wagentreck gefunden – oder besser gesagt die verkohlten Reste davon. Und ungefähr zehn Tote.“
„Wo genau war das, Captain?“, wollte der General wissen. North sagte es ihm, während die anderen Offiziere sehr besorgt dreinblickten.
„Und das ist noch nicht alles“, fuhr North fort. „Buckskin-Charly hat zum Glück noch rechtzeitig einen Kriegertrupp bemerkt ...“ Während er das sagte, schaute er den Scout an, und dieser fasste das als Zeichen auf, nun selbst das Wort zu ergreifen.
„Es waren mehr als hundert Krieger“, schilderte er das, was er gesehen hatte. „Sie hätten uns fertigmachen können, wenn sie das gewollt hätten. Aber sie haben uns nur beim Rückzug beobachtet und sonst nichts unternommen. Damit wollten sie uns zweifelsohne sagen, dass sie nach wie vor noch die Herren dieses Landes sind!“
„Ihre Einschätzung in allen Ehren, Mr. Weatherford“, meinte General Connor und strich sich kurz über das Kinn. „Aber die militärisch-taktischen Entscheidungen überlassen Sie besser uns Offizieren. Natürlich wollen die roten Teufel ihre Macht demonstrieren, und wie Sie richtig geschildert haben, ist Ihnen das ja auch gelungen. Aber sie werden auf lange Sicht gesehen gegen uns niemals gewinnen können. Die Zivilisation und die wirtschaftliche Entwicklung unseres gesamten Landes wird eine Horde von unzivilisierten Wilden niemals verhindern!“
Der Scout erwiderte nichts auf diese Bemerkung, sondern schaute stattdessen zu Captain North, als wenn er von ihm erwartete, jetzt noch einmal die Gefahr deutlich herauszustellen. Aber bevor er das tun konnte, sprach General Connor weiter.
„Sie können das nicht richtig beurteilen, weil Sie nicht wissen, welche Maßnahmen wir in der Zwischenzeit bereits getroffen haben“, sagte er im Brustton der Überzeugung. Und dann sagte er North und seinem Scout, was er wenige Minuten zuvor auch schon den übrigen Offizieren mitgeteilt hatte.
North und Buckskin-Charly hörten zu. Ihre Mienen wurden ernster, als sie begriffen, worauf das Ganze hinauslaufen sollte.
„Wie ich sehe, haben Sie den Ernst der Lage jetzt begriffen. Das ist auch gleichzeitig eine Chance für Sie und Ihre Pawnee-Scouts, Captain North“, richtete Connor nun das Wort an ihn. „Sie werden sich diesem Zivilisten-Treck anschließen und mit Ihrem Trupp dafür sorgen, dass er sicher in Montana ankommt. Sie natürlich ebenfalls, Mr. Weatherford. Gleich morgen früh werden Sie mit einer Kompanie ausrücken und dem Treck entgegenreiten. Ich verlasse mich darauf, dass Sie Ihren Job gut und effektiv machen ...“
North brauchte einige Sekunden, um zu verstehen, was das für ihn und seine Männer bedeutete. Das war das reinste Himmelfahrtskommando – und ihm blieb nichts anderes übrig, als diesen Befehl zu befolgen. Deshalb nickte er nur, grüßte vorschriftsmäßig und bestätigte vor allen anderen Offizieren, dass er den Befehl verstanden hatte und korrekt ausführen würde.
„Gott sei mit Ihnen und Ihren Männern, Captain North“, sagte General Connor. „Sie und Ihre Truppe sind ein wichtiger Bestandteil der ganzen militärischen Kampagne.“
Mit diesen Worten waren North und Buckskin-Charly entlassen. Sie verließen den Besprechungsraum und schauten sich dann gegenseitig auf eine Art und Weise an, die verdeutlichte, dass jeder die Gedanken des anderen ahnte und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zog. Buckskin-Charly brachte es in seiner unnachahmlichen Art auf den Punkt.
„Gütiger Himmel, Captain!“, entfuhr es ihm. „Der Tod wird schon darauf warten, wer von uns als Erster zur Hölle fährt ...“
Kapitel 2: Die Glücksritter
2. August 1865
Im Lager der Montana-Goldsucher
„Gott bittet euch noch um ein wenig Geduld!“, rief Reverend Abel Ferris, während er beide Hände in Richtung Himmel erhob, auf dem Bock eines Pritschenwagens stand und sein Wort an die umstehenden Goldsucher und Abenteurer richtete. „Die militärische Verstärkung für unseren Treck wird bald eintreffen.“
„Das sagen Sie uns nun schon seit einer guten Woche, Reverend!“, meinte Seamus Donegan, trat einen Schritt nach vorn und kratzte sich dabei an seinem roten Vollbart. „Glauben Sie nicht, dass der Herrgott unsere Geduld mittlerweile reichlich strapaziert hat? Irgendwann muss einmal Schluss sein ...“
Bei den letzten Worten blickte der Ire Beifall heischend in die Runde und erkannte an den Blicken der meisten anderen Männer, dass er genau das ausgesprochen hatte, was die anderen insgeheim dachten.
„Die Wege des Herrn sind unergründlich, mein Sohn“, meinte der Reverend mit beschwichtigender Stimme. „Wir müssen einfach noch ein wenig warten ...“
„Das können Sie ja tun, wenn Ihnen danach ist, Reverend!“, fiel ihm Donegan ins Wort. „Ich für meinen Teil werde morgen früh in Richtung Montana aufbrechen – und wer sich mir anschließen will, der ist dazu herzlich eingeladen!“
Zustimmendes Gemurmel erklang in der Runde. Reverend Ferris blickte betreten zu Boden. Er konnte die Menschen gut verstehen, die hier schon seit Tagen ausharrten und darauf warteten, dass es endlich losging. Aber James A. Sawyer und ein paar andere besonnene Männer hatten dazu geraten, lieber zu warten, bis weitere Soldaten im Lager eintrafen und den Schutz des Trecks dadurch verstärkten.
Das lag wohl unter anderem auch daran, dass die Soldaten, die sich bisher dem Treck angeschlossen hatten, von den meisten Goldsuchern abgelehnt wurden. Ein gewisser Lieutenant Philip Walsh kommandierte diese Soldaten, deren Uniformen ziemlich verschlissen und teilweise auch dreckig wirkten. Was unter anderem damit zu tun hatte, dass diese Soldaten sogenannte Galvanized Yankees waren – ehemalige Soldaten der Konföderation, die nach Lees Kapitulation bei Appomattox einen Eid auf die Union geschworen hatten und seitdem blaue Uniformen trugen.
Auch wenn schon einige Monate verstrichen waren, seitdem der blutige Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd endlich vorbei war, so herrschten noch immer tiefes Misstrauen und teilweise unterschwelliger Hass auf beiden Seiten. Wer auch immer entschieden hatte, dass ausgerechnet diese ehemaligen Rebellen die Goldsucher beschützen sollten – es schien keine gute Idee gewesen zu sein.
„Donegan – du kannst ja gehen, wenn du willst!“, griff nun James A. Sawyer ein und schaute den Iren streng an. „Niemand hindert dich, es auf eigene Faust zu versuchen. Aber du hast hier nicht zu entscheiden, falls du das vergessen haben solltest. Jetzt erinnere ich dich noch einmal daran. Was ist jetzt?“
Noch immer hatte Sawyers Wort ein ziemliches Gewicht unter den Männern. Bisher waren seine Entscheidungen immer richtig gewesen – wenn jetzt nur nicht dieses permanente Warten die allgemeine Stimmung auf den Nullpunkt getrieben hätte! Und Männer wie Donegan versuchten, daraus Kapital zu schlagen.
Der Ire musste auf einmal erkennen, dass er allein auf weiter Flur stand. Selbst diejenigen, die seinem Vorschlag bereits zugestimmt hatten, schienen es sich wieder anders überlegt zu haben. Deshalb fluchte er, spuckte aus und bahnte sich seinen Weg durch die Umstehenden. Das reichte aus, damit wieder Ruhe einkehrte.
„Dieser verdammte Querulant!“, knurrte Sawyer. „Irgendwann muss ich ihn einmal ganz deutlich in seine Schranken verweisen – und ich befürchte, dass Worte dann nicht mehr ausreichen, Reverend!“
„Wer sich in Gewalt begibt, kommt darin um, Mister Sawyer“, meinte der Reverend mit strengem Blick. Und mit etwas leiserer Stimme – sodass es nur noch Sawyer hören konnte, fügte er hinzu: „Aber verabreichen Sie ihm ruhig eine ordentliche Tracht Prügel, wenn es hilft ...“
„Ich bin erstaunt, Reverend“, schmunzelte Sawyer. „An solche Worte muss ich mich erst noch gewöhnen. Erst recht, wenn sie von einem Gottesmann kommen.“
„Hier draußen in der Wildnis muss man manchmal pragmatisch entscheiden, Mister Sawyer“, fügte Reverend Ferris hinzu. „Ich kann nur hoffen, dass sich dieser Hitzkopf so rasch wie möglich wieder beruhigt.“
„Das würde ich ihm auch dringend raten“, sagte Sawyer und schlug dabei mit seiner geballten rechten Faust in die offene linke Hand. Diese Geste sagte mehr aus als viele unnötige Worte.
Reverend Ferris wollte gerade noch etwas hinzufügen. Aber er kam nicht mehr dazu, weil plötzlich jemand etwas rief.
„Soldaten – da kommen Soldaten! Seht doch!“
Jetzt entstand wieder Unruhe unter den Goldsuchern. Alle blickten in die Richtung, die der Mann angedeutet hatte. Jetzt erkannten es Reverend Ferris und Sawyer ebenfalls. Ein Reitertrupp näherte sich dem Lagerplatz.
„Meine Gebete wurden erhört“, sagte der Gottesmann mit gefalteten Händen und blickte lächelnd hinauf zum Himmel.
Sawyer registrierte das nur am Rande. Er stieg hastig vom Wagen und eilte an die Spitze der Männer bei den Wagen. Lieutenant Walsh und seine zehn Soldaten kamen ebenfalls herbei, hielten aber immer noch etwas Abstand zu den Goldsuchern. Sie waren nicht willkommen, und das spürten sie!
Captain Frank North blickte mit gemischten Gefühlen in Richtung der Männer, die die Ankunft der Soldaten und der Pawnee-Scouts natürlich schon bemerkt hatten. Er sah die misstrauischen Blicke, die den Indianern galten, und wusste deshalb sofort, dass es kein leichter Job sein würde, den er und seine Männer auszuführen hatten.
Nach so einem langen und harten Ritt lagen die Nerven blank bei den meisten Männern. Streitigkeiten oder irgendwelche unterschwelligen Aggressionen mussten auf alle Fälle verhindert werden.
„Sehen Sie die anderen Soldaten, Captain?“, riss ihn die Stimme von Buckskin-Charly Weatherford aus seinen vielschichtigen Gedanken, während er neben North ritt. „Ich würde wetten, dass die noch nicht lange in blauen Uniformen stecken. Da wartet noch eine weitere Herausforderung auf uns, mit der wir nicht gerechnet haben.“
„Wie kommen Sie denn darauf?“, fragte North.
„Nennen Sie es Lebenserfahrung, Captain“, entgegnete der graubärtige Scout. „Aber ich würde verdammt noch mal einen ganzen Monatslohn darauf wetten, dass diese Männer vor nicht allzu langer Zeit noch eine graue Uniform getragen haben. Sehen Sie den jungen Lieutenant da drüben? Sieht der Ihrer Meinung nach so aus, als wenn er Erfahrung mit dem Kämpfen hätte? Ich möchte fast wetten, dass man den direkt von West Point hierher geschickt hat, damit er was lernen kann. Und wir alle müssen es dann womöglich noch ausbaden ...“
„Nun malen Sie den Teufel nicht an die Wand“, winkte North ab. „Vielleicht ist das ja alles halb so schlimm ...“
Der Scout erwiderte nichts darauf. Aber sein Blick war eindeutig. Währenddessen näherten sich einige Männer des Goldsuchertrecks den Soldaten. Einer von ihnen – offensichtlich ihr Anführer – hob die rechte Hand zum Gruß.
„Wir haben schon seit Tagen auf Sie gewartet!“, sagte er. „Mein Name ist James A. Sawyer. Ich bin der Anführer dieses Trecks, und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit Ihnen und diesen Rebellen dort hinten Montana erreichen werden.“
„Captain Frank North“, stellte er sich jetzt vor und bemerkte dabei das Grinsen des Scouts. So als wollte er sagen: Ich hab’s doch gleich gewusst ... „Wir kommen aus Fort Laramie und haben von General Connor die Order bekommen, für Ihren Schutz zu sorgen. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Wir hatten unterwegs einige Verzögerungen, weil wir immer wieder den Sioux ausweichen mussten. Wenn sie uns jetzt schon entdeckt hätten, wäre das nicht gut gewesen.“
„Aber das werden sie vermutlich noch frühzeitig genug“, meinte Sawyer. „Und wenn das der Fall ist, dann werden wir uns zu wehren wissen, Captain. Meine Leute und ich lassen uns von nichts und niemandem daran hindern, Montana zu erreichen. Irgendjemand müsste diesen Rothäuten vielleicht mal klarmachen, dass wir im Grunde genommen gar nichts von ihnen wollen. Wenn sie sich friedlich verhalten, dann tun wir das auch. Und falls nicht, dann ...“
Er sprach diesen Satz nicht zu Ende. Aber Captain North hatte auch so begriffen, was Sawyer ihm damit andeuten wollte. Er nickte nur und stieg aus dem Sattel, während Sergeant Martin den übrigen Männern und den Scouts befahl, das Gleiche zu tun. Natürlich bemerkte er sofort die ablehnenden und teilweise bösen Blicke der Männer, die den Pawnee-Scouts galten.
„Damit wir uns gleich von Anfang an richtig verstehen, Mr. Sawyer“, sagte er. „Diese Pawnee sind gute und zuverlässige Scouts. Sie würden die Sioux sofort bemerken, wenn sie in der Nähe wären. Es sind ihre Todfeinde – und das bedeutet nichts anderes, als dass sie nur darauf warten, gegen sie zu kämpfen, wenn es erforderlich sein sollte.“
„Das ist gut“, meinte Sawyer und schaute zu den anderen Männern. „Also – ihr habt es gehört. Beruhigt euch und gebt euch mit dem zufrieden, was ihr gerade gehört habt. Captain, wir sind erleichtert, dass wir jetzt zusätzlichen Schutz bekommen haben. Gemeinsam werden wir das schon schaffen.“
„... und falls es Probleme gibt, dann gibt es eine Sprache, die diese roten Bastarde ganz sicher verstehen werden!“, meldete sich ein gedrungener, rotbärtiger Mann zu Wort, der seinen Revolver aus dem Holster zog und damit noch einmal untermalte, was er damit vorhatte. Er lachte bei diesen Worten.