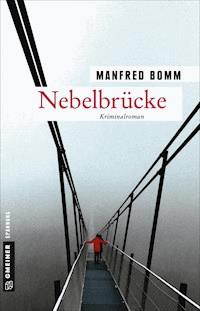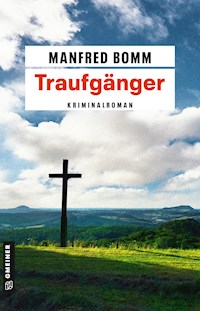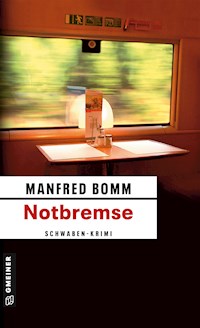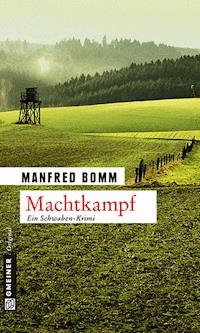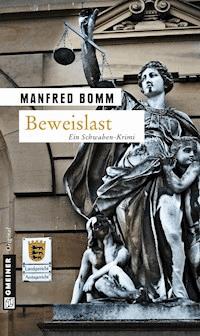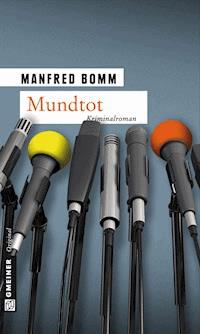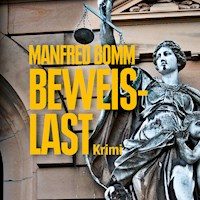Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Just an dem Tag, als er in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird, holt die Vergangenheit Kommissar August Häberle auf dramatische Weise ein. Er erhält einen anonymen Hinweis, der sich auf einen alten Fall bezieht. Denn 1982 war Häberle mit dem bis dahin größten Kidnapping-Fall Deutschlands konfrontiert gewesen, als drei höflich auftretende Gangster die Tochter des Göppinger Sparkassendirektors als Geisel nahmen. Ins Visier der Ermittler gerieten damals angesehene Bürger. Gerüchte machen die Runde - vor allem, weil sich in dieser Stadt mysteriöse Todesfälle häufen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Die Gentlemen-Gangster
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © piotrszczepanek / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6728-8
Gewidmet allen,
die eine Geschichte wie diese nicht aus der Distanz eines Unbeteiligten lesen, sondern selbst einmal von den bösen Schatten eines Verbrechens betroffen waren – was umso schwerer wiegt, wenn sich die Logik der Ermittlungen plötzlich gegen einen selbst richtet.
Denn wenn das scheinbar Naheliegendste zur Wahrheit erhoben wird, bleibt für das Unwahrscheinliche kein Raum mehr. Das Nachvollziehbare, wie es der Lebenserfahrung entspricht, lässt nämlich keine Zufälle gelten und verleitet dazu, leichte Wege zu gehen. Dann wird eine Verkettung unglücklicher Umstände oft als unwahrscheinlich empfunden, obwohl jedes Unglück kein solches wäre, wenn sich nicht schicksalhafte Ereignisse gekreuzt hätten.
Denken wir an all jene, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren, die in den Strudel von Gerüchten und Verschwörungstheorien gelangt sind – und ein Leben lang diese Last tragen müssen, sofern sich niemand die Mühe macht, das oftmals Undurchschaubare zu entwirren und die einfachen Wege zu verlassen.
Denken wir also an all jene, die vieles von dem, was in diesem Roman erzählt wird, selbst ertragen mussten: Todesängste in langen Nächten, schreckliche Ungewissheit in der Gewalt von Kidnappern – und dann noch die unterschwelligen Verdächtigung, womöglich selbst Rädelsführer gewesen zu sein.
Dies alles sind üblicherweise Geschichten, aus denen Thriller gemacht sind.
Im vorliegenden Fall sollten wir aber auch – und gerade – an die Opfer denken.
Ein Kriminalroman soll Spannung und Unterhaltung sein, uns aber gleichzeitig vor Augen führen, was wir niemals selbst erleben möchten.
Was man wissen muss
Dass Personen und Geschichte frei erfunden seien, trifft im vorliegenden Fall nur bedingt zu. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Zugrunde liegt nämlich einer der bis dahin größten Raubüberfälle auf ein Geldinstitut in der Bundesrepublik Deutschland. Geschehen im März 1982. Geändert wurden jedoch einige Namen und teilweise die Funktionen der geschilderten Personen. Somit wären Ähnlichkeiten mit den tatsächlich Beteiligten, deren Charakteren und Tätigkeiten rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Als die Kreissparkasse mit der Idee an mich herantrat, diesen spektakulären Fall anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens im Jahre 2021 als Grundlage für einen Kriminalroman zu nehmen, habe ich mich in meinem privaten Archiv noch einmal intensiv mit diesem Verbrechen befasst, über das ich damals als junger Journalist der Neuen Württembergischen Zeitung in Göppingen tage-, ja sogar wochenlang berichtete.
Glücklicherweise hatte ich unzählige Schriftstücke, Dokumente und Zeitungsartikel aufgehoben, sodass es mir nun möglich war, den Fall möglichst genau zu rekonstruieren – auch dank einiger Zeitzeugen, die sich bereit erklärt haben, mit mir über diese vermutlich schrecklichsten Stunden ihres Lebens zu reden.
Viele hatten sich damals auch im Mittelpunkt von Gerüchten und sogar falschen Verdächtigungen gesehen, weil angesichts des geradezu unglaublichen Vorgehens der Gangster zahlreiche Verschwörungstheorien die Runde machten, die sich jedoch nach intensiver Recherche allesamt als völlig aus der Luft gegriffen erwiesen. Vieles, was die Betroffenen erdulden mussten, war nie in der Zeitung zu lesen gewesen.
Nicht auszudenken, welchen Schmähungen und Unterstellungen sie heute im Zeitalter der sogenannten Sozialen Medien ausgesetzt wären, in denen jeder alles ungeprüft behaupten kann. 1982 waren veröffentlichte Informationen noch verantwortungsvoll recherchiert und nicht von gehetzten Journalisten oder Laien überhastet in die Welt gesetzt worden.
Ein Jurist sprach später von einem »einmaligen Fall«, von den »erfolgreichsten Gangstern Deutschlands«, die »wie Gentlemen« gehandelt hätten. Männer mit zwei Gesichtern: zum einen »biedere Bürger«, zum anderen aber »knallharte Täter mit wahrhaft kriegerischer Bewaffnung.« Fast ein Vierteljahrhundert lang konnten sie unerkannt ihre Raubzüge unternehmen und jedes Mal wie vom Erdboden verschwinden.
Ich habe mithilfe einiger fiktiven Handlungsstränge versucht, all das Merkwürdige und Ungewöhnliche aufzugreifen, das damals in und um diese Stadt Göppingen für Gesprächsstoff gesorgt, jedoch nie Eingang in die offizielle Berichterstattung gefunden hat. In Göppingen, das Garnisonsstadt der Ersten US-Infanteriedivision Forward gewesen war, die von hier aus engen Kontakt zum weithin bekannten Atomraketenstandort Mutlangen (bei Schwäbisch Gmünd) hatte, dürften auch international tätige Spione und clevere Geschäftemacher zwischen Ost und West ihr Unwesen getrieben haben. Einige (echte) Spuren führen deshalb in meiner Geschichte nach Sankt Petersburg (das damals noch Leningrad hieß) und in die Slowakei.
Der damals noch junge Kommissar August Häberle (für den es ein echtes Vorbild gab) wurde irgendwann in diese Gerüchteküche involviert und kam ein Berufsleben lang nicht mehr davon los. Vieles, was dann in der »Neuzeit« geschah, ist meiner Fantasie entsprungen. Häberle wurde just am Tag, als er in seinen Ruhestand verabschiedet wurde (siehe Roman »Schlusswort«), auf dramatische Weise von der Vergangenheit eingeholt.
1
Ein Sonntagabend Anfang März 1982
Martin Seifritz war leicht gereizt, als es an der Haustür klingelte. Der 48-Jährige erwartete weder Besuch noch wäre er an diesem Sonntagabend darauf eingestellt gewesen. Aber vermutlich war es wieder mal Manuela, seine ältere Tochter, die sich erst vor einer halben Stunde mit ihrem Freund verabschiedet hatte, um Richtung Tübingen zu fahren, wo sie Jura studierte. Oft genug schon hatte sie etwas vergessen.
Seifritz, angesehener Chef der Kreissparkasse Göppingen und seit zwei Jahren verwitwet, wollte das Wochenende vor dem Fernseher ausklingen lassen. Während die jüngere Tochter Marion im Obergeschoss Musik hörte, hatte er es sich gerade im Wohnzimmer beim Fernsehfilm Der Hauptmann von Köpenick gemütlich gemacht, den das ZDF anlässlich des 80. Geburtstags des Hauptdarstellers Heinz Rühmann zeigte.
Deshalb nervte das Klingeln an der Haustür. Seifritz sah auf die Uhr, erhob sich und drückte missmutig auf den Türöffner, fest davon überzeugt, dass gleich eine atemlose Manuela hereinstürmen würde, weil sie möglicherweise etwas vergessen hatte.
Doch Augenblicke später war alles anders: Im fahlen Licht der Diele tauchten zwei Gestalten auf und ließen hinter sich die Haustür zufallen. Einer war wie ein Polizist gekleidet, der andere zivil. Beide vollbärtig, die Augen mit großen Sonnenbrillen verdeckt, lange Haare. Seifritz stockte der Atem, ein nie gekannter Schock übermannte ihn. Erster reflexartiger Gedanke beim Anblick der grünen Polizeiuniform: War Manuela, der 21-jährigen Tochter, etwas zugestoßen? Ein Unfall?
Seine Augen hingen für eine Sekunde an dem Uniformierten, der doch zweifelsohne ein Polizist sein musste. Mit Mütze und dem baden-württembergischen Landeswappen am Ärmel des Anoraks. Gleich würde dieser Beamte eine schlimme Nachricht überbringen. Aber die große Sonnenbrille und möglicherweise eine Perücke mochten nicht zu einem seriösen Polizisten passen. Schon gar nicht jetzt, an diesem dunklen Märzabend.
Und auch der andere Mann, der zivil mit einem Trenchcoat bekleidet war, als sei er ein Kriminalist, trug ebenfalls eine große Sonnenbrille und wirkte genauso wenig vertrauenserweckend.
Seifritz stand wie gelähmt, spürte den Schreck in allen Gliedern – als sei sämtliches Blut in ihm gefroren. Denn augenblicklich erkannte er, was der Uniformierte versteckt gehalten hatte und nun auf ihn richtete: den Lauf einer Maschinenpistole. Die Hände in Handschuhen. Nein, das war kein Polizist.
Der andere hatte seine Hände tief in den Taschen vergraben. Ausgebeulter Stoff ließ eine verborgene Waffe befürchten.
Seifritz war sich schlagartig der Situation bewusst. Überrumpelt in der Wohnung. Keine Aussicht auf Hilfe. Überfallen und eingesperrt im eigenen Haus.
Im Berufsleben war er es als Bankchef und früher auch als Erster Staatsanwalt gewohnt, rational zu denken und entsprechend zu handeln. Jetzt verspürte er Ohnmacht, Panik und Angst. Gedemütigt und in grenzenloser Sorge um Marion, die sich im Obergeschoss aufhielt. Dazu die schreckliche Ungewissheit, was sie mit seiner anderen Tochter gemacht hatten, mit Manuela und deren Freund. Unterwegs auf der Fahrt nach Tübingen abgefangen?
»Wo ist die Frau?«, fragte der Uniformierte völlig unaufgeregt, als sei er sich ganz sicher, dass eine Ehefrau da sein müsste. Noch bevor Seifritz etwas erwidern konnte, traf ihn die Stimme des anderen Mannes ins Innerste: »Seien Sie still, sonst gibt es ein Blutbad.«
Seifritz stand wie erstarrt. »Blutbad«, hallte es in seinem Kopf nach.
»Wo ist die Frau?«, wiederholte der Uniformierte weiterhin ungewöhnlich ruhig.
Seifritz erwiderte mit zitternden Lippen: »Nur meine Tochter ist oben.«
Der Uniformierte fuchtelte mit der Maschinenpistole und bugsierte mit seinem Komplizen Seifritz ins Obergeschoss, wo Marion, die Musik gehört hatte, beim Auftauchen der Männer keinen Laut herausbrachte.
»Ihnen geschieht nichts, wenn Sie tun, was wir sagen«, versuchte der Uniformierte, die spannungsgeladene Atmosphäre mit leiser Stimme zu entschärfen.
»Was wollen Sie?«, wagte Seifritz einen ersten energischen Vorstoß.
Doch statt einer Antwort folgte die unmissverständliche Anweisung, dass Vater und Tochter getrennt würden: Er sollte sich im ehelichen Schlafzimmer aufs Bett legen, Marion in ihrem Zimmer.
Seifritz fühlte panische Angst: Überfall, Mord? Widerstand erschien sinnlos. Allein schon, wie der Uniformierte mit der Maschinenpistole hantierte, ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass die beiden nicht mit sich verhandeln ließen. Seifritz flehte die Gangster an, ihn nicht von der Tochter zu trennen. Die Täter ließen sich erweichen: Marion durfte sich neben ihren Vater auf das Ehebett legen. Dort mussten sie jeweils eines ihrer Handgelenke an das des anderen fesseln lassen – mit einer metallischen Handschließe. Jetzt war jeglicher Fluchtversuch vollends unmöglich.
Seifritz, den der rasende Puls atemlos gemacht hatte, riskierte noch einmal die Frage: »Was wollen Sie denn?«
»Fünf Millionen«, gab einer der Räuber zu verstehen und setzte sich seelenruhig neben dem Bett auf einen Stuhl.
Der Bankchef versuchte, wieder langsamer zu atmen, sachlich zu bleiben. »Wo wollen Sie die herkriegen?«
Antwort: »Das ist Ihr Problem. Sie sind doch der Bankdirektor.«
Am nächsten Morgen, noch vor Geschäftsbeginn, sollte das Geld beschafft werden. Doch bis dahin lagen acht qualvolle Stunden vor ihnen.
2
Es wurde die schlimmste Nacht seines Lebens. Und auch Marion würde diese quälende Ungewissheit nie mehr vergessen. Mit einer Hand aneinander gekettet, so lagen Vater und Tochter, den Gangstern hilflos ausgeliefert, auf dem Bett. Voll innerer Unruhe, Angst und Panik. Die Räuber, die sich einen weiteren Stuhl ins Schlafzimmer geholt hatten, stellten immer und immer wieder dieselben Fragen nach den Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstelle der Kreissparkasse, nach Personen und den Örtlichkeiten. Seifritz konzentrierte sich auf die Gespräche und Formulierungen – genau so, wie er es einst als Staatsanwalt gelernt hatte. Als studierter Jurist versuchte er, sich so viel wie möglich von ihnen einzuprägen. Dass sie zwischen 30 und 40 Jahre alt und offenbar Deutsche waren; der Uniformierte ließ einen schwäbischen, der andere einen badischen Akzent anklingen. Sie pflegten einen gewissen seriösen Umgangston, blieben immer beim höflichen »Sie« und wirkten ziemlich gelassen und selbstsicher. Wie Profis, die so etwas schon öfters getan hatten. Die Vollbärte waren vermutlich angeklebt, die Frisuren wohl Perücken. Und die Sonnenbrillen, die sie weiterhin trugen, verbargen die Augenpartien.
Während der Gespräche, bei denen die Männer sachkundige Fragen stellten, erhärtete sich Seifritz’ Verdacht, einer von ihnen könnte sehr gute Kenntnisse über die Abläufe in einer Bank haben. Sei es aus eigener Anschauung oder indem er sich vieles davon hatte erklären lassen. Von wem auch immer. Oder war er gar ein Insider? Ein ehemaliger Mitarbeiter? Sie schienen bestens vorbereitet zu ein.
Jedenfalls hatten beide Gangster einen klar definierten Plan, dessen Realisierung sie zielstrebig verfolgten. Sie wollten mit Seifritz am Montagmorgen kurz vor Geschäftsbeginn in das hoch aufragende Bankgebäude am Göppinger Bahnhof gehen und sich die geforderten Millionen aushändigen lassen. Es schien so, als seien sie sich ihres Vorgehens absolut sicher. Auch wenn ein so hoher Betrag gar nicht im Tresor lagerte.
Vollmundig erklärten sie, im Auftrag »einer Organisation« zu handeln und von dieser auch unterstützt zu werden. Der Uniformierte ergänzte gelassen: »Nach Geschäftsbeginn werden im Schalterraum Personen mit Handtaschen sein, in denen Bomben und Granaten versteckt sind.« Beobachter würden sich zudem im gegenüberliegenden Bahnhof positionieren.
Seifritz plagte nur ein einziger Gedanke: ob es eine Chance gab, mit der Tochter zu fliehen. Doch die Handschließe saß fest, die Rollos an dem am Stadtrand gelegenen Haus waren alle geschlossen – und außerdem hatten die Räuber vorsorglich die Sprechmuschel aus dem Telefon geschraubt. Nichts, was sie taten, wirkte nervös oder fahrig. Es mussten wirklich echte Profis sein, dachte Seifritz.
Irgendwann löschten die kaltblütigen Räuber das Licht, verharrten aber auf ihren Stühlen, um ihre Geiseln in der Gewalt zu haben. Einer der Männer gab sich geradezu fürsorglich: »Ich empfehle Ihnen zu schlafen, denn Sie werden morgen gute Nerven brauchen.«
3
4 Uhr. Erst in drei Stunden würde die Sonne aufgehen. Noch war es stockfinstere Nacht. Seifritz und seine Tochter hatten keine Sekunde schlafen können, lagen schweigend beieinander und lauschten bange und aufgewühlt in die Finsternis. Denn nachdem die Räuber ihre bohrenden Fragen beendet und das Licht gelöscht hatten, war nur noch deren bisweilen schwerer Atem zu hören gewesen. Seifritz hatte einige Male überlegt, ob die Männer eingeschlafen waren. Doch an eine Flucht wäre selbst dann nicht zu denken gewesen. Immerhin waren die beiden schwer bewaffnet und er an seine Tochter gekettet. Schon beim geringsten Versuch, aus dem Bett zu steigen, wären die Gangster wach geworden – sofern sie überhaupt schliefen.
Seifritz kämpfte unablässig mit einem wilden Gedankenkarussell und versuchte vergeblich, das Schreckliche zu verdrängen, das mit seiner anderen Tochter geschehen sein konnte. War sie auf der Fahrt mit ihrem Freund nach Tübingen ebenfalls in die Hände von Kidnappern geraten? Er wollte die beiden Gangster lieber gar nicht danach fragen. Wieder quälten ihn auch in diesen Stunden die schmerzhaften Erinnerungen an seine Frau, die vor zwei Jahren freiwillig aus dem Leben geschieden war; ein Schicksalsschlag, den er nie würde verdrängen oder überwinden können.
Als plötzlich das Licht angeknipst wurde, fühlte er so etwas wie Erleichterung, obwohl das Schlimmste noch bevorstand. Der Uniformierte, der sich als Wortführer hervortat, gab das Kommando. Er werde jetzt Marion in ein sicheres Versteck bringen, wo ihr nichts geschehe, wenn ihr Vater die geforderten Millionen besorge, erklärte er so emotionslos, als rede er von einem ganz normalen Vorgang.
Marions Herz raste. Sie hatte unbändige Angst. Seifritz’ flehende Bitte, seine Tochter freizulassen, war nicht mehr als der vergebliche Versuch eines verzweifelten Vaters, die Gangster umzustimmen. Erneut spürte er, dass sie sich von ihrem Plan nicht würden abhalten lassen. Komme da, was da wolle. Als die Fesseln von den schmerzenden Handgelenken gelöst waren, umarmte Marion ihren Vater und weinte.
»Es passiert nichts, wenn wir das Geld kriegen«, stellte der falsche Polizist klar und forderte die junge Frau auf, Schlafsack, Wolldecke, Handschuhe und Wollmütze zusammenzupacken.
Seifritz war für einen weiteren Moment erneut geschockt, weil er angesichts der geforderten Utensilien befürchtete, sie würden Marion mehrere Tage in ihrer Gewalt behalten: »Wie lange soll das denn gehen?«
»Bis wir das Geld haben«, keifte der mit dem Trenchcoat, während der falsche Polizist sie unsanft die Treppe hinab in die Diele zerrte. Dort öffnete er vorsichtig die Haustür, vergewisserte sich, dass niemand auf der nur spärlich beleuchteten Wohnstraße unterwegs war, und deutete zu einem Verbindungsweg hinüber, der in der Stille des kalten Wintermorgens lag. Marion überlegte, ob sie um Hilfe rufen sollte, aber der Gedanke an ihren Vater, der sich in der Gewalt des anderen Gangsters befand, hielt sie davon ab. Der harte Griff, mit dem sie der Mann am Oberarm vorwärtszerrte, während sie Decke und Schlafsack festhielt, ließ jeden Fluchtgedanken im Keim ersticken.
Eine halbe Minute später hatten sie über den verwilderten Fußweg die nächste Wohnstraße erreicht, die hier mit einer Wendeplatte endete. Am Fahrbahnrand standen mehrere Fahrzeuge, auf die ihr Entführer zuhielt. Marion vermutete, dass sein Ziel eine helle Limousine war, vermutlich ein Audi. Beim Näherkommen glaubte sie, ein WN-Kennzeichen für Waiblingen erkannt zu haben. Aber viel zu schnell hatte sie der Mann zur linken hinteren Tür bugsiert, diese geöffnet und nun charmant flüsternd gesagt: »Bitte einsteigen.« Marion tat wortlos, was ihr befohlen wurde. Sie musste sich auf den Rücksitz legen, sich vollständig in die Decke einhüllen und die Wollmütze tief ins Gesicht und somit über die Augen ziehen. Sie sollte nicht sehen, wohin die nächtliche Fahrt ging.
Der Gangster setzte sich hinters Steuer, ließ die Tür sanft zufallen und fuhr zügig los. Marion wagte nicht, den Kopf zu heben. In der Dunkelheit hätte sie aus ihrer liegenden Position heraus auch nichts von der Landschaft erkennen können. Stattdessen versuchte sie, sich anhand der Kurven und Abbiegevorgänge die ungefähre Route vorzustellen. Ihrem Gefühl nach zu urteilen, waren sie vom Göppinger Stadtrand gleich in die Vororte gefahren, Richtung Bartenbach und hinüber nach Rechberghausen. Vermutlich ging es zu den Anhöhen des Schurwaldes hinauf und dann hinüber ins Remstal. Jedenfalls zunächst bergauf.
Sie hätte nicht sagen können, wie viel Zeit schon verstrichen war, als der Wagen deutlich spürbar von der Hauptverkehrsstraße abbog und offenbar auf kleineren, holprigen Wegen weiterfuhr. Wenig später schienen sie ihr Ziel erreicht zu haben. Der Wagen stoppte.
Noch immer war es Nacht, und hier, wo sie sich nun befanden, gab es auch keine Straßenlampen. »Endstation«, knurrte der Mann, stieg aus und öffnete die linke Tür des Fonds. Marion streifte sich die Wollmütze vom Kopf und warf die Decke beiseite. Ihre Beine waren eingeschlafen, und sie tat sich mit dem Aussteigen schwer. Weil sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie die nachtschwarzen Umrisse von Sträuchern und Weidezäunen erkennen. Sie befanden sich eindeutig weit außerhalb einer Ortschaft. Am Horizont war nur schwaches Streulicht einer möglicherweise nahen Stadt auszumachen.
Der Mann packte sie am Oberarm und zerrte sie ein paar Schritte vom Auto weg in Richtung auf ein kleines Gebäude, das sich vor dem nahen finsteren Waldrand abzeichnete, der den ansteigenden Wiesenhang begrenzte. Im Dunkeln war eine heraneilende menschliche Gestalt zu sehen – ein Mann, wie sich sofort herausstellte. Der nahm sie unsanft in Empfang und zog sie an den gefesselten Armen wortlos über den Steilhang zu der kleinen Behausung hinauf, vermutlich einer Hütte. Sein Komplize stieg wieder in das Auto, und die Rücklichter verschwanden in der Nacht.
Marion schwieg und ließ sich im Schein einer schwachen Taschenlampe widerstandslos in das kalte und dunkle Versteck bringen, das nach altem Heu, Moder und Spiritus roch. Dort loderte die Flamme einer altertümlich anmutenden Sturmlaterne, sodass sie jetzt auch den Kopf des Mannes sehen konnte. Allein dieser Anblick war furchterregend. Denn der Mann, der kein Wort sprach, hatte sich einen Damenstrumpf übers Gesicht gezogen. Wie in einem Horrorfilm. Doch dies hier war bittere Realität.
Der Raum erinnerte im flackernden Licht der Flamme an ein verlassenes Wochenendhäuschen: Tisch und Stühle wie aus dem Sperrmüll, abseits davon eine längliche Sitzbank mit Polster. Der Maskierte zerrte Marion auf diese Bank, auf der sie sich zusammenkauerte, während ihre Fußgelenke mit einem Paketklebeband gefesselt wurden. So lehnte sie, erschöpft und sich ihrer hilflosen Lage vollends bewusst, in der Ecke.
»Wie lang soll das gehen?«, fragte sie leise, doch ihr Bewacher schwieg und legte ihr ein Handtuch über den Kopf. Sie sollte bei aufkommender Helligkeit nicht sehen, was um sie herum geschah. Das Tuch gab trotzdem einen kleinen Sichtspalt frei, sodass sie beobachten konnte, wie der Maskierte nervös auf und ab ging und oftmals durch ein Fenster nach draußen schaute.
4
Knapp eineinhalb Stunden, nachdem er weggefahren war, kam der falsche Polizist wieder in Seifritz’ Haus an. Es war inzwischen 5.30 Uhr und noch immer dunkel. »Läuft alles wie am Schnürchen«, beschied er seinem Komplizen mit leicht schwäbischem Akzent. »Jetzt kommt’s nur darauf an, ob die Millionen fließen.«
Seifritz verlangte Auskunft darüber, wohin Marion gebracht worden war.
»Keine Sorge. Sie ist an einem sicheren Ort. Ihr wird nichts geschehen«, bekam er zur Antwort. »Sie müssen nur tun, was wir wollen.«
Zum wiederholten Mal unternahm der erschöpfte und übermüdete Bankchef den Versuch, den Gangstern klarzumachen, dass der geforderte Betrag von fünf Millionen D-Mark kaum zu beschaffen sein würde. Im Tresor des Geldinstituts lagere deutlich weniger. Auch wäre es auffällig, wenn frühmorgens bei der Landeszentralbank, von der es eine Filiale in Göppingen gab, ein solcher Millionenbetrag geordert werde.
»Das ist Ihr Problem«, warf ihm der zivil Gekleidete vor. »Sind Sie nun Bankdirektor oder nicht?«
Schon in der Nacht hatte Seifritz darüber nachgegrübelt, ob er überhaupt befugt wäre, Geld der Bank als privates Lösegeld für seine Tochter zu verwenden. Aber wenn nicht … daran wollte er gar nicht denken. Er konnte in dieser Situation ja unmöglich mitten in der Nacht den Landrat als den allerobersten Chef der Kreissparkasse um Rat bitten. Wie es überhaupt schwierig sein würde, den Überfall geheimzuhalten, wenn er mit den beiden Gangstern noch vor Geschäftsbeginn im Hause auftauchen würde. Außerdem kam er allein ohnehin nicht an Geld. Er brauchte dazu den Hauptkassierer, und die Übergabe müsste im Tresorraum im streng abgeriegelten dritten Untergeschoss vonstattengehen. Dort lieferten die Geldtransporte nach einer Sicherheitsschleuse die Geldtaschen ab.
Wieder die quälende Angst: Wenn im Lauf der nächsten Stunden jemandem in der Bank etwas verdächtig erschien oder jemand Alarm schlug, dann würde er seine Tochter nie mehr wiedersehen. Er spürte von Minute zu Minute, wie ihn die Ungewissheit und die Sorge um das Mädchen zermürbte. Er musste das Geld besorgen. Aber durfte er das wirklich? Konnte er eigenmächtig den Geiselnehmern Millionen aushändigen, die ihm gar nicht gehörten? Es fiel ihm zunehmend schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Er fühlte sich müde, erschöpft und ausgelaugt. Die schlaflose Nacht forderte ihren Tribut.
Wieder vergingen qualvolle eineinhalb Stunden. Um 7 Uhr – inzwischen war der Himmel hell geworden – waren die beiden Gangster, denen er im Wohnzimmer gegenübersaß, unruhiger geworden. Der falsche Polizist nickte seinem Komplizen zu, was dieser als Zeichen für den Aufbruch deutete. »Sie fahren«, forderte er den Bankdirektor auf. Seifritz wischte sich trotz des frühen Morgens Schweiß von der Stirn. Er müsse sich noch frisch machen und etwas anderes anziehen, erklärte er, denn er könne unmöglich in diesem Zustand in der Bank auftauchen.
Bewacht von einem der Räuber rasierte er sich flüchtig, warf sich Wasser ins Gesicht und putzte die Zähne. Beim Blick in den Spiegel erschrak er über sein Äußeres. Die Spuren der Horrornacht waren deutlich zu sehen.
»Wir gehen ganz unauffällig raus«, erklärte der falsche Polizist. Und immer wieder die Drohung, zwar ruhig ausgesprochen, aber unmissverständlich: »Denken Sie an Ihre Tochter.«
Die Wohnstraße lag noch immer still in der Frische des kühlen Märzmorgens, als sie das Haus verließen. Der falsche Polizist hielt seine Uzi – die kompakte Maschinenpistole eines israelischen Herstellers – in der Aktentasche verborgen, was ihm beim Einsteigen hinten links in den Mercedes 280 SE einige Verrenkungen abverlangte. Sein Komplize hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Seifritz steckte mit zitternder Hand den Zündschlüssel ins Schloss und fuhr los. Hinter den Fenstern einiger der benachbarten Villen brannte zwar Licht, aber nirgendwo hatte jemand bemerkt, dass soeben eines der größten Bankraub-Verbrechen Deutschlands in die entscheidende Phase ging.
5
Auf der nur knapp einen Kilometer langen Wegstrecke von der Wohnung zur Hauptstelle der Kreissparkasse hatte Seifritz Mühe, sich auf das morgendliche Verkehrsgeschehen in der Innenstadt zu konzentrieren. Beinahe hätte er eine rote Ampel übersehen, worauf ihn der falsche Polizist neben ihm lautstark aufmerksam machte. »Halt – da ist rot.«
»Versuchen Sie ja nicht, einen Unfall zu provozieren«, kam die Stimme des anderen von hinten. »Denken Sie an Ihre Tochter.«
Seifritz, für den es nichts Ungewöhnliches war, lange vor Geschäftsbeginn im Bankgebäude zu erscheinen, steuerte den großen Wagen in die schmale Einfahrt der Tiefgarage hinab, schob die Parkkarte in den Automaten und ließ die Schranke hochgleiten.
»Sie parken dort, wo Sie immer parken«, befahl der Mann mit dem grünen Polizeianorak auf dem Beifahrersitz. Noch immer trugen die Gangster ihre Sonnenbrillen, die sie auch während der Nacht nie abgenommen hatten. Eine Reihe von Leuchtstoffröhren flammte auf, als sie das zweite Untergeschoss erreichten und Seifritz an seinem angestammten Platz parkte.
Die Männer hatten sich in der vergangenen Nacht die Situation im Gebäude exakt schildern lassen und sich sogar den Namen der Chefsekretärin eingeprägt. Demnach gelangte man von der Tiefgarage über das Treppenhaus ins zweite Obergeschoss, wo sich das Büro des Direktors befand. Noch begegneten sie auf dem Weg dorthin niemandem. Seifritz ging durchs menschenleere Vorzimmer und betrat, bewacht von seinen Peinigern, verunsichert sein Büro, das von der Größe her einem verantwortlichen Banker durchaus alle Ehre machte und eine Besucherecke samt lederner Sitzgarnitur aufwies.
Die beiden Räuber sahen sich prüfend um, als wollten sie sichergehen, von keiner Alarmeinrichtung erfasst zu werden. Seifritz sank unterdessen auf seinen Schreibtischsessel, während die Gangster seelenruhig auf der Couch am Besprechungstisch Platz nahmen und ihre Forderung nach fünf Millionen bekräftigten. Seifritz wiederholte, was er die ganze Nacht über beteuert hatte: dass so viel Geld nicht im Tresor lagere und auch nicht unauffällig zu beschaffen sei. Auf die Schnelle könne man allenfalls ein paar 100.000 Mark bei der Landeszentralbank ordern, wie dies jeden Morgen üblich sei.
Doch die Räuber, die bereits in der Nacht von diesen Gepflogenheiten erfahren hatten, blieben hartnäckig. »Dann lassen Sie sich halt etwas einfallen. Sie sind der Chef hier«, gab der Uniformierte gelassen zu verstehen.
Seifritz schloss für einen Moment die Augen. Marion. Er sah ihr ängstliches Gesicht, wie sie ihn heute Morgen angeschaut hatte, als sie weggebracht worden war. Wie sie geheult und gefleht hatte. Nein, er hatte natürlich gar keine andere Wahl, als das Geld zu beschaffen. »Blutbad«, dröhnte es wieder durch seinen Kopf. Sie hatten gestern Abend von einem Blutbad gesprochen, von Bomben in der Schalterhalle, von einem Aufpasser, der von der anderen Straßenseite, vom Bahnhof aus, das Bankgebäude beobachten werde.
Dann beunruhigte ein Geräusch aus dem Nebenraum die beiden Täter. »Wer ist das?«, wollte der Uniformierte wissen, der Seifritz’ Aktentasche auf dem Schoß hielt, während der andere erschrocken aufsprang.
»Meine Sekretärin, die Frau Rüger«, beruhigte Seifritz. »Wir werden das vor ihr nicht geheim halten können.«
»Denken Sie an Ihre Tochter«, mahnte der zivil gekleidete Mann und setzte sich wieder.
Kaum hatte er es gesagt, ging ohne ein vorheriges Klopfzeichen die Tür auf, und eine Frau mittleren Alters hielt überrascht in der Bewegung inne. Ihr Blick war nur auf den Uniformierten gefallen, der links von ihr auf der Couch saß. Für einen Augenblick dachte sie, ihr Chef habe einen verkehrspolizeilichen Verstoß begangen und sei mit einem Strafzettel konfrontiert worden. Sie machte kehrt, verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Aber schon Sekunden später ertönte an ihrem Telefon der sogenannte »Sekretärinnenruf«: Ihr Chef bat sie mit gedämpfter Stimme in sein Büro zurück. Energisch, wie sie sein konnte, trat sie erneut ein – und wurde sich der merkwürdigen Situation sofort bewusst: Der Uniformierte, den sie zuvor als Polizisten wahrgenommen hatte, trug eine Sonnenbrille und einen Vollbart. Noch während sie auch den anderen Mann anstarrte, der ebenso seltsam aussah, jedoch zivil mit einem Trenchcoat bekleidet war, erklärte Seifritz schnell: »Die Herren sehen zwar aus, als wenn sie von der Polizei wären, aber dem ist nicht so.« Den Hinweis, sie verlangten für die entführte Tochter fünf Millionen D-Mark Lösegeld, konterte die Sekretärin spontan: »Aber so viel Geld haben wir doch nicht.« Ihr erster Schock war einer gewissen Wut gewichen. Wut und Zorn darüber, dass es die Gangster gewagt hatten, die Tochter ihres Chefs zu kidnappen. »Sie sind doch Verbrecher«, brach es wütend aus ihr heraus, aber gleichzeitig überkam sie ob der eigenen Courage die Angst, diese angespannte Atmosphäre könnte außer Kontrolle geraten. Denn der falsche Polizist hatte in der Aktentasche ihres Chefs eine Maschinenpistole verborgen gehalten, mit der er nun drohend herumfuchtelte.
Für Karin Rüger ein Anblick, der ihr etwas in Erinnerung rief, das mehr als 20 Jahre zurücklag. Plötzlich tauchten Bilder auf, die noch tief in ihrem Unterbewusstsein steckten. Bilder, die sich im jugendlichen Alter beim Lesen ihres ersten Kriminalromans geformt hatten. Es war um einen Banküberfall gegangen, bei dem die Räuber alle Beteiligten erschossen hatten.
Mit einem Mal schien diese Szene lebendig zu werden: Schießerei, Maschinenpistole, zuckte es durch ihren Kopf. Und hier drinnen waren sie von Betonwänden umgeben. Querschläger? Ein panisches Gedankenkarussell. Ohne lange zu überlegen, herrschte sie den Uniformträger an: »Fuchteln Sie nicht mit diesem Ding rum.«
Der Angesprochene war über diese unerwartete Reaktion konsterniert. »Da geht kein Schuss los«, erwiderte er missmutig. »Aber damit Sie beruhigt sind, pack ich’s wieder ein.« Er steckte die Waffe zurück in die Aktentasche.
Seifritz hatte das kurze Wortgefecht am Schreibtisch sitzend verfolgt. Seine Sekretärin beobachtete mit Sorge, wie nervös und unruhig er geworden war. »Wollen Sie einen Whisky?«, fragte sie, um die gereizte Atmosphäre zu dämpfen. Seifritz nickte und ließ sich einen Johnny Walker eingießen, dessen Aufbewahrungsort in seinem Büro Frau Rüger genau kannte. Unterdessen beteuerte Seifritz immer wieder, keine fünf Millionen D-Mark besorgen zu können, weil ein solch hoher Betrag gar nicht im Hause aufbewahrt werde.
»Ich kann allein kein Geld besorgen«, stellte er nach einem Schluck Whisky klar und schlug vor, seinen Stellvertreter zu holen.
»Tun Sie das nicht«, mischte sich seine Sekretärin ein. »Je mehr Personen hier auftauchen, desto unübersichtlicher wird die Lage«, gab sie zu bedenken, als wie zur Bekräftigung ihrer Worte Geräusche aus dem Nebenraum die bewaffneten Männer erneut in Unruhe versetzten.
»Das ist meine junge Kollegin, die gerade gekommen ist«, versuchte Frau Rüger zu beschwichtigen.
»Erklären Sie ihr, was los ist. Sie soll niemandem etwas sagen und ganz normal weiterarbeiten«, ordnete Seifritz an, worauf seine Sekretärin die Mitarbeiterin im Vorzimmer instruierte.
Die beiden Gangster schienen sich von der Aufregung nicht anstecken zu lassen. Der falsche Polizist wirkte sogar eher entspannt, als er sich erneut an Seifritz wandte:
»Vielleicht sollte ich Sie noch mal an Ihre Tochter erinnern.« Sein Komplize ließ währenddessen den Entsicherungshebel einer schwarzen Pistole mehrfach klicken.
6
Heinrich Lackner, ein zurückhaltender, ruhiger Bankangestellter, die Seriosität in Person und als stellvertretender Leiter der Schalterhalle auch für die Hauptkasse zuständig, wie im hausinternen Jargon der Tresorraum im dritten Untergeschoss bezeichnet wurde, kam häufig früher als notwendig zur Arbeit. Er parkte seinen Wagen in einem nahen Parkhaus und betrat das mächtige Sparkassengebäude über die Zufahrt zur Tiefgarage, in der nur Kunden und die Vorstände ihre Fahrzeuge abstellen durften. Wie häufig, so galt auch an diesem Märzmontag sein erster Gang der Hauptkasse, die sich unter dem zweiten Untergeschoss der Tiefgarage befand. Ein Lastenaufzug, wie ihn die Angestellten nannten, führte durch alle Etagen, war aber nur für die interne Nutzung gedacht. Mit ihm fuhr Lackner ganz hinunter, wo in den klimatisierten, aber schmucklosen Räumen bereits Hauptkassierer Berthold Rilke einige Aufzeichnungen las. Wie immer prüfte er alle Daten, Zahlen und Anweisungen mehrfach, wie er es als penibler Bankmitarbeiter ein Berufsleben lang gewohnt war. Auch jetzt, kurz vor dem Renteneintritt, hatte er nichts von seiner korrekten Arbeitsweise verloren. Das Geld, das für den täglichen Geschäftsbetrieb droben in der Schalterhalle gebraucht wurde, konnte er jedoch nicht allein aus dem Tresor holen. Dazu bedurfte es eines zweiten Angestellten, und der war Lackner. Die eingespielte Prozedur wiederholte sich deshalb jeden Morgen: Lackner gab in das Zahlenkombinationsschloss die Geheimnummer ein, worauf Rilke mit seinem Schlüssel die schwere gepanzerte Tür öffnen konnte, hinter der sich über Nacht nur ein vergleichsweise geringer Betrag befand. Die beiden Männer wechselten noch ein paar Worte zum gestrigen Sonntag, den Lackner trotz des schlechten Wetters auf einer Wanderhütte bei Gruibingen verbracht hatte, und widmeten sich kurz einer weiteren Routinearbeit: Beide mussten sie den Scheck unterschreiben, mit dem die Geldboten jeden Morgen einen größeren Betrag für den zu erwartenden Tagesbedarf bei der Landeszentralbank-Filiale holen mussten, die sich Luftlinie nur etwa 300 Meter entfernt befand. Heute waren es 700.000 Mark.
»Dann noch einen schönen Tag«, wünschte Lackner seinem älteren Kollegen, der bisweilen nervös werden konnte, wenn nicht alles so lief, wie er es sich vorstellte. Dazu jedoch gab es an diesem Vormittag keinen Anlass.
Lackner bestieg den Aufzug und fuhr zur ebenerdig gelegenen Schalterhalle hinauf, in der sich sein Büro befand. Schon waren auch weitere Angestellte eingetroffen, die sich auf den Geschäftsbeginn vorbereiteten. Lackner machte sich über Akten und Protokolle her, in denen es um einige merkwürdige Überweisungen ging, die bei einem ausländischen Kunden aufgefallen waren. Als er ein paar Minuten später einen Kollegen in der Schalterhalle etwas dazu fragen wollte, lief ihm völlig unerwartet Rilke über den Weg, den er um diese Zeit noch immer im Tresorraum vermutet hätte. Bevor er ihn ansprechen konnte, war Rilke schnellen Schrittes Richtung Treppenhaus verschwunden. Lackner sah ihm eine Sekunde lang nach, zuckte verwundert mit den Schultern. So war Rilke eben. Oft in Eile, nervös und stets darauf bedacht, alles 100-prozentig richtig zu machen.
Lackner, der in Stresssituationen hingegen in sich zu ruhen schien und jedes noch so kritische Gespräch mit sonorer und sanfter Stimme entkrampfen konnte, setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch, um einige dubios erscheinende Geldtransaktionen zu verfolgen. Es verging kaum ein Monat, in dem nicht irgendetwas aus dem üblichen Rahmen fiel. Meist jedoch ließen sich die Sachverhalte logisch erklären, und der betroffene Kunde merkte von der hausinternen Prüfung überhaupt nichts. Allerdings schienen die Tricks der Ganoven und Geldwäscher immer ausgeklügelter zu werden. Spätestens seit es Geldautomaten gab, hatten die Betrugsversuche deutlich zugenommen. Es hatte bundesweit sogar schon Täter gegeben, die die stabilen Geräte mit Sprengladungen aus der Verankerung gerissen hatten.
So weit war es im beschaulichen Göppingen noch nicht gekommen, aber auch hier, im nördlichen Vorland zur Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart und Ulm, war man bestimmt nicht davor gefeit.
Tief in Gedanken versunken, wurde Lackner vom schrillen Ton des Telefons wieder in die Realität zurückgeholt. Er nahm ab, meldete sich und hörte sofort eine wohlvertraute Frauenstimme, die heute aber viel ernster klang als sonst: »Sie sollen doch bitte mal zu Herrn Seifritz kommen.« Es war Chefsekretärin Karin Rüger.
Lackner brummte ohne weitere Nachfrage ein »Okay« und legte auf. Zum Chef. Das hatte ihm am frühen Montagmorgen gerade noch gefehlt. Was er wohl wollte?
Er schlug die Akten zu und machte sich auf den Weg quer durch die Schalterhalle, die für den Kundenbetrieb noch geschlossen war, hinauf durch das im Halbrund gebaute turmartige Treppenhaus mit den Bullaugenfenstern. Dort kam ihm auf halbem Weg Rilke mit blassem, ernstem Gesicht entgegen. »Was ist denn los?«, wollte Lackner wissen, weil er sofort merkte, dass etwas anders war als sonst.
Die Antwort fiel kurz und knapp aus: »Ich war bei Seifritz. Geh rauf.« Dann eilte Rilke an ihm vorbei abwärts.
Lackner stand für einen Moment wie belämmert. So hatte er seinen Kollegen noch nie erlebt. Plötzlich befiel ihn die Gewissheit, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sein musste. Er verlangsamte seine Schritte und betrat vorsichtig die zweite Etage, das Reich der Vorstände, in dem für gewöhnlich gediegene Ruhe herrschte. Auch jetzt lag der Flur in absoluter Stille.
Er klopfte an die Tür des Vorzimmers und trat unmittelbar danach ein. Sein Blick fiel auf Chefsekretärin Karin Rüger, die kreidebleich an ihrem Schreibtisch kauerte und ihm grußlos andeutete, gleich ins Büro von Seifritz weiterzugehen, dessen Tür geschlossen war. Ihre junge Kollegin hatte nicht einmal aufgeschaut.
Lackners Verunsicherung stieg. Noch nie hatte es eine solch seltsame Situation gegeben. Er klopfte an die Tür, die sogleich geöffnet wurde. Vor ihm stand ein Uniformierter, der ihn in allerhöchste Alarmbereitschaft versetzte. Polizei, durchzuckte es Lackner. Üblicherweise kamen die Beamten direkt zu ihm, wenn es polizeiliche Ermittlungen gab. Die Anwesenheit eines Polizisten im Chefbüro konnte nichts Gutes bedeuten. Lag etwas gegen ihn selbst vor?
Aber die Sonnenbrille, das bärtige Gesicht und etwas, das wie eine Maschinenpistole aussah, jagten ihm augenblicklich ganz andere Ängste durch den Kopf: der Chef in der Gewalt von Gangstern.
Seifritz, der übernächtigt hinterm Schreibtisch saß, forderte seinen völlig irritierten Angestellten auf hereinzukommen und die Tür hinter sich zu schließen. Er hatte Lackners Entsetzen bemerkt und gleich klargestellt: »Herr Lackner, das sind keine echten Polizisten.«
Augenblicklich erfasste der Angestellte die bedrohliche Lage und erblickte erst jetzt den abseits stehenden zweiten Mann. Geschockt ließ er sich von dem sichtlich mitgenommenen Seifritz die Situation schildern – vor allem aber, dass die beiden Verbrecher seine Tochter entführt hätten. Worauf der Uniformierte, der die Maschinenpistole hielt, völlig unaufgeregt bekräftigte: »Keine Polizei. Wenn etwas schiefgeht, sieht Herr Seifritz seine Tochter nicht mehr lebend.«
»Und in der Schalterhalle gibt’s ein Blutbad«, ergänzte der andere ebenso ruhig.
»Die wollen fünf Millionen«, erklärte der Bankchef seinem Angestellten. »Ich hab ihnen aber bereits erklärt, dass das nicht geht.«
»Sie werden es hinkriegen«, lächelte der Uniformierte und sah Lackner in die Augen.
»Ich hab gesagt, dass der heutige Transport von der Landeszentralbank mit 700.000 Mark bald eintrifft – aber sie wollen fünf Millionen«, sagte Seifritz mit schwacher Stimme. Seine Hände zitterten, die Augen hinter der dicken Brille waren wässrig.
»Jetzt brauchen wir Ihre Hilfe«, wandte sich der falsche Polizist mit charmantem Unterton an Lackner, der nicht verstand, was dies bedeutete.
Seifritz stellte klar: »Herr Rilke holt einen Scheck. Mit dem können wir noch zwei Millionen bei der LZB besorgen lassen.«
Lackner kapierte: Weil zwei Unterschriften notwendig waren, mussten er und Rilke unterzeichnen. »Aber wenn die Boten gleich noch ein zweites Mal zur LZB kommen, fällt das auf«, gab er zu bedenken.
»Hab ich auch gesagt«, pflichtete ihm Seifritz bei, räumte dann jedoch ein: »Aber mit zwei Millionen könnte es klappen.
Der Uniformierte schien dies endlich zu begreifen, wandte sich aber drohend an Lackner: »Es darf nichts nach außen dringen. Denken Sie an die Tochter von Herrn Seifritz.«
Lackner musste sich eingestehen, dass es keinen Sinn machte, neuerliche Bedenken vorzubringen. Augenblicke später wurde Rilke von der Sekretärin hereingeführt. Er hielt den bereits ausgefüllten Scheck in der Hand, legte ihn auf den Schreibtisch des Chefs und unterschrieb. Seifritz nickte dankend, rührte das Papier aber nicht an, sondern gab nun mit einer stummen Handbewegung Lackner zu verstehen, dass es jetzt an ihm liege, den neuerlichen Geldtransport ebenfalls per Unterschrift zu bestätigen. Lackner zögerte, wartete noch auf eine klare Aussage seines Chefs, doch dieser verzog keine Miene. Sekretärin Rüger verfolgte angespannt die Szenerie und fragte sich insgeheim, weshalb nicht Seifritz selbst die zweite Unterschrift auf den Scheck setzte, denn kraft seines Amtes hätte er dies ohne Weiteres tun dürfen.
Sie spürte, dass auch Lackner darüber nachdachte. Er zögerte für einen kurzen Moment und überlegte offenbar, ob er es überhaupt würde verantworten können, per Unterschrift der Forderung der beiden Gangster nachzukommen. Aber immerhin schien es sein Chef so zu wollen. Wahrscheinlich, so beruhigte sich Lackner, wäre es bei der Landeszentralbank viel zu auffällig, wenn plötzlich der Bankchef höchstpersönlich die zweite Anforderung des Tages unterschrieben hätte.
Aber warum gerade er, Lackner, schoss es ihm durch den Kopf? Schließlich gab es außer ihm noch einen weiteren Angestellten, der befugt war, Geld von der Landeszentralbank zu ordern. Weshalb hatte Seifritz ausgerechnet ihn ausgewählt? Lackner verdrängte derlei Gedanken, denn er wollte unbedingt vermeiden, dass das Leben der jungen Frau leichtfertig aufs Spiel gesetzt wurde, nur weil er jetzt zögerte. Also trat auch er an den Schreibtisch, zückte einen Kugelschreiber und setzte mit zitternden Fingern seine Unterschrift unter das Dokument.
»Leiten Sie alles in die Wege«, nickte Seifritz dem Hauptkassierer zu. »Wir kommen dann auch runter.«
Rilke verschwand mit dem Scheck. Sobald die Boten mit den regulär georderten 700.000 D-Mark zurück sein würden, mussten sie sofort wieder zur Landeszentralbank geschickt werden, um den zweiten Auftrag zu erledigen. »Na also, geht doch«, brummte der Uniformierte, nachdem Rilke den Raum verlassen hatte. »Wenn wir das Geld haben, ist Ihre Tochter frei.«
Seifritz wischte sich mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn und sah auf die Uhr. Je näher die Öffnungszeit der Bank rückte, desto mehr Angestellte hielten sich in dem großen Gebäude auf. »Bomben und Granaten«, schallte es wieder durch seinen Kopf. Die Gangster wollten Sprengkörper in der Schalterhalle deponiert haben. Wenn dies tatsächlich so war, dann musste das Zeug bereits gestern hereingebracht worden sein. Womöglich war das Ganze die kaltblütige Tat einer professionellen Bande – und womöglich doch ein Wachposten gegenüber am Bahnhof postiert, um auf verdächtige Bewegungen außerhalb des Bankgebäudes zu achten. Dann aber müsste er mit den Geiselnehmern in Funkkontakt stehen. Dafür aber, so überlegte Seifritz, hatte es bisher keine Anhaltspunkte gegeben.
Der Uniformierte umklammerte die Aktentasche, in der sich die Maschinenpistole befand, und gab seinem Komplizen einen Wink. »Sie beide«, er wandte sich an Seifritz und Lackner, »bringen uns jetzt runter zur Hauptkasse.«
»Aber immer dran denken«, schaltete sich der schweigsamere Gangster ein, »wenn irgendjemand die Polizei ruft, ist Ihre Tochter tot.«
Seifritz reagierte nicht, sondern stand auf und verließ als Erster das Büro, gefolgt von den beiden Gangstern und Lackner. Die Sekretärin blickte die Männer sprachlos und entgeistert an. Erst jetzt schien sie die ganze Tragweite des Geschehens verinnerlicht zu haben. Ihr bislang couragiertes Auftreten war purer Angst gewichen.
»Ich bin für niemanden zu sprechen«, erklärte Seifritz und fügte verunsichert an: »Niemand darf etwas erfahren. Niemand. Haben Sie mich verstanden?«
Karin Rüger saß wie erstarrt auf ihrem Bürostuhl und umklammerte die Schreibtischkante. Ihre junge Kollegin wagte es nicht, sich umzudrehen, sondern tat so, als sei sie mit dem Studium einer Akte beschäftigt.
Erst als die vier Männer den Raum verlassen hatten, verspürte die Chefsekretärin für einen Moment eine gewisse Erleichterung. Obwohl an ein gutes Ende noch nicht zu denken war.
Auf dem Flur der Vorstandsetage herrschte die übliche Stille. Seifritz hatte inständig gehofft, dass noch niemand unterwegs war. Wie hätte er den Angestellten erklären sollen, weshalb er um diese Zeit in Begleitung eines Polizisten und eines weiteren Fremden schon sein Büro verließ, dazu noch gemeinsam mit Lackner?
Seifritz ging zielstrebig zu dem sogenannten Lastenaufzug, den er mit einem Knopfdruck anforderte. Die paar Sekunden, bis er eintraf, steigerten Seifritz’ innere Aufregung ins Unermessliche, während die beiden Kidnapper weiterhin so taten, als seien sie sich ihres Vorgehens absolut sicher.
Wortlos und dicht gedrängt standen sie nebeneinander, als der Aufzug in das dritte Untergeschoss ruckelte. Seifritz mied den Blickkontakt zu den anderen und starrte auf die beleuchteten Tasten. Lackner studierte hingegen verstohlen die verkleideten Gangster und ihre seltsame Maskerade und versuchte, sich möglichst viele Einzelheiten einzuprägen.
Der Aufzug hielt mit einem sanften Ruck, die Tür schob sich beiseite, und grelles, kaltes Licht schlug ihnen entgegen.
Im Vorraum, in dem sich die Kundenschließfächer befanden, sahen sie durch eine dicke Panzerglasscheibe in den eigentlichen Tresorraum, wo Hauptkassierer Berthold Rilke mit mehreren Bündeln Geldscheinen hantierte, die er in eine Ledertasche steckte. Als Lackner mit Seifritz und den beiden Gangstern über einen weiteren Nebenraum hereinkamen, stellte Rilke mit vor Aufregung heiserer Stimme fest: »Die 700.000 sind bereits da.« Sein Gesicht war aschfahl, jedes Wort verriet hochgradige Nervosität. »Die Boten sind gerade wieder weg, um die zwei Millionen zu holen«, ergänzte er und signalisierte damit, dass der Geldtransporter bereits wieder zur Landeszentralbank-Filiale unterwegs war.
»Wissen die Boten Bescheid?«, wollte Seifritz wissen.
»Nein. Bisher nicht. Aber gewundert haben sie sich«, erwiderte Rilke verängstigt.
Natürlich war es ungewöhnlich, dass an einem ganz normalen Geschäftstag sofort wieder eine größere Summe geordert wurde. Normalerweise kam dies allenfalls in der Vorweihnachtszeit vor, wenn die Zahl der Barabhebungen zunahm. Auch die Boten würden sich möglicherweise ihre Gedanken machen, zumal diese allein schon ihres früheren Berufes wegen misstrauisch waren. Bei den meisten handelte es sich nämlich um pensionierte Polizeibeamten, die sich mit diesem Job ein Zubrot verdienten, oder um jüngere Männer, die ihre Ausbildung bei der Polizei abgebrochen hatten.
Lackner, der zwischen Seifritz und den beiden Gangstern stand, musste daran denken, dass die Geldboten glücklicherweise nicht mehr bewaffnet waren. Nicht auszudenken, wenn sie nachher bei der Rückkehr mit den zwei Millionen D-Mark Verdacht schöpften und die Helden hätten spielen wollen. Früher, das wusste er, hatten Geldboten stets Waffen bei sich gehabt und deshalb regelmäßige Schießübungen absolvieren müssen. Sogar bei den Kassierern waren noch in den 60er-Jahren Schusswaffen durchaus üblich gewesen. Als Lackner vor 15 Jahren bei einer Zweigstelle draußen auf dem Land, in Süßen-Nord, tätig gewesen war, hatte er selbst zwar keine Pistole mehr bekommen, jedoch trotzdem an den Schießübungen teilgenommen, die offenbar für einige Angestellte der Kreissparkasse damals weiterhin vorgeschrieben waren.
Inzwischen hatte man die Bewaffnung abgeschafft, weil die Gefahr bestand, dass es mit Räubern zu gefährlichen Schießereien kam – mit unabsehbaren Folgen. Menschenleben waren schließlich mehr wert als Geld.
Nur für ein paar Sekunden gingen Lackner solche Szenarien durch den Kopf, weil ihn die Maschinenpistole beunruhigte, die der Uniformierte über der Schulter hängen hatte. Noch immer wirkten die beiden Gangster gelassen und selbstsicher. Seifritz, dessen Gedanken unablässig um seine Tochter kreisten, war mehr denn je davon überzeugt, dass die Männer ziemlich abgebrüht sein mussten.
Der falsche Polizist sah sich prüfend um und deutete auf eine nur angelehnte Tür. »Was ist da drin?«, wollte er in sachlichem Ton wissen.
»Das Archiv«, erwiderte Rilke, der noch immer ganz konzentriert die gebündelten Geldscheine zählte und in eine Ledertasche steckte. 700.000 D-Mark, überwiegend in blauen Hundertmarkscheinen.
Seifritz wurde von dem zivil gekleideten Gangster in den kühlen Nebenraum gedrängt, wo metallene Aktenregale und ein weißer Tisch in grelles Kunstlicht gehüllt waren.
»Wie lange sind die Boten unterwegs?«, verlangte der mit einer kleinen schwarzen Pistole bewaffnete Mann Auskunft.
»Kommt drauf an«, erwiderte der Bankdirektor, während er mit dem Gangster im Archivraum verschwinden musste und der Uniformierte draußen bei Rilke und Lackner blieb. »Wenn bei der LZB viel Betrieb ist, kann es dauern.«
»Ungefähr?«, drängte der Räuber auf eine klare Antwort und zog die Tür von innen zu, ohne sie einrasten zu lassen. Auf diese Weise waren sie zwar außer Sichtweite, konnten aber verfolgen, was Rilke und der uniformierte Gangster sprachen.
»20 Minuten brauchen die Geldboten«, erklärte Seifritz, auf dessen Stirn sich Schweißperlen gebildet hatten. »Ich weiß nicht, wie der Verkehr heute früh in der Stadt ist.«
Die Luft in dem kleinen Archivraum war trocken, das sanfte Rauschen eines Gebläses zu vernehmen.
»Und wenn das mit den zwei Millionen nicht klappt?«, wagte Seifritz verzweifelt und flüsternd einen Vorstoß. Er musste diese Frage jetzt einfach loswerden.
Ebenso leise kam die Antwort seines Bewachers: »Dann gibt es ein Blutbad.«
Seifritz fühlte den Satz wie einen Stich in die Seele. »Ich möchte Sie wirklich bitten, meiner Tochter nichts anzutun«, presste er flehend hervor, ergriffen von der unbezähmbaren Angst, das Mädchen und er stünden kurz vor dem Tod.
»Ihrer Tochter geschieht nichts. Sobald wir das Geld haben, ist sie frei«, bekam er wieder zur Antwort, aber für ihn klang es nicht überzeugend. Er hatte Mühe, die wild rotierenden Gedanken zu sortieren. »Es könnte aber sein, bei der LZB wird jemand misstrauisch und versucht, mich telefonisch zu kontaktieren.«
»Wird er nicht«, erwiderte der Gangster ungerührt. Wieder schien es so, als könne das Verbrechen gar nicht anders als geplant ablaufen.
Sie standen sich mit verschränkten Armen gegenüber, schweigend, abwartend, immer wieder auf die Armbanduhren schauend. Alle paar Sekunden blinzelte der Räuber durch den schmalen Türspalt nach draußen, wo Rilke und Lackner, bewacht von dem Uniformierten, noch immer schweigend mit den Geldscheinbündeln beschäftigt waren. In der Ledertasche musste nachher noch Platz für zwei Millionen sein.
Der Uniformierte nickte den beiden Bankangestellten zu: »Gut gemacht. Sehr gut. Aber jetzt müssten die Boten doch bald auftauchen, oder wie sieht das aus?«
Die Männer versuchten, den unruhig gewordenen Verbrecher zu beruhigen. Rilke deutete auf die Geldtasche: »Da sind jetzt exakt 689.500 Mark drin.« Lackner ergänzte: »Das Restliche, was wir noch im Tresor haben, müssen wir drin lassen, weil wir sonst für die Kassierer hier im Hause nichts mehr hätten. Das würde auffallen.«
Weitere bange Minuten verstrichen, bis endlich die Aufzugstür und näher kommende Schritte zu hören waren. Für den Gangster ein paar Schrecksekunden. Alles ging so schnell, dass er keine Chance mehr hatte, nach nebenan ungesehen im Archivraum zu verschwinden. Die beiden Geldboten tauchten auf und blieben wie erstarrt stehen, als sie durch die Sicherheitsscheibe neben den beiden Bankangestellten den Uniformierten mit der Maschinenpistole erblickten. Lackner wollte die spannungsgeladene Situation entschärfen, kam heraus, ließ die völlig verdatterten Boten eintreten und nahm die Geldtasche entgegen. Obwohl so gut wie nichts gesprochen wurde, war den Ankömmlingen sofort klar, was geschehen war. Einer von ihnen, ein jüngerer Mann, deutete mit einer Geste unmissverständlich an, dass er nicht gewillt war, den Gangster kampflos mit dem Geld entkommen zu lassen. Dieser mutige Widerstand war jedoch schnell gebrochen, als der Uniformierte zu seiner umgehängten Uzi griff und den Lauf blitzartig auf ihn richtete. Erst jetzt schien der Geldbote den Ernst der Lage zu begreifen, verharrte in der Bewegung und trat mit seinem Kollegen vorsichtig ein paar Schritte zurück.
Lackner und Rilke hatten in aller Eile damit begonnen, die herbeigeschafften Millionen in die vorbereitete Geldtasche umzusortieren. Sie wollten das Drama so schnell wie möglich hinter sich bringen.
Beklemmende Stille hatte sich breitgemacht, als plötzlich von außerhalb des Tresorraums erneut beunruhigende Geräusche zu vernehmen waren: Aufzug, Schritte.
»Wer kommt da? Wer ist das?«, entfuhr es dem Gangster erschrocken, während die Geldboten noch ein paar Schritte zurückwichen, als wollten sie sich aus der Schusslinie bringen. Unterdessen verfolgten Seifritz und der andere Verbrecher angespannt durch einen schmalen Türspalt des Archivs, was sich anbahnte.
Rilke sah zu Lackner und fühlte sich zu einer Erklärung gezwungen: »Wahrscheinlich kommt ein Kassierer, der Geld braucht.« Seine Stimme klang erstaunlich fest.
»Noch einer?«, fragte der Räuber schnell und war mit zwei, drei Schritten an der Archivtür, um dort verschwinden zu können.
»Normaler Vorgang«, erklärte Rilke, während der Gangster die Tür zum Archiv aufdrückte, wo ihm sein Komplize und Seifritz respektvoll Platz machten.
Ein paar Sekunden später tauchte draußen ein junger Bankangestellter auf, korrekter Anzug, Krawatte. Für einen kurzen Moment war er verwundert, neben Rilke auch Lackner und die Geldboten vorzufinden. Doch die beiden Verantwortlichen für die Hauptkasse täuschten Routinearbeit vor, blickten nur kurz auf, und Rilke fragte mit gespielter Gelassenheit: »Sie brauchen wie viel?« Lackner blätterte in einigen Unterlagen und war darauf bedacht, dass seine zitternden Hände die innere Unruhe nicht verrieten.
Den jungen Kollegen beschlich zwar beim Anblick der prall gefüllten Geldtasche und der verängstigt dreinschauenden Geldboten ein merkwürdiges Gefühl, doch er ließ es sich nicht anmerken und sagte emotionslos: »Ich sollte 30.000 haben.« Worauf ihm Lackner mit einem beherzten Griff in die vor ihm auf dem Tisch stehende Transporttasche schnell einige Geldbündel vorzählte und sich Rilke mit der schriftlichen Abwicklung befasste. Währenddessen wandte sich Lackner beiseite, um die nun in der Tasche fehlende Summe mit einigen Geldbündeln aus dem Tresor wieder aufzufüllen. Alles ging so fix, dass der junge Bankangestellte diesen etwas seltsam anmutenden Austausch nicht zur Kenntnis nahm.
Und für die im Archiv versteckten Männer war der schmale Blinkwinkel durch die angelehnte Tür viel zu klein, um das gesamte Geschehen überblicken zu können. Nachdem Rilke mit dem Kollegen aus den oberen Geschäftsräumen die schriftlichen Formalitäten abgewickelt hatte, verschwand der junge Mann mit einem kurzen Abschiedsgruß aus dem Tresorraum, ohne die eingeschüchterten Geldboten noch einmal zur Kenntnis zu nehmen.
Kaum war das Geräusch des abfahrenden Lifts zu vernehmen, wagten sich die Gangster mit Seifritz aus dem Versteck. »Na also«, resümierte der Uniformierte und sah den völlig erschöpften Bankdirektor an. »Wenigstens knappe drei Millionen. Seien Sie froh, dass wir uns damit zufriedengeben.«
»Und wann kommt meine Tochter frei?«, fragte der Bankchef angespannt, denn nur dies war ihm jetzt wichtig.
Die Antwort gab der zivil Gekleidete: »Sobald wir weg sind.« Er schnappte sich die Geldtransporttasche, während sein Komplize, an den Bankdirektor gewandt, entschied: »Herr Seifritz, Sie haben genügend mitgemacht, jetzt wird uns Herr Lackner begleiten.«
Alle Augen, auch die der erstarrten Geldboten, waren auf Lackner gerichtet, der sich plötzlich wie vom Donner gerührt fühlte. »Begleiten«, hörte er es im Kopf nachhallen. Wie bitte?, wollte er sagen, brachte aber keinen Ton aus der trockenen Kehle. Er und Seifritz sahen sich entgeistert an, als suche jeder beim anderen Halt. Doch der MP-Träger blieb dabei: »Sie kommen mit«, sagte er und gab mit einer Kopfbewegung in Richtung Lackner zu verstehen, dass dieser gar keine andere Wahl hatte. Und es klang beinahe wie eine Bitte, als er dem in Gedanken versunkenen Seifritz sagte: »Die Autoschlüssel.«
»Und meine Tochter? Was ist jetzt mit meiner Tochter?«, stammelte der Bankchef, während er in den Hosentaschen aufgeregt nach dem Wagenschlüssel fingerte und ihn dem Uniformierten aushändigte.
Der andere wurde deutlich: »Ihre Tochter wird bald wieder hier sein. Aber nur, wenn Sie nicht vor 10 Uhr die Polizei rufen.« Er sah auch zu den Geldboten hinüber. »Haben wir uns verstanden? Nicht vor 10 Uhr. Denken Sie daran.« Er hielt die Geldtasche mit den knapp 2,7 Millionen D-Mark umklammert und entfernte sich langsam. Lackner zögerte, wurde jedoch mit einer höflichen Handbewegung von dem Uniformierten aufgefordert vorauszugehen.
Seifritz und Rilke beobachteten atemlos die Szenerie und nickten dem völlig verstörten Angestellten zu – eine Geste der Verzweiflung, als wollten sie ihn ermuntern, sich widerstandslos in sein Schicksal zu fügen. Für einen Moment schien eine schwere Last von ihnen zu fallen. Aber nur kurz. Denn augenblicklich übermannte Seifritz wieder die Angst um die Tochter und die Sorge, es könnte noch etwas Unberechenbares geschehen. Die Gefahr dafür war groß, und vor allem: Was hatten sie mit Lackner vor?
Langsam verhallten die Schritte, die Tür des Lastenaufzugs schwenkte auf, Sekunden später schloss sie sich wieder. Eine beklemmende Stille erfüllte den Raum. »Und jetzt?«, wagte Rilke, der regungslos dastand, seinen apathisch wirkenden Chef zu fragen.
Schweigen. Rilke ließ noch ein paar Augenblicke verstreichen, sah in das fahle Gesicht von Seifritz, dessen Lippen bebten, bis sie endlich ein Wort formten: »Abwarten.«
7
Lackner stand mit weichen Knien im Aufzug und spürte den Atem des Uniformierten, der die Uzi wieder in der Aktentasche verbarg. Der andere Gangster hielt krampfhaft die Geldtasche umklammert und starrte auf den Boden, offenbar darauf konzentriert, die entscheidenden Schritte zur Flucht endlich tun zu können. Als der aufwärts fahrende Aufzug schon nach wenigen Sekunden im zweiten Untergeschoss stoppte, wo Seifritz’ Auto parkte, bemerkte Lackner als Erster, dass etwas nicht stimmte: Die Tür schwenkte nicht auf. Ein technischer Defekt? Eine Falle, durchzuckte es ihn. Hatte jemand die Polizei alarmiert?
»Was soll das?«, wurde der Uniformierte zum ersten Mal richtig ungeduldig und nervös. Lackner drückte erneut die Taste zum zweiten Untergeschoss. Eigentlich hätte der Aufzug vom dritten ins zweite Untergeschoss hochfahren sollen. Jetzt aber schien er irgendwie kurz davor steckengeblieben zu sein.
»Was ist hier los?«, entfuhr es dem Mann mit der Geldtasche und er warf einen zornig-wütenden Blick auf Lackner, dem es schwerfiel, kühlen Kopf zu bewahren. War er jetzt mit den Gangstern gefangen? Würde gleich eine Hundertschaft der Polizei heranstürmen, ihn befreien – mit einer wilden Schießerei? Der Uniformierte klemmte sich die Aktentasche zwischen die Schenkel und versuchte, die Tür mit bloßen Fingern gewaltsam zu öffnen, doch ohne Werkzeug hatte er keine Chance.
Lackner befürchtete, der Gangster könnte jetzt die Nerven verlieren und sich mit der Maschinenpistole den Weg freischießen. Fast gleichzeitig mit diesem schrecklichen Gedanken wurde er sich der Ursache für den vermeintlichen Defekt bewusst: Vor dem Aufzug parkte noch der gepanzerte Geldtransportwagen. Solange dieser hier in der Sicherheitsschleuse stand, öffnete sich die Tür des Lifts nicht. »Das geht nicht«, beeilte er sich zu sagen. »Der Geldtransporter steht noch vor der Tür. Wir müssen ins erste Obergeschoss fahren und dann die Treppe runter.« Noch bevor einer der Geiselnehmer etwas antworten konnte, drückte Lackner die entsprechende Taste, worauf sich der Lift wieder in Bewegung setzte.
»Wenn das ein Trick ist …«, drohte der Uniformierte, wurde aber von dem aufgeregten Lackner schnell unterbrochen: »Ist es nicht. Wir kommen nur raus, wenn wir übers Treppenhaus gehen.«
Der falsche Polizist presste die Aktentasche mit der Waffe wieder an sich und wechselte einen Blick mit seinem Komplizen.
Im ersten Obergeschoss schwenkte die Tür auf. Lackner hoffte, dass sich niemand auf dem Flur befand. Denn in Begleitung dieser Typen, die alles andere als vertrauenerweckend aussahen, könnte es sehr schnell zu unberechenbaren Reaktionen kommen.
Aber da war niemand. Lackner, jetzt dazu entschlossen, die Gangster so schnell wie möglich loszuwerden, eilte voraus zu der nahen Tür ins Treppenhaus, das wie ein halbrunder Turm in die Fassade des mächtigen Gebäudes integriert war. Er stellte erleichtert fest, dass sich auch dort niemand aufhielt. Er hastete nach unten, gefolgt von den beiden Kidnappern, deren Schritte auf den Steinstufen von hinten an sein Ohr hallten. Noch immer waren keine anderen Personen aufgetaucht. Die Aufschrift »Tiefgarage U2« an der Betonwand verhieß für einen Augenblick Entspannung. Er öffnete nacheinander zwei schwere Metalltüren, dann standen sie in der mit Leuchtstoffröhren erhellten Tiefgarage, aus der die Gangster vor über eineinhalb Stunden gekommen waren. Für einen Moment hielten sie inne, um an der Reihe der geparkten Autos entlangzuschauen, doch auch hier schien niemand zu sein. Der Uniformierte stürmte voraus zu Seifritz’ Mercedes, entriegelte die Türen und setzte sich hinters Steuer, während Lackner neben ihm Platz nehmen musste und der Gangster sich mit der Geldtasche dahinter in den Fond zwängte.
»Wo wollen Sie denn hin?«, fragte Lackner vorsichtig.
»Nur ein paar Minuten noch«, bekam er von dem falschen Polizisten zur Antwort, der den Motor startete und den Rückwärtsgang einlegte, um den Mercedes aus der Parkbucht heraus zu rangieren. Kaum hatte sich der Wagen für ein paar Meter in Bewegung gesetzt, trat der Geiselnehmer beim Blick nach hinten heftig auf die Bremse. Rote Lichter. Die drei Männer in Alarmstimmung. »Hinter uns fährt auch einer rückwärts raus«, stellte der hinten sitzende Räuber verärgert fest.
Lackner spürte zum wiederholten Male an diesem Tag den Schock in allen Gliedern. Also doch Polizei. Wollte jetzt ein Spezialkommando die Ausfahrt blockieren? Ohne Rücksicht darauf, dass er noch in der Gewalt der Gangster war? Augenblicke eisigen Schweigens. Die Rücklichter des anderen Autos verrieten, dass es sich nicht bewegte.
»Wer ist das?«, fauchte der Uniformierte so unfreundlich wie bisher noch nie.
»Ein Wagen des Vorstands«, presste Lackner hervor. »Lassen Sie ihn raus.«
Die Köpfe aller drei Männer waren nach hinten gerichtet. Offenbar wartete der Fahrer des anderen Autos, bis er sicher sein konnte, dass es zu keiner Karambolage kommen würde. Zwei, drei Sekunden später rangierte er rückwärts heraus und verließ dann vorwärts mit einem kurzen Seitenblick auf Seifritz’ Auto die Tiefgarage über die sanft ansteigende Rampe zur Ausfahrt in Richtung Bahnhofsvorplatz.
Lackner atmete auf, die beiden Gangster schwiegen. Der Uniformierte setzte das abrupt gestoppte Ausparken fort, griff zu der Parkkarte, die Seifritz am frühen Morgen in die Mittelkonsole gelegt hatte, und ließ den Mercedes zur Schranke rollen. Als sie sich öffnete und der Wagen ans Tageslicht gelangte, schloss Lackner erschöpft die Augen. Sie hatten es geschafft. Offenbar war die Polizei noch nicht eingeschaltet worden. Es sei denn, es wurde bereits unauffällig observiert. Womöglich vom Bahnhof aus. Wenn dies so war, dann konnte es bei einem etwaigen Zugriff noch gefährlich werden.
8
Marion fror. Obwohl sie in eine Decke gehüllt war und sich auf der hölzernen Bank in eine Ecke kauern konnte, spürte sie die Kälte des Märzvormittags am ganzen Körper. Ihre Hände waren gefesselt, die Beine an den Knöcheln mit Klebeband fixiert. Die durchwachte Nacht, der Schock und das pure Entsetzen ließen sie keinen klaren Gedanken mehr fassen. Dazu die Angst um ihren Vater, um dessen Gesundheitszustand sie sich Sorgen machte. Außerdem schmerzten inzwischen ihre Handgelenke, die noch immer in den metallischen Schließen steckten. Der Mann, der sie seit Stunden bewachte, saß ihr schräg gegenüber auf einem Stuhl, schwieg beharrlich und sah nur hin und wieder auf seine Armbanduhr.
Obwohl es draußen längst hell war und durch die morschen Holzwände der Hütte das Frühkonzert der Vögel drang, herrschte in dem muffigen Raum nur gedämpftes Licht. Vor das kleine und einzige Fenster waren vergilbte und zerfetzte Vorhänge gezogen, an den Wänden lehnten Gartengeräte, die gewiss seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden waren. Marion hatte es inzwischen aufgegeben, ihren maskierten Bewacher nach dem weiteren Fortgang des Verbrechens zu fragen. Er schwieg beharrlich.
Irgendwann hatte sie es erschöpft aufgegeben, weitere Fragen zu stellen. Unter dem Handtuch, mit dem er ihren Kopf abgedeckt hatte, konnte sie ihn nur durch einen winzigen Spalt hindurch sehen. Er schien an ihrem Schicksal gänzlich uninteressiert zu sein und nur seinen Auftrag erledigen zu wollen, der da hieß, sie zu bewachen.
Nicht einmal auf die Frage nach der Uhrzeit wollte er eingehen. Doch Marion schien es inzwischen, als seien mehrere Stunden vergangen. Sie lauschte angestrengt in die Stille, um herausfinden zu können, wo sie sich befand. In der Ferne waren Autogeräusche zu hören und seit dem Morgengrauen häufig auch Flugzeuge. Dies konnte darauf hindeuten, dass sie tatsächlich irgendwo ins Remstal verschleppt worden war, wo an- und abfliegende Flugzeuge des nahen Stuttgarter Flughafens erfahrungsgemäß sehr tief flogen.
Nachdem der Gangster immer häufiger auf seine Armbanduhr geschaut hatte, nervös und zunehmend unruhiger, erhob er sich schließlich und sagte: »Okay.« Als habe ihm jemand ein Zeichen gegeben. Doch da war niemand gewesen. Er verließ die Hütte und verriegelte sie von außen.
Marion verharrte noch für ein paar Sekunden, versuchte, von draußen ein Geräusch wahrzunehmen, aber alles blieb still. Kein Auto. Nichts. Vielleicht, so überlegte sie, hatte sich der Räuber mit einem Fahrrad davongemacht.
Jetzt wollte sie schnell handeln. Mit den gefesselten Händen schob sie die Decke beiseite, sodass auch das Handtuch auf den Boden fiel, und begann umständlich, das Klebeband zu lösen, das seit Stunden ihre Knöchel zusammenpresste. Es dauerte einige Minuten, bis sie sich tatsächlich davon befreien konnte. Doch ihre Beine schmerzten, sodass sie sich nur mühsam erheben konnte, um zur Tür zu gehen. Die sich aber trotz heftigen Rüttelns nicht öffnen ließ.
Das Fenster. Natürlich. Es musste ein Leichtes sein, dort hinauszusteigen. Sie schob die Vorhänge beiseite und erkannte zufrieden, dass nicht nur eine fest eingebaute Glasscheibe zum Vorschein kam, sondern ein Fensterflügel, den man öffnen konnte.