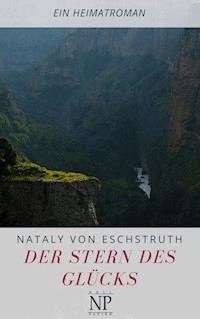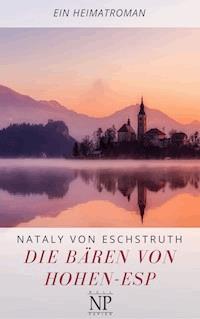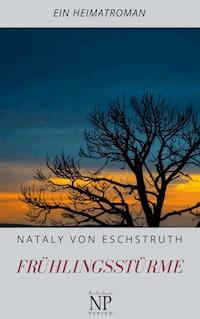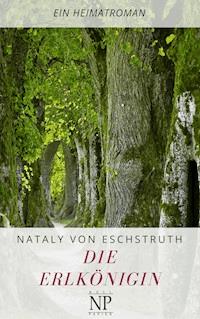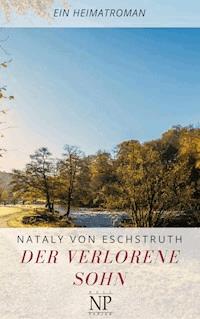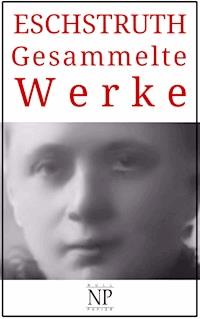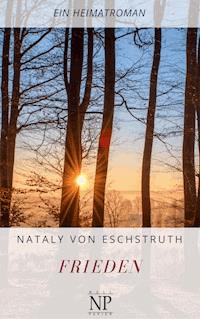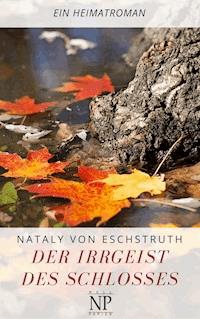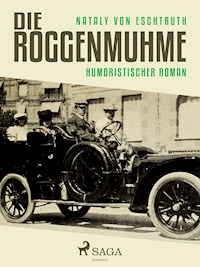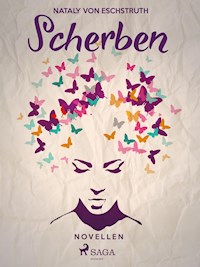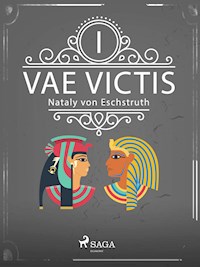Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Diese eindrucksvolle Geschichte lässt die Autorin in der Völkerschlacht von Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 spielen. Verzweifelt sucht Napoleon nach Verbündeten. Einer seiner Offiziere ist mit einem Brief unterwegs zu Napoleons Schwiegervater Franz I. von Österreich. Um sicherzugehen, möchte sich Napoleon aber auch an seinen alten Waffengefährten, den Marschall Bernadotte, wenden, der als schwedischer Kronprinz vor Leipzig liegt. Für diese gefährliche Aktion wählt der Kaiser den jungen Offizier Graf Guise aus. Es ist ein Ritt auf Leben und Tod. In der Dunkelheit verirrt sich der Graf. Als er ein Gutshaus erreicht, ist ihm nicht klar, ob sich in ihm Freund oder Feind verschanzt haben. Wie unsagbar groß ist aber seine Überraschung, als er dort anstelle von Soldaten die Gräfin Gabriele antrifft, die er einst in Paris kennengelernt hatte. Kaum dass sie sich ausgesprochen haben, erreichen feindliche Soldaten das Schloss. Jetzt geht es um alles.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Die Ordre des Grafen von Guise
Novellen
Inhalt:Die Ordre des Grafen von GuiseSymone
Mit Illustrationen von Aug. Mandlick und M. Flashar
Saga
Die Ordre des Grafen von Guise
© 1884 Nataly von Eschstruth
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711469910
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Die Ordre des Grafen von Guise.
Eine Erinnerung an die Tage von Leipzig.
I.
Der Himmel hatte sich schaudernd verhüllt, um die Greuel nicht mit anzusehen, unter welchen die Erde drunten erzitterte.
Ströme dampfenden Blutes schrieen zu ihm empor, brechende Augen flehten ihn an, Angstgeschrei und das Wimmern namenloser Qualen drangen zu ihm hinauf, und dazwischen gellten die Sturmglocken, dröhnten die Donner der Kanonen, knatterte, klirrte, rasselte und tobte es, wenn die Furie des Krieges stets neue Massen daherbrausen liess, die zuckenden Glieder der Verwundeten und Sterbenden, die getürmten Leichen in den schlammigen Boden zu stampfen.
Der Mann mit dem dreieckigen Hut auf dem Haupt, welcher mit untergeschlagenen Armen und finster dräuendem Blick neben Murat auf den Dämmen der alten Teiche bei Meusdorf auf und niederschritt, war es, welcher einst Rechenschaft über die vielen Tausende ablegen sollte, die seine Ruhmesgier, sein unersättliches Verlangen, seine wahnwitzige Selbstvergötterung, auf dem Schlachtfelde von Leipzig dahingeschlachtet.
Der Sturm heulte über die Ebene und zerrte den grauen Mantel des Imperators, gleichwie die Krone der zu hoch gewachsenen Pappel neben ihm, deren Zeit gekommen, da sie zurück in den Staub geschmettert werden sollte, aus welchem sie aufgewachsen.
Auch die Sonne, welche lange Zeit geduldig die Ungerechten bescheint, verhüllt endlich ihr Angesicht und überlässt es den vernichtenden Wettern, Rache zu üben und zu vergelten.
Der kleine, grosse Kaiser bleibt hochatmend stehen und hebt das Glas an die Augen, die Umgegend sorgsam zu durchspähen. Sein Antlitz zuckt unter der Aufregung, welche sich mehr und mehr des Mannes bemächtigt, welcher mit frivoler Hand ganz Europa die Gesetze geschrieben, und nun auf einsamer, sturmumtobter Höhe voll zitternder Erregung eines Federzuges harrt, durch welchen ein anderer, jüngst noch so spöttisch und übermütig Belächelter sein Schicksal bestimmen soll.
Murat neben ihm ist verstummt.
Er hat umsonst versucht, den grossen Feldherrn durch lebhafte Erzählungen von ungeheuren Verlusten, welche die Verbündeten erlitten, zu erheitern.
Napoleon glaubt es nicht mehr, sah er doch mit zusammengebissenen Zähnen, wie die Reiterei des Herzogs von Padua von Pfaffendorf her in wilder Flucht und grösster Unordnung teils nach Schönefeld, teils nach Leipzig zurückfloh. Husaren und Kosaken verfolgten sie — so war auch Eutritzsch in russischen Händen.
Und immer, immer noch keine Nachricht von seinem Schwiegervater. — Schwiegervater!
Lächerlich, dass ein Mann wie Napoleon sich plötzlich der verwandtschaftlichen Beziehungen mit Kaiser Franz so lebhaft entsann und sogar an dieselben appellierte. Er war ihm niemals ein besonders zärtlicher Schwiegersohn gewesen und hatte es selber mit ironischem Lächeln betont, dass Politik und Verwandtschaft durch eine himmelweite Kluft getrennt, ja dass erstere gleich einem Moloch sei, welcher selbst die eigenen Kinder als Opfer verschlingen würde.
Sollte Kaiser Franz von ihm gelernt und diese Ansicht gar zu seiner eigenen gemacht haben?
Nimmermehr! Der Übermut und die Verblendung eines Napoleon mussten erst den Beweis dafür in Händen halten, ehe sie solch Undenkbares glaubten.
General Merveldt musste schon längst bei Kaiser Franz angelangt — ja er musste eigentlich schon längst wieder mit der Antwort zu ihm zurückgekehrt sein. — Wo bleibt er?
Napoleon war ihm besonders freundlich begegnet, und ebenso, wie er sich ehemals mit dem österreichischen Unterhändler wegen des Waffenstillstandes von Leoben verständigt hatte, ebenso musste sich Kaiser Franz diesmal von ihm verständigen lassen, da Napoleon nun bei ihm um einen Waffenstillstand bat.
Sollten die Verbündeten in der That so klug sein, sich ihre schwer erkämpften Vorteile durch solch erheuchelte Friedensliebe nicht aus der Hand winden zu lassen? — Sie dachten vielleicht an Austerlitz und Tilsit. — Oder deuchten ihnen die Zusagen, welche er als Preis des Waffenstillstandes wegen Hannover, den Hansestädten und Polen gemacht, zu allgemein?
Immer grösser wird die Ungeduld und Aufregung des Imperators. Das Glas, welches er an die Augen hebt, erzittert. — Nichts, nichts Erfreuliches und Ersehntes spiegelt sich darin, nur die wüsten Feuerbrände der Dörfer, die entsetzliche grauenvolle Zerstörung ringsum. Er hat einen eigenhändigen Brief an den „lieben Schwiegerpapa“ geschrieben, einen Brief, welchen Merveldt zu besorgen hatte, und welcher trotz aller verwandtschaftlichen Vertraulichkeit immerhin so vorsichtig und politisch abgefasst war, dass er vor sämtlichen Alliierten verlesen werden konnte.
War das wirksam genug? Der Kaiser Franz befand sich zur Zeit in Rötha, die anderen Fürsten in seiner nächsten Nähe — die Antwort musste bereits zurück sein, wenn Merveldt das gewünschte Resultat erzielt. — Aber es kam keine Antwort, weder durch den Österreicher noch — durch den Grafen Guise.
Warum blieb auch Graf Guise so unerklärlich lange aus?
Als Napoleon in der Nacht, da Merveldt mit seinem Brief davongesprengt war, allein und finster sinnend in seinem Zelte sass, welches bei der Ziegelscheune aufgeschlagen und von dem grossen Wachtfeuer beleuchtet ward, kam ihm jählings der Gedanke, ob dieser offizielle Brief wohl das rechte Mittel sei, auf den Sinn des Kaisers zu wirken?
Wer kannte dessen tiefinnerste Herzenswünsche besser wie Napoleon, und welche Hand war so mächtig wie die des kleinen Korsen, sie, wenn auch ungern — zu erfüllen? Den 4. Dezember von 1805 konnte Kaiser Franz nicht vergessen, er krankte an seinem verlorenen Einfluss auf Italien und Deutschland. — Er sollte ihn wieder gewinnen — wenn heute, in dieser Stunde der Vernichtung, eine Hand die andere wusch. Ein Waffenstillstand allein konnte Napoleon vor vollständiger Niederlage retten; setzte Kaiser Franz denselben in seinem eigenen Interesse durch, wollte er es ihm alsdann auch seinerseits grossmütig vergelten.
Sein kaltes, unbewegliches Bronzegesicht erglänzte zum erstenmal unter feucht perlendem Schweiss, den ihm die zitternde Angst um seine Existenz, um die Gloire der grossen Nation auspresste. Kurz entschlossen griff er zu Feder und Papier und schrieb bei dem Schein der Kerze, deren Flamme der Sturm jeden Augenblick zu löschen drohte, einen Brief an seinen Schwiegervater, welcher für ihn wohl die sauerste Arbeit der Leipziger Tage war.
Sekret — ganz sekret. Kein anderes Auge durfte diese Zeilen lesen, als wie nur der, an welchen sie gerichtet waren.
Als Napoleon geendet, sprang er jach empor und schritt unruhig in dem beschränkten Zeltraum auf und nieder.
Der Regen klatschte auf die triefende Leinwand, und das Feuer draussen zischte und qualmte im Verlöschen.
Kein Stern am Himmel! — Ist Napoleons Hand in dieser Stunde zu schwach gewesen, selber einen neuen Glücksstern über sich aufzurichten, droht ihn die Nacht zu verschlingen, welche alle Siegesfackeln vergangener Tage nicht wieder erhellen können?
Noch einmal wägt sein kühler Verstand alle Vorteile und Nachteile ab, welche dieser geheime Brief ihm bringen kann, und da die Vorteile grösser sind, wie sie es stets sein müssen, wenn ein Napoleon grossmütig sein will, rührt er kurz entschlossen die kleine silberne Klingel, welche auf dem Tisch neben dem Schreibzeug steht.
Sein persönlicher Adjutant steht vor ihm.
„Den Kapitän a cheval Graf Guise!“ herrscht ihn der Korse an, ohne den finstern Blick zu heben, und wenige Augenblicke später verneigt sich der junge Reiteroffizier vor seinem Kaiser.
Napoleon bleibt vor ihm stehen, sein Adlerblick flammt sekundenlang wie in scharfer Prüfung zu dem blassen, geistvollen Gesicht des Kapitäns aus dem Reiterkorps von Sebastiani auf.
„Sie sind mir als besonders zuverlässig empfohlen, Graf“, stösst er kurz yervor, „darum möchte ich Ihnen eine Mission anvertrauen, welche ebenso viel Bravour wie Verschwiegenheit und Aufopferung verlangt!“
Das Antlitz des Genannten färbt sich in stolzer und dennoch bescheidener Freude rot.
„Sire“, antwortet er stramm, „möge Gott mir helfen, dieses ehrende Vertrauen zu rechtfertigen!“
Eine Minute tiefes Schweigen; die Blicke der beiden Männer senken sich tief in einander. Dann wendet sich Napoleon, schaut hinaus durch die Zeltthür, sich zu überzeugen, dass sie unbelauscht sind, und tritt dann dicht neben den jungen Offizier. Graf Guise muss sein Haupt herab neigen, um den Worten zu lauschen, welche der kleine Parvenu im Purpur ihm hastig, zischend beinahe, in das Ohr flüstert.
Die Zukunft Frankreichs, die Ehre der ganzen Nation in seiner Hand! — Wie ein Schwindel braust es durch das Haupt des jungen Kapitäns. Seine Brust hebt sich unter einem Atemzug unbeschreiblicher, beseligender Genugthuung.
„Ich schwöre Eurer Majestät, mir meines Auftrags in seiner ganzen, furchtbaren Bedeutung bewusst zu sein!“ sagt er mit bebenden Lippen.
Der Kaiser wendet sich zu dem Tisch, auf welchem ein Degen liegt. Er ist schlicht und einfach, nur eine kleine Kaiserkrone ziert als kaum bemerkbarer Schmuck den sehr derben, festen Griff.
Abermals flüstert er ein paar hastige Worte — ein kurz erklärender Handgriff — und er reicht dem Reiteroffizier die Waffe.
Mit stolz flammendem Auge nimmt sie Guise in Empfang und legt sie sogleich vor den Augen seines Monarchen an.
„Lecoq begleitet Euch. Er wird die Uniform eines Majors tragen, die Aufmerksamkeit des Feindes bei einem eventuellen Zusammenstoss mehr auf sich wie auf Euch zu lenken. Und somit Gott befohlen, mein wackrer Kapitän — Sie tragen die Grösse und den Ruhm von Frankreich — tragen Sie dieselbe mit Ehren an ihr Ziel!“
Wenige Minuten — ein hastig Herundhin — und dann klingt Hufschlag durch die stille Nacht, zwei Reiter sprengen voll wilder Hast einem unbestimmten Schicksal entgegen. Gehen sie unter in den Wogen des Verderbens, welches als grauenvolles Gespenst die Dunkelheit durchstreift, so sinkt mit ihnen die stolze Siegespalme des grossen Kaisers in den Staub.
Lange steht Napolon und starrt schweigend in die Nacht hinaus — das Jammergeschrei der Verwundeten schrillt durch die Stille, Feuergarben lohen zum Himmel, wenn Häuser und Scheunen in den brennenden Dörfern über ihren unglücklichen Opfern zusammenbrechen.
Eine in einen Mantel gehüllte Gestalt stand in einiger Entfernung und blickte gleichfalls schweigend in die Nacht hinaus.
Napoleon erkannte den sächsischen General Brause, welchen er wegen der Neuzusammenstellung seiner Division zu sich beschieden. Er trat neben ihn.
„Was überlegen Sie, General?“ fragte er kurz.
Brause wandte ihm sein ernstes, erregtes Gesicht zu:
„Ich überlege, Sire, wie man dem Elend auf den Schlachtfeldern zu Hilfe kommen könnte, die Angst- und Schmerzensschreie der Blessierten gellen bis hierher. Man könnte ihnen vielleicht so weit es angeht —“
Napoleon zuckte ungeduldig die Achseln und wandte sich brüsk ab.
„Wir haben mehr zu thun!“
„Es sind auch die Unsern, Sire, welche dort verbluten und verschmachten.“
Da zeigte ihm der Korse sein starres, erbarmungsloses Gesicht.
„C’est la guerre!“ erwiderte er kalt und zog sich in sein Zelt zurück, sich zu kurzem Schlafe nieder zu legen.
Brause aber stand regungslos und presste die zitternde Hand auf das Herz. Ihm war es, als blute dieses Herz weher als all jene Todeswunden auf dem Schlachtfelde drunten, als müsse es verbluten an dem bittern Schmerz, für diesen ehr- und gewissenlosen Tyrannen, für den schmählichen Unterdrücker seines Vaterlandes, für den Henker und Schlächter seiner Brüder die Waffe in der Faust zu halten! Da schäumte es wild über in der Brust des Generals, und die Feuersäulen, welche die Dörfer seines Heimatlandes in Asche legten, brannten ihm so grell und furchtbar in die Augen, dass sie auch in seiner Brust eine Flamme entzündeten, die grosse, heilige Flamme gerechten Zornes und einer Empörung, welche die Ketten der Knechtschaft zerbrechen und den Unterdrücker zu Boden schlagen will!
Brause stand an der Spitze seiner sächsischen Brüder, an der Spitze von Männern, welche nur die Gewalt gezwungen, für Napoleon zu kämpfen, welche, im Herzen treu und deutsch gesonnen, voll bittern Ingrimms solche Schmach ertrugen. Schürte es schon ihren Groll, mit ansehen zu müssen, wie übermütig und verächtlich der Korse und seine Marschälle das Sachsenhäuflein behandelten, wie viel Roheit, Willkür und Gemeinheit ihren Landsleuten widerfuhr, wie Sachsen durch diesen eigenen Alliierten verwüstet und ausgeplündert wurde, so lief das Mass vollends über durch den schmählichen Schimpf, welchen Ney den wackern Soldaten angethan, indem er den Sachsen die Schuld an der verlorenen Schlacht von Dennewitz zuschrieb, um durch solchen lügenhaften und verleumderischen Bericht die Ehre der französischen Armee auf Kosten der sächsischen zu retten.
Das nagte unvergessen an den Herzen der braven, heldenhaften Männer, und auch General Brause gedachte in diesem Augenblick mehr denn je dieser Schmach.
Er ballte die Faust über dem Herzen und starrte voll brennender Sehnsucht hinab in die Ebene, wo fern die preussischen Wachtfeuer brannten, und ein schwaches, windverwehtes Echo Klänge zu ihm herübertrug, welche nicht anders lauten konnten als: „Ein’ feste Burg ist unser Gott.“
Heisse Thränen brannten in den Augen des alten Mannes. Ja, ein’ feste Burg ist unser Gott! — Er, der Lenker der Schlachten, der Richter jeder fluchwürdigen Gewaltthat, wird auch ihn nicht verlassen, wenn er einen Plan zur Ausführung bringt, welcher immer dringender, immer gewaltiger sein Herz bewegt. Darf er es? Darf er? Noch schwankt er zwischen seiner Vaterlandsliebe, der Begeisterung für die deutsche Sache und dem Gehorsam gegen seinen armen, verblendeten König! Diese einsame Nachtstunde aber reift die Entscheidung. Er hatte mit General Ryssel einen eventuellen Übergang zu der Armee der deutschen Verbündeten bereits erwogen, doch hielt sie die unbestimmte Antwort ihres Königs, an welchen sie sich um Erlaubnis gewandt, noch in quälender Ungewissheit.
Auch jetzt noch zogen Zweifel aller Art marternd durch seine Brust, und doch war der Zeitpunkt der Entscheidung da und ein Entschluss dringend geboten. — Darf er es aber? — Darf er?
Napoleon plante eine Hinterlist, irgend einen Bubenstreich, welcher den Alliierten ihre so schwer erkämpften Siege noch im letzten Augenblick streitig machen sollte. Brause hatte beobachtet, dass der Kaiser in gang besonders heimlicher und wichtiger Angelegenheit zwei junge Reiteroffiziere soeben mit einem Befehl, oder, wie wohl eher anzunehmen, mit einem Handschreiben abgeschickt. — Wohin sonst, als zu Bernadotte, dessen krumme Wege und schleichende Winkelzüge längst verrieten, dass ihn nur die Berechnung auf Seite der Alliierten gestellt, er selber und seine volle Sympathie jedoch zu Napoleon hinneigten, jeden Augenblick bereit, um seinet- und der von ihm gebotenen Vorteile willen, seine Verbündeten schmählich zu hintergehen.
Sollten all jene Todeswunden auf dem Schlachtfelde rings vergeblich bluten? Sollte so manch liebe Heimatstätte seines Vaterlandes vergeblich zum rauchenden Schutthaufen zusammensinken? Nein! Tausendmal nein! Der König soll und muss sich fügen! Komme, was da wolle — deutsch und deutsch! Ein einig Volk von Brüdern wollen sie sein, Brust an Brust, gemeinsam den Räuber ihrer Ehre und ihrer Freiheit zu zermalmen!
Brause wandte sich flammenden Auges zu dem Zelt Napoleons.
„Komm nur grosser Cäsar, und fordere morgen Rechenschaft von mir! — Wirst du fragen: ‚Warum brachst du deinen Eid und liefst zum Feinde über?‘ — so werde ich mit deinen selben Worten erwidern: ‚C’est la guerre, Sire!‘“
Der General wandte sich hastig ab und schritt durch Sturm und Regen eilig in die Nacht hinein. Gegen die Dämme wandte er sich, um seine harrenden Ordonnanzen mit den Pferden zu erreichen.
Still und dunkel, nur die Posten schreiten auf und ab, Säbelklirren, Anrufe werden laut, und der General steigt hastig zu Pferde und trabt, nur von zwei Mann begleitet seiner Brigade entgegen. Immer noch erwägt er, immer noch schwankt er.
Der Mond bricht minutenlang durch das sturmzerfetzte Gewölk, und der Blick des alten Offiziers schweift scharf musternd in die Runde.
Da sieht er, wie eine dunkle Gestalt in hastigem Lauf einhält und sich dicht vor ihm in einen Graben niederwirft.
Was bedeutet das? Verräterei? Blessierte liegen hier nicht, oder sollte sich ein Unglücklicher bis hierher geschleppt haben in der Hoffnung, Leipzig zu erreichen?
Brause packt den Säbel fester und reitet scharf auf die Stelle zu.
„Qui vive? — Wer da?“ ruft er laut in die Stille hinaus.
Keine Antwort.
Abermals leuchtet der Mond, und der General sieht dicht vor sich eine Gestalt zusammengekauert liegen.
„Holla! Bist du blessiert? Antwort — oder es gibt Feuer!“
Da richtet sich der Schatten langsam empor und steht regungslos.
„Freiwilliger von der württembergischen Reiterbrigade Normann!“ klang es halb erstickt zu ihm empor.