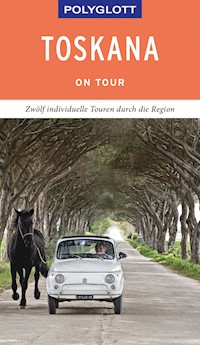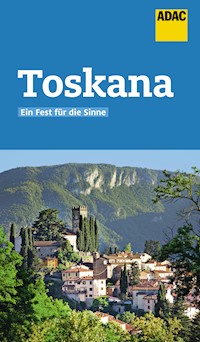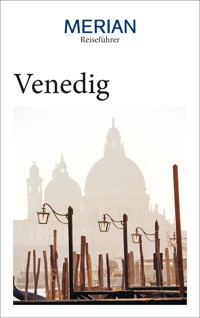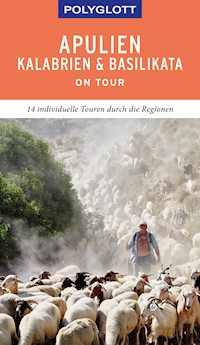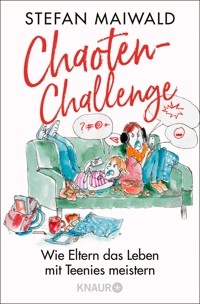Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Thalmeyer-Saga
- Sprache: Deutsch
Große Träume, Rebellion, vertraute Feinde und das Schicksal einer Familiendynastie. Selb in den 60er Jahren: Jana Thalmeyer, die Tochter der Porzellanmanufaktur-Geschäftsführerin Marie Thalmeyer, zieht es zum Jura-Studium nach München. Dort wird sie von einer neuen Zeit mitgerissen: Anti-Establishment-Proteste, Demonstrationen und Drogen bestimmen die neue Welt, in die die junge Frau eintaucht. Jana genießt die scheinbar unbeschwerte Zeit, doch schon bald gerät sie im wilden, glamourösen Schwabing in gefährliche Gesellschaft – Menschen, die Gewalt befürworten, Sabotageakte durchführen und sogar Attentate planen. Nach einem Streit überwirft sie sich mit ihrer Mutter. Marie und ihre jüngere Schwester Sophie haben nicht nur überraschend Erfolg mit Luxusporzellan und einer besonderen Zusammenarbeit mit Paul Bocuse, sondern kriegen es auch mit einem neuen Gegner zu tun: Abel Metsch, der die Druckerei seines Vaters übernommen hat und die einflussreiche Oberfränkische Stimme herausgibt, plant üble Intrigen gegen die Familie Thalmeyer … Als Marie lebensbedrohlich erkrankt, muss Jana sich entscheiden: Unterstützt sie ihre Familie und rettet das Porzellanerbe oder konzentriert sie sich weiter auf ihre eigenen Träume? Der Abschluss der großen Thalmeyer-Trilogie – ein detaillierter Einblick in die 60er Jahre und die Geschichte einer ganzen Generation! "Ein Roman so vielseitig und filigran wie Porzellan. Ein einzigartiger Einblick in die bewegte Zeit der 60er Jahre! Der würdige Abschluss einer großartigen Familiensage. Wunderbar recherchiert und mit viel Herz und Fingerspitzengefühl erzählt!" - Bestsellerautorin Ellin Carsta
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Stefan Maiwald
DIE PORZELLANMANUFAKTUR – Zerbrechliche Träume
Roman
Über das Buch
Große Träume, Rebellion, vertraute Feinde und das Schicksal einer Familiendynastie.
»Marie fand, das schickte sich nicht. Aber sie war nun mal hier. Und sie musste sich eingestehen: Sie hatte ein Bedürfnis nach Nähe. Nach Wärme. Vielleicht nach mehr. Jedenfalls nicht erneut nach Problemen, Bedenken, Sorgen.«
Selb in den 60er Jahren: Jana Thalmeyer, die Tochter der Porzellanmanufaktur-Geschäftsführerin Marie Thalmeyer, zieht es zum Jura-Studium nach München. Dort wird sie von einer neuen Zeit mitgerissen: Anti-Establishment-Proteste, Demonstrationen und Drogen bestimmen die neue Welt, in die die junge Frau eintaucht. Jana genießt die scheinbar unbeschwerte Zeit, doch schon bald gerät sie im wilden, glamourösen Schwabing in gefährliche Gesellschaft – Menschen, die Gewalt befürworten, Sabotageakte durchführen und sogar Attentate planen. Nach einem Streit überwirft sie sich mit ihrer Mutter.
Marie und ihre jüngere Schwester Sophie haben nicht nur überraschend Erfolg mit Luxusporzellan und einer besonderen Zusammenarbeit mit Paul Bocuse, sondern kriegen es auch mit einem neuen Gegner zu tun: Abel Metsch, der die Druckerei seines Vaters übernommen hat und die einflussreiche Frankenpost herausgibt, plant üble Intrigen gegen die Familie Thalmeyer …
Als Marie lebensbedrohlich erkrankt, muss Jana sich entscheiden: Unterstützt sie ihre Familie und rettet das Porzellanerbe oder konzentriert sie sich weiter auf ihre eigenen Träume?
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2024 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2024
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Vladimir Sukhachev / Shutterstock, Mr Doomits / Shutterstock, 1000 Words / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI books GmbH
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-030-1
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
1966
1. Kapitel
Grenzübertritt
2. Kapitel
Backfisch
3. Kapitel
Kinski
4. Kapitel
Der Reporter
5. Kapitel
Der Werber
6. Kapitel
Im Schlamm
7. Kapitel
Motorsport
8. Kapitel
Der Werber
9. Kapitel
Luca schraubt
10. Kapitel
Das liebe Geld
11. Kapitel
Die Verabredung
12. Kapitel
Schwestertermin
13. Kapitel
Joachim und Drafi
14. Kapitel
Die Qualifikation
15. Kapitel
Der Verleger
16. Kapitel
Abels Artikel
17. Kapitel
Abels Gedanken
18. Kapitel
Der große Tag
19. Kapitel
Die Kampagne
20. Kapitel
Der Helfer
21. Kapitel
Die Vereinbarung
22. Kapitel
Das Versprechen
23. Kapitel
Der Verleger
24. Kapitel
Der Umzug
25. Kapitel
Kinski dreht durch
26. Kapitel
Der Kandidat
27. Kapitel
Abendessen zu viert
28. Kapitel
Der Plan
29. Kapitel
Der Protest
30. Kapitel
Die gescheiterte Revolte
1967
31. Kapitel
Der Besuch
32. Kapitel
Die Wahl
33. Kapitel
Das Telefonat
34. Kapitel
Das Mittagessen
35. Kapitel
Der Abend
36. Kapitel
Feilschen
37. Kapitel
Gemeinheiten
38. Kapitel
Das letzte Loch
39. Kapitel
Die Schalte
40. Kapitel
Gewerkschaft
41. Kapitel
Leg dich nicht mit Sophie an
42. Kapitel
Und noch ein Werber
43. Kapitel
Werners Ansichten
44. Kapitel
Abel verwandelt
45. Kapitel
Der Manager
46. Kapitel
Der Deal
47. Kapitel
Toleranz
48. Kapitel
Die Konferenz
49. Kapitel
Sophies Eingreifen
50. Kapitel
Maries Vorschlag
51. Kapitel
Neue Liebe
52. Kapitel
Hollywood
53. Kapitel
Ein neues Opfer
54. Kapitel
Das Match
55. Kapitel
Die letzte Anfrage
56. Kapitel
Ein letztes Mal
57. Kapitel
Der Brief
58. Kapitel
Der beste Koch
59. Kapitel
Der Besuch
60. Kapitel
Die Reduktion
61. Kapitel
Volle Bücher
62. Kapitel
Einbußen
63. Kapitel
Das Geständnis
64. Kapitel
Die Flucht
65. Kapitel
Fränkisches Bier
66. Kapitel
Wiedersehen
67. Kapitel
Der Albtraum
68. Kapitel
Im Krankenhaus
69. Kapitel
Das viele Bier
Zur historischen Genauigkeit
Der Autor Stefan Maiwald
Widmung
Für Laura, Lilly und Bea
1966
1. Kapitel
Grenzübertritt
Es war ein frischer, leicht bewölkter Sommertag in London mit Temperaturen um 20 Grad, als Alan Ball, der Flügelstürmer vom FC Blackpool, am 30. Juli um 17.23 Uhr Ortszeit von rechts scharf in die Mitte flankte und Geoff Hurst fand, den Stürmer in den Diensten von West Ham United. Der drehte sich geschickt, zog aus kurzer Distanz ab, Torwart Hans Tilkowski von Borussia Dortmund war überwunden, der Ball prallte gegen die Unterkante der Latte und zurück in den Strafraum. Der Kölner Verteidiger Wolfgang »Bulle« Weber klärte den Abpraller ins Aus. Kein Tor, entschied der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst. Im Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen England und Deutschland vor 96.924 Zuschauern im Wembley-Stadion blieb es beim 2:2. Zumindest noch für wenige, äußerst konfuse Sekunden.
In diesen dramatischen Augenblicken fuhr Gustav, der ehemalige Schmuggler und jetzige Besitzer der örtlichen Autowerkstatt von Selb, auf die schwer bewachte deutsch-deutsche Grenze zu. Und zwar vom Osten aus. Ja, er befand sich auf einer menschenleeren Landstraße in der DDR, und auch noch in der Todeszone, wie es im Westen hieß, jenem praktisch bevölkerungsfreien Streifen unmittelbar vor dem Klassenfeind, in dem es Zwangsumsiedlungen gegeben hatte und Minen verlegt worden waren. Hier, in Thüringen, war es am 30. Juli bewölkt und regnerisch – schon der zweite Juli in Folge, der ziemlich ins Wasser gefallen war.
Der Grenzübergang Rudolphstein/Hirschberg war erst vor wenigen Wochen geöffnet worden, nachdem die im Krieg zerstörte Saalebrücke wiederaufgebaut worden war.
Gustav verfügte als Kleinunternehmer und Bringer von willkommenen Devisen über weitgehende Reisefreiheit, ein Diplomat war er jedoch noch lange nicht: Mit scharfen Kontrollen musste er jederzeit rechnen. Aber doch nicht heute, zum WM-Endspiel! Auch die DDR-Grenzposten würden lieber vor dem Radio hocken, als die passierenden Autos allzu genau zu kontrollieren, gar Gepäckstücke und Kofferräume öffnen zu lassen. Sie würden sich die Pässe zeigen lassen, und gut war es. Denn dieser Grenzübergang war ja ganz und gar nachrangig, die ostdeutschen Behörden konzentrierten sich lieber auf die typische Route der Schmuggler am stark frequentierten Grenzübergang Helmstedt/Marienborn.
Das hoffte Gustav jedenfalls.
Denn er war nicht allein im Auto.
Ein paar Monate zuvor war Gustav von einer Bekannten um Hilfe gefragt – nein, angefleht worden. Die Bekannte hatte eine alte Schulfreundin, die sie nach der Schulzeit wegen des Eisernen Vorhangs zunächst lange nicht mehr gesehen hatte. Marita spielte als Cellistin im DDR-Rundfunkorchester, hatte sich aber vor einem halben Jahr bei einem Konzert in Westberlin von der Reisegruppe abgesetzt, trotz scharfer Bewachung durch Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ihr Mann durfte nicht nachreisen und musste nun mit allerlei Drangsalierungen rechnen, sogar mit der Verhaftung, eine typische Sanktion für Angehörige von Republikflüchtlingen. Man wollte, dass fluchtbereite Menschen ihre Pläne wieder fallen ließen, weil es ihren Angehörigen danach böse ergehen würde.
Könne Gustav, bat die Bekannte, nicht was machen? Gustav lehnte zunächst ab, doch dann tauchte die Bekannte ein paar Tage später mit Cellistin Marita auf. Die Cellistin, eine blasse, zierliche Person, bekniete Gustav geradezu, ihr zu helfen, und brach sogar in Tränen aus. Wer konnte da schon Nein sagen?
Es gab viele Möglichkeiten, DDR-Bürgern zur Flucht zu verhelfen. Sicher war keine Methode, aber eine schien besser als jede andere zu sein. Also machte sich Gustav mit Luca an die Arbeit. Denn Luca Esposito hatte zum Kummer seines Vaters das Studium der Geschichte und Romanistik in Nürnberg abgebrochen, wollte auch trotz seines Geschicks mit Töpfen und Herden – er war ja praktisch im Restaurant aufgewachsen – von der Übernahme des Restaurants nichts wissen und hatte bei Gustav eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker gefunden; Motoren faszinierten ihn, er stellte sich äußerst geschickt an, und seine Gesellenprüfung stand unmittelbar bevor.
Aus einem BMW 1600 hatten sie nach einigen Experimenten die Rückbank ausgebaut und ganz unauffällig zehn Zentimeter nach vorn gesetzt. Die Kofferraumablage hatten sie etwas erhöht und in den so gewonnenen Platz einen hölzernen, trapezförmigen Verschlag eingebaut, sodass ein Hohlraum entstand, der einer Person Platz bieten könnte. Der schlaksige Luca hatte beim Ausprobieren arge Schwierigkeiten, sich in den Verschlag zu quetschen; beide mussten lachen.
Dann bestand Luca darauf, mitzukommen. Gustav weigerte sich, Luca bestand darauf: Zu zweit, so argumentierte er, war es einfach sicherer. Schließlich hatten sie schon gemeinsam so einiges geschmuggelt, früher, als das noch möglich gewesen war. Inzwischen war an einen Grenzübertritt zu Fuß überhaupt nicht mehr zu denken. Gustav blieb beim Nein.
***
Die Cellistin hatte mit ihrem Mann einen monatlichen Treffpunkt bei einer Bushaltestelle in Suhl ausgemacht, ganz früh am Morgen. Doch wer wusste schon, wer an dieser Bushaltestelle warten würde? Wer wusste, ob der Mann, immerhin ja mit einer Republikflüchtigen verheiratet, nicht überwacht würde?
An der Bushaltestelle war es so belebt, dass der Mann zunächst im viel zu engen Fond Platz nahm – ein riskantes Manöver, denn kein DDR-Bürger durfte so einfach in ein Westauto steigen. Doch niemand schien ihnen zu folgen. In einem Waldstück außerhalb der Stadt kletterte der Mann, der glücklicherweise weder groß noch massig war, mit einem Stoßgebet in den Verschlag. Obendrauf stellte Gustav handgeschnitzte Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge, die er für gute Devisen eingekauft hatte.
Und dann ging es in Richtung Grenze. Der BMW 1600, ein fast neuer schicker Viersitzer in beiger Farbe, dessen erstes Modell 1964 vom Band gelaufen war, war eigentlich ein viel zu auffälliges Auto für verbotene Aktionen, doch Gustav dachte um die Ecke: Würde ein Schmuggler oder ein Fluchthelfer wirklich mit einem so neuen, feinen Auto in der DDR aufkreuzen?
Er hielt auf den Grenzübergang zu. Dort wartete schon ein Grenzer vor seinem Unterstand, mit den Händen auf dem Repetiergewehr Karabiner 38. Gustavs Herz schlug schneller, und die Zeit verlangsamte sich. Er hatte den Krieg miterlebt, war Fallschirmspringer gewesen. Er wusste seine Angst für sich zu nutzen. Seine Sinne wurden ganz scharf; es schien, als könne er schon jetzt die Augenfarbe des Soldaten erkennen, die einzelnen Tropfen auf dem Wagendach unterscheiden, den sommerlichen, feuchten Westwind spüren, der die Karosserie umfasste.
Der BMW kam vor dem Schlagbaum zum Stehen. Ein Durchwinken kam ohnehin nie vor, wusste Gustav. Ein Warnschild forderte die Fahrer auf, den Motor abzustellen. Jetzt kam es darauf an. Sie waren das einzige Fahrzeug weit und breit. Natürlich, das Endspiel zwischen England und Deutschland. Wer war da schon auf den Straßen unterwegs?
Der Grenzer war ganz jung und offenbar neu, das war schlecht. Der würde Dienst nach Vorschrift machen und sich beweisen wollen. Ein weiterer Grenzer saß im Zollhäuschen auf der Beifahrerseite der Straße und würdigte die Szene keines Blickes. Er rauchte und starrte in die Luft. Gustav hielt ungefragt den Pass aus dem heruntergekurbelten Fenster. Der Grenzer ging damit ins Häuschen.
Und wenn sie doch den Kofferraum sehen wollen?, fragte sich Gustav zum hundertsten Mal. Im Zweifel würde er Vollgas geben müssen. Doch die Grenztruppen hatten für solche Fälle vorgesorgt. Mochte auch der Schlagbaum von den 83 PS des BMW ausgehebelt werden können – doch das war keineswegs sicher –, führte die Strecke anschließend fünfhundert Meter über ganz freie, von Bäumen gerodete Fläche bis auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik; Zeit genug, um viele gezielte Schüsse abzugeben.
Nach ein paar Minuten kam der Grenzer wieder hinaus. Das Beunruhigende: Er war nicht allein, der ältere begleitete ihn, überließ aber dem Jungspund das Wort.
»Zweck Ihres Besuches in der Deutschen Demokratischen Republik?« Er sagte den Satz ganz gelangweilt auf, wie ein Schulreim. Es war klar, dass er ihn schon viele Male gesagt hatte. Dennoch musste Gustav wachsam bleiben.
»Import von handwerklich hochwertigen Produkten.« Gustav zeigte auf die Rückbank, auf der zwei in Papier eingeschlagene, aber in ihrer Form sichtbare Weihnachtspyramiden standen. Zwei weitere lagen im verkleinerten Kofferraum.
»An einem Samstag?«
»Meine Kunden schlafen nie.«
Nun war es entscheidend. Der Jüngere blickte prüfend in die Pässe, der Ältere ging um den Wagen herum und blieb vor Gustavs Fenster stehen. Er hatte keinen Karabiner, sondern trug nur eine Pistole im Holster.
»Drei zu zwei«, sagte er schließlich.
»Äh, pardon?«
»Na, für die Tommys«, erklärte der Grenzer. »Der Linienrichter hat das Tor doch gegeben. Russe halt.«
»Wie viele Minuten sind’s noch?«, fragte Gustav, ehrlich interessiert.
»Höchstens fünf. Ich hoffe, der Seeler oder der Müller schaffen noch den Ausgleich.«
Der jüngere Grenzer reichte Gustav den Pass, wünschte eine gute Fahrt und hob den Schlagbaum.
2. Kapitel
Backfisch
Die ersten Monate des Jahres 1966 verlaufen in der Bundesrepublik und in ganz Europa äußerst turbulent. Am 7. Januar unterstützt die Bundesregierung den Eintritt der USA in den Vietnamkrieg, zehn Tage später stürzt über der südspanischen Stadt Palomares ein US-Bomber vom Typ B-52 mit vier Atombomben an Bord ab (sie werden in einer dramatischen Suche allesamt wiedergefunden). In Frankreich tritt am 1. Februar die volle juristische Gleichberechtigung der Frauen in Kraft, und in Österreich bekommt die ÖVP bei den Nationalratswahlen am 6. März erstmals die absolute Mehrheit und bildet eine Alleinregierung. Am 10. März fordert die Abgeordnetenkammer Luxemburgs Entschädigungen von der Bundesrepublik für im Zweiten Weltkrieg zwangsrekrutierte Luxemburger, am selben Tag heiratet Kronprinzessin Beatrix der Niederlande ausgerechnet einen Deutschen – Skandal! –, nämlich Claus von Amsberg. Am 23. März wird Ludwig Erhard neuer Parteivorsitzender der CDU, und das Außenministerium weist die Forderung Luxemburgs zurück, da alle Ansprüche bereits abgedeckt seien. Am 24. März findet eine erregte Debatte über den Einsatz des Kampfflugzeugs Starfighter statt, der bei der Luftwaffe bereits den Spitznamen »Witwenmacher« bekommen hat – 51 Flugzeuge sind bis dato abgestürzt, 27 Piloten ums Leben gekommen. Massive Schmiergelder sollen an deutsche Politiker geflossen sein, um den Deal mit den anfälligen Flugzeugen zu genehmigen. Am 8. April wird Leonid Breschnew zum Generalsekretär der KPdSU ernannt, am 5. Mai gewinnt erstmals eine deutsche Mannschaft einen europäischen Pokal: Borussia Dortmund holt sich mit einem 2:1 gegen den FC Liverpool den Europapokal der Pokalsieger. Am 12. Mai stellt die Deutsche Bundespost den Betrieb der letzten Handvermittlungsstelle für innerdeutsche Gespräche ein – das Fräulein vom Amt stirbt damit aus –, und am 18. Mai entdecken Fischer bei Duisburg einen Weißwal im Rhein, der von der Presse »Moby Dick« genannt wird und viel Aufsehen erregt. Am 28. Mai wird der TSV 1860 München deutscher Fußballmeister.
Auch bei Marie und Sophie Thalmeyer, den beiden Porzellanschwestern, hatte sich viel verändert. Der arme Wolfi war längst tot, die Arthrose hatte ihm so sehr zu schaffen gemacht, dass Marie ihn einschläfern lassen musste. Das war ein ganz bitterer Moment gewesen. Wer hätte gedacht, wie sehr einem so ein Tier ans Herz wachsen konnte? Doch schon war ein neuer Hund ins Haus gekommen, ein treuherziger, verschmuster Bernhardiner, den die kleine Jana »Wuschel« genannt hatte – einen Namen, für den sie sich nun, da sie aufs Abitur zuging, arg genierte. Wuschel leistete Marie am Vormittag im Büro Gesellschaft, am Nachmittag Jana bei ihren Hausaufgaben.
Lina, die gute Seele aus der Oberpfalz, konnte nicht mehr den Haushalt führen und hatte eine ehemalige Mitarbeiterwohnung gegenüber von der Manufaktur bezogen. Dennoch war sie fünf Tage in der Woche in der Thalmeyerschen Villa und half, wie sie eben konnte.
Karl Metsch war 1959 an einem Herzinfarkt gestorben. So recht hatte er sich von seiner Gefängnishaft nie mehr erholt. Marie schickte ein Beileidstelegramm, das unbeantwortet blieb. Schon zuvor hatte Karls Sohn Abel die Familiengeschäfte an sich gerissen, tatkräftig unterstützt von der nimmermüden Mutter Alexandra, die auch jetzt noch, nach fast sieben Jahren, mit ihrem Witwenschwarz durch Selb spazierte. Sie war noch ein wenig hagerer geworden und ging leicht gebückt; die Kinder fürchteten sich vor ihr.
Auch der alte Stuhlfauth war tot. Er hatte testamentarisch dreißig Prozent der Anteile an der Kaolingrube der Kriegsgräberfürsorge vermacht, siebzig Prozent aber den Schwestern überlassen, was eine großzügige Geste war und die Porzellanmanufaktur finanziell spürbar entlastete. Denn die Nachfrage ließ nach. Dem Wirtschaftswunder war ein wenig die Luft ausgegangen; gut, dass die Schwestern in der Zwischenzeit klug gewirtschaftet hatten. Die Manufaktur hatte die Zahl ihrer Angestellten verdoppelt, gut vierzig Personen arbeiteten nun für die Schwestern.
Sophie hatte ihre schweren Unfallfolgen fast völlig überstanden, sie hinkte nur noch ganz leicht und konnte es geschickt kaschieren. Wer nicht darauf achtete, merkte nichts. Ihre lebenslustigen Locken waren genauso voll, ihre Rundungen waren noch ein wenig ausgeprägter geworden, und die Bewerber standen nach wie vor Schlange. Sie ging mit manchen Männern aus, was für ordentlich Klatsch im Ort sorgte; eine ernste Sache war aber bislang nie draus geworden.
Marie war nach wie vor eine schöne Frau mit einer beinahe aristokratischen Aura, die ihr nur Dummköpfe als Arroganz auslegten, und sie weigerte sich, die grauen Strähnchen zu färben. Marie und Sophie hatten beide die große Liebe ihres Lebens auf tragische Weise verloren, und sie hatten viele Schlachten zu schlagen gehabt, um die Porzellanmanufaktur, die in der fünften Generation der Familie gehörte, zu erhalten. Mochte das Leben sie beide auch abgehärtet haben: Von Verhärmung war keine Spur, im Gegenteil.
Maries Tochter Jana hingegen machte ein wenig Kummer. Nicht in der Schule, wo sie nun in die Abschlussklasse des Gymnasiums ging: Ihre Noten waren exzellent, in vielen Fächern war sie Jahrgangsbeste. Doch sie gab sich schroff zu ihrer Mutter, auch ihre Tante Sophie konnte kaum mit ihr reden. Sie aß immer nur kurz mit der Familie, antwortete auf jede Frage so knapp wie möglich und zog sich dann auf ihr Zimmer zurück. Dort las sie Bücher, von denen selbst die belesene Marie noch nie etwas gehört hatte. Marie hatte es mit Strenge versucht, mit einem klärenden Gespräch, dann wieder mit Strenge. Nichts hatte geholfen. Es war, als lebte Jana in ihrer eigenen Welt, denn auch Freundinnen hatte sie keine. Nur manchmal, wenn es kühler wurde und der Kamin munter brannte, dann kam sie runter, setzte sich mit einem ihrer Bücher auf das Sofa neben Marie und las fleißig. Marie konnte sie dabei zärtlich am Oberarm berühren, ohne dass die Tochter sofort murrte, und das genoss die Mutter sehr. War sie das, die magische Kraft der Literatur?
Nur mit Onkel Joachim, der alle zwei Wochen aus München nach Selb kam, verstand sie sich blendend, lachte und blühte regelrecht auf. Joachim konnte es daher kaum glauben, wenn ihm die Schwestern von den Schwierigkeiten mit Jana berichteten.
»Es fehlt einfach der Vater«, sagte Marie.
»Das stimmt doch nicht«, widersprach Sophie energisch. »Du machst das wunderbar, und unsere Familie ist eine gute Clique. Es kann Jana gar nicht besser gehen. Das sind halt die üblichen hormonellen Wallungen in dem Alter. Das vergeht schon, wirst sehen.«
»Also ein Backfisch«, seufzte Marie, um sich selbst zu beruhigen.
»Teenager heißt das heute«, grinste Sophie.
3. Kapitel
Kinski
Im deutschen Fernsehen hatte sich einiges getan: Ein zweites Programm war hinzugekommen, dazu Regionalsender. Die ARD sendete von 10 bis 23 Uhr, das ZDF begann ab 14 Uhr. Nachts summte das Testbild aus den klobigen und sehr, sehr teuren Schwarz-Weiß-Fernsehern. Besonders beliebt waren Übertragungen aus dem Ohnsorg-Theater, die Bergführer-Geschichten von Luis Trenker und das »Spiel ohne Grenzen«, moderiert von Camillo Felgen. Heinz Schenk präsentierte erstmals die Show »Zum Blauen Bock«, die Preisverleihung der Goldenen Kamera feierte Premiere, und Borussia Dortmunds Sigfried Held weihte die Torwand des ZDF-Sportstudios ein; er traf zweimal.
Joachim Thalmeyer ging es blendend: Der Älteste der Geschwister fungierte in der Porzellanmanufaktur als stiller Teilhaber und überließ den Schwestern die Geschäftsführung. Seine Welt waren die Musik und das Fernsehen. Die von ihm erdachte Show »Was bin ich?«, die seit 1955 lief, wurde ein großer Erfolg, aber erst im zweiten Anlauf: Denn zunächst lief sie unter dem sperrigen Titel Ja oder Nein. Ein psychologisches Extemporale mit sieben unbekannten Größen. Joachim Thalmeyer hatte dagegen protestiert, doch die Granden des Bayerischen Rundfunks wollten unbedingt den Anschein einer Sendung fürs Bildungsbürgertum bewahren.
Robert Lembke wurde Moderator, weil sich niemand anders dafür gemeldet hatte – paradiesische Zeiten! Als erster Gast war eine gewisse Tilde Bublitz-Lindmayer geladen, deren Beruf (Friseurin) erraten wurde. Der erste Stargast, drei Folgen später, hieß Vico Torriani.
Doch dann ließen die Quoten nach, erst in einer Neuauflage mit einem pfiffigeren Rateteam, darunter dem Schweizer Guido Baumann, wurde die Sendung zum Erfolg. Und sie hieß nun »Was bin ich?« Für wochenlangen bundesweiten Gesprächsstoff sorgte die Folge, in der sich eine Hausfrau vorstellte; das Rateteam erriet ihren Beruf spät. »Könnte Ihr Beruf von einem Mann ausgeführt werden?«, wollte Ratefuchs Baumann wissen. Lembke entschied: »Sagen wir Nein.«
Auch wenn Joachim Thalmeyer keine Tantiemen bekam, wusste man doch sehr genau, wem man diesen Fernsehschlager zu verdanken hatte – eine Schau, die von so vielen Deutschen gesehen wurde und die dabei so wenig in der Produktion kostete, dass es fast ridikül war. Die Teilnehmer konnten maximal fünfzig Mark gewinnen, auch der Moderator bekam kaum etwas: Es wäre nicht viel billiger gewesen, eine weiße Wand abzufilmen.
Die Künstler, die Joachim als Agent unter Vertrag hatte, machten nahezu ausnahmslos Karriere. Joachim hatte ein Händchen für das, was die Menschen wollten. Unterhaltung mit einem Schuss Exotik. Und deswegen konnte sich vor allem die junge Caterina Bravo, die auf Italienisch und Französisch singen konnte und trotz akzentfreiem Deutsch beim Singen bei manchen Wörtern hin und wieder einen leichten südländischen Akzent einstreute, vor Anfragen kaum retten.
Viel wichtiger aber: Die Edgar-Wallace-Reihe, für die er gemeinsam mit dem österreichischen Regisseur Harald Reinl so vehement gekämpft hatte, war in den Kinos hervorragend angelaufen. Der vermeintliche Schönling Fuchsberger, dem viele eine tragende Rolle gar nicht zugetraut hätten, machte sich ausgezeichnet in seinen verschiedenen Rollen als Privatermittler oder Polizeiinspektor, Eddi Arendt, meistens als Butler gecastet, war unverzichtbar geworden, Karin Dor, Uschi Glas und der völlig erratische Klaus Kinski wurden zu Stars. Auch die Drehorte funktionierten bestens, obwohl die Geldgeber und TV-Bosse skeptisch gewesen waren: Mit ein bisschen Rauch, Nebel und einem entsprechenden Auto außen sowie Kolonialstilmöbeln und Teeservice innen wurde aus jedem deutschen Straßenzug und aus jeder Villa das perfekte London-Setting. Ein paar kurze hinzugekaufte Außenaufnahmen, etwa vom Verkehr am Piccadilly Circus oder von einem Frachtschiff, das unter der Tower Bridge hindurchfuhr, machten die Illusion komplett. Zwanzig Filme waren entstanden, allein in diesem Jahr würden drei neue in die Kinos kommen und von bis zu drei Millionen Besuchern gesehen werden. Und wenn die Filme später im Fernsehen ausgestrahlt wurden, saß halb Deutschland auf dem Sofa.
Joachim Thalmeyer hielt sich von Klaus Kinski fern, dabei waren sie beinahe Nachbarn in Schwabing. Kinski lebte in der Elisabethstraße zur Untermiete bei einer älteren Dame und hatte sich sein Zimmer knöchelhoch mit Laub ausgelegt.
Er war auch schon seltsam und geradezu gefährlich, als er noch nicht berühmt war. In seinen Tobsuchtsanfällen schmiss er Geschirr, wenn die Hemden nicht perfekt gebügelt waren.
Joachim war froh, als Co-Produzent nicht am Set sein zu müssen. Erst letzte Woche hatte der Regisseur seinen exzentrischen Schauspieler gelobt und gesagt, seine Darbietung sei »sehr gut« gewesen. Daraufhin war Kinski mit wahnhaft aufgerissen Augen auf den Regisseur zugestürmt und hatte die Arme in die Luft geworfen: Sehr gut, sagst du? Sehr gut? Ich sage dir, wie ich war: ICH WAR EPOCHAL!
Nein, von solchen Menschen sollte man sich fernhalten
Dennoch war es Kinski, der eines Tages auf ihn zukam. Er solle ihn vertreten, weil alle anderen doch nur Idioten und Kretins seien. Er schrie die Worte dramatisch heraus, ein normales Sprechen schien ihm unmöglich. Aber er, Joachim Thalmeyer, scheine ganz in Ordnung, befand Kinski, als er sich sein blondes, selbst geschnittenes Haar aus der glänzenden Stirn wischte.
4. Kapitel
Der Reporter
Doch das war nicht die einzige merkwürdige Begegnung in Joachim Thalmeyers neuem, glamourösen Leben mitten im aufstrebenden deutschen Fernsehen und Film, die doch so dringend auf der Suche nach neuen Stars waren. Generell waren seine Arbeitstage bestimmt von exzentrischen Gestalten, und da schien es beinahe eine Wohltat, als sich Paul Meyerheinrich bei ihm vorstellte, ein junger Reporter der einflussreichen Münchner Abendzeitung, gut gekleidet, mit leiser Stimme und von einem etwas ungewöhnlichen Äußeren, denn die Trapezform seines Gesichts mit großer Stirn und spitzem Kinn wurde noch verstärkt durch das dicke, gelblich blonde Haar über seinen Ohren, während es hoch oben schon auf dem Rückzug war.
Der junge Reporter hatte Joachim Thalmeyer viele Wochen lang telefonisch um ein Treffen geben, ihn umschmeichelt mit Worten wie »Alleswisser« und »Strippenzieher«, sodass Joachim schließlich zugestimmt hatte, obwohl er extrem viel zu tun hatte.
Also hatten sie sich zuerst in der Hotelbar des Bayerischen Hofs in München auf einen Drink verabredet, und Meyerheinrich, der Joachim gleich das Du anbot, wollte einen großen Report über die neue deutsche Film- und Fernsehwelt schreiben. Joachim, ansonsten ein cleveres und abgebrühtes Kerlchen, der die Lagerhaft in Russland überlebt hatte, verließ sich auf sein Bauchgefühl und wurde nicht misstrauisch. Reklame, das hatte er längst (und früher als andere) begriffen, war überlebenswichtig in diesem Geschäft, und die Illustrierten und Tageszeitungen bildeten eine echte Macht. Auch an ihnen lag es, wer ein Star wurde und wer ganz schnell verglühte.
Nun also saß der Reporter neben ihm, ein Sitzriese, der deutlich kleiner als Joachim war, auf dem Barhocker aber auf Augenhöhe mit ihm redete.
»Und was genau wollen Sie – also, was willst du schreiben?«
»Na ja«, lächelte der Reporter, »so ganz genau weiß ich das auch noch nicht. Aber ich will unseren Lesern erzählen, wie es hinter den Kulissen der Filmwelt zugeht.«
»Verstehe«, sagte Joachim, obwohl er es nicht verstand.
»Ja, weißt du, unsere Leser lieben die Stars. Muss ich dir ja nicht erklären. Was wären wir ohne euch vom Film? Man kann ja nicht immer nur über Politik schreiben, Krieg und Steuern. Nein, wir brauchen den Glitzer.«
»Schön gesagt.«
»Danke. Und ein Blick hinter die Kulissen – das hat es noch nicht gegeben.«
»Aber du weißt schon, dass ich dir da wenig zu bieten habe? Ich muss ja diskret bleiben.«
»Natürlich.« Paul legte seine Hand in einer vertraulichen Geste auf Joachims Unterarm. »Ich könnte ja auch nicht einfach so über meinen Arbeitsplatz reden. Aber es wäre wunderbar, wenn du mir ein paar Türen öffnest. Mich mit ein paar Stars sprechen lässt. Die sind doch sowieso alle in deiner Tasche.«
»So würde ich das nicht ausdrücken«, antworte Joachim zögerlich.
»Vertrau mir, das wird eine flotte Sache. Eine tolle Geschichte für beide von uns.«
Joachim nickte. Und Paul zückte seinen Notizblock.
5. Kapitel
Der Werber
Eine ganz neue Form von Unternehmen schoss in diesen Jahren aus dem Boden wie Pilze nach einem sommerlichen Regenguss: sogenannte Werbeagenturen. Die Reklame hatte ihren schlechten Ruf verloren, die Menschen vertrauten wieder dem, was sie im Fernsehen oder schwarz auf weiß gedruckt in den Tageszeitungen und Magazinen sahen. Natürlich hatt es Werbeagenturen auch schon früher gegeben, doch neu waren nun die sogenannten Spots, die in den Kinos vor den Filmen liefen, aber auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn auch in streng reglementierten Zeitfenstern und im ZDF versüßt durch die beliebten Mainzelmännchen, die allerdings einen Sturm der Entrüstung entfachten – würden etwa so die schutzlosen Kinder besonders perfide verführt, die Reklame zu schauen?
Aber das waren letztlich kleinere intellektuelle Scharmützel, welche weder die Bevölkerung noch die Unternehmer interessierten. Werbung war nicht nur unverzichtbar geworden, sondern längst Teil der Unterhaltung. Konsumenten jeden Alters konnten die berühmtesten Werbespots mitsprechen, etwa »4711: weltberühmt durch Qualität«, »Wer wird denn gleich in die Luft gehen?« für HB-Zigaretten, »Frauengold schafft Wohlbehagen – wohlgemerkt an allen Tagen«, und alle konnten mitsingen: »Herr Wirt, Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt, wir wollen Coca-Cola haben, und zwar, und zwar sofort«, »Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück«, »Kommt keine zu mir – zwei Worte, ein Bier!« Der kleine Koch Fridolin von Maggi erschien ungefragt an den Tischen der Familien, kritisierte vor der entsetzten Hausfrau und der peinlich berührten Tischgesellschaft das fade Essen und pries seine Würzsauce an. Und die Unternehmen freuten sich über immer stärker steigende Umsätze. Reklame, daran gab es keinen Zweifel, wirkte.
»Wir müssen da was machen«, fand Sophie.
»Ich glaube, unser guter Ruf sollte uns reichen«, entgegnete Marie.
Sie saßen in der Thalmeyerschen Villa beim Abendessen, das Lina gekocht hatte. Jana war wie immer schon früher fertig geworden, um auf ihr Zimmer zu stürmen, weil sie noch Hausaufgaben zu erledigen hatte.
Am Herd war Lina nach dem Krieg regelrecht aufgeblüht, hatte die Rezepte der Region perfektioniert und manchmal sogar verfeinert, denn die harten Kriegs- und Nachkriegsjahre hatten ihren Erfindungsreichtum gesteigert – und vor allem hatte sie nun zu schätzen gelernt, dass alle beliebigen Zutaten zur Verfügung standen. Dennoch behandelte sie jedes Rezept mit großer Ehrfurcht und kochte mit viel Liebe. Der freche Fridolin von Maggi hatte an der Thalmeyerschen Tafel nichts verloren. Die mit Zwiebelwürfeln gebratene Gans, die sie heute servierte, war ihr ausgezeichnet gelungen, typisch oberfränkisch gewürzt mit Majoran und Beifuß und nicht etwa wie in Norddeutschland mit Äpfeln, Dörrpflaumen und Nüssen gefüllt; das hatte ihr der selige Harry Kruskopp berichtet. Dazu gab es Klöße nach Frankenwälder Art: Lina hatte den rohen Kartoffelbrei mit gekochter Kartoffelmasse gebrüht, dann die Kartoffelstärke hinzugegeben und kräftig durchgerührt. Dazu brauchte es kräftige Arme, über die Lina trotz ihres fortgeschrittenen Alters verfügte.
Bloß in den Beinen war sie nicht mehr fit. Die Arthrose in ihren Knien machte ihr arg zu schaffen, sie musste sich beim Kochen oft abstützen. Und sie versuchte, es vor den Schwestern zu verbergen. Was ihr bislang gut gelang.
***
»Der Markt ist riesig, und wir könnten doch so viel mehr produzieren!« Sophie steigerte sich mit ihrer typischen Begeisterungsfähigkeit richtig in das Thema rein. »Wer nicht wirbt, der stirbt, heißt es.«
»Ach bitte, jetzt übertreibst du«, winkte Marie ab, als Lina den Nachtisch brachte, Polsterkrapfen auf evangelische Art, mit dünnerem, knusprigerem Teig. Auch Jana kam runtergelaufen, setzte sich an den Tisch und aß gleich zwei Stück mit Wonne.
»Dir schmeckt’s ja«, freute sich Marie.
Doch bevor ein Gespräch zustande kommen konnte, war Jana schon wieder oben verschwunden. Die Schwestern sahen ihr nach, Sophie zuckte mit den Schultern und war gleich wieder bei ihrem momentanen Lieblingsthema.
»Wäre doch eine feine Sache, wenn wir plötzlich in ganz Deutschland bekannt wären.«
»Willst du was gelten, mach dich selten, hat Papa immer gesagt.«
»Ausgerechnet Papa. Der doch immer wie ein Geck durch den Ort flaniert ist.«
Marie musste grinsen. Ja, das stimmte. Ludwig Thalmeyer, der viel zu früh verstorben war, hatte es genossen, im feinen Rock und mit Zigarre durch Selb zu spazieren, überall ein Schwätzchen zu halten und Komplimente für seine gut gehende Firma und die hübschen kleinen Töchter entgegenzunehmen.
»Du wirst doch zugeben, dass es nicht schaden kann, unsere Marke bekannter zu machen!«
»Ja, aber nur bei den richtigen Leuten.«
»Dafür sind doch diese Agenturen da! Die versprechen dir eine Werbung, die genau die Leute erreicht, die wir erreichen wollen.«
»Ja, klar versprechen sie dir das«, sagte Marie. »Aber ich habe noch ein Sprichwort für dich: Frage nie einen Frisör, ob du einen Haarschnitt brauchst.«
Sophie lachte auf. »Der ist gut. Woher hast du den Spruch denn?«
»Lebenserfahrung«, flüsterte Marie, plötzlich ganz nachdenklich. Ihre Augen starrten ins Nichts, und Sophie kannte diese Anwandlungen ihrer Schwester, die immer wieder unvermittelt ganz still wurde.
In den letzten Jahren waren sie trotz aller Gegensätze noch enger zusammengerückt. Sophies Harry war bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen, der beinahe auch Sophie zum Verhängnis geworden wäre, und John McNarney, der Vater von Maries Tochter, war in Washington einer alten Kriegsverwundung erlegen. Beide Schwestern waren danach keine weiteren Beziehungen eingegangen – sie einte der Wille, das Familienunternehmen voranzubringen. Marie verwaltete die Manufaktur, Sophie war für den Außendienst zuständig. Insbesondere Sophie, die ja ständig in der Republik unterwegs war, bekam ständig Blumen, Einladungen zu Restaurantbesuchen und sogar eindeutigere Angebote, obwohl sie nach wie vor ihren Ehering trug. Doch der Richtige war nie dabei, weder für Sophie noch für Marie. Und: Ihnen fehlte nichts. Das versicherten sie sich jedenfalls. Sie hatten ja genug zu tun mit der Manufaktur, der Verwaltung, den Mitarbeitern, dem Vertrieb, der Buchhaltung.
»Lass es uns doch mal versuchen.« Sophie holte ihre große Schwester in die Gegenwart zurück. »Wir treffen uns einfach mal mit einem dieser Reklameleute.«
»Ganz unverbindlich?«
»Ganz unverbindlich. Irgendwo in einem Restaurant. Wo wir«, setzte Sophie lächelnd hinzu, »auch schnell wieder fliehen können.«
»Das hast du wohl bei den Verabredungen mit aufdringlichen Großeinkäufern gelernt?«
»Ganz genau. Soll ich was arrangieren? Es gibt da eine Münchner Agentur mit Dependance auch in Nürnberg, die mir geeignet scheint.«
»Also schön.« Marie wusste: Widerspruch war bei Sophie in diesem Stadium einfach zwecklos.
6. Kapitel
Im Schlamm
Ein Bulldozer schob mit qualmendem Dieselmotor gewaltige braune Erdmassen vor sich her, und zwei Männer befüllten einen Grünbunker, indem sie mit Spaten auf der Ladefläche eines Kleinlasters standen und von dort den feinen Sand über die Seitenplanke in die ausgehobene Grube schütteten. Bernhard von Limburger, der erfahrene Golfplatzarchitekt, den alle Welt nur Limmy nannte, stand am Rand der Grube, ebenfalls mit einem Spaten in der Hand, und gab Anweisungen. Ab und zu glättete er den Sand.
Obwohl Michael McNarney ein guter Golfer war und auch vom sogenannten Layout eines Platzes so einiges verstand, war es doch Limmy, der dafür sorgte, dass bei ihrem gemeinsam erdachten Platz alles von Beginn an richtig gemacht wurde. Denn ein Grünbunker war nicht einfach nur ein Loch, in das man Sand zu schütten hatte. Zunächst mussten an der tiefsten Stelle Dränstränge und Sickerrohre gelegt werden, um Regenwasser ablaufen zu lassen. Der Sand musste eine spezielle, gleichmäßige Körnung haben (das war teuer) und etwa zehn Zentimeter hoch geschichtet sein, an den Wänden bis zu fünf Zentimeter. Der umgebende Rasen musste extrem stabil sein, damit der Golfer beim Hinein- und Hinausgehen die Bunkerkante nicht kaputt trat. Und das regelmäßige Harken schon jetzt, in der Bauphase, sollte verhindern, dass Pflanzen Wurzeln schlagen würden.
Auch im Aufbau eines Grüns steckte mehr Arbeit, als Michael das gedacht hatte. Erst ein aufwendiges Drainagesystem (»ist hier in Deutschland leider notwendig«, erklärte Limmy), dann eine Kiesschicht, um das Wasser schnell abzuleiten; diese Kiesschicht musste von Hand geglättet werden, damit die schweren Maschinen nicht den ondulierten Aufbau wieder zerstörten. Dann der Oberboden, die sogenannte Keimschicht und schließlich die Saat einer speziellen Grasart. Limmy ließ sich nicht lumpen, und Michael wusste nun, warum der Bau eines Golfplatzes so viel Geld kostete.
Apropos Geld: Er hatte sich von Marie eine stattliche Summe leihen müssen, denn Limmy war mal wieder knapp bei Kasse gewesen. Der Deutsche versprühte aber seinen üblichen – und für diese Menschen beinahe außergewöhnlichen – Optimismus, der auf den jungen Amerikaner ansteckend wirkte.
Es hatte vor ein paar Stunden geregnet, nun brach die Sonne durch die Wipfel des Mischwaldes. Es war Nachmittag, und Limmy blinzelte in den aufklarenden Himmel.
»Weißt du, was wir jetzt machen?«
»Nein.«
»Jetzt spielen wir.«
Michael blickte verblüfft, aber Limmy war schon im Clubhaus verschwunden, wie er es scherzhaft nannte, einer ziemlich erbärmlichen Wellblechhütte, in der sich die Geräte stapelten. Heraus kam er mit seinem Golfbag. »Teilen wir uns«, sagte er und teete den Ball mitten auf der Wiese auf.
»Hier so ungefähr wäre der erste Abschlag, oder?«
»Ja, genau.«
»Na, dann los!«
Und sie hatten einen mächtigen Spaß, als sie quer über das Gelände stapften und Bälle aus Schlamm und Pfützen auf imaginäre Fahnen schlugen. Dabei diskutierten sie die möglichen Platzierungen, Limmy holte sogar einen Notizblock aus der Innentasche seines Tweed-Jacketts hervor und machte sich Notizen. Auch von dem Hügel, den der Bulldozer gerade zusammengeschoben hatte und der ein Abschlag werden sollte, schlugen sie Bälle in die Ferne.
»Irgendwann werden wir auch hier Drainagen legen müssen«, sagte Limmy. »Dann kannst du auch bei Regen spielen. Und hier, mein lieber Amerikaner, regnet es häufiger als in Kalifornien, und der Boden ist nicht so schön sandig wie in Schottland oder Irland, wo das Wasser sofort aufgesogen wird und auf Nimmerwiedersehen verschwindet.« Die Augen hinter den runden Brillengläsern funkelten unternehmungslustig.
Sie standen auf Bahn neun, einem kurzen, aber tückischen Par 4, das vom Abschlag eine leichte Biegung nach rechts beschrieb und dessen Grün deutlich oberhalb der Spielbahn lag, und gerade hatte Michael nach einem sehr guten Abschlag ein kurzes Eisen ins Grün geschlagen, das sich in einer majestätischen Parabel in Richtung Fahne senkte. Limmy schickte sich an, ihm auf seine übliche Weise Bewunderung zu zollen, als Mike, der noch im Finish stand, ein Röcheln hörte. Erschrocken drehte er sich um und sah, dass sein Geschäftspartner auf die Knie gesackt war und ganz flach atmete. Er sprang zu ihm und half ihm auf die Beine, stützte ihn mit der Schulter. Beide wankten in Richtung Clubhaus. Als sie an der Hütte angekommen waren, fegte Mike mit der freien Hand ein paar Arbeitsgeräte von einem Holzschemel und setzte Limmy dann darauf ab. »Verdammter Blutdruck«, keuchte Limmy, der ganz weiß im Gesicht war. Sein runder, properer Körper war ganz eingefallen, wie ein erschlafftes Kissen.
»Zu hoch oder zu niedrig?«, fragte Mike, der zum ersten Mal in seinem Leben mit so etwas konfrontiert war.
»Zu niedrig. Aber es geht schon wieder. Muss was essen, glaube ich.«
In dem Moment traf der Mann im Clubhaus ein, der den Bulldozer bedient hatte. Mike erklärte hastig die Situation, und der Mann holte aus seiner Brotdose, die er dort abgestellt hatte, eine Wurststulle, brach sie mit seinen schmutzigen Händen in zwei Teile und gab eine davon dem Architekten, der begierig hineinbiss – es war jetzt nicht die Zeit, allzu pingelig über Hygiene nachzudenken. Beinahe sofort kam wieder Farbe in seine Wangen.
»Feierabend für heute«, sagte der Bulldozerfahrer in seinem schlammverschmierten Arbeitskittel. Aber Mike und Limmy sahen nach ihrer improvisierten Golfrunde auch nicht gerade sauberer aus. »Ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt, aber unser Lohn ist doch schon seit ’ner Woche überfällig, und ich wollt fragen, ob nicht …«
Limmy, der immer noch zusammengekauert auf dem Schemel saß, hob die Hand. »Schon gut, schon gut«, mümmelte er. »Heute hab ich’s nicht dabei, morgen bekommt ihr alles.«
Der Bulldozerfahrer nickte und verabschiedete sich. Draußen hörte man Gemurmel, er setzte wohl die beiden Arbeiter von der Situation in Kenntnis. Richtig, der Lohn war tatsächlich überfällig, dachte Mike – dabei hatte Limmy doch gesagt, er würde sich darum kümmern.
Limmy hatte den letzten Bissen heruntergeschluckt und schien vollständig wiederhergestellt. »Ich brauche«, sagte er nun zu Mike, »eventuell deine Hilfe.«
7. Kapitel
Motorsport
Es war nicht erst das Wirtschaftswunder, das die Autobegeisterung der Deutschen entfachte: Das Volk der Tüftler und Ingenieure – und der Erfinder des Automobils – war auch schon vor dem Krieg ganz verrückt nach Motorsport gewesen. Das Idol vieler Deutscher hieß damals Rudolf Caracciola, ein schnittiger Rennfahrer aus bestem Hause und der erfolgreichste Fahrer, den das Land je hervorgebracht hatte. Von seinen Kollegen nur »Karratsch« genannt – denn wer wollte schon einen italienischen Namen aussprechen? –, gewann er erst auf dem Motorrad einige bedeutende Rennen, dann, im Jahr 1926, völlig überraschend und bei üblem Wetter, auf vier Rädern den Großen Preis von Deutschland auf der Berliner Avus-Rennstrecke. 1927 gelang ihm auf dem neu gebauten Nürburgring der Geniestreich, als er in der engen Linkskehre absichtlich mit zwei Rädern in den Straßengraben fuhr und so mit höherer Geschwindigkeit wie auf Schienen um die Kurve schoss. Später gewann er bedeutende Bergrennen und zahlreiche Grand-Prix, darunter 1936 den berühmten Großen Preis von Monaco, ein Rennen, bei dem er sich noch 1933 ganz schwer verletzt hatte. Auch bei der Mille Miglia und den 24 Stunden von Le Mans konnte er siegen. Sein Geschwindigkeitsrekord von 432,7 km/h in einem Mercedes Benz W 125, aufgestellt 1932, sollte noch viele Jahrzehnte bestehen bleiben.
Luca war natürlich noch viel zu jung gewesen, um die Triumphe Caracciolas mitbekommen zu haben, auch wenn ihm sein Vater später oft und gern davon erzählt hatte, schließlich war der tollkühne Rennfahrer, Enkel eines Weinhändlers, ja auch irgendwie Italiener.
Nein, Lucas’ Idol war Wolfgang Graf Berghe von Trips, der trotz schwerer Krankheiten in der Kindheit, darunter Kinderlähmung und Hirnhautentzündung, ein würdiger Nachfolger Caracciolas wurde. Seine ersten Rennen hatte er unter dem Pseudonym »Axel Linther« bestritten, damit sich seine Eltern keine Sorgen machen mussten. Erst fuhr er in einem VW Käfer, dann in einem Porsche 356 A, später im Ferrari. Er war ein echter Bruchpilot und bekam von der internationalen Presse den Spitznamen »Count Crash«. Aber trotz gebrochener Gliedmaßen und Rückenwirbeln und monatelang getragenen Gipsverbänden und Korsetts war ihm immer wieder das Comeback gelungen, und 1961 führte er sogar die Gesamtwertung in der Formel 1 an, bis zu jenem schwarzen Tag beim Großen Preis von Italien in Monza, als er in der zweiten Runde mit Jim Clark kollidierte, aus seinem Boliden geschleudert wurde und mit Genickbruch sofort tot war. Der führerlose Ferrari 156 durchbrach die Drahtabzäunung und tötete fünfzehn Zuschauer. Ganz Deutschland trauerte, und Luca versah das Poster, das er von Graf Berghe von Trips im elterlichen Zimmer über dem Bella Venezia hatte, mit einem Trauerflor.
Aber sein sehnlichster Wunsch, Rennfahrer zu werden, wurde eher noch größer.
***
Bald ging es los mit kleineren Straßenrennen, die oft lokal organisiert waren; mal stiftete ein örtliches Autohaus einen Pokal oder einen Gutschein für einen neuen Reifensatz, mal gab es einen kleinen Siegerscheck, den man von den Antrittsgeldern zusammenkratzte. Das bedeutendste Rennen in Franken fand jährlich auf dem Norisring statt, einem Stadtkurs aus dem Jahr 1947, wo sich erst Motorräder, dann Rennautos maßen. Zweimal hatte Luca dort schon zugeschaut, zuletzt 1964, als von 65 Wagen nur 44 ins Ziel kamen; der enge, kurvenreiche Kurs ging brutal auf die Reifen, sodass Hobby-Rennfahrer ohne Team im Rücken kaum eine Chance hatten. In der Klasse der GT-Wagen gab es einen kuriosen Vorfall, denn Zweiter wurde ein US-Amerikaner mit dem Namen James Bond. Doch trotz mehrmaliger Aufforderungen per Lautsprecher erschien der Mann nicht zur Siegerehrung – hatte er, so witzelte man auf den Tribünen, einen dringenden Geheimauftrag von M erhalten?
Lucas erstes Rennen, bei dem er selbst antrat, war der Marktredwitz-Preis, ein Straßenrennen über hundert Kilometer. Mit seinem VW Käfer wurde er Vorletzter, aber er ließ sich nicht entmutigen: Schon im zweiten Rennen namens Rund um Bamberg landete er im Mittelfeld, und nur ein Wochenende später wurde er in heftigem Regen bei der Bayreuth-Trophy sogar Fünfter. Andere Fahrer wurden auf den jungen Mann aufmerksam, einige gratulierten. Lucas körperliche Fitness durchs Box- und Krafttraining kam ihm zugute, denn Autorennen waren Schwerstarbeit, und viele seiner Gegner – Adlige und Industriellensöhne – legten mehr Wert auf Champagner, schöne Frauen und maßgeschneiderte Rennjacken aus Leder, statt sich mit Hanteln herumzuquälen. Luca hingegen ging noch dreimal die Woche am Abend zum Training bei Hansi Prell, dem ehemaligen fränkischen Meister im Mittelgewicht, in den »Kampfsportverein Wunsiedel«, und die Fahrt dorthin nutzte er mit seinem Fahrzeug – inzwischen hatte er einen BMW 700 – für kleinere Belastungstests, wie er das nannte. Da wurde etwa eine Kurve auf der leeren Landstraße mal so schnell genommen, dass das Auto ausbrechen wollte. So bekam er jeden Tag ein wenig mehr Gespür für das, was er da steuerte.
Natürlich, Luca war ein ganz kleines Licht im deutschen Rennsport. Nur manchmal assistierte ihm Gustav, aber ein echtes Team konnte er sich unmöglich leisten. Er trat stets nur mit einem Reifensatz an, während viele andere Fahrer während des Rennens wechselten und so viel höheres Tempo gehen konnten.
Aber: Luca machte nicht nur mit Kraft, sondern auch mit Talent vieles wett. Dass er als begabter Automechaniker auch genau wusste, was dort vorn im Motor passierte, war ein weiterer kleiner Vorteil: Manchmal fühlte er sich, als wären er und das Auto ein einziges gut funktionierendes Lebewesen. Die meisten anderen Rennfahrer hatten für so etwas ja Hilfskräfte und interessierten sich eher wenig für Zylinder, Bremsbeläge, Zündverteilerantriebswellen oder Ölschlauchanschlüsse.
Und er analysierte die Rennen – diejenigen, die er gefahren hatte und diejenigen, die er noch fahren wollte. Er wusste, auf welchen Strecken er mithalten konnte und wo er nahezu chancenlos war. Er wusste auch, dass schlechtes Wetter ihm entgegenkam: Auf nassen, rutschigen Straßen waren die PS-Vorteile der leistungsstärkeren Autos nahezu dahin, es kam dann viel mehr auf das fahrerische Können an. Da reichte es bei Weitem nicht, den Fuß einfach nur auf dem Gaspedal zu lassen. Extrem kurvenreiche Strecken hingegen ließen die kostbaren Räder allzu schnell verschleißen, er konnte nicht alles geben, wenn er bis zum Ziel durchhalten wollte. Ideal wäre ein langer, hügeliger Rennkurs. Und am besten noch im Regen.
Luca hatte da eine Idee. Eher ein Hirngespinst. Gustav sagte er noch nichts. Und er überlegte, wie er es hinbekommen konnte.
8. Kapitel
Der Werber
Sie hatten einen Tisch im Bella Venezia reserviert. Giuseppe Esposito, der Besitzer, längst ein guter Freund der Familie Thalmeyer, war agil wie eh und je, ging von Tisch zu Tisch, um seine Spezialitäten anzupreisen und zu erklären, aber bei den Schwestern blieb Bepi besonders lange stehen. Das dritte Gedeck machte ihn neugierig, und Sophie, die den fragenden Blick auffing, schwatzte unbekümmert drauflos: »Wir warten auf einen Mann von einer Werbeagentur.«
»Ah, die Reklame!«, rief Bepi mit aufgeregt geweiteten Augen. »Sehr gut, die Porzellanmanufaktur geht mit der Zeit! Das muss ja auch so sein. Löblich, löblich.«
Sophie nickte Marie triumphierend zu, die versuchte, ihr Grinsen zu unterdrücken, aber es gelang ihr nicht. Ja, so war es wohl, man musste mit der Zeit gehen und sich all diese neuen Versprechungen der Reklame zunutze machen.