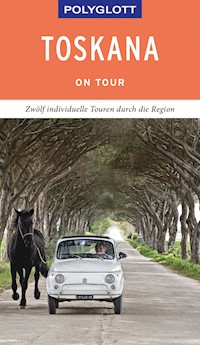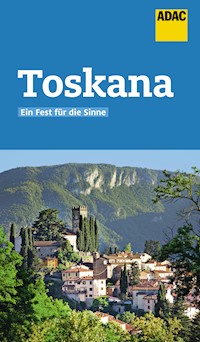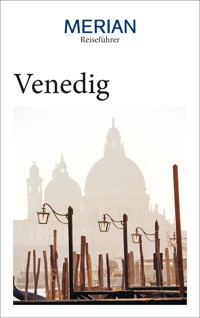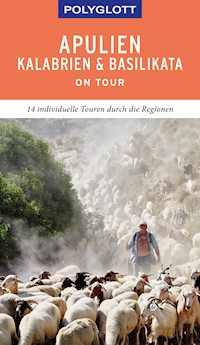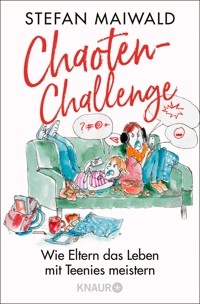Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Thalmeyer-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine Porzellanmanufaktur in Scherben. Ein im Krieg verschollener Bruder. Eine Familiendynastie zur Zeit des Wiederaufbaus. »Sie stand jetzt in der Verantwortung. Für sich, für ihre Liebsten. Und für die Arbeiter in der Manufaktur und ihre Familien.« Selb, die Heimat des weißen Goldes, 1947: Als der Familienpatriarch Ludwig Thalmeyer überraschend verstirbt, muss Marie als älteste Tochter die traditionsreiche Porzellanmanufaktur übernehmen. Mühsam arbeitet sie sich in das Geschäft ein, wird jedoch als junges Fräulein kaum ernst genommen. Unterstützung erhält sie von ihrer jüngeren, wilden Schwester Sophie. Insgeheim hoffen beide, dass der in Russland verschollene Bruder Joachim nach Hause zurückkehrt, auch wenn er als Pianist dem Unternehmen schon lange vor dem Krieg den Rücken gekehrt hat … Deutschland befindet sich im Wiederaufbau und viele Menschen suchen in ihrer Verzweiflung ihr Glück auf dem Schwarzmarkt, um zu überleben – keine einfache Situation für die Porzellanmanufaktur, die immer wieder Probleme hat, Kaolin zu beschaffen. Um dies zu lösen, muss Marie mit dem mächtigen Papierfabrikanten Karl Metsch zusammenarbeiten, der seine Macht missbraucht. Ausgerechnet er wird kurz darauf der neue Bürgermeister und setzt alles daran, die Porzellanmanufaktur zu ruinieren – und zwingt Marie zu einer riskanten Entscheidung … Zwischen Wiederaufbau, florierendem Schwarzmarkt und jeder Menge Geheimnissen suchen zwei junge Frauen den Weg zum Erfolg – und zu ihrer Liebe, denn Maries Wahl fällt ausgerechnet auf den stellvertretenden US-Militärgouverneur John McNarney. Doch bald darauf muss dieser zurück in seine Heimat … Der Auftakt der großen Thalmeyer-Trilogie – ein detaillierter Einblick in die Jahre der Nachkriegszeit und die Geschichte einer ganzen Generation! "Dramatisch, emotional, inspirierend: Eine Reise in eine Zeit, die so fragil ist wie das Porzellan selbst." – Bestsellerautorin Ellin Carsta
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Stefan Maiwald
DIE PORZELLANMANUFAKTUR Zerbrechlicher Frieden
ROMAN
Über das Buch
Eine Porzellanmanufaktur in Scherben.
Ein im Krieg verschollener Bruder.
Eine Familiendynastie zur Zeit des Wiederaufbaus.
»Sie stand jetzt in der Verantwortung. Für sich, für ihre Liebsten. Und für die Arbeiter in der Manufaktur und ihre Familien.«
Selb, 1947: Als der Familienpatriarch Ludwig Thalmeyer überraschend verstirbt, muss Marie als älteste Tochter die traditionsreiche Porzellanmanufaktur übernehmen. Mühsam arbeitet sie sich in das Geschäft ein, wird jedoch als junges Fräulein kaum ernst genommen. Unterstützung erhält sie von ihrer jüngeren, ungestümen Schwester Sophie. Beide hoffen, dass der in Russland verschollene Bruder Joachim nach Hause zurückkehrt, auch wenn er als Pianist dem Unternehmen schon lange vor dem Krieg den Rücken gekehrt hat.
Deutschland befindet sich im Wiederaufbau – keine einfache Situation für die Porzellanmanufaktur, die immer wieder Probleme hat, Kaolin zu beschaffen. Marie muss mit dem Papierfabrikanten Karl Metsch zusammenarbeiten, der seine Macht missbraucht. Kurz darauf wird ausgerechnet Karl Metsch der neue Bürgermeister und zwingt Marie zu einer riskanten Entscheidung …
Zwischen Wiederaufbau, florierendem Schwarzmarkt und jeder Menge Geheimnissen suchen zwei junge Frauen den Weg zum Erfolg – und zu ihrer Liebe, denn Maries Wahl fällt ausgerechnet auf den stellvertretenden US-Militärgouverneur John McNarney. Doch bald darauf muss dieser zurück in seine Heimat …
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2023 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2023
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Happy Stock Photo / Shutterstock, DedMityay / Shutterstock, GreenLandStudio / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI books GmbH
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-026-4
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
Teil I: 1947
1. Kapitel
Der Schmuggel
2. Kapitel
Die Übergabe
3. Kapitel
Der Geburtstag
4. Kapitel
Der Überraschungsgast
5. Kapitel
Die Nachwirkungen
6. Kapitel
Die Schneiderin
7. Kapitel
Die Buchführung
8. Kapitel
Der Zocker
9. Kapitel
Die Flak
10. Kapitel
Das Fest
11. Kapitel
Die Boxer
12. Kapitel
Die Nähstube
13. Kapitel
Der Traum
14. Kapitel
Das Treffen
15. Kapitel
Der Apotheker
16. Kapitel
Das Werben
17. Kapitel
Der Strauß
18. Kapitel
Der Italiener
19. Kapitel
Die Entscheidung
20. Kapitel
Das Lager
21. Kapitel
Romantische Tage
22. Kapitel
Die Versammlung
23. Kapitel
Der Herr der Fliegen
24. Kapitel
Verschwendete Jugend
25. Kapitel
Die Rückzahlung
26. Kapitel
Die Unterstützung
27. Kapitel
Das Heimspiel
28. Kapitel
Swingmusik
29. Kapitel
Der Plan
30. Kapitel
Der Ausbruch
31. Kapitel
Das Verhör
32. Kapitel
Der Brief
33. Kapitel
Schmetterlingsärmel
34. Kapitel
Der zweite Versuch
35. Kapitel
Schuld und Sühne
36. Kapitel
Die Verlobung
37. Kapitel
Der Rückkehrer
38. Kapitel
Der Zauberer
39. Kapitel
Die Hypothek
40. Kapitel
Harry enthüllt
41. Kapitel
Im Trockenen
42. Kapitel
Die Order
Teil II: 1948
43. Kapitel
Die Heimkehr
44. Kapitel
Der Neuanfang
45. Kapitel
Metsch zieht die Schrauben an
46. Kapitel
Ein gefährliches Spiel
47. Kapitel
Die Hochzeit
48. Kapitel
Das Gedicht
49. Kapitel
Der Coup
50. Kapitel
Nachwuchs
51. Kapitel
Der Erdrutsch
52. Kapitel
Nachricht aus Washington
53. Kapitel
Keine Kuckucksuhren
54. Kapitel
Harry hilft
55. Kapitel
Schiffe und U-Boote
56. Kapitel
Kurierdienste
57. Kapitel
Harrys Plan
Teil III: 1949
58. Kapitel
Die Konjunktur
59. Kapitel
Der Denunziant
60. Kapitel
Alexandras Rache
61. Kapitel
Ein uraltes Gesetz
62. Kapitel
Die Besucherin
Nachwort
Zur historischen Genauigkeit
Stefan Maiwald: Die Porzellanmanufaktur – Zerbrechliche Hoffnung: Leseprobe 1. Kapitel
Klar zum Entern
2. Kapitel
Der Klau
Der Autor Stefan Maiwald
Und so geht es weiter:
Der dritte Band:
Weitere historische Romane im Verlag
Band 2 unserer Allsberg-Trilogie:
Band 3 unserer Allsberg-Trilogie:
Widmung
Für Laura
Teil I: 1947
1. Kapitel
Der Schmuggel
Während Marie Thalmeyer mit Hilfe ihres Dienstmädchens die bestickte Decke auf der Mahagoniplatte ausbreitete, das Silberbesteck hervorholte und die Vasen mit Schnittblumen befüllte, lag er im Dreck des Waldes. Das Gebell der Hunde wurde endlich leiser. Hatte er es überstanden? Suchscheinwerfer vom neu errichteten Wachturm stocherten in der Nacht umher, erhellten die Baumwipfel und erloschen schließlich. Er drückte das Gesicht bis auf den Boden, spürte die feuchte Erde auf der Wange, roch die Wildgräser, den Lehm. Seine Atemluft bildete Wölkchen.
Dann war es still. Die Kälte dieser Frühlingsnacht kroch unter seinen zerschlissenen Ledermantel. Die Mondsichel erhellte die Umgebung ein klein wenig, gerade so, dass er die nächsten Schritte planen konnte. Er war die Dunkelheit gewohnt, und den Schleichweg bis zur Grenze kannte er gut.
Aber heute war irgendetwas anders als sonst. Er konnte es nicht genau beschreiben, hatte es nur im Gefühl. Die Jahre an der Front hatten seine Sinne geschärft. Waren plötzlich mehr Soldaten unterwegs? Halfen nun auch die Russen den Tschechen beim Kontrollieren? Hatte er vorhin tatsächlich zwei T-34-Panzer gesehen, so nah am amerikanischen Sektor? Und die Suchscheinwerfer – das waren keine Funzeln mehr, sondern diese wattstarken Strahler, die im Krieg bis zu den Bombern im Himmel gereicht hatten.
Er stand vorsichtig auf und hob den Lederbeutel an die Brust. So ganz agil war er nicht mehr; diese illegalen, ja lebensgefährlichen Ausflüge machten ihm mehr und mehr zu schaffen. Aber es nützte ja nichts. In diesen Zeiten gab es keine andere Möglichkeit. Er hatte drei Kinder, und die Jüngste litt an Rachitis, kein Wunder in diesen Zeiten des Mangels. Der Krieg war gerade zwei Jahre vorbei, und jetzt war es fast noch schwieriger, frisches Obst und Gemüse zu bekommen – oder überhaupt nur irgendetwas Nahrhaftes. Und die Medikamente waren teuer.
Der amerikanische Sektor lag direkt vor ihm, keine dreihundert Meter entfernt. Die Luft schien rein. Er verließ die Deckung.
Und dann splitterte es neben ihm, Holzstücke flogen ihm ins Gesicht. und erst dann hörte er den Knall: Die Patrone war auf Brusthöhe in den Buchenstamm eingeschlagen. Er warf sich erneut zu Boden, auf die weiche, dicke Ledertasche. Hatten sie ihn doch entdeckt?
Doch langsam beruhigte er sich. Der Schuss musste von weither gekommen sein, der Schall kam spät an. Das wusste er noch aus seiner Zeit bei den Fallschirmjägern – wenn du den Knall gehört hast, bist du nicht getroffen worden.
War es ein Zufallsschuss? Vage in seine Richtung? Unmöglich, in dieser Dunkelheit so weit zu sehen. Er wusste, dass die Tschechen und auch die Russen gern mal in Richtung Westen feuerten, besoffen von Wodka und höllischem Selbstgebrannten.
Und wie er es aus seiner Zeit im Krieg kannte, überkam ihn plötzlich diese gleichgültige, vollkommene Schicksalsergebenheit. Er konnte nicht noch mehrere Stunden so liegen bleiben. Wenn er heute sterben musste, dann war es eben so. Also stand er auf.
Die Nacht blieb still, bis auf den Ruf einer Eule und das Knacken der Äste unter seinen Stiefeln.
Zügig und ohne sich umzuschauen setzte er seinen Weg fort.
2. Kapitel
Die Übergabe
Der Kiesweg zur Villa war geharkt und vom Unkraut befreit. Das hatten die Flüchtlinge erledigt, die dort drüben im Wirtschaftsgebäude der Porzellanmanufaktur wohnten und Hilfsarbeiten für die Thalmeyers verrichteten. Einer war schon früh auf den Beinen und traktierte eine morsche Tür mit Schleifpapier. Familien aus Böhmen und Mähren waren hier untergekommen und hatten es gut getroffen – kein Vergleich zu den hoffnungslos überfüllten Auffanglagern mit ihren Zwanzig-Bett-Zimmern und Latrinen und undichten Dächern.
Er hatte die Nacht nach dem Grenzübertritt daheim verbracht, mit drei Stunden Schlaf und wirren Träumen. Dann hatte er sich auf den Weg gemacht. Nun war es früher Morgen. Der Tau glitzerte im Gras, die Luft war belebend klar. Die pralle Ledertasche trug er wie in der Nacht vor der Brust. Denn der Inhalt war wertvoll.
Und nun stand er vor dem Hauptgebäude der Thalmeyers. Es war eine zweistöckige Villa mit Sprossenfenstern und Walmdach sowie zwei Runderkern, die wie Säulen wirkten, und einem sechsstufigen Aufgang zum Portal. Die Bewohner von Selb fanden den Bau, 1927 fertiggestellt, ein wenig exzentrisch, ja geradezu frivol. Aber den Thalmeyers verziehen es die meisten, es waren hochgeachtete Leute. Zumal Familienoberhaupt Ludwig kurz vor dem Einweihungsfest seine Frau Franziska im Kindbett verloren hatte. Was für eine Tragik, fanden die Selber.
Die Sonne stand noch tief, ein Schäferhund schleppte sich aus dem Schatten heran und beschnupperte die Ledertasche. Der Hund lahmte leicht und zog den rechten Lauf nach, aber er wedelte freudig.
»Ist ja gut, Wolfi.« Er streichelte den Hund, der sich immer offensichtlicher für den Inhalt der Ledertasche interessierte, und zog am Glockenseil.
Ein Dienstmädchen öffnete ihm – das einzige, das den Thalmeyers von ihrem Personal aus der Vorkriegszeit geblieben war. Sie war müde von Alter und Arbeit und ging leicht gebeugt. Haar und Haut schienen von derselben Farbe.
»Guten Morgen, Lina. Ist Fräulein Thalmeyer zu sprechen?«
Lina nickte, ließ die Tür angelehnt und kehrte ins Innere der Villa zurück. Die Magd war keine Frau der vielen Worte. Er hatte sie in den vergangenen Monaten vielleicht zwei- oder dreimal sprechen hören. Und konnte sich weder an ihre Sprachmelodie erinnern noch an das, was sie gesagt hatte. Sie war eine ätherische, geisterhafte Erscheinung. Sie wäre eine gute Schmugglerin, dachte er.
Eine junge Frau stand im Türrahmen. Sie war deutlich größer als er, aber er war auch sehr klein geraten. Den Spott über seine Körpergröße hatte er sich oft genug anhören müssen, besonders in seinem Knochensack, dem Anzug der Fallschirmspringer, wenn er sich zum Absprung bereit machte. »Kleine Leute werden als Letzte vom Regen nass, aber ertrinken als Erste«, hatte der Hauptmann stets gesagt, ein harter Schlesier mit Hasenscharte. Doch er wusste auch: Kleine Leute sind schwerer zu treffen. Wer weiß – vielleicht hatte er deswegen den Krieg überlebt, als einer von nur dreien in seiner ganzen Einheit?
»Gustav!« Die Frau lächelte. Was hatte sie für schöne Zähne! Sie konnte einen wirklich in Verlegenheit bringen, nur mit diesem Lächeln. Und das Beste war, dass ihr das gar nicht bewusst war.
»Fräulein Thalmeyer. Wie versprochen.« Mit einer etwas ungelenken Bewegung überreichte er ihr die Ledertasche, die er in der Nacht zuvor unter Lebensgefahr aus dem Osten in die amerikanische Besatzungszone gebracht hatte.
Marie Thalmeyer trug ein schlichtes helles Morgenkleid und hatte ihr braunes Haar hochgesteckt. Ihre Haut war ganz hell und makellos. Porzellankind nannte man sie im Ort. Wer genau hinsah, so wie Gustav und viele andere Männer, dem entgingen nicht ein paar Sommersprossen über den hervorstechenden Wangenknochen.
»Woher hast du – nein, ich will es lieber nicht wissen.«
Aus der Villa strömte Kaffeegeruch. Schwach und dünn zwar, aber ganz eindeutig Kaffee, kein Muckefuck aus Gerste oder Eicheln. Auch das war Gustavs Verdienst gewesen, dank ein paar Deals mit einem GI aus Tennessee, der inzwischen ein verlässlicher Lieferant geworden war.
Marie blickte nun endlich in die Tasche und spitzte die Lippen. Beherzt griff sie hinein – und holte ein Huhn hervor, das sie triumphierend emporhielt. Dann blickte sie erneut in die Tasche und hob mit einem ungläubigen Ausdruck den Kopf.
»Gleich zwei? Formidabel!«
»Der Tscheche war spendabel.«
»Da wird sich Papa aber freuen!«
»Gerupft und ausgenommen. Nur das Beste zum Geburtstag des Herrn«, erklärte der Schmuggler feierlich.
»Warte.« Marie verschwand im dunklen Flur und kam dann wieder mit ihrer Geldbörse, aus der sie vier Ein-Dollar-Scheine zog – das Beste, was ein Mensch in diesen wirren Zeiten für den Schwarzmarkt gebrauchen konnte, denn mit Bezugsscheinen, der alten Reichsmark oder dem neuen Besatzungsgeld gab es überall nur die letzten Reste.
Gustav hob die Hände. »Nein, wirklich, das geht heute aufs Haus.«
Marie blickte ihn aus ihren grünen Augen an, als wollte sie ihn hypnotisieren. Er hatte sie viel schüchterner in Erinnerung.
»Wann wird man schon mal sechzig?«, wagte Gustav den Widerspruch.
Marie war eine zurückhaltende Person, doch nun sah Gustav die Entschlossenheit ihres Großvater Georg in ihr aufblitzen, der die Porzellanmanufaktur zu einem landesweit bekannten Namen gemacht hatte. Sie streckte Gustav die Dollarscheine entgegen.
Gustav hatte keine Wahl, dabei hatte er es durchaus ernst gemeint und hätte Ludwig Thalmeyer und seiner Tochter die Hühner gern geschenkt. Sie gehörten zu seinen treuesten Kunden und hatten ihn immer gut behandelt. Er mochte sie. Im Krieg hatte er gelernt, wie wichtig es war, im horrenden Chaos von vernünftigen, verlässlichen Menschen umgeben zu sein. Und die chaotischen Zeiten waren noch lange nicht vorbei, im Gegenteil. Der Russe mit seinen Stalinorgeln stand nur ein paar Kilometer entfernt, da war das letzte Wort noch nicht gesprochen, glaubte Gustav.
Aber nun steckte er die Dollarscheine ein, wünschte den Thalmeyers eine fröhliche Geburtstagsfeier und empfahl sich mit einer leichten Verbeugung.
Gustav war mehr als ein Schmuggler. Er hatte echtes Geschäftstalent und ein Gespür dafür, wo was gefragt war. Er war ein Besorger. Und er hatte gut zu tun. Zigaretten, Schokolade, Medikamente, Mehl, Kochtöpfe, Fahrkarten für Fernzüge – für die es eine Sondererlaubnis brauchte –, Schuhe, schicke Strümpfe: Fragt Gustav, hieß es überall. Einer seiner Geniestreiche war es, sich noch im Krieg das Rauchen abgewöhnt und mit seinen Rationen ein kleines Vermögen von seinen Kameraden ertauscht zu haben. Seine gedrungene Gestalt und der naiv-freundliche Gesichtsausdruck unter dem schütteren roten Haar, der ihm etwas Kindliches verlieh, half ihm bei den knallharten Verhandlungen. Außerdem sprach er passabel Englisch, was beim Handeln mit den GIs half. Gustav hatte jedenfalls den Schwarzmarkt von Hof, Weiden und Selb voll im Griff. Wer etwas wollte, kam zu ihm. Und er konnte es sich leisten, im Hinblick auf seine Kunden wählerisch zu sein.
Gustav leistete die Drecksarbeit fast immer höchstpersönlich, aber vielleicht war es mal an der Zeit, über die Erweiterung seines Netzwerks nachzudenken. Bloß wusste er auch, dass er, wenn es um Leben und Tod ging, niemandem trauen konnte.
Wolfi stupste ihn zum Abschied mit der Schnauze, aber der unwiderstehliche Duft war jetzt nicht mehr an ihm. Gustavs Blick fiel auf das Manufakturgebäude, eine schmucklose Industriehalle. Hier würde die Arbeit heute ruhen. Das Dach war nach dem Treffer einer verirrten Brandbombe vom März 45 immer noch nicht vollständig repariert worden, denn das rare Baumaterial wurde anderswo dringender gebraucht; selbst Gustav konnte da nichts organisieren.
Gegenüber der Fabrik – und mit der Villa am Kopfende ein U bildend – stand das zweistöckige Wirtschaftshaus. Ursprünglich zur Unterbringung des Dienstpersonals errichtet, hatte es Patriarch Georg nach dem Ersten Weltkrieg zum Wohnhaus der Manufakturarbeiter mit sechzehn Wohneinheiten auf zwei Stockwerken ausgebaut. Nun wohnten noch zehn Arbeiterfamilien dort; die weiteren Wohnungen belegten mehrere Großfamilien von Sudetendeutschen, die von Tschechiens starkem Mann Edvard Beneš vertrieben worden waren. Das Militärgouvernement hatte die Flüchtlinge zwangsweise dort einquartiert, sehr zum Unmut der ansässigen Bevölkerung. Und dann, so wurde gemunkelt, schien die Thalmeyerauch noch freundschaftliche Kontakte zu diesen Menschen zu pflegen! Darunter begann der Ruf der Familie im Ort dann doch etwas zu leiden.
Aus dem Gebäude zogen Kohleschwaden der alten Heizöfen herüber, ein Baby schrie, ein Kleinkind weinte, zwei Männer sprachen in derbem Dialekt miteinander. Derweil machten sich ein paar Flüchtlinge als Gärtner nützlich und kümmerten sich um die Beete, die sie durch den Zierrasen getrieben hatten, denn in diesen Zeiten konnte niemand irgendwelche hübschen, aber sinnlose Grasflächen gebrauchen. Sie grüßten Gustav aus der Ferne mit einer gewissen Ehrerbietung.
Und der, der an der Tür arbeitete, winkte Gustav zu sich. Es war ein ziemlich alter Mann, aber in diesen Nachkriegszeiten konnte man nie so genau sagen, ob ihn vielleicht nur der Krieg ausgezehrt hatte. Er beugte sich vor und flüsterte. Er brauche Schleifpapier, etwas Farbe und vor allem Nägel, mindestens acht Zentimeter lang. Ob Gustav da was machen könne?
3. Kapitel
Der Geburtstag
»Oh, wie fein, das wird ein Fest!« Maries Wangen waren vor Aufregung ganz rot, was bei ihrem hellen Teint sehr kindlich aussah – und überhaupt ein ungewöhnlicher Anblick war, denn sie war normalerweise von gefasstem, wenig zu erschütterndem Charakter. Sie stand mit Lina in der Küche, die sich schon über die Hühner hergemacht hatte und die letzten Federn abflämmte. Selbst das Dienstmädchen musste lächeln. So etwas Frisches war wirklich eine besondere Sache in diesen Zeiten. Die Gäste würden staunen!
Denn heute Abend war es so weit: Der sechzigste Geburtstag Ludwig Thalmeyers sollte gefeiert werden, erstmals nach dem Krieg in großer Gesellschaft. Ein Dutzend Gäste wollten der Einladung folgen, ebenso angesehen wie geschätzt, und denen wollte man schließlich etwas bieten. Marie hatte sich alle Mühe gegeben und Frühkartoffeln organisiert, etwas Sekt, Wein, Wacholderschnaps, Kesselfleisch. Dazu Erdbeeren, Birnen, Gurken, Tomaten. Lina hatte Mehl und Zucker bekommen und einen Kuchen mit Fruchtglasur gebacken. Statt Mandeln gab es Kürbiskerne. Aber die Hühner, ganz frisch und feist – da würden die Gäste wirklich Augen machen!
Marie brachte noch mehr Schnittblumen ins Esszimmer, wo Lina schon eingedeckt hatte, mit bestem Porzellan natürlich und drei der berühmten Thalmeyer-Figuren als Tischdekoration: König Maximilian I. von Bayern im detailgetreu bemalten Königsornat, Ludwig I. zu Pferde, die Bavaria mit Siegerkranz. Jede der Figuren war einen halben Meter hoch und wirkte ganz prächtig. Lina hatte die Figuren fast einen halben Tag lang mit lauwarmem Wasser gereinigt, und das Porzellan funkelte, als wäre es frisch aus dem Brennofen gekommen. Die noch ziemlich tief stehende Sonne ließ den ganzen Tisch aufs Vorteilhafteste glänzen. Oh ja, das würde eine schöne Feier werden.
»Wo ist eigentlich Sophie?«, fragte Marie, als sie zurück in die Küche kam.
Lina hob ein wenig resignierend die Schultern, und Marie verstand: Ihre jüngere Schwester schlief noch, wie immer. Dafür kam Papa Ludwig herein, heftig umwölkt von Tabakduft.
»Na, meine Kinder?« Das war sein ritueller Morgengruß, auch wenn nur Lina anwesend war. Marie vermutete, er würde es wohl auch in die leere Küche hereinrufen.
Lina verbeugte sich, Marie gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Herzlichen Glückwunsch, Papi!«
»Erinnere mich nicht«, winkte Ludwig ab.
»Du sollst nicht so früh schon rauchen«, mahnte Marie und stemmte die Hände mit nur halb gespieltem Ernst in die Hüften. »Du weißt doch, was Doktor Rappenhuth gesagt hat.«
»Nicht einmal an meinem Geburtstag?«
Ludwig Thalmeyer trug schon früh am Morgen seinen geliebten Stresemann und wirkte ein wenig aus der Zeit gefallen. Aber er wusste eben, was er sich, der Familie und dem Ort schuldig war. Auf den ersten Blick wirkte er jünger als sechzig, denn seine Haut war von gesunder Färbung, er war schlank und seine Haltung die eines Dreißigjährigen. Das volle graue Haar trug er kurz und scharf gescheitelt, was ihn wie einen Ufa-Filmstar aussehen ließ. Vielleicht nicht wie der Hauptdarsteller, aber wie der ehrbare Vater der betrogenen Braut. Doch die Zigarette im Mundwinkel gab ihm etwas allzu Legeres, und beim Auspusten des Rauchs zeigten sich seine schlechten Zähne, die dem Krieg geschuldet waren, denn die Zahnärzte waren fast alle zur Front abberufen worden und viele waren nicht zurückgekommen. Auch sein schleppender Gang verriet, dass er nicht mehr so jung war, wie er zunächst wirken mochte.
»Es wird ein langer Tag, du wirst genug Qualm einatmen. Wenn der Metsch wieder mit seinen stinkenden Zigarren kommt.«
Ludwig Thalmeyer winkte lächelnd ab. Er mochte es ja doch, wenn Marie sich um ihn Sorgen machte.
»Papi, bald werden die ersten Gäste zum Gratulieren läuten, iss schnell was zur Stärkung.«
Ludwig Thalmeyer nahm mit der rechten Hand die Zigarette aus dem Mundwinkel und fuhr sich mit der linken Hand durchs Haar. An das neumodische Papi würde er sich nie gewöhnen – er hatte seinen Vater Georg noch siezen müssen –, aber er liebte seine Kinder viel zu sehr, um es ihnen zu verübeln. »Ach, ihr wisst doch, dass ich das alles nicht will.« Kokettieren konnte er schon immer gut.
»Schau mal, was wir haben.« Marie zeigte ihm die Hühner.
Ludwig lächelte. »Gustav?«
»Gustav.«
Nun kam auch Sophie in die Küche, erkennbar verschlafen, immer noch im Nachtkleid und sogar barfuß. Sie gähnte mit Genuss, streckte ihre Arme von sich wie ein Kätzchen seine Glieder, und aus dieser Streckbewegung schlang sie die Arme geschickt um ihren Vater.
»Happy birthday«, sagte die junge Dame und spielte Frau von Welt. Ludwig Thalmeyer genoss und erwiderte die Umarmung.
»Du wirst dir noch einen Schnupfen holen auf den kalten Dielen«, bemerkte Marie spitz. Bestimmt hatte ihre kleine Schwester wieder die ganze Nacht in ihrer Kammer gelesen, amerikanische Liebesromane womöglich, die einer empfindsamen Seele doch unmöglich guttun konnten.
Doch heute blieb keine Zeit für einen schwesterlichen Disput. Allzu viel musste arrangiert werden, denn die Feierlichkeiten sollten schon um fünfzehn Uhr beim Kaffee beginnen und dann in ein Abendessen münden, und weil Lina ganz allein war, halfen die Schwestern mit – und tatsächlich machten schon am Morgen die Gratulanten ihre Aufwartung. Zunächst kamen zwei der Arbeiter sowie Bürofräulein Hennemann, die dem Firmenchef zwar unbeholfen, aber mit großer Herzlichkeit gratulierten. Die Hennemann trug stotternd eine längliche Geburtstagspoesie vor, die sie unter einiger Anstrengung auf Ludwig Thalmeyer umgedichtet hatte. Zudem überreichten sie einen großen Strauß Wiesenblumen. Dafür wurden sie von Marie mit einem Glas Schnaps entlohnt, das sie gern entgegennahmen und der Sitte nach in einem Zug tranken, auch Frau Hennemann, und zwar ohne mit den langen Wimpern zu zucken.
Es folgte als Abordnung aus dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude ein böhmisches Ehepaar mit ihrer bildhübschen blonden Tochter. Die junge Familie hatte, wie viele der derzeit dort Untergebrachten, ihre eigentliche Heimat wohl auf immer verloren, auch wenn die Hoffnung auf Rückkehr sich hartnäckig hielt. Die Kleine, höchstens acht Jahre alt und mit kecken geflochtenen Zöpfen zu beiden Seiten, sang mit hoher, aber fester Stimme ein Lied im böhmischen Dialekt, das kaum einer der Anwesenden verstand, aber die Melodie entzückte alle. Im Namen der sudetendeutschen Gemeinde überreichte das Ehepaar dem Jubilar ein großes Stück Speck. Auch die beiden Böhmen bekamen einen Schluck Schnaps, und die Tochter, die Klara hieß, durfte so viele Bonbons aus einer Porzellanschüssel nehmen, wie sie mit ihren kleinen Händen greifen konnte. Sie unternahm diese Operation mit so großem Ernst und in so verbissener Konzentration mit der Zungenspitze im Mundwinkel, dass alle Anwesenden lachten.
Eine weitere Abordnung der Arbeiter erschien. Die rund zwanzig Angestellten der Porzellanmanufaktur, die in Alliierten Militärmark bezahlt wurden, hatten heute freibekommen, aber die meisten hatten sich trotzdem auf den Weg gemacht, brachten vor der Thalmeyer-Villa ein kleines Ständchen, und Buchhalter Walter Willemsen übergab im Namen der Belegschaft ein Geschenk – eine heimlich in den Pausen gefertigte Porzellanbüste des Hausherrn, die jenem allerdings etwas peinlich war.
* * *
Am Nachmittag marschierte die Ortskapelle die Anhöhe empor, auf der das Anwesen der Thalmeyers lag. Marie, Sophie – inzwischen schicklich gekleidet – und Ludwig Thalmeyer traten vor die Tür. Es war kurz vor fünfzehn Uhr, flockige Wölkchen bedeckten den Himmel, und zugleich näherte sich ein knatterndes Motorengeräusch: Karl Metsch, wie immer etwas zu früh, kam mit seiner Frau Alexandra und seiner Neuerwerbung: einem Volkswagen Typ 51 in blassgelber Farbe, der mittlerweile unter englischer Aufsicht gebaut und nur an »berechtigte Personen« verkauft wurde. Und Metsch, der gewiefte Papierfabrikant, hatte sich einen solchen Berechtigungsschein erschlichen; unklar aber war, woher er die Devisen genommen hatte.
Die Kapelle stellte sich in Position, Metsch öffnete seiner Frau galant die Tür und begab sich dann mit kurzen Schritten schnurstracks zu den Musikern, um sich, gut gelaunt wie immer, neben den Kapellmeister zu stellen und beim Dirigieren mitzuhelfen, während seine Frau verlegen mit den Schultern zuckte.
Die Musiker, ein Dutzend Männer, hatten sich in Tracht herausgeputzt, an den Jankern und den roten Hemden funkelten die Knöpfe, zur Lederhose trugen sie weiße Strümpfe und Schnallenschuhe und auf dem Kopf eine Art Dreispitz. Paukist Eberhard gab mit monotonen Schlägen den Einsatz vor, und schon erscholl das Oberfrankenlied, die Hymne der Region.
Oberfranken ist mein Heimatland, wo der Main sich schlängelt wie ein Silberband …
Metsch dirigierte Seite an Seite mit Kapellmeister Gotthard so furios mit, dass alle lachen mussten, selbst die Musiker hatten es schwer, sich zu beherrschen. Karl Metsch sah aus wie eine Karikatur mit dem runden Gesicht, dem schütteren, sorgsam über den Schädel gekämmten Haar, der gebogenen Nase, die auf einen Schnurrbart fiel, der nach vorn abstand wie bei einem Seehund, und dem stets tiefroten Gesicht. Kurz und wohlgenährt war er, eine seltene Erscheinung in diesen Zeiten. Bei den Musikern dagegen, fast alle blass und allzu schlank, waren so einige Kriegsverletzungen zu sehen. Trompeter Volkmar Raudinger war der Schienbeinknochen weggeschossen worden, Hanno Möllendorf, der den Schellenbaum spielte, hatte das linke Auge eingebüßt. Und Paukist Eberhard war wegen eines Granatsplitters im Hirn etwas wirr im Kopf, seine Mutter musste ihm den Haushalt führen, aber den Takt hielt er noch besser als alle anderen. Welche Narben mochten sich unter den Trachten noch verbergen?
Die dargebotene Musik war von einer Qualität, die den armen Wolfi winseln ließ. Marie wies ihn zurecht, er gehorchte und zog sich ins Haus zurück. Wo es ja auch schon viel verlockender duftete.
Auch die übrigen Gäste trafen ein: Doktor Friedbert Rappenhuth mit Frau Gisela, beide in gleichem Maße von Alter und Krieg gebeugt – ihr einziger Sohn war schon in den ersten Kriegstagen vor Warschau gefallen –, die Familie Joseph und Wilhelmina Müllerschön, im Holzgroßhandel tätig, samt ihrem erwachsenen Sohn Karlotto, der ein wenig zurückgeblieben schien, alles sehr langsam erledigte und von einer deutlich erkennbaren Zuneigung zu Sophie erfüllt war, die in ihrer Hilflosigkeit komisch wirkte und alle Beobachter auf prickelnde Art im Unklaren ließ, ob es sich um eine freundschaftliche Verehrung oder um ein heftiges hormonelles Unwetter handelte. Armin und Ilse Füllhorn, kinderlos, Besitzer des Gasthauses Bayerischer Hof samt kleiner Brauerei. Das Gasthaus hatte schon wieder geöffnet, die Braukessel waren jedoch längst in den USA zu dringend gebrauchtem Kupferdraht verarbeitet.
Wie immer als Letzter kam der junge Pastor Maximilian Holzapfel, dem die Obhut über die Gemeinde wenige Tage vor Kriegsende übertragen worden war, denn der Vorgänger, der alte Bernward von Hautzen, war auf ganz eigentümliche Art zu seinem Herrn berufen worden, wurde er doch am helllichten Tag, über einen Feldweg zu einer letzten Ölung radelnd, von einem aus fünf Kilometern Höhe herabfallenden Triebwerk einer Boeing B-17 getroffen, jenes amerikanischen Langstreckenbombers, der »Fliegende Festung« genannt wurde. Der Krater, den das tonnenschwere Triebwerk schlug, war drei Meter tief, und im Ort fragte man sich wenig pietätvoll, wie viel von dem Pastor und wie viele Triebwerksteile, Stahlsplitter, Öl und verschmorte Plastikschläuche wohl in dem Sarg liegen würden, denn der Pastor war unbeliebt gewesen – einer, der sich gern zwei Stunden und länger predigen hörte, und Nazi der ersten Stunde dazu.
Der junge Holzapfel dagegen machte sich recht gut, war still und freundlich und hielt seine Gottesdienste am Sandsteinaltar der Sankt-Andreas-Kirche erfreulich kurz, denn in dem neugotischen Bau mit den gusseisernen Säulen, der den Krieg schadlos überstanden hatte, konnte es besonders im Winter bitterkalt werden.
Die Gäste gruppierten sich im Halbkreis um die Kapelle, und Metsch, des größer werdenden Publikums gewahr und darob äußerst zufrieden, gab noch einmal alles. Das Gesicht des leicht übergewichtigen Mannes war zu einem noch intensiveren Rotton angelaufen.
Es folgten Hoch auf dem gelben Wagen, weil das nun mal zum Repertoire der Kapelle gehörte – und weil fast alle anderen Lieder im Repertoire seit 1945 nicht mehr gespielt werden durften –, sowie Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut, ein Schlager, mit dem unter anderen Marek Weber und sein Orchester in der Vorkriegszeit das Publikum begeistert hatten. Schließlich erklang Hoch soll er leben (die Hochrufe von Metsch übertönten alle anderen Stimmen) und zum Ende noch »Zum Geburtstag viel Glück«, konsequent auf Deutsch gesungen natürlich, außer von Sophie, die leise auf Englisch mitsang und sich von einem dezenten Ellbogenstoß ihrer älteren Schwester nicht davon abbringen ließ. Auch die neuen Bewohner des Wirtschaftsgebäudes sangen aus gebotener Entfernung mit, bloß Karl Metschs Elan ließ deutlich nach, ja er schien persönlich beleidigt und stemmte schließlich die kurzen Arme kopfschüttelnd in die Seite.
»So ein Yankee-Lied«, moserte Metsch in Richtung Kapellmeister. »Wo kommen wir denn da hin?«
Lina brachte einen Krug Wein und Gläser auf einem Tablett für die Gäste, Marie schenkte den Musikern Schnaps ein und steckte dem Kapellmeister ein schönes Stück Käse zu, während die geladenen Gäste, als der leicht atonale Klang der Kapelle noch in den Ohren nachdröhnte, dem Jubilar ihre Aufwartung machten, ihn herzlich umarmten und auch das eine oder andere Geschenk überreichten.
Unterdessen machte Metsch in seinem eigentümlichen Humor eine Szene, als er sich den Flötisten vornahm, einen gewissen Hartmut, Sohn einer kriegsverwitweten Bäckerin, keine siebzehn Jahre alt. »Na, da ist ja ein Knopf lose, Menschenskind«, brüllte er so laut, dass es alle Anwesenden mitbekamen. »Zeig doch mal ein bisschen Anstand beim Geburtstag unseres hochverehrten Freundes!« Und mit dieser Überleitung stapfte er mit seinen dicken Beinen außer Atem auf Ludwig Thalmeyer zu und umarmte ihn. Auch Alexandra, die ihren Mann einen halben Kopf überragte, kam heran. Ihr Haar hatte eine aschblonde Färbung, nahm zu ihrem Kummer aber immer mehr Grautöne an, und weil Färbelotionen nicht zu bekommen waren, setzte sie ihren Schopf allerlei unappetitlichen Hausmittelchen aus.
Marie und Sophie begrüßten das Paar kühl. Denn mochten sich die beiden Schwestern auch in keinerlei Hinsicht ähnlich sein – Marie hatte mit ihrer Blässe und der geraden Haltung des Vaters beinahe eine aristokratische Aura, während Sophie mit ihrer Stupsnase und den unbezähmbaren Locken noch eindeutig kindlich-freche Züge trug, die sie zeit ihres Lebens nicht ablegen würde –, so waren sie doch in ihrer Abneigung gegen die Metschs, und vor allem gegen Karl, vereint. Er kniff beiden von ihnen in die Wange, als wären sie noch die kleinen Vorkriegstöchterlein von einst.
* * *
Man begab sich zu Tisch, an dem repräsentativen Vorraum vorbei, in dem ein Klavier stand, ein schöner Bösendorfer mit Kirschfurnier. Und Karl Metsch verharrte kurz davor und seufzte. »Ja, wenn Joachim jetzt hier wäre, er würde dir ein schönes Ständchen darbringen, da bin ich mir sicher!«
Marie und Sophie kniffen zeitgleich in stiller Entrüstung die Augen zusammen – eine Geste, die von niemandem bemerkt wurde außer von Alexandra Metsch.
Denn Joachim Thalmeyer, der erklärte Kronprinz der Porzellanmanufaktur, ältester Sohn Ludwigs, war seit Ende 44 in Russland verschollen. Niemand wusste von seinem Schicksal, aber es gab Hoffnung, waren doch zweihunderttausend deutsche Soldaten in russische Gefangenschaft geraten. Es war nur eine kleine Kerze der Zuversicht, aber immerhin brannte sie. Ludwig Thalmeyers Töchter verachteten Metsch dafür, dass er Joachims so schwer auf allen Seelen lastendes, so erschreckend unbekanntes Schicksal auf so nonchalante Weise zur Sprache brachte, und dann noch an einem Festtag wie diesem. Doch Ludwig Thalmeyer machte es nichts aus: Er dachte ohnehin, unabhängig von den äußeren Umständen, jede Minute an seinen Sohn.
Und so nahmen die Damen und Herren am Tisch Platz: Ludwig am Kopfende, flankiert von seinen beiden Töchtern, dann die beiden Metschs, die Rappenhuths, die Müllerschöns, die drei Füllhorns, der Pastor. Alle bewunderten kennerhaft das Porzellan, das Königsornat König Maximilians, den Siegerkranz der Bavaria, und Lina schenkte reihum Sekt ein. Dazu wurden Aufschnitt und Käsewürfel serviert.
Ludwig Thalmeyer war schon den ganzen Tag ein wenig schwindlig, der Puls schlug unruhig und viel zu schnell, aber er schob es auf die Aufregung wegen der Feierlichkeiten. Marie beobachtete ihren Vater mit Sorge. Doktor Rappenhuth hatte ihr vor einigen Wochen gesagt, dass der Patriarch ein wenig mehr Ruhe brauche, denn das Herz sei nicht das stärkste und sicher auch in der Sorge um den Sohn in Mitleidenschaft gezogen.
Der Jubilar stand auf, erhob das Glas und hieß seine Gäste in einer kurzen, etwas spröden Ansprache willkommen, anschließend wurde eine sämige Kartoffelsuppe serviert. Dann war Doktor Rappenhuth an der Reihe, der ein launiges Geburtstagsgedicht vortrug, welches zu seinem festen Repertoire gehörte. Auch Karl Metsch stand auf, hielt eine etwas wirre Rede, wedelte mit seinem Glas wild herum und rief schließlich Lina zu, »nun endlich den guten Wein« zu bringen – denn sein Geburtstagsgeschenk waren drei Riesling-Weine aus dem exzellenten Jahr 1943, deren erste Flasche unter großem Hallo von Metsch selbst entkorkt und von ihm auch in der nächsten halben Stunde weitgehend selbst geleert wurde.
Alles ging seinen schönsten Gang, es war eine Feier, wie sie es seit dem Krieg nicht mehr gegeben hatte, und dabei wartete das Hauptgericht noch im Ofen. Zur hereinbrechenden Dunkelheit hatte sich ein leichter Regen gesellt, der das Beisammensein umso gemütlicher gestaltete, als das Feuer in dem Kamin hinter dem schmiedeeisernen Gitter knisterte. Auch wenn Metsch wieder bei seinem Lieblingsthema war: wie der Krieg dennoch hätte gewonnen werden können. Aber Metschs bizarre Theorien waren längst durch die betäubende Wirkung des Alkohols bei allen Beteiligten wie in eine weiche Wolke eingebettet, die emporstieg und verpuffte, ohne für Verstimmung zu sorgen.
Dann zog sich Ludwig entschuldigend zurück, und als sich kurz danach auch Doktor Rappenhuth erhob, war Marie die Einzige, die dies bemerkte, und entschuldigte sich nach einigen Momenten ebenfalls.
4. Kapitel
Der Überraschungsgast
Im Vorraum saß Ludwig Thalmeyer auf einem Sessel, und Doktor Rappenhuth sprach leise auf ihn ein. Als Marie sich näherte, sah sie, dass der Doktor den Puls ihres Vaters fühlte und dabei auf seine Uhr sah.
»Es ist nur die Überanstrengung, die Ihre Hypertonie auslöst«, sagte er schließlich.
»Bluthochdruck also«, seufzte Ludwig Thalmeyer.
»Ruh dich doch ein wenig aus, keinen der Gäste wird das stören«, schlug Marie vor. »Eine halbe Stunde nur. Dann lassen wir das Huhn servieren.«
Ludwig überlegte und wollte sich eine neue Zigarette anzünden, wogegen sowohl Doktor Rappenhuth als auch seine Tochter protestiert hätten.
Doch dann läutete es. Ludwig sprang aus dem Sessel auf, voller neuer Energie.
»Ein Gratulant um diese Zeit?«, wunderte sich Marie. »Das ist aber nicht sehr …«
»Kein Gratulant, sondern ein Gast.«
»Aber wer kann das denn sein?«
Ludwig Thalmeyer lächelte verschmitzt, während auch Lina aus der Küche blickte. »Du wirst überrascht sein. Öffnest du bitte?«
Marie strich sich ihr gelbes Kleid glatt, das mit einem Blumenmuster und einer Knopfleiste vom Dekolleté bis zur Taille versehen war, und nickte.
An der Tür erschrak sie. In der einsetzenden Dunkelheit stand ein amerikanischer Soldat – nein, kein gewöhnlicher Soldat, mindestens ein General, sofort auch für Laien zu erkennen an den vier Sternen auf den Schulterklappen. Er war größer als Marie und nahm mit seiner grünen Uniform fast den ganzen Türrahmen ein. Oder kam er ihr nur so bedrohlich vor?
Der General lächelte verbindlich, aber das hatte ja nichts zu bedeuten. Marie war alarmiert. Ein zweiter, rangniedrigerer und deutlich jüngerer Soldat tauchte hinter dem General auf. Nun sah Marie auch den Jeep, mit dem die beiden hergekommen waren. Darin saß ein dritter Mann, der allerdings dort blieb und keinerlei Anstalten machte, auszusteigen.
»Yes, please?«, fragte Marie und bemühte sich um eine feste Stimme. Würde nun jemand verhaftet werden? Dabei waren die Thalmeyers doch bekannte Nazi-Gegner gewesen, wenn auch nicht im aktiven Widerstand, und Ludwig hatte seinen Persilschein als einer der ersten Unternehmer in ganz Oberfranken bekommen! Aufgrund der Angaben in Ihrem Meldebogen und den vielen Zeugenaussagen zu Ihren Gunsten sind Sie von dem Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 nicht betroffen. Marie kannte den Satz in dem Brief sogar auswendig!
Der Angesprochene wollte etwas sagen, doch da tauchte schon Maries Vater hinter ihr auf und zeigte sich erkennbar erfreut. Jegliches Zeichen von Schwäche und Erschöpfung war aus seinem Gesicht verschwunden. Was ging denn hier vor?
»Governor! It is an honor!«, freute sich Ludwig Thalmeyer.
»Aller Gute zu Geburtstag«, brachte der Militärgouverneur hervor, und Marie, nun beruhigt, wusste endlich, wen sie vor sich hatte, denn sie hatte sein Bild schon mehrmals in den Zeitungen gesehen, die bereits zugelassen waren: Es war John McNarney, hohes Mitglied des US-Gouvernats der amerikanischen Zone, die sich über Bayern, Franken und die Oberpfalz bis Hessen und Teile von Baden und Württemberg erstreckte.
John McNarney stellte seinen Begleiter vor, einen schüchternen jungen Soldaten, der sich das Barett fast stürmisch vom Kopf riss und sich eilfertig verbeugte, was Marie so komisch vorkam, dass sie ein Lachen unterdrücken musste. Die Amerikaner waren ja überall hier die neuen Herren und hatten keinen Anlass zu kratzfüßigem Betragen.
»Das ist mein Adjutant Bob«, erklärte der Gouverneur. »Ein braver Soldat und sprach …, ah, … sprachsicher. Sohn deutscher, ah …«
»Einwanderer«, flüsterte Bob so diskret wie möglich.
»Ich lerne, aber nicht sehr gut«, lächelte der Mann mit den vier Sternen auf der Schulterklappe.
»Kommen Sie doch rein zu uns, der Hauptgang sollte bald serviert werden.«
* * *
Das war eine Überraschung nach Ludwig Thalmeyers Geschmack: Die ganze Tischgesellschaft stand auf, als der Militärgouverneur den Raum betrat. Die Gäste verbeugten sich, rückten herum, machten Platz, als Lina mit Maries Hilfe ein neues Gedeck auftrug. Besonders Karl Metsch tat sich hervor und tauschte sogar den Platz mit seiner Frau, um neben dem Ehrengast zu sitzen, der sich am Kopfende neben dem Hausherrn niederließ. Adjutant und Übersetzer – und wohl auch Leibwächter – Bob blieb hinter dem General stehen.
Ludwig erhob sich. »Wir fühlen uns alle sehr geehrt, Sie, Herrn Gouverneur, Herrn General McNarney, bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Geste, die Sie uns damit bereiten, eine Geste, die von Ihrem Großmut und Bemühen um Verständigung zeugt.« Im Hintergrund war das Zischeln des Übersetzers zu hören, der die allzu schwierigen Phrasen übersetzte. »Unsere Völker treten aus dunklen Zeiten empor und aufeinander zu, und es besteht Anlass zur Hoffnung, dass die Zukunft hell und frei sein wird.«
Es gab Applaus, doch Ludwigs heimlicher Wunsch, dass auch der General eine kleine Rede halten würde, erfüllte sich nicht. So weit war man dann doch noch nicht in dem schwierigen und langwierigen Versöhnungsprozess, der vor ihnen lag.
Der General hatte breite Schultern, aber ein eher schmales, gebräuntes Gesicht mit wohlproportionierten Zügen und scharfen Labialfalten. Die Lippen unter der großen, schmalen und leicht gebogenen Nase waren stets zusammengepresst – die typische Haltung eines hohen Offiziers, der viele Befehle zu geben hatte. Seine ganze Haltung, ja sein Wesen hatte etwas ausgesprochen Militärisches, dachte Marie. Es war ein Mann, der viele Jahre lang nur den Krieg gekannt hatte. Die Augen dagegen waren von einem fast verträumten Blau und schienen eine andere Wirklichkeit zu erblicken.
Karl Metsch erhob sich und gab den Mundschenk. Er ließ ungeniert durchblicken, dass der gute Riesling von ihm sei, und füllte dem General das Glas beinahe bis zum Rand. Doch das war ein Fehler, wie Marie freudig feststellte, denn der Blick des Generals verfinsterte sich. Empfand er diesen Füllstand als obszön, wie es sich für einen Mann von Geschmack gehörte?
Dann tippte der General indigniert auf das Riesling-Etikett. Denn dort prangte ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen, der doch arg an ein Nazi-Symbol erinnerte. Und dann noch der Jahrgang: 1943! Karl Metsch lief, wenn das überhaupt möglich war, noch ein wenig mehr an, seine Wangen bekamen einen purpurnen Ton. Als langjähriger Weintrinker versuchte er den Gast zu beruhigen: Es sei ein jahrhundertealtes Wappen, das von den Winzern im Rheingau verwendet werde, um ihre außergewöhnlichen Weine zu kennzeichnen.
Dann war es still. Es schien, als stünde der ganze Abend auf der Kippe. John McNarney räusperte sich.
»Gar nichts dagegen den Adler, oder wie sagen Sie? Ein schöne Tier, auch unser Wappen in den Vereinigten Staaten!«
Und zur Erleichterung aller nahm der General einen Schluck und nickte anerkennend. »Besser als die Alsacians«, sagte er.
»Die Elsässer«, half Bob, und alle waren zufrieden. Besonders Karl Metschs Purpur war zu einem stolzen Kupferton abgeklungen; triumphierend blickte er sich um.
Nun endlich kam der Hauptgang. »Besser als ein Adler«, scherzte Marie, und John McNarney lächelte ihr zu. Dabei veränderte sich für einen Augenblick sein ganzes Gesicht, er wurde vom Militär zum Zivilisten, vom General zum Gast. Von einem Fremden, nur für einen Moment, beinahe zu einem Freund. Alles, was die Kriegerkaste ausmachte, fiel von ihm ab.
Lina hatte die Hühner behutsam mit Honig bestrichen, im Ofenrohr gebraten, immer wieder mit Bier abgelöscht und nach der Hälfte der Garzeit Kartoffeln und Karotten hinzugegeben, dazu eine, wenngleich gestreckte, Soße auf der Basis einer Mehlschwitze gezaubert. Das Vorhaben war ihr perfekt gelungen, die Hühner hatten eine dunkle Kruste und verströmten köstliches Röstaroma, die Kartoffeln und Karotten waren auf den Punkt gegart, die Sauce schimmerte goldbraun. Zwei Hühner für diese Gesellschaft – und für diesen Anlass! – schienen ein bisschen wenig, aber es waren eben harte Zeiten, und Lina zerschnitt Brust und Schenkel mit geschickter Hand, sodass keiner der Gäste sich beklagen musste. Alle ließen es sich schmecken, und Wolfi bettelte unter dem Tisch. Aus Versehen ließ Ludwig ein, zwei Fleischstückchen fallen, die Wolfi geradezu einatmete. »Ich war ein wenig nachlässig in seiner Erziehung«, lächelte er.
Auf einen Wink des Generals begab sich sein Übersetzer nach draußen zum Jeep. Und er kam, es war kaum zu glauben, mit zwei Flaschen französischem Champagner zurück!
»Mein Geschenk für Ihnen«, sagte John McNarney, und Ludwig hätte vor Glück beinahe eine Zigarette aus der Packung geholt und vergaß, dass er ja bereits eine im Mundwinkel hatte.
Nun standen also die beiden Flaschen auf dem Tisch. Sie bildeten von der Hitze des Raumes schon einen leichten Kondensfilm, was bewies, dass sie gut gekühlt waren. Karl Metsch war begierig, das Öffnen und Einschenken zu übernehmen, doch McNarney hob die Hand – und nickte Marie zu.
»Sie, mein Fräulein?«
Marie wurde rot, was sie ärgerte. »Es wäre mir eine Ehre.«
Es war lange her, dass sie eine Flasche mit einer Agraffe geöffnet hatte, und besonders die Metschs schauten ganz genau hin. Doch Marie machte alles richtig und ließ den Korken, wie es sich in feinen Kreisen gehörte, nicht etwa knallen, sondern die Luft mit einem Zischen entweichen.
»Bravo!« Karl Metsch sprang auf und klatschte in die Hände. Allen Anwesenden war klar, dass er schon ordentlich getrunken hatte. »Welche Eleganz! Was für eine junge Dame! Und die saß bei mir auf dem Schoß, als sie sooo klein war.« Er hielt eine flache Hand neben sein Knie. »Engelsfurz heißt das«, rief er nun und zeigte auf die Flasche. »Ja, so nennen es die Franzosen, wenn die Luft nur ganz leicht entweicht. Nein, hier wird nicht herumeffektiert, sondern dezent gearbeitet, wie man es von den Thalmeyers eben kennt. Aber nun her mit Franzmanns bestem Zeug!«
Marie blickte verstohlen zu John McNarney, der immerhin nicht das Gesicht verzog, aber glücklich sah er auch nicht gerade aus. Lina brachte neue Gläser, Marie drehte ihre Runde und schenkte ein, und bald war die Tischgesellschaft wieder in kleine Kreise zerfallen, die angeregt plauderten. Sophie hatte sich unterdessen erhoben und flirtete mit dem armen Übersetzer, der gar nicht wusste, wohin er sich wenden sollte.
* * *
Als der Hauptgang beendet war, bat der Amerikaner Ludwig Thalmeyer um ein Gespräch unter vier Augen. Die beiden begaben sich in das Arbeitszimmer, in dem Lina ebenfalls ein Feuer im Kamin geschürt hatte. Auch der Übersetzer ging mit. Ludwig zündete sich eine neue Zigarette an und warf den gerade aufgerauchten Stummel in die Glut. Eine Weile kreiste das Gespräch in einer eleganten Weise, wie es nur Menschen der angelsächsischen Welt beherrschen, um das Wetter und das Essen und die Straßenverhältnisse, doch dann wurde es ernst, und John räusperte sich, wie um den Themenwechsel einzuläuten.
»Mein lieber Mister Thalmeyer. Wir Amerikaner können nicht ewig hier sein. Zumal sich da im Osten was, äh …«, der General beugte sich zum Übersetzer, der ihm etwas zuflüsterte, »zusammenbraut, was keiner kann gefallen.«
»Stalin?«
»Ja. Die Russen wollen aus Ostdeutschland machen einen Satellitenstaat. Und selbst die Tschechoslowakei will sich anschließen den Russen.«
»Keine guten Aussichten.«
»Nein. Der Kommunismus hat gewonnen große Gebiete. Und uns wird berichtet von viel Grausamkeit. Aber das ist auch eine gute Nachricht für Selb und alle anderen Orte an der Grenze zu den Kommunisten. Wir werden den Russen geben keinen Inch mehr. Es war schon ein Fehler, ihnen Thüringen zu überlassen.«
In diesem Moment kam Marie vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, denn sie war besorgt um ihren Vater, der augenscheinlich am heutigen Tage, der an ihm zehrte, nicht auf der Höhe seiner Kräfte war. Als sie die beiden Männer im intensiven Gespräch sah, wollte sie sich zurückziehen. Doch John McNarney winkte sie heran.
»Wir brauchen jede Generation, nicht wahr? Hören Sie gut zu, Fräulein …«
»Marie.«
»Fräulein Marie. Irgendwann wir sind keine Besatzer mehr, und dann wir brauchen gute Manner, ah …, Männer. Und gute Frauen.«
»Was heißt das?«, fragte Ludwig.
»Es gibt Pläne, bald schon auf …, ah … Bob, kannst du … could you say it?«
Bob nickte und begann mit dünner Stimme und kaum hörbarem Akzent. »Es gibt Pläne des Gouvernats, zumindest die kommunale Verwaltung baldmöglichst in die Hände von Einheimischen zu legen. Es versteht sich von selbst, dass nur Einheimische infrage kommen, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Ist das verständlich?«
Ludwig nickte, und Marie blickte ihren Vater an.
»Sie gehören zum inneren Kreis, wie es heißt«, sagte nun wieder John McNarney. »Also, Herr Thalmeyer. Das Gouvernat denkt nach darüber, Wahlen zu Bürgermeister zu installieren in den kleinen Gemeinden und Städten. Auch bei den Engländern und Franzosen es gibt ähnliche Pläne. Die Kandidaten dürfen nur reine Weste haben, natürlich.«
Ludwig Thalmeyer behielt die vollkommene Haltung. Nur Marie merkte, wie stolz er war, gefragt zu werden. Eine Karriere in der Politik: Das hatte schon sein Vater Georg immer gewollt. Wer es dort schafft, hat seine Familie auf Generationen etabliert.
»Ich weiß, dass Sie sich nicht haben an Schuld aufgeladen. Wir wissen zu schützen, ah …, zu schätzen, dass Ihre Familie helfen mit den Flüchtlingen aus Ostgebieten, die wohnen bei Ihnen. Sie wissen gar nicht, wie gut diese Menschen es haben bei Ihnen.«
»Solidarität ist in diesen Zeiten doch selbstverständlich.«
McNarney blickte Ludwig lange an. »Das sehen so nicht alle.«
»Vielleicht nicht alle, aber doch die meisten im Ort.«
»In Nürnberg, das sollten Sie sehen. Da wohnen die Leute in alten Güterwaggons und unter Brücken oder in Ruinen. Als Dach Holzbretter oder Decken. Tausende so! Die Engländer haben uns Wellblech geschickt, und wir haben aufgebaut alte Armeezelte. Aber noch so ein Winter wie der letzte …«
Der Winter 1946/1947 war tatsächlich einer der kältesten gewesen, die Deutschland je erlebt hatte. Meterhohe Schneeverwehungen, zusammenbrechende Lebensmittelversorgung, zugefrorene Flüsse vom Rhein bis zum Selbbach, kein Brennmaterial, Mangelernährung und Zehntausende Tote. Erst Mitte April waren die Temperaturen wieder in den Plusbereich gestiegen.
Ludwig Thalmeyer hustete und bot John McNarney eine Zigarette an, die dieser dankend annahm. Beide rauchten und blickten in den Kamin.
»Ich halte für denkbar, Sie wären guter Bürgermeister für diesen Ort.«
Just in diesem Moment kam Alexandra Metsch auf dem Weg zur Toilette an der Küche vorbei. Sie hatte ihre Schritte verlangsamt und den Satz des Amerikaners gehört.
Ludwig Thalmeyer hustete lange. Marie blickte beunruhigt auf ihren Vater. Dann räusperte er sich mehrmals.
»Ich stehe für alles zur Verfügung, was der Konsolidierung der Verhältnisse dient.«
»Das freut mich. Sie sind frei von Nazismus und ein fähige Unternehmer.«
»Aber ich muss um einen Gefallen bitten.«
Der Amerikaner seufzte. Er ahnte, was jetzt kam.
»Ich weiß, dass wir in keinerlei Position sind, uns irgendetwas zu erhoffen oder zu erflehen. Aber wenn Sie doch die Bemühungen um meinen Sohn noch einmal intensivieren können? Ich hatte Ihnen ja bereits alle Informationen gegeben, die Ihnen nützlich sein könnten, und …«
Der Militärgouverneur unterbrach: »Ich verstehe Ihre Sorge als Vater. Ich habe alles weitergegeben längst an meinen Kollegen in Osten, General Pavel Kusnezov. Ich kennen ihn. Ein fähiger Soldat. Er war nicht begeistert von mein Anliegen. Kein Freund von euch Deutschen, um zu sagen es vorsichtig. Aber er hat versprochen, er will sich kümmern.«
Ludwig Thalmeyer nickte schwach, und er war wieder so müde und zerstreut wie zu Beginn des Festes. »Ich danke Ihnen dafür. Wie gesagt, nun ja, ich weiß sehr wohl, dass ich … und dass Sie … und dass wir Deutschen, nun ja … wir ja erst recht nicht …«
John legte mit verständnisvoller Miene eine Hand auf den Unterarm des Jubilars. »Wir gehen zurück?«
* * *
Im Esszimmer ging es hoch her, die Getränke zeigten ihre Wirkung. Armin Füllhorn gab einige seiner Imitationen von Dörflern und Anwesenden zum Besten, die aus ihm mit erstaunlicher Leichtigkeit flossen. Er konnte Dialekte, Stimmen, Spracheigenheiten vortrefflich nachmachen, und gerade gab er einen hervorragenden Metsch ab, der viel zu laut herumpolterte und seinen Bauch hervorstreckte und obszöne Witze riss. Metsch, das musste man ihm lassen, lachte herzlich darüber, so wie alle anderen Gäste. Doch als der Militärgouverneur wieder eintrat, wurde die Atmosphäre stiller und feierlicher, auch der Gastwirt setzte sich wieder still an den Tisch, als hätte es die Rampensau von eben nie gegeben.
Bloß Karl Metsch ließ sich von nichts irritieren und behielt die prall zur Schau gestellte gute Laune bei. Marie spürte, dass das nicht lange gutgehen konnte, und etwas widerwillig bemühte sie sich um ein Gespräch mit den Metschs. Lina trug ihren Kuchen auf, dessen Duft sogleich den Raum erfüllte. Wie lange hatte man so etwas Köstliches nicht mehr riechen können? Wie lange waren die Gerüche von Schmutz und Mangel bestimmt worden!