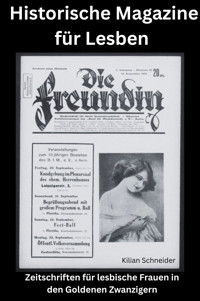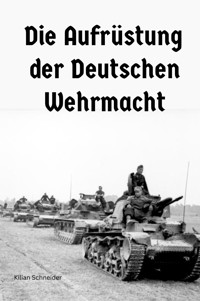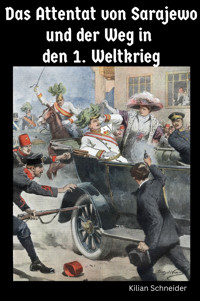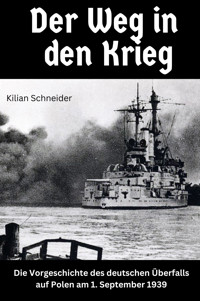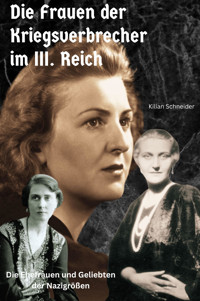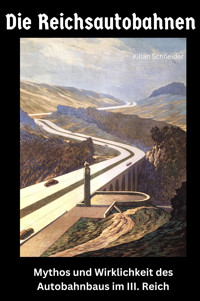
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
DIE REICHSAUTOBAHNEN Mythos und Wirklichkeit des Autobahnbaus im III. Reich Das Reichsautobahnsystem war ein Netz von Fernstraßen für den Kraftfahrzeugverkehr, dessen Bau zu Beginn der 1930iger Jahre begonnen wurde. Bereits in der Weimarer Republik gab es Pläne für Autobahnen in Deutschland, von denen aber nur zwei gebaut worden waren. Nachdem sich die Nationalsozialisten zuvor gegen die Pläne für ein Autobahnnetz gewehrt hatten, griffen sie diese nach ihrer Machtübernahme auf und präsentierten das Projekt als Hitlers eigene Idee. Sie wurden als „Straßen des Führers“ bezeichnet und als ein wichtiger Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit dargestellt. Dieses Werk beschreibt dieses gigantische Bauprojekt der Nazis, dessen Spuren auch heute noch sichtbar sind. Viele zeitgenössische Bilder ergänzen dieses Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Reichsauto-bahnen
Mythos und Wirklichkeit des Autobahnbaus im III. Reich
IMPRESSUMAutor: Kilian Schneider
Herausgeber: Juergen.PommersbergerHaendelstr 1793128 Regenstauf
Einleitung
Die Reichsautobahnen (RAB) waren ein Netz von Schnellstraßen im Eigentum des Deutschen Reiches. Mit der Planung und dem Aufbau wurde zur Zeit der Weimarer Republik begonnen; nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 wurde der Ausbau beschleunigt.
Saalebrücke der Reichsautobahn Berlin–München bei Hirschberg
Von Bundesarchiv, Bild 146-1979-096-13A / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419126
Er wurde von ihnen als Maßnahme gegen die seit der Weltwirtschaftskrise 1930/31 herrschende Massenarbeitslosigkeit propagiert. Des Weiteren versprach die NS-Propaganda die Mobilität der angestrebten Volksgemeinschaft (siehe auch KdF-Wagen). Die Reichsautobahnen und ihre umfangreichen Planungen bildeten später einen Grundstein für das Bundesautobahnnetz in der Bundesrepublik Deutschland und das Autobahnnetz in Österreich.
Deutschland und seine Reichsautobahnen nach dem Plan der Reichsregierung Mai 1934
Geschichte / Weimarer Republik
Die Vorgeschichte des Autobahnbaus beginnt mit zwei Schnellstraßen. Als erste autobahnähnlich ausgeführte Schnellstraße in Deutschland gilt die AVUS in Berlin. Mit dem Bau der sogenannten „Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße“ wurde im Jahr 1913 begonnen. Nach der durch den Ersten Weltkrieg verursachten Unterbrechung der Arbeiten wurde die Strecke 1921 für den Verkehr freigegeben.
Vornehmliche Ziele waren bei diesem Projekt die Nutzung als Rennstrecke sowie verschiedene Versuchszwecke. Die Benutzung war kostenpflichtig und diente nicht dem öffentlichen Fernverkehr, sondern der Erprobung von Kraftfahrzeugen und der Verwendung von bituminösen Straßendecken. Heute ist die AVUS Teil der A 115.
Bezeichnung „Autobahn“
Die Bezeichnung Autobahn tauchte zum ersten Mal zu Beginn des Jahres 1927 in einer Fachzeitschrift auf; als Schöpfer gilt der Bauingenieur Robert Otzen, der auch Vorsitzender des Vereins zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel (HaFraBa) war. Dieser Verein begann bereits in den 1920er Jahren mit Planungen zu einem für den Automobilverkehr reservierten Straßennetz. Die HaFraBa gab ab 1928 auch eine Vereinszeitung mit dem zukunftsweisenden Namen Die Autobahn heraus. In Analogie zur Eisenbahn sollte der Ausdruck für das ersonnene Straßennetz stehen. Die im Deutschen Reich getroffenen Überlegungen zum Aufbau leistungsfähiger Straßen sind nur im Kontext zu den verschiedensten Überlegungen zu verstehen, die damals in allen europäischen Industriestaaten angestoßen wurden. Bereits in den 1920er Jahren war an eine Autobahn zwischen Deutschland und Italien gedacht worden. Der Begriff „Autobahn“ war somit, genauso wie die Idee dazu, schon lange vor der Vereinnahmung durch die NS-Propaganda gebräuchlich.
Die HaFraBa
Die HaFraBa e. V. (Silbenwort für Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel) war das erste große Reichsautobahn-Projekt in Deutschland, an das bis heute der Autobahnbau anknüpft.
Plakat zu einer Ausstellung im Gewerbemuseum Basel 1927, gestaltet von Robert Stöcklin
„Bei Kriegsende 1945 waren rund 3900 Kilometer [Autobahn] fertig gestellt, davon 2200 Kilometer im Bereich der späteren Bundesrepublik.“
Der Verein wurde am 6. November 1926 als Verein zum Bau einer Straße für den Kraftwagen-Schnellverkehr von Hamburg über Frankfurt a. M. nach Basel von Straßenbaufirmen unter der Führung von Robert Otzen gegründet und hatte seinen Sitz in Frankfurt am Main. Geschäftsführer des Vereins wurde Willy Hof. Die Organisation projektierte eine Autobahnverbindung von Hamburg über Hannover und Frankfurt am Main nach Basel (und dann weiter durch die Schweiz nach Genua). Die damals geplante Trasse entspricht in etwa dem Verlauf der heutigen Bundesautobahn 5 (zwischen Heidelberg und Darmstadt abweichend der A 656, Teilen der A 6 und A 67) und weiter nördlich der A 7 bis Hamburg.
Am 31. Mai 1928 wurde der Verein umbenannt in Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel, um auch die Hansestädte Bremen und Lübeck in die Planungen einbeziehen zu können – dabei blieb das Kürzel HaFraBa passenderweise unverändert. 1930 wurden in mehreren summarischen Artikeln mit dem Untertitel Städte an den Hafrabastraßen von J.F. Amberger (Heidelberg), Adolf Elsaesser (Stadtbaudirektor Mannheim), Theodor Krebs (Darmstadt), Maurer (Mainz), Rehorn (Verkehrsdirektor Kassel) und Carl Thalenhorst (Senator für Bauverwaltung Bremen) im Hafraba-Mitteilungsblatt die detaillierten Planungen der jeweiligen Städte zur Anbindung an die Hafraba vorgestellt. Da die öffentlichen Stellen keine Notwendigkeit für das Projekt erkannten, war zur Finanzierung über ein Mautsystem nachgedacht worden. Die Berechnungen ergaben folgende Preise:
ein Auto inklusive Fahrer: 3 Pfennig je Kilometer
jede weitere Person: 1 Pfennig je Kilometer
Lastkraftwagen: 2 Pfennig je Kilometer
Beladung: ½ Pfennig je Tonne und je Kilometer
Das Projekt stieß zunächst auf Ablehnung seitens der Nationalsozialisten. Nach Hitlers Machtübernahme wurden die Planungen jedoch teilweise übernommen und die Ideen-Urheberschaft reklamiert. So forderte der damalige Generalinspektor für das Deutsche Straßenwesen, Fritz Todt: „Die Reichsautobahnen, wie wir sie jetzt bauen, haben nicht als von der HAFRABA vorbereitet zu gelten, sondern einzig und allein als Die Straßen Adolf Hitlers“. Der Name des Vereins wurde in GEZUVOR („Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsautobahnen e. V.“) geändert. Das Hauptaugenmerk für die Autobahnnutzung galt weniger dem Individualverkehr, der damals nur sehr beschränkt vorhanden war, als dem Lastwagenverkehr und den Reichsbahn-Schnellomnibussen Frankfurt–Darmstadt–Mannheim–Heidelberg, die dreimal und zwischen Darmstadt und Frankfurt sechsmal täglich in beide Richtungen verkehrten.
Die Landstraße 185 Köln-Bonn
Eine weitere Schnellstraße für den Fernverkehr, die alle wesentlichen Merkmale späterer Autobahnen aufwies, war die rund 20 km lange „Landstraße 185“ zwischen Köln und Bonn (heute Bundesautobahn 555). Die nach der AVUS erste deutsche Kraftwagenstraße, die als reine Autobahn geplant war, ist die von 1929 bis 1932 gebaute Strecke von Köln (Anschlussstelle Wesseling) nach Bonn, die 18 Kilometer lang war. Zu ihrer Eröffnung wurde eigens eine Polizeiverordnung erlassen, die das Halten oder Parken von Fahrzeugen verbot. Der Verkehr wurde vollständig auf Kraftwagen beschränkt. Motorräder, Gespanne, Fahrräder und das Treiben und Führen von Tieren waren verboten. Die zwölf Meter breite Fahrbahn war vierspurig angelegt, einen begrünten Mittelstreifen gab es noch nicht. Stattdessen waren die Fahrspuren lediglich durch eine breite, durchgezogene Linie voneinander getrennt. Die zwei Meter breiten Bankette waren genauso hell gehalten wie die in regelmäßigen Abständen aufgestellten Leitsteine, deren Köpfe schwarz gestrichen waren. Teile der Strecke waren nachts beleuchtet. Die unter dem damaligen Kölner Bürgermeister Konrad Adenauer fertiggestellte Rheinische Provinzialstraße Köln – Bonn blieb die einzige „Autobahn“ (wenn man sie denn bereits so bezeichnen will, fehlten doch z. B. noch ein Netzwerkcharakter sowie ein System von Nebenbetrieben), welche mittels kommunaler Eigenfinanzierung gebaut wurde. Die Strecke führte direkt an den Rand der beiden Städte, die sie verband, und mündete dort in einem Verteiler. Mit einer einzigen zusätzlichen Auffahrt bei Brühl besaß sie nur einen begrenzten Zugang. Es war zum damaligen Zeitpunkt nicht geplant, diese Straße in ein deutschland- beziehungsweise europaweites Autobahnnetz einzubinden.
Die Planung und Erbauung erfolgte unter der Federführung der Rheinischen Provinzialverwaltung in Düsseldorf unter dem Vorsitz des Landeshauptmanns Johannes Horion und mit Unterstützung des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer und seines Bonner Kollegen Franz Wilhelm Lürken, die sie auch gemeinsam einweihten. Adenauer hatte eine federführende Rolle bei der Planung des Projekts gespielt, wobei insbesondere außenpolitischen Faktoren großes Gewicht zukam, die ihre Grundlage in dem verloren gegangenen Weltkrieg hatten.
Wilhelmshaven.- Leichter Kreuzer "Köln", Stapellauf, in Anwesenheit von (vorne vlnr) Hans Zenker, Wilhelm Groener, Konrad Adenauer(Mitte), Gustav Noske
Von Bundesarchiv, Bild 102-05952 / CC-BY-SA 3.