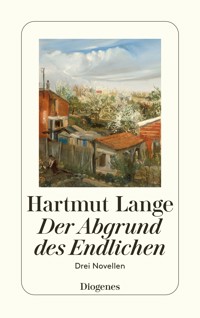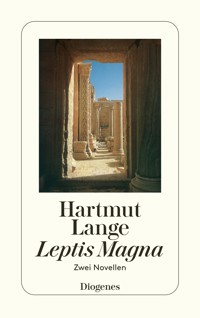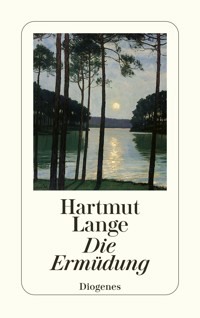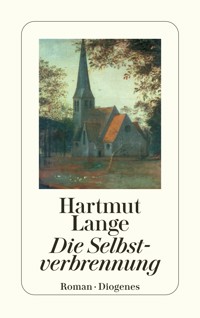
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Nachricht von der Tat eines Pfarrers, der sich selbst verbrannt hat, beunruhigt die Hauptpersonen dieses Romans: Sempert, der in einem kleinen Dorf an der Elbe Ruhe sucht, um ein Traktat zu schreiben. Und Koldehoff, den Pfarrer dieser Gemeinde. Koldehoffs Tochter und Sempert verlieben sich ineinander… Bis ein anderes Ereignis Sempert und Koldehoff auf unterschiedlichste Weise betrifft und betroffen macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hartmut Lange
Die Selbstverbrennung
Diogenes
1
Das Gras zwischen den alten, verwitterten Grabsteinen war längere Zeit nicht geschnitten worden, es reichte dem Pfarrer Martin Wilhelm Koldehoff bis über die Knie. «Hier ruht in Gott unsere liebe Mutter Maria Schlei, geborene …» Der hagere Mann mit dem kurzen, strenggescheitelten Haar (das Haar hielt dem Wind stand, es glänzte, der Pfarrer benutzte offenbar eine Salbe), der hagere Mann hielt ein Notizbuch in der Hand und notierte mit einem daumenlangen Bleistift die Namen der Toten. «Hier ruht in Gott unsere liebe Mutter …»
Es war Herbst. Die Blätter der Linden verfärbten sich. Ihr helles, fleckiges Gelb glänzte vor Nässe. Es hatte die Nacht über geregnet, und die Straße war übersät mit Wasserlachen, in denen sich der Himmel spiegelte. Aber bis gegen Nachmittag würde der Wind, falls er anhielt, alles wieder trockenfegen. Dies war jedenfalls die Ansicht eines jungen Mannes, der in dem Gasthaus der kleinen Ortschaft am Fenster saß und dem Pfarrer bei seiner merkwürdigen Tätigkeit zusah.
Das Gasthaus, ein Bau aus roten Ziegelsteinen, und die Kirche mit dem Friedhof und der Pfarrei lagen einander gegenüber, getrennt durch die Straße und den Teich, ein schmutziges Gewässer, das bei großer Hitze austrocknete und in dem meist Enten und Gänse badeten und dessen Oberfläche jetzt voll von Lindenblättern war, die der Wind übereinanderschob. An einem Ende des Ufers standen Sträucher, am anderen Ende (der Teich war oval, in Richtung der Straße etwas langgestreckt) stand ein Obelisk aus Granit, dem man die bronzene Gedenkplatte für die Gefallenen der Jahre 1914 bis 1918 ausgebrochen und statt dessen eine große, hölzerne Tafel umgehängt hatte, auf der in weißen Buchstaben auf rotem Grund eine Losung zu lesen war: «Vorwärts, Bauer – zum Sieg des Sozialismus!»
Sempert, so hieß der nicht mehr ganz junge Mann am Fenster, lächelte über diese Losung. Er erinnerte sich an das Gesicht jenes ehemaligen Landarbeiters, der sie erfunden hatte: Es war grob, gutmütig, aber die Unsicherheit desjenigen, dem fremde Fähigkeiten zudiktiert werden, die seine eigenen Fähigkeiten übersteigen, machte auch dieses Gesicht zur Drohung. Und Drohungen gutmütiger Art kannte Sempert zur Genüge. Sie waren von allen politischen Verkrampfungen, die dieses Land heimsuchten, die unerträglichsten.
Es war übrigens das erste Mal, daß man Sempert untätig in dem Gasthaus am Fenster sitzen sah. Er saß sonst längst in seinem Mansardenzimmer und war, sowie er gefrühstückt hatte, mit dem Studium seiner Bücher beschäftigt, aber ein Gefühl der Ermattung, der Gleichgültigkeit, das sehr wohltuend und sinnlich greifbar in der Gegend des Magens zu sitzen schien, hielt ihn heute zurück. Er genoß jene Mischung aus schlechtem Gewissen und trägem Kitzel, es war ihm angenehm, nach dem Frühstück, die Tasse mit dem kaltgewordenen Tee vor sich, einfach so dazusitzen und der absterbenden Natur zuzusehen, deren Monotonie und Gleichgültigkeit ihn beruhigte, auch wenn nichts weiter geschah, als daß der Wind an den Linden rüttelte und Blatt für Blatt sich aus dem Geäst löste und, von der Kraft des Windes gehalten, langsam, aber sicher zu Boden fiel.
Das Gesicht des Vierzigjährigen zeigte Spuren der Resignation. Es wirkte schlaff. Die blauen, etwas verschleierten Augen und das müde Lächeln, das sich in zwei tiefen Furchen über den Mundwinkeln festgesetzt hatte, der von Jahr zu Jahr immer weiter zurückweichende Haaransatz, dessen Blöße Sempert durch geschicktes Kämmen der Schläfenhaare zu bedecken versuchte, die träge Art zu sprechen, das kaum merkliche Hängenlassen der Unterlippe, die Angewohnheit, den Kopf immer etwas zu sehr in Richtung Nacken zu halten, so daß der Eindruck entstand, er würde, falls Sempert diese Anstrengung unterließ, unweigerlich mit dem Kinn auf die Brust fallen, dies alles waren Anzeichen einer nachlassenden Spannkraft. Aber ihm selbst war dieser eigene, aus innerer Befindlichkeit herrührende Zustand durchaus noch unbewußt, da er von Kind auf daran gewöhnt war, dem Werden und Vergehen der Außenwelt seine freudige Aufmerksamkeit zu widmen. Daß aber diese eigene, freudige Aufmerksamkeit ebenfalls nur ein Werden und Vergehen war, diese Entdeckung stand Sempert noch bevor.
Wer der Herr auf dem alten Friedhof sei, wollte Sempert wissen, und er sagte bewußt «alter Friedhof». Denn er wußte, die örtlichen Vertreter der Staatsmacht hatten dafür gesorgt, daß sich die Verstorbenen künftig nicht mehr, wie seit Jahrhunderten üblich, in die Erde um Kirche und Pfarrei teilen mußten. Man hatte ein Stück Wiese umgebrochen, Birken gepflanzt, das Ganze mit einem Zaun aus Draht umgeben, und achtzehn Gräber lagen schon (sehr zur Genugtuung des ehemaligen Landarbeiters) in der viel helleren, freieren Umgebung, statt im Schatten jener Gebäude, die der ehemalige Landarbeiter mit der bereits bekannten drohenden Gutmütigkeit «die muffigen Monumente eines überlebten Aberglaubens» nannte.
«Das ist der Pfarrer», antwortete die Frau, die hinter der Theke an einem Pullover strickte und ansonsten Brot, billige Leberwurst und Bier aus verstaubten Flaschen verkaufte.
«Ja, aber was macht er?» fragte Sempert.
«Was wird er schon machen.»
«Es scheint, er notiert die Namen der Toten von den Grabsteinen.»
«Kann sein», sagte die Frau.
«Aber der Mann steht nicht nur auf dem Friedhof. Er predigt hoffentlich zu den Leuten.»
«Ganz recht. Man hört schon, daß er predigt.»
«Gehen überhaupt Leute in die Kirche?»
«Ja», sagte die Frau. «Die Koldehoffs sind beliebt hier. Besonders die Tochter. Und der Vater soll nicht nur aus der Bibel lesen. Er studiert die Sterne und macht überhaupt merkwürdige Sachen.»
«So», sagte Sempert und schwieg. Die Erwähnung privater Umstände, denen auch der Mann auf dem alten Friedhof ausgesetzt war, dämpfte sein Interesse. Er betrachtete nun das kleine Gebäude mit dem verrosteten Kreuz auf dem Giebel, jenes fleckige Gebilde, von dem der Putz abbröckelte und von dem bei Sturm Reste der verschlissenen Dachrinne zu Boden fielen, und er schüttelte sich bei dem Gedanken, in der kleinen Kirche könnte es ebenso riechen wie in der Totenhalle einer städtischen Begräbnisanstalt und es könnten am Altar ebensolche Blumen aufgestellt sein wie beim Begräbnis seiner Mutter: graue, wachsartige Gebilde, denen der Staub bei ihrer künstlichen Fertigung unauslöschlich aufgedrückt war und die Sempert mit einer Trostlosigkeit sondergleichen gezwungen hatten, mitten in der Totenfeier, als Violine und Cello noch ihre kratzenden, schluchzenden Töne von sich gaben, gegen einen Anfall von Ekel, ein Gefühl heftigster, Übelkeit erzeugender Abneigung anzukämpfen, und sich, den Sarg seiner Mutter vor Augen, weit weit wegzuwünschen.
Nein, sterben, das schwor Sempert damals, sterben und begraben werden war keine Feier wert, an der Lebende teilzunehmen gezwungen werden sollten. Seine Mutter hatte ihm wenigstens hier nichts voraus als jene kurze Spanne Zeit, die auch an ihm vollzogen wurde, damit auch er unter solcher Art Blumen zu liegen käme. Aber diese kurze Spanne Zeit war für ihn die vergängliche, zufällige, unwiederholbare Form seiner selbst, und es war ihm unbegreiflich, wie vernunftbegabte Menschen am offenen Grab, von der Kanzel herab, in der Geselligkeit von Synoden in spekulativer Sorge über das Jenseits ihres Herrn das wirkliche Leben versäumen konnten. Er erhob sich, da die Gedanken an den Tod seiner Mutter ihn beunruhigten und sich das angenehme Gefühl der Ermattung, das ihn beim Anblick der herbstlichen Natur überkommen war, nicht wieder einstellen wollte, er zahlte der Frau hinter der Theke seinen Tee, grüßte respektvoll und trat auf die Straße hinaus.
Woher kam dieser resignativ wirkende, nicht mehr ganz junge Mann, der nun, obwohl der Regen wieder einsetzte, mit schleppenden, unentschlossenen Schritten die Dorfstraße in Richtung Westen verließ? Er kam aus Magdeburg. Was wollte er in dieser Einöde? Er wollte Ruhe, und er hoffte, inspirative Luft zu atmen. Er hatte hochgespannte Absichten, er schrieb an einem philosophischen Traktat «Zum Lobe der materialistischen Vernunft», und er durfte die Elbwiesen zur Gegend seiner unmittelbaren Herkunft rechnen. Sein Großvater war hier als elftes Kind einer armen Pächterfamilie geboren und hatte in Magdeburg oft von ihrer melancholischen Schönheit geschwärmt. Er hatte sein Leben in der Stadt, von der er sich nie wieder losmachen konnte, als Tischler mit Anstand und sauberer Ärmlichkeit hinter sich gebracht, und er starb in ungestillter Sehnsucht nach Kühen, Pferden, Störchen, dem Geruch blühender Pappeln, dem kurzen, aufgeregten Flug der Kiebitze über binsenumstandenen Wasserlachen, dem erschreckenden Gekreisch der Krähen, die, sowie die ersten Herbststürme von Westen her den Himmel eindunkelten, in wahren Völkerschaften in die von Hufen aufgewühlten Viehkoppeln einfielen, er starb in ungestillter Sehnsucht nach dieser regen- und winderfüllten Landschaft inmitten von Sägespänen, harziger, staubiger Luft und Töpfen mit Knochenleim.
Das war vor vierzig Jahren. Vier Jahre später fiel Semperts Vater in der Schlacht am Kursker Bogen, und als Semperts Mutter starb und Sempert jedes Gefühl näherer Verwandtschaft zu verlieren fürchtete, beschloß er, die Gegend seiner großväterlichen Herkunft aufzusuchen. Er nahm ein Fahrrad als Expeditionsgut mit sich, um von den Bussen und seiner Unkenntnis der Fahrpläne unabhängig zu sein, wechselte mehrmals die Personenzüge über Stendal, Wittenberge, Ludwigslust, verließ in Dersenow den Bahnhof und radelte über Gülze bei strahlendem Wetter in Richtung Bernede. Er wußte, er würde ein, zwei Cousinen in eben dem Dorf rechts der Elbe antreffen, und so saß er abends unangemeldet und erschöpft von der ungewohnten Radtour auf ihrem Sofa und lächelte ihnen ins Gesicht. Am nächsten Morgen zeigten ihm die Cousinen die langgestreckte Kate, in der der Großvater gezeugt und geboren worden war, und man war sich einig, in solch einem üblen Gemäuer sollte niemand mehr gezeugt und geboren werden. Dann saß man wieder auf dem Sofa, Sempert versicherte, er sei froh, hier gewesen zu sein, versprach aber auf ihren Rat hin noch einen Besuch der näheren Umgebung.
Es war Ende Mai. Das überschwengliche, überfallartige Hervorbrechen der Natur faszinierte ihn. Er lag, die Rückfahrkarte nach Magdeburg griffbereit in der Tasche, stundenlang im Gras, beobachtete die Insekten oder stocherte mit einem Stecken im Gestrüpp der Entwässerungsgräben herum. Er vergaß die Zeit, er atmete wie sein Großvater den Duft der Pappelblüten tief in sich hinein, und die Cousinen zeigten Nachsicht über so viel Selbstvergessenheit. Sie lächelten ebenfalls und winkten zurück, wenn sie, auf den hinteren Schutzblechen eines Traktors sitzend, die Kopftücher fest unters Kinn verknotet, zu den Feldern hinausfuhren.
Am nächsten Tag verließ Sempert Bernede unter Zurücklassung seines Fahrrades, aber acht Wochen später erschien er wieder, diesmal einen Koffer bei sich, in dem er große Mengen Papier, Bücher, eine kleine Schreibmaschine verstaut hatte, und sein verlegenes Lächeln, das die Cousinen nun nicht mehr beantworteten, kündigte an, daß er vorhatte, in dieser Gegend neue, und wie schon erwähnt, inspirative Luft zu atmen. Er entzog sich den verwandten, aber säuerlichen Gesichtern, murmelte ein paar Höflichkeiten, schob sein Fahrrad, das die Cousinen im Regen hatten stehen lassen, auf die Straße, lud den Koffer auf und fuhr in die Nachbarschaft, wo ihm bei einer freundlichen Bäuerin namens Karsten, die er bei seinen Cousinen kennengelernt hatte, ein kleines Mansardenzimmer zur Miete versprochen war.
Nun folgten neun Wochen, in denen Sempert vor allem in seinem Mansardenzimmer hockte, denn er wollte die endgültige Rückreise nach Magdeburg nicht antreten ohne das stolze Gefühl, in seinem Koffer genügend Material für das Verfertigen belangvoller Gedanken angesammelt zu wissen, und welche Art belangvoller Gedanken Sempert bevorzugte, darüber hätte Frau Karsten Auskunft geben können, wenn sie mit ihrem Tuch jene sieben Buchbände abstaubte, aus denen Sempert mehrmals am Tag exzerpierte und die er stets, soweit es die Umstände erlaubten, griffbereit hielt.
Mit diesem Rüstzeug und der gelegentlichen Nahrungsaufnahme von Brot, billiger Leberwurst und Zwiebeln studierte Sempert in der Abgeschiedenheit Bernedes die Erscheinungswelt der sich selbsterkennenden Logik, und er durchlebte Stunden rauschhafter Konzentration, aber auch Stunden, ja Tage völliger Abgeschlafftheit, an denen nur noch die Selbstachtung ihn dazu zwingen konnte, statt Ergebnisse klaren, freudigen Denkens wenigstens trübe, unklare Bemühungen aufs Papier zu malen. Obwohl er Alkohol als unerträglich empfand, griff er gelegentlich doch zu einer Flasche Wodka, und drei, vier Gläser dieses hochgradigen Destillats konnten seine apathische, oft mutlose Stimmung aufbessern, so daß er wieder fähig und bereit war, sich auf den Flügeln philosophischer Wünsche und Verheißungen zu erheben. Es war die unbedingte Freude an der Fähigkeit menschlichen Erkennen-Könnens, die Sempert mit dem Philosophen seiner Wahl teilte, und er teilte auch dessen Zuversicht, daß sich der menschliche Kopf, dieses kostbare, einzigartige Instrument, auf den Flügeln des Begriffs hoch über seine eigene und sonstige stupide Materialität erheben und zuletzt nach ständigem, unaufhörlichem Wachsen eben diese eigene und sonstige Materialität mit den Mitteln der wissenden Vernunft steuern würde, wohin es ihm immer beliebte. Sempert huldigte also einer Philosophie, die seinem Intellekt, der ihm reichlich zur Verfügung stand, schmeichelte. Es war dies eine Weltsicht, die auch dem Staat, in dessen Machtbereich Sempert lebte, in all seinen Institutionen das Ansehen strenger, selbstbewußter Vernünftigkeit gab, da jeder höhere Beamte in Zirkeln, Seminaren, gesonderten Schulen ausgiebig darüber belehrt wurde, daß er sein Amt nicht aus Willkür oder fremdem Interesse, sondern einzig infolge seiner Einsicht in die objektiven, gesetzmäßigen Prozesse dieser Welt ausüben durfte.
Es dämmerte. Die nasse, von Regenlachen übersäte Erde begann Semperts Schuhsohlen aufzuweichen, und er entschloß sich, sowie er heimkam, Schuhe und Sokken an der Heizsonne zu trocknen, aber vorher wollte er noch einen Spaziergang versuchen. Er tänzelte zwischen den Lachen hin und her, in der Hoffnung, das brüchige Leder doch noch vor der kalten, unangenehmen Nässe zu schützen, und er erreichte jenes Feld, das zu überqueren ihm jedesmal eine besondere Entschlossenheit abverlangte. Es war fünf Hektar groß, quadratisch angelegt, und es hatte in der Mitte eine dammähnliche Zufahrt, die es in zwei Hälften teilte, und wer dieser Zufahrt folgte und das Feld überschritt, erreichte jenen Mischwald, der zur Elbe führte, und den zu betreten nur unter Gefahr für das eigene Leben möglich war.
Sempert folgte der Zufahrt, blieb aber nach einigen Metern stehen, um rechter Hand die Schönheit einer uralten Eiche zu bestaunen, deren oberes, abgestorbenes Geäst in den Himmel ragte. Er wunderte sich über den Geschmack derjenigen, die diesen Baum inmitten umgebrochener Erde hatten stehen lassen, wie um mit seiner nutzlosen Schönheit auf die Nützlichkeit seiner Umgebung hinzuweisen, und er schlenderte bis zur Mitte des Feldes, wo er umkehren wollte. Zuvor aber wollte er den Einbruch völliger Dunkelheit abwarten, die hier, in der freien Sicht auf die Wolken und wo man die Silhouette des dichten, unheimlichen Mischwaldes vor Augen hatte, am eindrucksvollsten war.
Sempert hatte hier oft gestanden und über dem Mischwald bei zunehmender Dunkelheit einen unbestimmten Schein entstehen sehen, der hell genug war, um darunter Lauenburg oder sogar Hamburg zu vermuten. Aber dies waren Vermutungen, denen Sempert keinerlei Beachtung schenkte, wie überhaupt gesagt werden muß, daß ihn die politische Markierung, deren Unüberwindlichkeit durch Androhung sofortiger Todesstrafe garantiert werden sollte, daß ihn dieser Streifen unberührbaren Landes, zu dem die Elbwiesen gehörten, die von hölzernen Türmen, von Zäunen und versteckten Minenfeldern gesichert wurden, daß ihn diese Grenze anschaulich gemachter Ideologie keineswegs daran hinderte, seinen Blick unbekümmert mit den Wildenten in Richtung Nordnordwesten wandern zu lassen. So stand er auch heute eine Weile, beide Fäuste in den Hosentaschen, den Kragen seiner Jacke hoch aufgeschlagen, die Schultern hochgezogen, um den Kopf gegen den kalten, andrängenden Wind zu schützen, und sah in das Geviert, dessen büscheumstandene Umrandung immer undeutlicher wurde. Dabei spürte er, wie so oft, wenn er sich der alle Unterschiede verwischenden Dunkelheit ausgeliefert sah, ein Gefühl beklemmender Unsicherheit. Er fühlte sich beobachtet. Und stand nicht am Ende der Zufahrt in unmittelbarer Nähe des Mischwaldes, aber doch in solch einem Abstand, daß dessen schwarze Schatten ihn nicht verschluckten, dort, wo die Zufahrt durch einen Schlagbaum gesperrt und der Unbefugte durch eine Tafel mit dem Hinweis «Grenzgebiet» am Weitergehen gehindert werden sollte, stand da nicht irgend jemand und sah in Semperts Richtung? Und stand er nicht seit Anfang an, seit Sempert das freie Feld betreten hatte, so unauffällig da, ohne sich zu rühren?
Sempert bemühte sich, die Distanz, die Einzelheiten jener Erscheinung verwischte, durch besondere Anstrengung seiner Augen zu überwinden, was ihm nicht gelang. Aber der Himmel zwischen den Wolken gab dem Unbekannten ausreichend Konturen, und Sempert wußte: ein Posten würde, nachdem er ihn durch sein Fernglas gemustert hatte, weiterziehen. Dieser aber benahm sich wie jemand, der die Gegend ebenfalls zu scheuen hatte und dessen Abwesenheit ein herausforderndes Beharren war und der bereit schien, falls diese Herausforderung entdeckt wurde, sofort wieder zu verschwinden. Er zeigte die Haltung eines starken, aber scheuen Tieres, und Sempert spürte, je mehr er Gewißheit darüber erlangte, daß der Unbekannte ihn selbst und die Gegend, die zu betreten ihm verboten war, überaus herausfordernd musterte, eine Mischung aus Neugierde und ängstlicher Empörung.
Er ging einige Schritte auf der Zufahrt in Richtung Mischwald dem Unbekannten entgegen, in der Absicht, ihn in Stellvertretung einer abwesenden Wache zu stellen oder ihn doch ernsthaft daran zu erinnern, daß dies nicht der Ort für herausfordernde Haltungen war, und obwohl er gleichzeitig das Anmaßende, ja Lächerliche dieser Absicht spürte, wuchs ihm, je näher er dem Unbekannten kam, ein Gefühl von aggressiver Kompetenz zu. Er begann rascher, entschlossener zu gehen, er hatte Mühe, sich zu zügeln, er hatte das Bedürfnis, den Unbekannten schon jetzt, über diese beträchtliche Distanz hin, mit schneidender Stimme anzurufen. Aber nun überraschte ihn von Westen her ein trockener Knall. Eine Leuchtkugel stieg hinter der Silhouette des Mischwaldes zum Himmel auf, und als Sempert ihren farbigen Schein zur besseren Sicht auf den Unbekannten nutzen wollte, war dieser zwischen Büschen verschwunden. Eine Weile noch stand Sempert irritiert und unschlüssig da, die Ellbogen gegen die Rippen gepreßt, die Augen gegen den Wind zusammengekniffen, die Wucht der aggressiven Erregung spürend, der das Objekt so plötzlich entzogen war, aber dann brach die Dunkelheit, die er abwarten wollte, mit massiver Wolkendecke über ihn herein. Wind und Regen wurden unerträglich, er kehrte in sein Mansardenzimmer zurück.
Um den Weg dorthin abzukürzen (das Haus mit dem Mansardenzimmer lag außerhalb der Ortschaft), ging er geradewegs über die aufgeweichten Felder, und endlich angekommen, legte er, nachdem er schon die Treppe barfuß, Schuhe und Socken in der Hand, hinaufgestiegen war, die durchnäßte Kleidung in die Nähe der Heizsonne; und da er nun buchstäblich nackt war (Sempert besaß nur, was er auf dem Leib trug), entschloß er sich, frühzeitig ins Bett zu gehen. Zwar hatte er sich vorgenommen (die losen Blätter lagen griffbereit auf dem Tisch, er hätte die Arbeit ebensogut im Bett unter dem Schutz der Wolldecke leisten können), eines seiner zahlreichen Exzerpte noch einmal kritisch zu überprüfen, aber die neuerliche Trägheit, die so verführerisch, so sinnlich greifbar in der Gegend des Magens zu sitzen schien, hinderte ihn daran, Arme und Beine in Bewegung zu setzen. Er bedauerte, daß er keinen Wodka mehr hatte, um seinen Schlaf, der ihm jetzt wünschenswert erschien, künstlich herbeizuführen. Er lag lange Zeit apathisch unter der Decke, hörte auf das Geäst der Bäume, das der Wind vor dem Fenster gegeneinanderschlug, atmete den schweren, süßlichen Geruch der trocknenden Kleider und begann zu träumen.
Er träumte von jener Begegnung in der Nähe der Grenze. Aber nun sah Sempert sich, statt in der Rolle des kompetenzwütigen Verfolgers, in der Rolle des Verfolgten. Er hetzte durch den Mischwald, immer das dunkle, undurchdringliche Unterholz fürchtend, immer auf der Suche nach einer Lichtung, die er sich, wie um sich zu quälen, als rettenden, aber unerreichbaren Ort vorstellte. Zuletzt sah er Wiesen, darin ein langgestrecktes, schimmerndes Etwas, er sprang hinein. Es war die Elbe. Er wurde sofort unter Wasser gezogen, ertrank und trieb nun als Leichnam stromabwärts. Dagegen protestierte er heftig. Er schrie, er ärgerte sich über so viel Unsinn noch im Traum und wünschte zu erwachen, was ihm gelang. Nun ging er zum Fenster und versuchte, sein Herz zu beruhigen und starrte auf den Mond, der im Südosten in einem inzwischen windstillen, fast wolkenlosen Himmel aufgestiegen war. Verblüfft über den für ihn jähen Wechsel im Zustand der Natur, erinnerte er sich dreier Strophen, die er als Jugendlicher gereimt hatte und in denen er jetzt wie in einem metaphorischen Spiegel an sich selbst eine Entdeckung zu machen glaubte.
‹Merkwürdig›, dachte er. ‹Es ist, als gäbe es keine Veränderung in der Zeit. Als sei ich trotz widersprechender Wahrnehmungen immer ein und derselbe. Als hätte ich wie die Natur an mir selbst einen imaginären Kreis vollzogen: Denn dies ist der Himmel wie vor sechzehn Jahren!›
Der Wind hat sich verhangen
Das Mondlicht hockt im
Strauch Ist übers Moor gegangen
Und brennt und knistert auch
Die Eiche grinst gespalten
Verstohlen treibt das Boot
Am Himmel ziehn Gestalten
Die Fledermaus ist tot
Die Nacht hat sie begraben
Jetzt grillt der letzte Gast
Zwei Totenkäfer schaben
Und Nebel fällt vom Ast.
Und es überfiel ihn zum erstenmal, indem er sich, wohl aus Schlaftrunkenheit, der naiven Unheimlichkeit seiner Verse ausgeliefert sah, so etwas wie Angst darüber, es könnten mit ihm und um ihn herum Dinge geschehen, die er mit seinem Intellekt nicht mehr fassen konnte. Er hatte plötzlich das Verlangen, dieser ländlichen Gegend ihrer einfachen, aber unbestechlichen Anschaulichkeit wegen zu entfliehen, um in der Stadt, in der kein Mond, kein Friedhof, kein büscheumstandenes Geviert ihn erschrecken und seinen Intellekt daran hindern konnten, die eigene Natürlichkeit vergessend, die Dinge um sich her so lange zu ordnen, bis sie eine zweite, ihm gemäße Art zu existieren annahmen.
Er packte seinen Koffer und entschloß sich zur Abreise schon am nächsten Tag. Aber dann war er wirklich müde. Er setzte die Heizsonne außer Betrieb, öffnete das Fenster, spürte noch die frische, kalte Luft, die er gierig in sich einsog – und schlief ein.
2
Am nächsten Tag war herrliches Wetter. Wind und Wolken hatten sich, wie schon erwähnt, im Laufe der Nacht verflüchtigt. Auf der Dorfstraße war niemand, aber bald, es fehlten wenige Minuten, würden sich einige ältere Männer und Frauen, darunter die alte Hanna, auf den Weg zur Kirche machen, schweigend, jeder für sich, in beträchtlichem Abstand zueinander, bis sie das Portal aus roten, vom Regen verwaschenen Ziegelsteinen erreicht hatten, vor dem Martin Wilhelm Koldehoff wartete, um jedem von ihnen, bevor er ins Kircheninnere trat, die Hand zu reichen. Dies tat Koldehoff auch beim Abschied, und dies war die Stunde, Hin- und Rückweg der Gläubigen eingerechnet, der Gottesdienst dauerte akkurat fünfundvierzig Minuten, die den ehemaligen Landarbeiter ärgerte. Er saß, beide Ellbogen aufgestützt, die Hände unter dem Kinn gefaltet, im Gasthaus von Bernede in der Nähe der Theke, das Gesicht Sempert zugewandt, den er aber nicht ansah, sondern er versuchte, an ihm vorbei aus dem Fenster zu sehen, das Sempert mit seinem Rücken abdeckte.
«Gleich fängt er an zu bimmeln», sagte er. «Länger als erlaubt. Dann redet er, und sie singen. Dann bimmelt er wieder, und dann schwanken diese Gestalten in ihre Behausungen zurück. Man wollte die Pfarrbude abreißen, aber seit dieser Kerl da ist, rühren sich die alten Gespenster wieder.»
Sempert hatte zum letztenmal Tee bestellt, der Koffer stand griffbereit neben dem Stuhl, und nun kam auch schon die Frau hinter der Theke hervor, um ihm den Tee zu bringen und um zum soundsovielten Male mit einem feuchten Tuch den Tisch zu wischen, und Sempert sah, daß sie geschwollene Beine und ganz und gar unförmige Knie hatte und trotzdem einen kurzen Rock trug, anstatt ihren Zustand mit einem barmherzigen Stück Stoff zu bedecken.
‹Sie hat Wasser›, dachte er. Ihre ungesunde Nähe beunruhigte ihn, und er sagte, in der Absicht, die Frau am weiteren Wischen mit dem Lappen, der säuerlich roch, zu hindern:
«Ich möchte gleich zahlen.»
«Sie wollen uns wieder verlassen?»
«Ja», sagte Sempert.
«Wohin gehen Sie?»
«Zurück nach Magdeburg.»
«Hoffentlich hast du auch geschrieben, daß wir über fünfhundert Stück Vieh haben. Aber nun haben einige die Seuche, und nun bitten wir, daß uns nicht alle eingehen.» Mit diesen Worten schob sich der Beamte, nach einem kurzen Griff in die Jackentasche, eine Zigarette zwischen die Lippen, setzte sie mit einem Feuerzeug in Brand, zog den Rauch mit tiefen, heftigen Zügen, die die Zigarette zentimeterweise aufbrauchten, ins Lungeninnerste, und Sempert wartete darauf, daß der Rauch beim Ausatmen wieder zum Vorschein käme, aber er blieb verschwunden.
Die beiden Männer kannten sich. Sempert hatte diesen Beamten mehrmals besucht, und er hatte, eingehend darüber befragt, Einzelheiten seiner Arbeit erwähnt, ohne allerdings bei dem ehemaligen Landarbeiter mehr als das Bedürfnis nach neuen Fragen zu wecken. Denn der konnte Sinn und Zweck solch hoher, einzig in den Sphären des Begriffs tätiger Anstrengung nicht einsehen. Trotzdem herrschte zwischen den beiden längere Zeit ein freier, offener Ton, wie er sich bei Leuten versteht, die zuerst ihre Außenwelt und zuallerletzt ihre innerliche, subjektive Befindlichkeit aufzufassen willens und in der Lage sind. Aber auch eine Beamtenschaft, die ständig und mit wechselndem Erfolg bemüht war, auf den Höhen bewußter Vernünftigkeit zu wandeln, zeigt sich irgendwann in den Niederungen unbewußter Empfindungen. Bald wurde die Stirn des Überforderten, sobald er Sempert sah, krauser und krauser, und Sempert versuchte, über dieses und jenes, nur nicht über den Sinn seiner Tätigkeit zu reden, weil er wußte: Er schrieb mit seinem Traktat etwas durchaus Wünschenswertes, aber gerade dies Wünschenswerte konnte Mißtrauen erwecken, falls es unter Ausschluß öffentlicher Kontrolle und wie hier aus ganz eigener Neigung, aus angeborener Neugierde für die letzten Gründe logischer Dinge in Bewegung gesetzt wurde.
Zuletzt unterließ Sempert seine Besuche, man verlor sich, da die Ernte den Beamten Tag und Nacht beanspruchte, aus den Augen, und nun, da man sich zufällig wieder traf, war die gegenseitige Reserviertheit unübersehbar. Sie grüßten einander nicht mehr, Sempert sah schweigend auf das kreisrunde Abzeichen im oberen linken Knopfloch, das dem Mann seinen obligatorischen Rang verlieh, er sah das strenge, mißmutig wirkende Gesicht, dessen Augen immer noch einen Ausblick durch das Fenster hinter seinem Rücken suchten. ‹Jawohl›, dachte er in einem Anflug von Herablassung. ‹Staune du nur, was in deiner Einöde geschrieben wird. Du glaubst, ein Schriftsteller würde ausschließlich über die Befindlichkeiten deiner Kühe schreiben, da dies hier und höheren Orts von einem Schriftsteller stillschweigend vorausgesetzt wird.›
Und in diesem Augenblick begann die kleine Glocke der Dorfkirche von Bernede zu läuten (es war eher ein helles, blechernes, hastiges Bimmeln), und die beiden Männer, von der Gottlosigkeit der eigenen und sonstigen Natur felsenfest überzeugt, sahen sich mit stillem Amüsement an, und dann deutete der ehemalige Landarbeiter mit der rechten Hand auf die Straße und sagte: «Dort geht die Tochter des Pfaffen. Sie hilft der Alten aus dem Bett. Gott würde sie eine Stunde länger schlafen lassen.»
Sempert sah sich um und sah ein mageres, hochaufgeschossenes Mädchen, das die Straße in Richtung auf den ovalen Teich entlangeilte. Er hätte gern ihr Gesicht gesehen, aber das Fenster, das seinen Blickwinkel verengte, ließ ihm dazu keine Zeit. So bemerkte er noch das offene, schulterlange Haar und daß die Erscheinung etwas Federleichtes, Entrücktes, ja Unwirkliches an sich hatte.