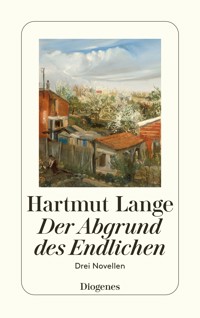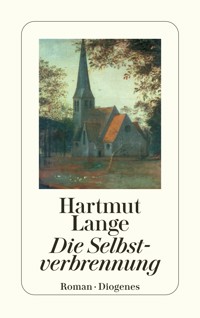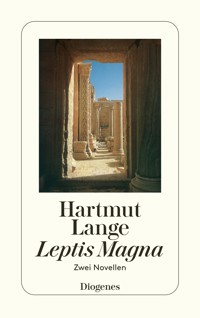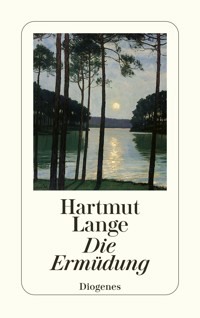14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Hartmut Lange zählt zu den Meistern der deutschen Erzählkunst. Seine Novellen thematisieren den schmalen Grat zwischen der Normalität des Alltags und dem Einbruch des Irrationalen, dem metaphysischen Abgrund, der sich dahinter auftut. Sie zeigen Menschen, die ihre scheinbare existenzielle Sicherheit verlieren und die pötzlich die Sehnsucht überkommt, jene Grenze zu überschreiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Ähnliche
Hartmut Lange
Gesammelte Novellen
in zwei Bänden
Band eins
Diogenes
Über die Alpen
Meine Adresse weiß ich nicht mehr: Nehmen wir an, daß sie zunächst der Palazzo del Quirinale sein dürfte.«
Das letzte, dessen er sich erinnern konnte, war ein Gefühl, unaufhörlich zu wachsen, ein Gehoben-Werden jenem Licht zu, das er vom Engadin her kannte. Es war ein inwendiges Ausufern ins Unendliche, und doch konnte er von der Vorstellung nicht lassen, bei aller Entfesselung, die der Geist an ihm vornahm, auf irgendeine Weise gekreuzigt zu sein.
Zwei Tage vorher war er noch mit irdischen Verwicklungen beschäftigt, er spürte dieser und jener Fährte nach, die seine Existenz zu bestätigen schienen. Es waren Nachrichten aus Paris, Kopenhagen, St. Petersburg, aber sie konnten ihm, dem Verhungernden, keine Nahrung mehr zuführen, und so schrieb er jenen denkwürdigen Satz:
»Ich halte ernsthaft die Deutschen für eine hundsgemeine Art Mensch und danke dem Himmel, daß ich in allen meinen Instinkten Pole und nichts anderes bin.«
Man schrieb die ersten Januartage des Jahres 1889. Das Wetter in Turin war strahlend, aber doch von jener Gebrochenheit, die dem italienischen Himmel aufgenötigt wird, wenn die Sonne den Horizont nicht mehr hinter sich lassen kann. Die Enge des Zimmers, das ihm zugewiesen worden war, deprimierte ihn nicht mehr, da alle Dinge, die er wahrnahm, aus ihm selbst zu kommen schienen, so auch die nachlässigen Handreichungen des Cameriere während der täglichen Mahlzeit und die Blicke der Passanten, wenn er die Straße zur Osteria überquerte.
Er war nun gesichert. Er war in der Zuversicht, Gott zu sein, Ursprung und Einheit aller Dinge, und er war entschlossen, von dieser Zuversicht Gebrauch zu machen, wann immer es ihm beliebte. Denn dieses Belieben war es ja, nach dem er sich gesehnt hatte, wenn die Dinge um ihn her sein Selbstgefühl auf hartnäckige Weise in Frage gestellt hatten, so daß er gezwungen war, dem vorzubeugen, indem er sich in vollkommener Einsamkeit, den Blick auf Schneefelder gerichtet, hoch in die Lüfte erhob, in der Hoffnung, man würde soviel Auftrieb letzten Endes doch anerkennen müssen. Und wie oft war er gezwungen, wenn diese Anerkennung ausblieb, am eigenen Bewundern ein Genüge zu haben.
Nun brauchte er keine Bewunderung mehr, er war die Bewunderung selbst. Briefe waren noch zu schreiben, Botschaften übermütiger Gelassenheit, Nachrichten darüber, daß er alles, was ihn sterblich und also verwundbar machen konnte, hinter sich gelassen hatte.
»Ah, Freund! Welcher Augenblick! – Als Ihre Karte kam, was tat ich da … Es war der berühmte Rubicon …«
Er ging die vier, fünf Schritte in seinem Zimmer auf und ab wie jemand, der sich darin gefällt, nicht durch die Wände zu gehen. Die Stiege nahm er behutsam, mit durchgedrückten Knien, den Kopf hoch erhoben, er hätte fliegen können, aber dies wäre ihm billig erschienen. Und so ging er auch die Straße entlang, Schritt für Schritt, jedem Hindernis fast bis zur Umständlichkeit ausweichend. Er wollte die Passanten bitten, ihr zustimmendes Lächeln zu unterlassen, ihm fiel aber immer wieder rechtzeitig ein, daß er es selbst war, der sich begegnete, oder daß zumindest alle Dinge den Schein ihrer Unabhängigkeit nur wahren konnten, weil seine Bescheidenheit es verlangte. Dies hatte er notiert, aber nun war auch diese Notiz der Post übergeben.
Vor dem Palazzo Carignano sah er in das Gewimmel, und während er prüfte, ob es der Mühe wert war, diese Ansammlung menschlicher Unerheblichkeiten erschaffen zu haben, entdeckte er ein Pferd und wie dieses, da der Karren, den es ziehen sollte, zu schwer war, auf den vorderen Hufen ausrutschte und wie der Kutscher, erbittert vor Wut, mit einer Peitsche auf die Kreatur einschlug und wie sie bei jedem Versuch, das Unmögliche, das man von ihr erzwingen wollte, doch noch zu leisten, hoffnungsloser und endgültiger auf den Knien zusammenbrach. Es war ein Bild des Jammers.
Er ging auf den Kutscher zu und wollte ihn energisch zurechtweisen, wie er dazu käme, ein Tier, das in jeder Hinsicht höher stünde als er, derart zu quälen, und ob er nicht wisse … Aber plötzlich schien ihm das Gefühl der Allmacht, jenes Ausufern ins Unendliche wie das Spannen einer Feder, die, je mehr man sie dehnt, an Kraft und Widerstand zunimmt, bis sie jenen Zustand erreicht, wo sie zurückschlagen muß. Er konnte den Blick von der Peitsche nicht mehr wenden, das verzerrte Gesicht des Fluchenden, dieses unnachgiebige, bis in den äußersten Willen angestrengte Wüten, bäumte sich vor ihm auf wie eine Wand. Nun sank sein Mut, der eben noch alle Grenzen überstiegen hatte, ins Unerhebliche. Er begann zu schluchzen, warf sich dem Pferd um den Hals, wobei er ins Stolpern kam, und als einige Männer ihn fassen wollten und als auch der Kutscher, ernüchtert durch die überfallartige Verzweiflung des Fremden, ihm hilfreich die Hand reichte, stieß er Schreie der Empörung aus. Er verfluchte die Welt, nannte das Tier seinen Bruder und hing, noch haltloser, noch unlösbarer mit dem Pferd verbunden, an dessen Hals, und jeder sah, daß hier jemand ein für allemal die Fassung seines Lebens verloren hatte.
Man brachte ihn auf sein Zimmer. Er war immer noch außer sich, konnte aber die Fragen, die man ihm nach Herkunft, Alter, Beschäftigung stellte, klar beantworten. Überhaupt schien es unnötig, sich um ihn, der immer wieder versicherte, er brauche Schlaf, einen tiefen, ausgiebigen Schlaf, sonst nichts, weiter zu kümmern. Eine halbe Stunde später lag er mit weit von sich gestreckten Armen reglos da, er atmete tief, ruhig, als wäre es ihm gelungen, seine übermäßige Wachheit noch einmal zu besänftigen.
Was träumte er? Unwichtig. Vielleicht sah er etwas Herbstliches. Oder ein Boot, das vom Ufer weggestoßen wurde. Ein, zwei stumme Zypressen … Er schrie auf, sprang vom Bett, und als er die Augen öffnete, als er das dämmrige Licht sah, das durch die kleinen Fenster in seine Stube eindrang, wußte er, daß er gestorben war. Er stand ganz still. Für Augenblicke nichts weiter als Erleichterung. Vorbei. Et in arcadia ego. Er hatte auch das letzte Problem hinter sich gelassen: die Zeit. Ein Lächeln, ein zustimmendes Nicken. Aber wer war er? Auch die Ewigkeit hatte einen Namen.
Er lief zu dem Stummen Diener, an dem seine Jacke hing, riß die Dokumente aus der Tasche. Die Hände zitterten ihm, als er sein passeport auseinanderfaltete, und was er nun lesen mußte, war allerdings entsetzlich. Da stand in einer steilen, allzu deutlich gehaltenen Schrift ein Name, den er kannte: FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE!
›Da hast du sie‹, dachte er und spürte einen Schlag und wie ihm ein eisernes Viereck (war es ein Spaten?) langsam, aber unwiderruflich durchs Gehirn zog. ›Da hast du sie, die ewige Wiederkehr des Gleichen, die du dir gewünscht hast. Und nichts wird sich ändern! Dieselbe Hölle der Einsamkeit!‹
Ihn fröstelte. Er rief nach dem Wirt, verlangte ein Glas Wasser, ließ es aber zurückgehen, weil es nicht durchsichtig genug war. Ein neues Glas Wasser! Dies trank er wie ein Fiebernder in ein, zwei Zügen leer, dann wies er schon mit hilfloser Geste auf seinen Magen und teilte dem Wirt mit, er hätte sich überanstrengt.
Auf dem Hof, den er nur mit Mühe, beide Hände gegen den Leib gepreßt, erreichte, mußte er sich übergeben, und es war ihm, als würde er in ein Meer von Übelkeit getaucht und als könne er diesen Zustand keine Sekunde länger ertragen. Er preßte den Ärmel seiner Bluse gegen den Mund, weil er wußte, daß heftige Konvulsionen folgen würden, dabei fiel sein Blick auf einen leeren Blumenkübel. Nun erst bemerkte er, daß ein Kind in unmittelbarer Nähe auf eben diesem Kübel saß und ihn mit großen Augen ansah, unbeweglich, gebannt vom Elend eines Erwachsenen. Er vergaß seine Beschwerden, war nun seinerseits gebannt von dieser ruhigen, selbstverständlichen Art zu staunen, er nickte mit dem Kopf und sagte:
»Ganz recht. Ja, so machen wir’s. Die Welt ist verklärt, und alle Himmel freuen sich.«
Dann wandte er sich ab. Wehmut überfiel ihn, Selbstmitleid, seine Augen füllten sich mit Tränen. Er ging, so wie er war, ohne Jacke, die Ärmel seiner Bluse halb aufgekrempelt, in jene Osteria, in der er seit Tagen nur noch Wein und Brot, hin und wieder ein Glas Wasser zu sich genommen hatte.
Auf der Straße zeigte er sich beeindruckt darüber, daß ein derart unschuldiges, voraussetzungsloses Staunen, wie er es eben erlebt hatte, überhaupt möglich war und daß er den Zustand des Kindes an sich selbst nie erfahren hatte. Er hielt Ausschau, ob ihm das gleiche Erlebnis im Gedränge des Marktes, den er überquerte, noch einmal begegnen würde, aber er fand nichts.
In der Osteria setzte er sich stumm an einen Tisch, und als der Cameriere ihm mit einem Lächeln, ohne zu fragen, alles Gewohnte, die gefüllte Karaffe, die Schale mit dem Brot, das Salz, vorsetzte, fühlte er sich wie ein reumütiges Kind, das nach einer langen, langen Zeit der Widersetzlichkeit Abbitte zu leisten gewillt ist.
»Mein Herr«, sagte er, »was ein Genie seinem Zeitalter übelnimmt, übelnehmen muß, ist nicht das Unverständnis, sondern das geringschätzige Lächeln, das dieses Unverständnis begleitet. Ich habe Bücher geschrieben, so tief, so in Sprache abgefaßt, ich verbeuge mich vor mir selbst, ich habe keinen Bedarf nach fremden Verbeugungen. Aber das gewisse Lächeln, mein Herr, dieses gewisse Lächeln hat mich zum Hammer greifen lassen.«
»Certo, certo«, antwortete der Cameriere und ging fort. Nietzsche wollte dessen Hand ergreifen, faßte aber ins Leere. Einen Augenblick lang verharrte er in dieser Geste der Ergebenheit, die ihm verhaßt war, Rücken und Kopf gebeugt, die Augen halb geschlossen, dann richtete er sich auf.
»Ecce homo! Ein Talent haben ist nicht genug, man muß auch eure Erlaubnis dazu haben, wie, meine Freunde!« rief er höhnisch und musterte alle, die in dem engen Raum saßen, in einer Weise, als hätten sie sich ihm gegenüber durchaus zu verantworten.
Man sah ihm zu oder tat doch zumindest alles, um einen offenbar gereizten Gast, dessen Sprache niemandem geläufig war, freundlich zu behandeln. Dies bemerkte er. Er wollte noch etwas sagen. Er wollte darauf hinweisen, daß er bereit sei, nicht immer nur über sich selbst zu reden. Er liebe sich nicht so sehr, wie es den Anschein habe. Er bewundere vielmehr die stillen, zarteren Naturen, jene, die lieber vergehen, bevor sie sich unter die Erde lächeln lassen, die in der Einsamkeit ihren Peinigern Werke hinterlassen, die diese dann, jetzt im Lächeln der Anerkennung, als Produkt ihrer Verständigkeit anpreisen. Diese Naturen, wollte er sagen, sind ausbeutbar, ja ihre stille, zarte Demut ist geradezu ihre List und Rache, da sie durch das Eigenlob ihrer Ausbeuter wieder auf diese Welt zurückkommen. Sie geben sich aus Klugheit von vornherein auf, sie leben nach ihrem Tode, sie würden niemals einen Hammer in ihre Hände nehmen, aber er hatte nicht die Kraft, über das Lächeln seiner Peiniger hinwegzukommen!
Dies wollte er sagen, aber er schwieg.
Auf der Straße fuhr ein Landauer vorbei, der von Kindern umringt wurde, und das Geschrei, das sich über den Anblick eines solch aufgeputzten Gefährts, es war eine Hochzeitskutsche, erhob, ließ die Pferde ängstlich werden, die, unter den anfeuernden Rufen ihres Herrn, irritiert und beunruhigt vorwärts tänzelten.
Er sah hinaus, aber mit verständnislosen Augen. Er wirkte verloren, wie beziehungslos zu der ihn umgebenden Szenerie, ihn bedrückte das Links und Rechts, die ihn fast berührende Anwesenheit der Gäste. Er kämpfte gegen eine Verspannung in der Gegend des Nackens, weil er fürchtete, diese Unpäßlichkeit würde, wie so oft, zu einem Krampf ausarten und seine Augen behindern. Er wußte, daß dieser Kampf aussichtslos war, wenn er jenes Gefühl, minderwertig zu sein, das ihm durch die Nichtachtung seiner Zeitgenossen aufgezwungen worden war und das seiner Selbsteinschätzung auf das heftigste widersprach, nicht loswerden konnte. Aber dieses unsichtbare Tier, das ihm Augen und Nacken verspannte, das sich von seiner Eigenliebe losgerissen und gegen ihn sich gerichtet hatte, das er in unzähligen Reflexionen, aber auch durch Spott und durch den Hinweis auf dessen Nichtigkeit, ja Grundlosigkeit, nicht hatte bändigen können, dieses Tier drohte nun wieder anzuwachsen.
Er verließ die Osteria, um sich Bewegung zu verschaffen, ging aber nur wenige Schritte und betrat eine Kirche. Die Dunkelheit, die von schmalen, bleigefaßten Fenstern und einigen brennenden Kerzen erträglich gehalten wurde, war ihm angenehm. Er blieb in der Nähe des Portals stehen und sah, wie eine Bäuerin mit fast am Boden schleppenden Röcken, das Gesicht fest eingeknotet in ein schwarzes, wollenes Tuch, zum Weihwasserbecken trat, hineinfaßte, um sich mit nassen Fingern zu bekreuzigen. Sie sah kurz zu ihm hin, aber es war ein Blick ohne Bedeutung, denn sie ging schon zu einer der Bänke, beugte die Knie, um den Marienaltar zu grüßen, senkte den Kopf und betete.
Wie lange dies ging, wußte er nicht. Er sah nur immer auf die gebückte Gestalt, und das ruhige Verharren der Frau zog ihn unwiderstehlich an. Er beneidete sie um ihre Demut und hatte gleichzeitig Angst, etwas zu verlieren. Er fühlte sich leer, matt, wollte sich setzen, wagte aber nicht, auf eine der Bänke zuzugehen.
›Dies‹, dachte er, ›kann unmöglich die Wiederkehr meinesgleichen gewesen sein. Man hat mich betrogen. Ich war mehr, als ich jetzt bin.‹
Und er begann zu suchen: Worin war er einst unverwechselbar? Was hatte ihm das Leben erträglich gemacht? Hatte es einen Ort gegeben, an dem man verweilen konnte? Was hatte er getan, um dessentwillen es sich lohnte, es noch einmal zu tun?
Er stürzte ins Freie, hastete die Trottoirs entlang, wobei er von der Vorstellung nicht loskommen konnte, er müsse Raum gewinnen, er würde ersticken, wenn er jenes Etwas, das auf seinem Gedächtnis lastete, nicht von sich warf. Er wollte auf sein Zimmer zurück. Er überquerte die Piazza Carlo Alberto, erreichte das Tor mit dem Lorbeer, aber es gelang ihm nicht, das Eisen, mit dem er klopfen mußte, damit man ihm öffnete, zu berühren. Er lief noch einmal um das Haus, das ihn beherbergte, sah das Fenster zu seinem Zimmer, konzentrierte all seine Sinne, um das Eisen doch noch zu fassen. Er tat es heftig, mit solcher Ungeduld, daß das Tor aufgesprungen wäre, hätte man ihm nicht rechtzeitig geöffnet.
»Ja, ja«, sagte er, »ja, ja«, und ging weiter.
Auf den letzten Stufen der Stiege mußte er innehalten. Er rang nach Atem, Schweißperlen fielen ihm von der Stirn. Aber er sah die Sonne. Ja, es war die Sonne, die ihm durch den Türspalt entgegenfiel. Ein letztes Aufbäumen, ein unwiderrufliches Drängen mit der Schulter gegen das harte Holz, ein Schmerz – dann gab alles nach … Er stand mitten im Zimmer.
»Gut, daß du gekommen bist«, sagte eine schwarze, hochaufgerichtete, in allen Mitteln der inneren und äußeren Beherrschtheit formvollendete Gestalt, die auf dem Kanapee saß und die, obwohl sie lächelte, ganz unverkennbar und ohne daß man diese Tatsache zu überprüfen genötigt war, auf böse Weise faszinierte.
»Gut, daß du gekommen bist«, sagte sie, und Nietzsche bemerkte, daß er sich getäuscht hatte: Es gab keine Sonne, es war längst Nacht geworden.
Der Fremde rauchte, führte die Zigarette, die er in der linken Hand hielt, in regelmäßigen Abständen zum Mund, zog daran mit einer Miene eisigen Gleichmuts, und man sah, daß er die Lebensmitte bereits überschritten hatte. Die kurzgeschnittenen Haare waren in einer Weise frisiert, daß sie glatt auf dem schmalen, langgestreckten Schädel zu liegen kamen, das Gesicht war ebenmäßig, aber mit etwas zu scharfer Kontur, die Augen wirkten flach, ohne Güte, oder besser: Hier zeigte sich am deutlichsten, daß dieser Mann entschlossen schien, seinem vorgefaßten Willen, was dieser auch immer zu bedeuten hatte, bis zum Letzten Geltung zu verschaffen.
»Du bist Zarathustra«, sagte Nietzsche.
»Nein«, sagte der Fremde, »ich bin nicht Zarathustra.«
»Aber du willst mich in das Engadin zurückholen!«
»Nein«, sagte der Fremde, »vergiß das Engadin.« Er zog ein silbernes Etui aus seiner Jackentasche, das er mit langen, feingliedrigen Fingern öffnete, und während er noch die halbaufgerauchte Zigarette an der Innenseite des Deckels ausdrückte, löste er schon eine neue aus dem Gummiband. Ein hartes Zuschnappen, ein rasches Zurückgleitenlassen des Etuis, der Griff nach dem Streichholz.
Nietzsche sah ihm zu, sah die kleine Flamme und wie diese ihm alle vertrauten Gegenstände wieder vor Augen brachte und zurechtrückte. Er fühlte sich geborgen in der selbstverständlichen Ruhe und Sicherheit dieses Fremden, er hätte mit ihm eine Ewigkeit so dasitzen können.
»Ja, mein Herr«, sagte er, »das Engadin! Man schwärmt davon, aber wer hat sich die Mühe gemacht zu prüfen, wie meine Welt eigentlich aussieht? Ich sehe hinunter, über Hügelwellen, gegen einen milchgrünen See hin, links Felshänge, Schneefelder über breiten Waldgürteln, rechts hoch über mir zwei ungeheure, beeiste Zacken – alles groß, still, hell. Unwillkürlich, was wäre natürlicher, stellt man in diese reine, scharfe Lichtwelt griechische Heroen. – Vorbei. Et in arcadia ego. Verstehen Sie meine Einsamkeit? Ich kam aus Naumburg. Kennen Sie Naumburg? Mein Vater war Pfarrer. Kennen Sie das Christentum? Mein Lehrer war Ritschl. Kennen Sie die herkömmliche Philologie? Kennen Sie Leipzig? Dann kennen Sie die menschliche Steppe. Mein Herr, Napoleon war gestorben, mit Mozart war die Musik von mir gegangen, ich habe Wagners Arien getrunken, wie ein Verdurstender Wein trinkt, und doch sind meine Lippen verdorrt. Der Rest war rasender Kopfschmerz.«
Für längere Zeit blieb alles still. Nietzsche saß unbeweglich und sah auf das Kanapee, und die Dunkelheit war derart, daß er nicht wußte, ob er sich noch in Gesellschaft befand. Hoch über seinem Kopf, weit in der Luft, ging ein Donner in schwachen Wellen wie bei einem Gewitter, dessen Kraft gebrochen war.
»Ich bitte um Entschuldigung«, flüsterte er, »ich wollte niemanden kränken. Ich wollte eigentlich nur über das Engadin sprechen und über ein gewisses Gefühl … Mein Herr, kennen Sie dies Gefühl: Man bittet um Salz, bekommt aber doppelt und dreifach Pfeffer? Man wird gesund, findet aber keinen Ausweg aus dem Spital? Man möchte heiraten, aber die Welt hat die Regeln des Aufgebots vergessen? Es ist dies ein Gefühl, mein Herr, an dem ein Mensch wahnsinnig werden kann.«
Der Wirt kam, brachte eine brennende Kerze, fragte den bewegungslos Dasitzenden, ob ihm nun wohler sei oder ob er nach einem Arzt rufen solle. Er bekam keine Antwort. Als er das Fenster, das einen Spaltweit geöffnet war, schließen wollte und dabei in die Nähe des Kanapees trat, bat Nietzsche ihn, indem er die Hand hob, stehenzubleiben. Man möge ihn als Gefangenen betrachten, sagte er, und die Tür sorgfältig gegen ihn schließen, denn er hätte das Verbrechen begangen, über den Menschen nachzudenken.
Der Wirt verließ das Zimmer.
»Vergiß, daß du ein Mensch bist«, sagte der Fremde. »Hör auf zu denken. Wer über den Menschen allzu gründlich nachdenkt, endet im Wahnsinn.«
»Aber ich bin ein Problem«, sagte Nietzsche. »Und was für mich gilt, muß ebensogut für die anderen gelten.«
»Der Mensch ist kein Problem«, sagte der Fremde, »er ist das Unmögliche.«
Nietzsche versuchte, sein schemenhaftes Gegenüber mit hellwachen Augen zu fassen, aber auch jetzt, im Schein der Kerze, sah er nichts anderes als formvollendete Kälte und wie der andere, während er ihn ansah, den Blick auf eine Weise erwiderte, die ihm das Gefühl gab, überflüssig zu sein.
Dies konnte er nicht ertragen. Er stand auf, prüfte, ob die Bretter unter seinen Füßen ihn hielten, er hatte Angst, ins Bodenlose zu fallen. ›Denn wo der Mensch das Unmögliche ist‹, dachte er, ›beginnt der freie Fall.‹
»Ich muß mich halten«, rief er und gegen den Fremden gerichtet: »Du hast nicht das Recht, mir Vorwürfe zu machen, weil ich mir das Unmögliche abverlangt habe.«
Er stürzte zum Kanapee, entschlossen, die impertinente Unnahbarkeit des Fremden zu brechen.
»Du bist ein Träumer«, rief dieser noch und lachte. »Du wirst deinen Zarathustra nie von Angesicht zu Angesicht schauen.«
Aber dann war er schon ausgelöscht, und Nietzsche saß selbst als der andere da, saß mit angehaltenem Atem und versuchte, nicht mehr zu denken. Er hörte sein Herz schlagen, und ein Gewisper, tief, ganz tief unten in seiner Mitte, flüsterte ihm zu, daß sein Denken durchaus kein geringes sei und daß er mit seinem Zarathustra das Unmögliche möglich gemacht hatte. Er hörte alles genau und mit wachsender Aufmerksamkeit, wollte aber nichts davon zulassen. ›Noch nicht‹, dachte er. ›Sie sollen nur kommen, meine liebsten Gedanken, ich werde die Tür gegen sie zusperren. Es soll ihnen nicht erlaubt sein, mich wieder auseinanderzureißen.‹ Und er hielt seinen Kopf zwischen beide Hände wie zwischen eiserne Klammern gepreßt. Aber die Stimme, ach jene Stimme, die er allzu gut kannte, wurde lauter und flehte in einer Weise …
»Ich bin Zarathustra«, rief es, »kennst du mich nicht mehr? Hast du vergessen, wie glücklich wir waren? Töte mich nicht! Ich bin Ein-aus-dem-Gedanken-Geborener!
Oh Lebens Mittag! Zweite Jugendzeit! Oh Sommergarten!
Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten!
Der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit,
Der neuen Freunde! Kommt! ’s ist Zeit! ’s ist Zeit!
Dies Lied ist aus – der Sehnsucht süßer Schrei Erstarb im Munde:
Ein Zaubrer tat’s, der Freund zur rechten Stunde,
Der Mittags-Freund – nein! fragt nicht, wer es sei –
Um Mittag wars, da wurde Eins zu Zwei …«
Er wollte die Hände lösen. Alles, was ihn eben noch bleischwer niedergehalten hatte, begann nach oben zu drängen. Der Kopf, eben noch ein allzu enges Gefäß, weitete sich inwendig. Aber nun fiel ihm ein, daß er seine liebste Erfindung aus Not geboren hatte, aus übermächtiger Sehnsucht nach Nähe zum Menschen, und daß er die Einsamkeit, unter der er litt, derart eindringlich, unwiderruflich predigen ließ, weil man ihm diese Nähe verweigert hatte. Und die Jahre vergingen. Die Zeit konnte ihn nicht heilen. Und doch mußte er, bei Strafe des Untergangs, die ihm gemäße Art der Genesung finden.
»Oh«, rief er, »oh! Warum muß man sich immer und immer wieder einen Freund erschaffen? Gibt es denn keine Möglichkeit, ein Mensch unter Menschen zu sein? Oder man wird zum Verbrecher«, fügte er hinzu. »Da man in diese Welt nicht paßt, vielleicht macht man sich diese Welt passend? Auch eine Möglichkeit, vielleicht die kürzeste.«
Ja, da war sie wieder, die Lust, mörderische Gedanken gegen all jene auszuschicken, die ihm das Leben unerträglich gemacht hatten. Er wollte den Fremden zurückholen, den er eben noch ausgelöscht hatte, er wollte mit ihm eine Möglichkeit zur Flucht aus seinem Verhängnis besprechen. Ob man den Menschen durch Mord bessern könne, wollte er wissen, und ob der Wunsch, den er jetzt öfter verspüre, nämlich mit diesem und jenem Verbrecher einig zu sein, etwas Ehrenrühriges hätte? Und ob man wisse, daß er mit all seinen Gedanken der Welt lediglich einen neuen Begriff hatte geben wollen: den eines anständigen Verbrechers.
Aber der Fremde antwortete nicht mehr, und dies machte ihn besorgt. Er begann sich zu verbeugen, leicht, freundlich, in Richtung gegen den Stuhl, dann gegen die Tür hin, und bat ihn wiederzukommen. Er entschuldigte sich für seine unangemessene Gereiztheit. Er wäre nun, versicherte er, vollkommen von der Unmöglichkeit seiner Existenz überzeugt, besonders aber davon, daß das Alleinsein keine Art zu leben genannt werden könne, und daher hätte er jetzt, nachdem er so vermessen gewesen sei, das Unmögliche doch wieder einmal zu wagen, den Wunsch nach angenehmer Gesellschaft.
Er bekam keine Antwort.
Mondlicht fiel ins Zimmer, die Schatten der Möbel umstanden ihn stumm, wie unverrückbar, und auch er selbst bewegte sich nicht mehr. Er sah den Mond und wie dieser seine Leblosigkeit mit selbstverständlicher Ruhe zur Schau trug. Er übersah die Dächer der Stadt bis zum Fluß, den Corso Regina Margherita und den Dom, der wie ein schwarzer Fels hoch aufragte, dahinter, ganz im Dunkeln, ganz unbestimmt, einen Wald Zypressen. Über allem aber lag wie ein steinernes Grabmal der Mond, und immer wieder war es der Mond, der ihn daran erinnerte, daß diese Welt auch und vor allem durch ihre Leblosigkeit bezaubern konnte.
›Warum sind meine Wünsche immer nur auf das Leben gerichtet‹, dachte er. ›Der Tod ist die Harmonie der Dinge.‹
Und nun schien ihm die Reglosigkeit, in der er verharrte, der einzige Zustand zu sein, in dem man überdauern konnte. Die kalte Luft, die plötzlich durchs Fenster eindrang, tat ihm wohl, und für Augenblicke war ihm alles, was er fühlte und sah, ununterscheidbar miteinander verwoben. Er wurde müde. Es verlangte ihn danach, einfach so dazustehen und mit geöffneten Augen zu schlafen.
Dies ging eine Stunde und länger, und als der Mond gegen Westen hin über dem Gebirge verschwunden war, stand er immer noch da, und alle Konturen, die Mühe hatten, sich gegen die Dunkelheit, die nun herrschte, zu behaupten, verwandelten sich vor seinen Augen ins Unwirkliche.
Er sah einen See, schwarz, abgründig tief, und fühlte, daß er sich auf einem Boot befand und wie dieses sich unter leichtem, angenehmem Schaukeln auf eine Mitte zubewegte, die von uralten Bäumen umstanden war. Vor ihm saß eine Gestalt, die mit sanften, aber nachdrücklichen Bewegungen ruderte, und er wunderte sich, daß er ihr Gesicht nicht sehen wollte, obwohl sie es ihm ständig zugewandt hielt. Als er sich der Mitte näherte, versuchte er, durch das dichte Geäst hindurch zu ergründen, wohin man ihn ruderte. Aber er sah nichts, und dies genügte ihm. Er berührte das Wasser, ließ es durch seine Finger gleiten, beugte sich über das leichte, ach allzu leichte Boot, das ihn davor bewahrte zu fallen, und wollte nichts weiter als diese Fahrt, auf ein Ziel zu, das es nicht gab, das aber auf geheimnisvolle Weise von Bäumen umstanden war.
»Ariadne«, flüsterte er, »ich liebe dich.« Und: »Ich suche nach einer Ewigkeit für Jegliches. Warum sollten die kostbarsten Salben und Weine für immer verloren sein. Das Meer spült sie wieder heraus.«
Am nächsten Morgen saß er am Fluß und erkundigte sich nach dem ruhenden Gewässer. Es gäbe hier kein ruhendes Gewässer, antwortete man ihm, aber er nickte immer nur mit dem Kopf und sagte: Doch, doch, es läge ja zum Greifen nahe, und wann endlich das Boot käme, wollte er wissen.
Man zuckte mit den Achseln und ließ den Verwirrten, so wie er war, die Haare aufgeweht, den Mantel mit verdrehten Ärmeln über der Schulter, am Ufer gewähren. Er aber tat, als ginge ihn, was in seinem Rücken passierte, nichts an, und kauerte mit angezogenen Knien, auf denen die Ellbogen ruhten, wie versteinert, wie in nicht rückgängig zu machender Abwesenheit, an der äußersten Grenze des Ufers.
Die Zuversicht, die er während der Nacht gewonnen hatte und die ihn auch jetzt noch, nach einem kurzen, bewußtlosen Schlaf, gefangenhielt, wurde durch eine neue Irritation aufgezehrt, gegen die er sich wehrte.
Es begann damit, daß er fror und ein Zittern seiner Hände nicht unterdrücken konnte. Es beunruhigte ihn, daß der Fluß sein Wasser so rasch an ihm vorbeidrängte, und das Glitzern auf den Wellen tat seinen Augen weh. Er wollte sie nicht schließen und sah immer intensiver, immer ungehaltener auf jene tausend Irrlichter, die von der Sonne angefacht und wieder ausgelöscht wurden. Warum wollte das Gewässer nicht stillstehen? Dies empörte ihn. Er wollte mit beiden Fäusten in die Wellen greifen, um sie anzuhalten, er drohte der Sonne, er würde sie ausblasen, wenn sie es nicht unterließe, seine Augen zu belästigen. Dabei erhob er sich und spürte wieder, wie er wuchs, und wunderte sich darüber, daß andere dies Gefühl, bis ins Grenzenlose bedeutend zu sein, nicht teilen wollten. Er wünschte Zeugenschaft, sofort und ohne irgendwelche Ausflüchte. Man sollte ihm zusehen, dem Augenschein trauen, dann würde man bestätigen müssen, was er jetzt sage: Es bereiteten sich in ihm ungeheure Dinge vor!
Dies rief er einigen Fischern zu, die damit begannen, ihre Netze am Flußufer abzustecken. Sie beachteten ihn nicht, aber er wollte sich Gehör verschaffen.
Er verließ die Wiesen über eine steinerne Treppe, erreichte die Stadt und rief in den Straßen nach dem Fremden, immer nur nach dem Fremden, von dem er behauptete, dieser müsse sich ganz in der Nähe aufhalten, denn er hätte ihn, Friedrich Nietzsche, eben noch durch seine Anwesenheit geehrt. Er müsse ihn finden, versicherte er, denn dieser Mann hätte ihm Dinge gesagt, die, wenn er sie ausplaudern würde, durchaus geeignet seien, der Welt brennende Fackeln aufzusetzen.
Ob man sich der Konsequenzen bewußt sei: Der Mensch ist das Unmögliche und damit eine Sache der Form. Gut oder Böse, man entscheide sich! Die Güte sei der Welt abhanden gekommen, aber der Fremde sei durchaus jemand, man solle ihm nur ins Gesicht sehen, der den Willen zum Bösen bis in jene Ruhe hinein verfeinert hätte, die selbst durch den eigenen Untergang nicht mehr zu erschüttern sei. Dies hätte ihn beeindruckt. Er selbst habe sich, da die Deutschen ihm jede Form zu leben verweigerten, für den Wahnsinn entschieden. Aber man solle deshalb nicht gering von ihm denken. Auch der Wahnsinn trage, und dabei wies er auf seinen Mantel, die Attribute der Gewalt und der rücksichtslosen Verneinung all dessen, was seiner Form nicht angehört, offen zur Schau. Ja, er erwäge, ob der Wahnsinn nicht der einzig mögliche Weg sei, den Menschen in sich zu überwinden. Er habe versucht, über andere Möglichkeiten nachzudenken, aber man solle ihm glauben, wenn er sage: Man kann auf dieser Welt kein Mensch unter Menschen sein!
Man riet dem seltsamen Passanten, ruhiger zu werden, wobei man seinen euphorischen Eifer ratlos zur Kenntnis nahm. Er dankte, aber wie jemand, der nicht einsah, warum dies nötig sein sollte, und jede Berührung, jedes freundliche Wort schien ihm überflüssig. Auch die Gesellschaft des Fremden fand er kaum noch der Mühe wert.
Wenig später, in der Nähe der Kirche, die er gestern betreten hatte, jetzt aber unbeachtet ließ, war es ihm, als würde der Fremde folgen, in der Absicht, ihn mit den Händen zu berühren. Aber dies interessierte ihn nicht mehr. Was sollte jener ihm sagen, das er nicht schon wußte? Ihm, der wieder in der Zuversicht war, Gott zu sein, Ursprung und Einheit aller Dinge!
Er ging schneller und schneller. Wie lange dies dauerte, wußte er nicht. Er bemerkte nur, wie eng Turin war und daß er die Stadt, die er liebte, aber offenbar überschätzt hatte, mit drei, vier Schritten von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende durchmessen konnte. Mitunter hatte er den Eindruck, er ginge im Kreis, damit die Beengtheit, die ihn störte, einigermaßen gemildert wurde. Aber dann fand er doch, man bewege sich im Quadrat besser.
Er wußte, man schrieb die ersten Januartage 1889. Auch er fand das Wetter strahlend, aber die Gebrochenheit, die dem italienischen Himmel aufgenötigt wurde, weil die Sonne den Horizont nicht mehr hinter sich lassen konnte, fand er skandalös. Dies wollte er bessern. Aber nicht heute, später, später.
Am folgenden Tag kam Overbeck, um den kranken Freund abzuholen. Nietzsche wehrte sich heftig, denn er sah keinen Grund, über die Alpen nach Basel zu reisen. Man bestand darauf.
Als er das Gebirge sah, war es ihm, als näherte er sich einer Wand, hinter der es nichts mehr gab, um dessentwillen es sich lohnte, so übermäßig besorgt zu sein. Er wurde ruhiger. Aber es war der Beginn jener Ruhe, in der die Gedanken sterben.
Die Waldsteinsonate
Franz Liszt starb am 31. Juli des Jahres 1886, an die näheren Umstände hierzu konnte er sich nicht erinnern. Er fand sich allerdings im Vollbesitz seiner Sinne und geistigen Gaben auf einer Straße wieder und ging zielstrebig – wohin, dies bedeutete ihm eine Einladung, die er in der Tasche hielt, eine Einladung mit der lapidaren Bemerkung: »Frau Magda G. bittet um Ihren Besuch im Bunker der Reichskanzlei, und zwar für den 1. Mai 1945.«
In der Reichskanzlei, offenbar waren dies Räumlichkeiten unter der Erde, fand er sich auf einem Stuhl sitzend wieder, ohne zu wissen, wie er so rasch und ohne alle Umstände hierhergekommen war. Er musterte den Raum, der hin und wieder, in unregelmäßigen Abständen, von Detonationen erschüttert wurde. Er sah einen langen Eichentisch, darum herum Stühle mit hohen, gepolsterten Lehnen, dann eine Büste, einen männlichen Kopf darstellend, von ebender Farbe, wie sie der Kalk hatte, der aus Rissen von den Wänden rieselte. Dieser Kopf zog ihn unwiderstehlich an. Aber nun sah er schon in einer äußersten Ecke, ihm schräg gegenüber, ein Pianoforte, dessen schwarzer Lack von staubigem Mörtel und von Stücken Mauerwerk dicht übersät war.
Dahinter, auf einem Hocker, ganz in ängstlicher Haltung, ganz in sich zusammengesunken, aber den Blick doch mit fragender, fast flehender Aufmerksamkeit auf den Neuankömmling gerichtet, saß eine Frau mittleren Alters. Sie hatte ihr blondes Haar im Nacken zu einem Knoten gebunden, sie hielt ihr Gesicht etwas zu sehr erhoben, hier und da zeigten sich rötliche Flecken.
»Ich freue mich, daß Sie gekommen sind«, sagte sie kaum hörbar. »Nicht wahr, Gräfin d’Agoult war die Mutter Ihrer Kinder.«
Liszt war verwirrt, da er so unerwartet, auf direkte Weise und von einer Frau, die er nicht kannte, von der er aber annehmen mußte, daß sie litt, an frühere Umstände erinnert wurde. Dann, nach Augenblicken der Unentschlossenheit, die zu der Würde seines Alters einen merkwürdigen Kontrast bildeten, erhob er sich und ging auf das Pianoforte zu.
»Warum weinen Sie, Madame?« fragte er. »Um Gottes willen, warum weinen Sie?«
Und als er die Arme ausstreckte und fast schon versucht war, da sie nun aufschluchzte, ihre Hände zu ergreifen, erstarrte er in seiner bemühten, freundlichen Bewegung, denn nun stand in der Tür, die mit einem unangenehmen, metallenen Klirrton geöffnet und wieder geschlossen worden war, ein schmächtig wirkender Mann, der ihnen mehrmals und mit heiterer Selbstverständlichkeit zunickte.
»Reden Sie mit ihm«, rief die Frau und umklammerte Liszts rechte Hand. »Er will, daß ich meine Kinder umbringe.«
Aber gleichzeitig schämte sie sich, ihren Mann, der in der Tür stand und um Haltung bemüht war, vor einem Fremden, auch wenn dieser Franz Liszt hieß, zu desavouieren.
»Ich behaupte nicht«, fügte sie hinzu, und ihr Gesicht war tränenüberströmt, »ich behaupte nicht, daß dies nicht auch mein Wunsch wäre. Aber Sie verstehen, ich wünsche etwas, das ich unmöglich ausführen kann.«
»Es bleibt keine Zeit, der Arzt wartet«, sagte Josef G. und lächelte. »Ich bin sicher, der unsterbliche Franz Liszt wird dir genügend Kraft geben, das Unvermeidliche zu tun.«
Damit ging er auf seine Frau zu, umfaßte sanft ihren Ellbogen und führte sie, die kaum widerstrebte, zur Tür, und Liszt bemerkte, daß ihn eine Mißbildung, ein zu kurzes Bein, beim Gehen hinderte.
»Sie wollen Ihre Kinder töten?« fragte er, und das Ehepaar wandte sich um und sah die erschreckte Güte im Gesicht des Ehrwürdigen und daß dieser wie ein Priester gekleidet war.
Es folgte eine Detonation, derart heftig, daß man fürchten mußte, sie würde sich bis ins Innere der Erde fortsetzen. Das Licht verlosch, und als die Glühbirne, die an der Decke des Zimmers angebracht war, wieder aufflammte, war Liszt allein. Er wußte nicht, ob er dem Ehepaar, das offenbar hinter der Tür verschwunden war, folgen sollte, und versuchte, die Umstände, in denen er sich befand, zu begreifen.
›Aber wie denn‹, dachte er, ›es ist unmöglich, daß man mich in dieses Haus bittet, damit ich Zeuge eines Verbrechens werde. Ich muß mich verhört haben!‹
Und die Zurückhaltung, die er ein Leben lang eingeübt hatte, das Unverbindliche im Betrachten der Welt, wie sie sich auf Konzertreisen darstellte, die Unmöglichkeit, als vielgefragter Virtuose die Gewohnheiten seiner Gastgeber zu durchschauen oder auch nur wahrzunehmen, dies alles hinderte ihn auch diesmal daran, sich um sein Erstaunen gründlicher zu kümmern.
Er beschloß, den Lauf der Dinge abzuwarten. Er setzte sich, nachdem er die Tastatur, den Mörtel nicht achtend, freigelegt hatte, hinter das Pianoforte und spielte die ersten Takte der WALDSTEINSONATE bis zu jenem Triller, der den düsteren, melancholischen Auftakt ins Heitere zu wenden versucht. Dies tat er wieder und noch einmal, als würde er zögern, die Kostbarkeit, die er so oft durch seine Hände hatte entstehen lassen, preiszugeben. Aber er spielte, sowie sich seine Selbstvergessenheit festigte, weiter, und zuletzt herrschte jene Magie, eine Ununterschiedenheit zwischen Künstler und Instrument, die nur der Virtuose geltend machen kann.
Wieder öffnete sich die Eisentür, sanfter als beim ersten Mal, und Frau G. kehrte in den Raum zurück. Liszt war es, als hörte er hinter dem Korridor, den die Tür verdeckte, Kinderstimmen und wie diese, offenbar im Spiel miteinander, lachten, aber es war vage und unbestimmt und so fern, daß er nicht wußte, ob er sich getäuscht hatte.
»Wie wunderbar Sie spielen«, sagte Frau G. und setzte sich auf einen der Stühle, die um den Eichentisch gruppiert waren.
»Ich danke Ihnen, Madame«, antwortete der Pianist, unterbrach sein Spiel und verbeugte sich gegen sie.
Die Stille, die nun folgte, dauerte etwas zu lange. Frau G. blickte zu Boden und sagte leise, wie zu sich selbst und wie um das entstandene Schweigen zu entschuldigen:
»Denken Sie nicht schlecht von meinem Mann. Er liebt die Kinder ebenso wie ich. Aber auch er möchte ihnen das Leben ersparen.«
»Madame, wovon reden Sie?« sagte Liszt und sah auf jene bis zur Erschöpfung einsam wirkende Frau, die man weder alt noch jung, weder schön noch häßlich, weder anziehend noch abstoßend, aber in ihrer endgültigen Traurigkeit anrührend nennen mußte und die nun seinen Blick erwiderte. Dabei hielt sie den Kopf hoch erhoben, sie preßte ihre Hände gegeneinander, um Halt zu finden, aber es waren die Augen, diese geweiteten, in äußerster Erregung hilflos wirkenden Augen, die verrieten, daß hier jemand Anstrengungen unternahm, obwohl er wußte, daß er jeden Anlaß hierzu längst hinter sich gelassen hatte.
»Ich möchte Sie bitten, sich meiner Kinder anzunehmen«, sagte sie. »Ich mache mir Sorgen, was aus ihnen werden wird, wenn sie gestorben sind. Sie sind ja noch so jung. Ich weiß«, fügte sie hinzu, »wie gütig Sie sind, und ich hoffe sehr, daß Sie die Kinder nicht unbeachtet lassen.«
Liszt starrte auf ihr Haar und bemerkte, daß sich eine Strähne, die mit einer Klammer befestigt war, gelöst hatte und nun über ihre Schläfe fiel und wie sie diese Nachlässigkeit unbeachtet ließ. Er konnte nicht umhin, die Anmut, die trotz aller Verzweiflung für einen Augenblick entstanden war, zu bewundern.
»Aber Ihre Kinder leben«, sagte er. »Und sie haben eine Mutter, die unmöglich wünschen kann, daß es anders wäre.«
Sie antwortete nicht.
Er wollte sie bitten, ihre, wie ihm schien, unverständlichen Worte zu erklären, aber nun stand Josef G. in der Tür, offenbar in der Absicht, seine Frau, deren Zustand er mißtraute, nicht aus den Augen zu lassen.
»Wer sein Haus nicht mehr retten kann, für den wird es zum Scheiterhaufen. Wer sich und seine Kinder opfert, adelt den Untergang«, sagte er. Dabei ging er zum Eichentisch, setzte sich, suchte die Nähe seiner Frau, und zwar so sehr, daß sie einander mit den Schultern berührten.
Wie lange sie so dasaßen, wußte Liszt nicht zu sagen. Er sah immer nur auf das seltsame Paar, hörte auf die Detonationen, die näher und näher kamen, und sah, wie Josef G., der solche Umstände seit langem gewohnt war und mit Verachtung auf alle äußere Gefährdung zu reagieren pflegte, zusammenzuckte, aber es war ein Reflex seiner Nerven, den er unbeachtet ließ.
Nur einmal, als die Tür, wie aus den Angeln gerissen, ohne daß jemand sie berührt hatte, aufsprang, versicherte er, daß die Einschläge, die von der Artillerie herrührten, die Gesichertheit dieser Räume, man befände sich mehrere Meter unter der Erde, keineswegs gefährden könnten und daß der deutsche Soldat, obwohl erschöpft, obwohl aus unzähligen Wunden blutend, durchaus noch willens und in der Lage sei, den Feind bis zum Abend aufzuhalten.
Ordonnanzen kamen und brachten Nachrichten, die dieser Zuversicht widersprachen. Niemand, versicherten sie, sei imstande, die umkämpften Straßen, jenes schmale Gebiet zwischen Tiergarten und Voßstraße, das den Mächtigen des DRITTEN REICHES noch verblieben war, länger als ein, zwei Stunden zu verteidigen.
»Es ist gut so«, sagte Josef G. »Wir haben die Welt, da sie in ihrer Schläfrigkeit zu ersticken drohte, mit eisernen Fäusten durchgerüttelt, und wir haben diesen Kampf nicht auf uns genommen, um zu siegen. Was ist schon der Sieg? Er ist billig zu haben, wenn man nicht das ganze Verhängnis herausfordern, das Fatum selbst gegen sich herbeizwingen will.«
Und wieder war es Liszt, als würde er Kinderstimmen hören, deutlicher als beim ersten Mal, ja er glaubte sogar, Unterschiede ihres Alters wahrnehmen zu können. Er erhob sich.
›Die Wahnsinnigen‹, dachte er. ›Sie führen einen Krieg, sie wünschen ihren Untergang. Aber ich muß sie daran hindern, daß ihre Kinder dafür büßen müssen.‹
Er bedankte sich für die Einladung, bedauerte, daß er an der verzweifelten Lage seiner Gastgeber nichts, aber auch gar nichts ändern könne, daß er jedoch bereit sei, auf dem Pianoforte zu spielen, falls man dies wünsche, und daß er nichts dagegen hätte, wenn auch die Kinder … Ja, er würde sich über ihre Anwesenheit geradezu freuen, denn, versicherte er mehrmals und immer drängender, es gäbe für ihn kein größeres Vergnügen, als vor Kindern zu spielen.
»Ja, spielen Sie, spielen Sie!« rief Magda G.
Doch schon hatte Josef G. ihre Hand genommen, hielt sie sanft, aber unmißverständlich fest, lächelte, und Liszt schien es, als würde auch sie für einen Augenblick triumphieren, als seien ihre Augen auf diesen Mann wie auf einen Magier gerichtet, der imstande war, inmitten einer brennenden Festung, den eigenen und den Untergang der Kinder wie einen Sieg erscheinen zu lassen.
Dies beunruhigte Liszt.
»Aber«, sagte er, »Sie werden nicht so unhöflich sein, den Raum zu verlassen, solange ich auf dem Pianoforte spiele. Dies wäre mir in meinem Leben nie begegnet«, fügte er hinzu, und: ›Wenn dieser Krieg in wenigen Stunden beendet sein soll‹, dachte er, ›muß die Musik sie bezaubern. Beethoven! Beethoven wird die Kinder retten. Er ist mächtiger als alles andere‹, dachte er, und: ›Der müßte erst geboren werden, der der WALDSTEINSONATE widerstehen kann.‹
Er begann zu spielen. Aber bevor er dies tat, musterte er noch einmal, seine Hände lagen auf der Tastatur, die Zuhörer, so wie er es gewohnt war. Es war dies ein Augenblick äußerster Konzentration. Und als er die ersten Takte anschlug, sah er, wie Magda G. von ihrem Mann abrückte, unmerklich, indem sie mit dem geringsten Aufwand an Bewegung ein Taschentuch aus dem Gürtel ihres Kleides zog und es gegen die Lippen führte, und wie Josef G. von dieser Bewegung keinerlei Notiz nahm.
Aber er, Franz Liszt, sah dies sehr wohl und nahm es als Beweis, wie rasch der Zauber seiner Virtuosität zu wirken begann. Das machte ihm Mut.
›Weiter, immer weiter‹, dachte er. ›Die Sonate bewältige ich in dreiundzwanzig Minuten, aber man wird sich wundern, wenn diese kurze Ewigkeit bis zum Abend dauert.‹
Er wiederholte den Anfang, setzte die Akkorde besonders weich, in der Absicht, die düstere Entschlossenheit der beiden zu mildern. Dann unterbrach er, bevor er mit den Variationen begann, sein Spiel, sah aber nicht auf, um niemanden zum Beifall zu nötigen. Minuten später fühlte er sich bestätigt.
Josef G. saß da wie jemand, dem der Zustand der Welt, der ja doch nur sein eigener Zustand war, durch die Musik auf wunderbare Weise wieder zurechtgerückt wurde. Er sah immer nur auf Liszt, auf dessen Hände und sah nicht, wie sehr Magda G., um ihr Gemüt einigermaßen zu bändigen, ununterbrochen mit dem Taschentuch beschäftigt war.
Sie litt unter der Vorstellung, die Kinder könnten sich diesem Raum nähern, obwohl man es ihnen verboten hatte, und sie würden nun, angezogen von der Musik, ach von dieser wunderbaren Musik, die Nähe ihrer Eltern suchen, jene Nähe, in der sie sich so selbstverständlich sicher fühlen durften und die man ihnen nie verweigert hatte. Sie ertrug den Gedanken nicht, daß sie diese Nähe, bevor es Abend werden konnte, dazu mißbrauchen mußte, die Kinder zu hintergehen. Aber auch ihr wurde der Schmerz durch den Wechsel der Akkorde, das Auf und Ab einander widersprechender und sich wieder versöhnender Klangflächen, die den Raum ins Unbegrenzte ausweiteten, auch ihr wurde die Gewißheit des Todes, der so hastig, so unwürdig vollzogen werden sollte, durch die Musik auf wunderbare Weise wünschenswert gemacht.
Liszt konnte ihre Stimmung nicht bessern, aber seine Kunst bannte sie fest in dem Verlangen, es möge sich an ihrem Unglück nichts ändern, ja sie wünschte geradezu, in der Verzweiflung, die ihr jetzt ebenso unentbehrlich schien wie das Pianoforte, eine Ewigkeit zu verweilen.
»Wie wunderbar Sie spielen!« rief Magda G.
»Ich danke Ihnen«, antwortete Liszt, verbeugte sich aber nicht gegen sie, spielte weiter und war nun fest davon überzeugt, daß auch die Kinder ihn hören mußten, obwohl man sie so gründlich vor ihm versteckt hielt.
Wieder bewegte sich die Eisentür, und ein Mann mittleren Alters betrat den Raum. Er trug eine schwarze Uniform, hatte die Ärmel seiner Jacke bis zum Ellbogen aufgekrempelt, der Kragen war weit geöffnet, die kurzgeschnittenen Haare waren nicht frisiert, in der linken Hand hielt er einen kleinen Koffer. Er schien das Klavierspiel nicht zu bemerken, richtete seine Aufmerksamkeit noch dem Korridor zu, aus dem er gekommen war, antwortete einer Stimme, als wollte er sich irgendeiner Sache vergewissern, dann sah er mit äußerster Ungeduld auf Josef G. Es war der Arzt. Und Liszt spürte, daß nun jemand anwesend war, den er zu fürchten hatte.
›Der gleiche Kopf, den ich dort als Büste stehen sehe‹, dachte er. ›Er ist blaß wie Marmor, ohne Güte, ganz und gar unerreichbar. Er hört die Musik nicht.‹
Dabei sah er auf den Kragenspiegel der Uniform, der mit einem Totenkopf geschmückt war, und konnte nicht umhin, die Ununterschiedenheit zwischen Gesicht, Uniform und den Insignien des Todes zu bewundern. Er, der so lange Jahre von der Schönheit der Güte fasziniert gewesen war, hatte nun die Schönheit des Bösen vor Augen, und er fühlte, wie das Spiel seiner Hände, das bisher ohne Anstrengung, fast wie von selbst, vor sich gegangen war, stockte und wie er sich dagegen wehrte, indem er die Bässe und die äußersten Höhen über Oktaven hinweg mehrmals gegeneinander anschlug.
Aber der Arzt blieb unbeeindruckt, und Josef G. erhob sich langsam, ging, die Schritte behutsam auf den harten Beton setzend, zur Tür, wobei er immer noch auf Liszt und in Richtung Pianoforte zurücksah, dann, an der Tür angekommen, hob er, wie zum Gruß, seinen rechten Arm mit einer Miene des Bedauerns.
»Ich spiele noch!« rief der Pianist. »Die Regel des Anstands gebietet, daß zuerst der Künstler den Raum verläßt. Madame«, rief er und wandte sich nun an Magda G., »gibt es einen Grund, meinen Vortrag derart zu mißachten?«
Aber sie sah schon zur Tür, sah, wie Josef G. und der Arzt sich entfernten, und ließ nun, indem sie versuchte, sich ebenfalls zu erheben, das Taschentuch fallen, das sie so lange umklammert hatte. Sie wollte den beiden nach, aber ihre Knie ertrugen die rasche Bewegung, der sie folgen sollten, nicht, und so fiel sie, kaum daß sie sich erhoben hatte, wieder auf den Stuhl zurück, wobei sie mit dem rechten Ellbogen hart gegen den Tisch aufschlug.
»Helfen Sie mir. Er geht zu den Kindern. Rasch, geben Sie mir Ihren Arm.«
»Nein«, antwortete Liszt und spielte weiter, immer nur weiter. »Nein«, antwortete er und versuchte seiner Stimme Schärfe zu geben, »solange Sie mir zuhören, kann den Kindern nichts geschehen.«
»Sie irren sich. Wenn ich mich ihrer nicht erbarme, tötet sie der Arzt. Wir sind schuldig. Wir dürfen nicht in die Hände unserer Feinde fallen«, sagte sie, erschrak aber gleichzeitig über ihr Geständnis und wollte es ungeschehen machen. »Nein«, fügte sie hinzu und erhob sich. »Nein«, wiederholte sie fast flehend und ging auf Liszt zu, »wir sind nicht schuldig.«
Dabei kam sie ihm so nahe, daß er sich genötigt sah, sein Spiel zu unterbrechen, und als sie nochmals und nun mit aller Eindringlichkeit von ihm wissen wollte, ob auch er glaube, daß sie nicht schuldig seien, sagte er:
»Madame, ich weiß es nicht. Aber da Sie es sagen, will ich es glauben.«
»Ich danke Ihnen«, antwortete sie und schwieg.
Liszt spürte, wie die Lampe über ihren Köpfen, die Möbel ringsherum, ja der ganze Raum zu schwingen begann, und wunderte sich, daß dies in vollkommener Stille vor sich ging. Und da Magda G. immer noch schwieg und in merkwürdiger Unentschlossenheit einfach so dastand und er nicht wußte, wie er dies deuten sollte und ob es angemessen wäre, jetzt weiter auf dem Pianoforte zu spielen, begann er leise und eindringlich zu reden:
»Madame«, sagte er, »Sie sollten mit dem Leben nicht ungerecht sein, und vor allem: Man muß nicht immer und um jeden Preis etwas wollen. Ich hatte zwei Kinder aus erster Ehe, Cosima und Blandine, das heißt, sie waren eigentlich unehelich, ich habe mich aber trotzdem um sie gekümmert. Blandine starb leider sehr früh, aber Cosima war, wie Sie wissen, von Bülows, dann Richard Wagners Frau und starb erst im Jahre 1930. Was für ein langes, ereignisreiches Leben! Natürlich: Auch ich hatte Gründe, unzufrieden zu sein, und ich habe Cosimas Untreue gegenüber von Bülow und ihre Zuneigung zu Wagner nie goutiert, und ich kann auch nicht behaupten, daß die Sorgen, die ich mir um Cosima machen mußte, erheblich waren. Sie, Madame, sind verzweifelt, aber: Keine Verzweiflung, auch jene nicht, die den Tod sehnsüchtig herbeiwünscht, darf uns dazu verführen, alles nur mit eigenen Augen zu sehen. Nichts übersteigt das eigene Unglück, aber: Madame, man muß auch der Welt, und dazu gehören die eigenen Kinder, ihren Lauf lassen.«
Sie hörte ihm zu, bemerkte jetzt erst, wie alt dieser Mann war, ja daß er sich an der Grenze seiner Hinfälligkeit befand, und die bedächtige, fast betulich wirkende Art zu sprechen tat ihr wohl, und daß er das Gewand eines Priesters trug, war ihr nun selbstverständlich. Ob sie seine Worte billigte, konnte er nicht sagen. Sie schien in Gedanken weit, weit weg zu sein, und auch als eine Stimme zaghaft nach der Mutter rief, schien sie dies nicht zu bemerken.
»Wieviel Kinder haben Sie?« fragte Liszt.
Sie konnte nicht antworten. Sie schämte sich. Es schien ihr unmöglich zu erklären, daß sie sieben Kinder hatte, aber nur eines vor ihrer Fürsorge in Sicherheit war. Auch schien es ihr unvorstellbar, daß man sechs Kinder so verschiedenen Alters und in so kurzer Zeit töten konnte. Die Kleinsten, ja, was wäre daran entsetzlich, wenn man sie nahe bei sich, wie sie es gewohnt waren, einschlafen ließe, dies eine Mal für immer. Aber die Älteren, die schon verständig waren, die voller Mißtrauen nur noch unter neuen, immer neuen Versicherungen, daß ihnen nichts geschehen könne, seit Tagen tapfer in ihrem Zimmer aushielten, wie sollte man ihnen das Äußerste antun, nachdem man versprochen hatte, sie davor zu bewahren.
Sie wunderte sich, daß diese Gedanken, die ihr unerträglich waren, sie nicht niederdrückten und wie so oft dazu zwangen, sich hinzulegen, um wenigstens ihr Herz einigermaßen zu beruhigen. Es wurde ihr alles leicht, der Boden unter ihren Füßen bewegte sich wie ein Schatten, und sie erinnerte sich plötzlich an frühe, sehr frühe Umstände, in denen sie vor Glück und gehobener Stimmung hätte vergehen können, und sie mußte rasch, aber doch so, daß Liszt es nicht bemerkte, mit den Händen das Pianoforte fassen, um nicht zu fallen. Und weil sie dabei lächelte, dies aber nicht billigen konnte und fürchten mußte, die Gewalt über ihre Empfindungen zu verlieren, sagte sie:
»Ich danke Ihnen. Ich muß zu meinen Kindern. Sie hören ja selbst, sie rufen nach mir.«
Liszt wollte ihr behilflich sein. Er hatte sehr wohl bemerkt, daß sie wankte und Mühe hatte, vom Pianoforte loszukommen, aber als er die zwei, drei Schritte ging, die nötig waren, um sie zu erreichen, verfing er sich mit den Schuhen im Saum seiner Soutane, konnte gerade noch verhindern, daß er stolperte, und als er nach dieser Ungeschicklichkeit mit einem Wort der Entschuldigung endlich seinen Arm anbieten wollte, war sie verschwunden. Er starrte auf den Korridor, dessen eiserne Tür weit geöffnet war, wie auf einen Abgrund, der aus der Welt führte, und nun fiel ihm ein, daß er es versäumt hatte zu spielen.
»Warten Sie«, wollte er rufen. »Entschuldigen Sie meine Nachlässigkeit! Lassen Sie die Kinder, es geht weiter! Wir sind mit der Sonate noch nicht am Ende!«
Aber er ahnte, wie nutzlos dies alles war, brachte nur hastig und halblaut etwas Unverständliches über die Lippen und stand da wie jemand, der zusehen mußte, wie ein Unglück, dessen Entstehen er hatte verhindern wollen, gerade durch ihn und, wie er glaubte, durch seine Geschwätzigkeit möglich geworden war. Er fühlte seinen Rücken kalt werden und wie ihm die Hände, diese kostbaren, zur äußersten Disziplin erzogenen Hände, zu zittern begannen und wie er dem panischen Verlangen nicht folgen konnte, sofort, unwiderruflich, zum Pianoforte zurückzugehen, um das Versäumte nachzuholen. Aber dann erreichte er doch, wobei er den Eindruck hatte, er würde sich über Arme und Beine hinweg zu dieser Anstrengung zwingen, die Tastatur und begann zu spielen.
›Gott sei Dank‹, dachte er, ›dies Instrument bringt, wenn man nur darauf zaubert, alles zum Schwingen.‹
Und wirklich: Das schlechte Gewissen, das ihn trieb, die verzweifelte Hoffnung, er könnte, wenn er nur überall zu hören wäre, alles Lebendige unter dieser Erde wieder zurück in seine Nähe zwingen, aber auch die Vorstellung, die Kinder könnten, wenn er nicht spielte, in ihrer Not vor Entsetzen aufschreien und er wäre dazu verdammt, es zu hören, dies alles brachte ihn dazu, mit dem Adagio derart erregt und hochauftürmend einzusetzen, daß es schien, als würden der allzu enge Raum, die eiserne Tür, aber auch der Korridor wie durch die Wucht einer Posaune auseinandergesprengt. Aber dabei ließ er es nicht bewenden.
»Wagen Sie es nicht!«, rief er, »wagen Sie nicht, den Kindern etwas anzutun! Es sind Geschöpfe Gottes!« Und: »Ich maße mir nicht an, über die Welt zu urteilen, ich bin ebenso gering wie Sie, aber: Wer seine Kinder mordet, der soll in Ewigkeit weder leben noch sterben, weder Vater noch Mutter genannt werden!« rief er.
Und je mehr er die Stimme hob, je vorbehaltloser seine Drohungen wurden, je unbedingter er wünschte, das Unglück der Kinder, koste es, was es wolle, zu verhindern, desto deutlicher spürte er, daß seine Kraft für so viel Zorn nicht mehr ausreichte. Eine Weile schien er sich zu behaupten, bis ein Husten, den er nicht unterdrücken konnte, ihm so sehr den Atem nahm, daß er sich vom Pianoforte abwenden mußte, wobei er mit der rechten Hand, die linke lag schon kraftlos auf der Tastatur, den Fortlauf der Sonate aufrechterhielt.
Er keuchte, rang nach Luft, konnte die Schwäche, die ihn überfallen hatte, nicht wieder loswerden. Er hoffte, daß sich jemand zeigen würde und daß, wenn dies zuviel verlangt war, wenigstens eine Stimme, die ja nicht ihm gelten mußte, sich hören ließe. Aber es blieb alles still.
Er klappte das Notenpult zurück, schloß das Pianoforte.
›Gut‹, dachte er, ›gut. Dann habe ich meine Schuldigkeit getan, und nun sind alle Himmel verschlossen‹.
Er saß da, zusammengesunken, den Kopf gebeugt, die Hände ruhten auf den Knien, und während sein Atem langsam ruhiger wurde, überkam ihn ein Gefühl von Gleichgültigkeit. Er dachte an die Gräfin d’Agoult und daß er zu ihrem Begräbnis nicht gekommen war.
Daran dachte er jetzt. Und auch, daß er der WALDSTEINSONATE zuviel, ja das Unmögliche zugemutet hatte.
Über der Erde, dort, wo man dem Himmel sieben, acht Meter näher war, begann der Frühling. Die Kastanien blühten. Sie hatten Mühe, sich gegen den Geruch, der über der brennenden Stadt lag, zu behaupten.
Im November
Als sie Berlin etwa eine Meile hinter sich gelassen hatten, als die Kiefern immer enger gegen das Gefährt heranzudrängen schienen, als der Nebel, der gegen die Scheiben schlug, sich immer noch nicht lichten wollte, sah er das erste Mal hinaus. Er sah die Böschung und daß der Kutscher die Pferde etwas zu sehr in die Nähe des Grabens führte, aber er hatte kein Gefühl der Unterschiedenheit zwischen dem Gefährt, in dem er saß, und dem Wald, der unbestimmt und halbdunkel hinter dem Graben aufragte. Dies machte ihn unruhig.
Er wunderte sich, daß Madame Vogel so gelöst, so selbstvergessen an seiner Seite saß, indem sie, soweit es ging, gegen die Tür hin von ihm abgerückt war, um nun, solange diese Fahrt auch andauerte, in ein und derselben Haltung bewegungslos zu verweilen.
Vor kurzem noch hatten sie, bevor sie die Kutsche bestiegen, einander versichert, wie hartnäckig ihre Heiterkeit war und daß sie auf dieser Fahrt dafür sorgen müßten, nicht zu sehr in die Nähe des Übermuts zu geraten. Aber nun, da die himmelverhangene Düsternis ihn bedrängte, da die Welt der Erscheinungen, an der er litt, sich ihm durchaus nicht, wie sonst, bis zur Ermüdung, ja bis zum Überdruß seiner Sinne zeigen wollte, nun sah er keine Grenze mehr, die man hätte überschreiten können.
Madame Vogel bemerkte seine Unruhe. Der Schal, den sie trug, bedeckte beinahe ihr Gesicht, sie lächelte, als sie auf seine Frage, ob die Sonne nicht scheinen werde und ob es möglich sei, bei diesem Wetter das gemeinsame Ziel zu erreichen, antwortete: Es sei ja noch früh. Es sei kein Regen, und für einen Augenblick, dafür verbürge sie sich, würde die Sonne schon scheinen.
Dies ließ er sich gern sagen. Dabei war er versucht, ihre Hände zu fassen, bemerkte aber, wie sie diese vor ihm versteckt hielt, so, als würde sie dem Versprechen, das sie einander gegeben hatten, nämlich sich nicht zu berühren, mißtrauen.
Sie wirkte zuversichtlich, und er wußte, sie war fest davon überzeugt, daß ihre Natur, die sie immer noch willig ertrug, ganz und gar ohne Bedeutung war. Und wie wenig sie dies zum Anlaß ihres Kummers nahm! Und daß sie sterben wollte, ohne besondere Gründe geltend zu machen! Dafür bewunderte er sie. Und er zog, rascher als nötig, seine Blicke zurück und sah auf das Polster, mit dem die vordere Wand der Kutsche bespannt war.
Eine Elster folgte dem Gefährt. Sie erhob sich und flog, sobald der Kutscher die Pferde an dem Ast, auf dem sie saß, vorbeigeführt hatte, immer wieder voraus, setzte sich, wobei sie unruhig mit dem Schwanz hin und her wippte. Madame Vogel, auf deren Seite dieser Vorgang geschah, bemerkte das Tier, das ununterbrochen zeterte, und wies mit der Hand ins Freie, solange die Elster durch das Fenster, bevor sie aufflog, zu sehen war. Er folgte ihren Blicken, bemerkte, wie angenehm ihr diese Ablenkung war, konnte aber das Tier, ohne daß er sich zu sehr über ihre Schulter hätte hinwegbeugen müssen, nicht sehen, und da er dies nicht wollte, ließ er sie mit ihrer Beobachtung allein.
So fuhren sie dahin, spürten, wie der Kutscher, den sie gebeten hatten, zügig zu fahren, die Pferde immer wieder antrieb, bis diese eine gute Weile durchgehalten hatten, dann durften sie sich bei langsamerer Fahrt ausruhen. Man passierte ein kleines Gewässer, dessen Brücke beschädigt war, und nun hatten beide für Augenblicke, als die Kutsche darüber hinwegging, als ein Rad zwischen die Bohlen geriet, das Gefühl zu schleudern. Sie umfaßten, jeder für sich, die Griffe an ihren Türen, um nicht gegeneinanderzufallen. Und die Fahrt ging weiter, eintönig, ereignislos, wie sie begonnen hatte.
Nur einmal, als sie die Kiefern hinter sich gelassen hatten und der Kutscher in unmittelbarer Nähe eines Gevierts, auf dem man den Wald gerodet und Wintergetreide angesät hatte, plötzlich, die Pferde waren kaum zum Stehen gekommen, vom Bock sprang und fluchend ein Hindernis, das die Straße versperrte, zur Seite räumen wollte, um dann, als ihm dies nicht gelang, für Minuten im Unterholz zu verschwinden, für dies eine Mal überkam sie eine unerklärliche Angst.
Es begann damit, daß Madame Vogel, weil das Gefährt ohne ersichtlichen Grund, wie sie meinte, so plötzlich stillstand, von der Vorstellung nicht loskommen konnte, sie seien außerhalb der Zeit, sie würden ihr Ziel nie erreichen und sie müßten, da der Kutscher die Flucht ergriffen hätte, ewig in dieser Enge nebeneinandersitzen.
Dies sagte sie ihm, und er erwiderte, ohne den Sinn ihrer Worte zu erfassen: Ja, ja, auch er hätte in letzter Zeit daran gezweifelt, ob ihn der Tod erlösen könne und ob er, gesetzt, er würde die Pistole gegen sich richten, dazu verdammt sei, nach der kurzen Seligkeit des Sterbens wieder zu leben. Mitunter, fügte er hinzu, fühle er sich wie jemand, der gezwungen sei, von einem Zimmer ins andere zu gehen, und dem ein Gott die Gnade des Todes, wie dem Tantalus das erlösende Wasser, vor die verdurstenden Lippen bringe, aber es sei ihm unmöglich, davon zu trinken!
Eine halbe Stunde später sahen sie die Havel. Die Sonne hatte den Nebel durchbrochen, und nun lag alles, die Wiesen, das Ufer, das schwarze Geäst der Erlen, klar vor ihren Augen, und sie konnten sich nicht satt sehen. Er öffnete die Tür, zeigte auf das Wasser und sagte:
»Sehen Sie, dies ist ein Anblick, geschaffen, um zu sterben. Hier hat der Mensch eine Grenze, und vor allem: Ich muß die Natur sehen können, wenn ich mich in ihre Arme begeben soll.«
Sie sah mit ihm hinaus, sah, wie unbestimmt die Farbe des Wassers war, dort, wo der Nebel Schatten auf die Oberfläche warf, und wie die Wälder von ihren Höhen herab bis an die Ufer, ja darüber hinaus, in die Tiefe zu drängen schienen. Aber sie fröstelte bei diesem Anblick. Und als er fragte, ob es nicht wünschenswerter sei zu ertrinken, in all dieser Schönheit, ganz still, ohne daß jemand sie sah, zu ertrinken, zog sie den Schal enger und sagte: Nein. Sie traue dem Wasser nicht, und der Abschied vom Leben dürfe keinesfalls länger als eine Sekunde dauern.