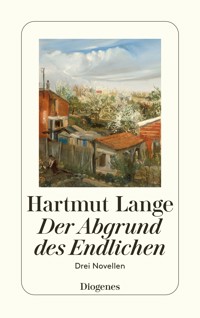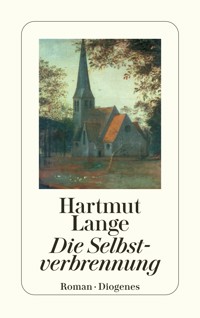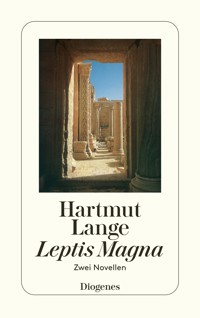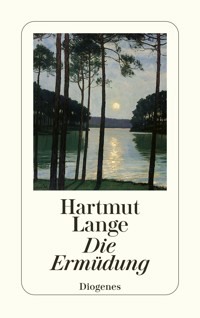7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist Schönbergs 4. Streichquartett Opus 37, das Berghoff unermüdlich übt, nicht gerade geeignet, seinen ohnehin angespannten Geisteszustand zu beruhigen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass seine Frau Elisabeth mit den Töchtern zu einer Erholungsreise aufgebrochen ist, die kein Ende nehmen will. Als dann plötzlich – Traum eines jeden Geigers – eine wertvolle Mittenwalder Geige in seiner verlassenen Wohnung steht, nimmt ein Alptraum seinen Lauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hartmut Lange
Das Streichquartett
Novelle
Diogenes
Ich bedanke mich für die Mitarbeit meiner Frau
1
Es begann damit, daß Berghoff eine Aufnahme aus dem Jahre 1937 mitbrachte. Er zog einen CD-Player aus der Aktentasche, dazu zwei kleine Kopfhörer, die er herumreichte, und er bestand darauf, daß man erst einmal, statt zu proben, das verkratzte Archivmaterial zur Kenntnis nehmen sollte.
»Das Largo ist das Schönste. Es dauert neun Minuten«, sagte er.
Dann saß jeder auf seinem Stuhl. Man hörte das Streichquartett Nr. 4, op. 37 von Arnold Schönberg, gespielt vom Kolisch-Quartett, genauer von den Herren Khuner, Lehner, Heifetz und eben jenem Rudolf Kolisch, der die erste Violine spielte.
»Erstaunlich«, sagte Berghoff, der sich auf einem Bogen Papier Notizen gemacht hatte.
Er hielt einen kurzen Vortrag über das Kolisch-Quartett. Es sei überaus berühmt gewesen, versicherte er, und hätte sich neben dem klassischen Repertoire auch mit Webern und vor allem mit Schönberg befaßt. Das Opus 37 von Schönberg sei in einem Hollywood-Studio, genauer in einem Schuppen mit einem einzigen Mikrophon, aufgenommen worden. Es hätte damals noch kein Tonband gegeben, und so hätte kein einziger Fehler verbessert werden können, erklärte Berghoff. Er erwähnte noch, daß die Presse die Uraufführung in Los Angeles und das letzte Konzert in Wien vollendet genannt habe, bedauerte, daß davon nichts, aber auch gar nichts überliefert sei. Alle hörten sich, wohl aus Hochachtung, nochmals das verkratzte Material an.
»Was meint ihr dazu?« fragte Berghoff, nachdem er die Kopfhörer wieder eingesammelt und samt Player und CD in der Aktentasche hatte verschwinden lassen.
Der Raum, in dem man sich befand, war etwas zu groß. Es war eine stillgelegte Fabrikhalle in der Nähe der Invalidenstraße. Die Miete war erschwinglich. Anfangs hatte es akustische Irritationen gegeben, die allerdings aufhörten, nachdem man die Wände mit Tüchern abgehängt hatte. Man sprach über das Programm für die nächste Tournee, einigte sich auf Beethoven, Brahms und Schubert, aber natürlich mußte man auch einen Komponisten der Moderne anbieten.
Am nächsten Tag, alle hatten sich die Partitur besorgt, am nächsten Tag blätterte man in dem Opus 37, und es war immer noch nicht sicher, ob man Schönberg ins Repertoire nehmen würde. Und wieder redete Berghoff über das Kolisch-Quartett, erwähnte, daß es gezwungen gewesen sei, die Schallplattenaufnahme in einem zugigen Atelier und in aller Eile, sozusagen zwischen den Filmaufnahmen, zu realisieren.
»Kolisch war übrigens Schönbergs Schwager.«
»So«, sagte von Rosen, nahm sein Cello auf und schlug vor, daß man sich über die ersten Takte einig werden sollte.
Man besprach Details, begann zu proben. Das Thema der ersten sechs Takte gab Berghoff mit seiner Geige an, und darüber war man sich einig: Melodisch gab es zwei Intervalle zu beachten. Kleine Sekunde und große Terz. Es folgte ein weiteres Teilmotiv aus drei Tönen mit aufsteigender Quinte und absinkender großer Sekunde. Das eröffnende Motiv verdichtete sich im vierten Takt zu einem dreimalig gespielten Akkord von Violine, Bratsche und Cello.
»Der Rhythmus entsteht durch Wiederholungen innerhalb des Themas. Immer dort, wo Notenwerte von Achtelbewegungen unterbrochen werden, wo sich Dramatik einstellt, werden die Anfangsnoten der Achtelgruppen zwei- oder dreimal wiederholt«, sagte Berghoff und wies mit dem Finger auf die entsprechende Notenzeile.
Vom Nebenraum her gab es ein Geräusch. Oder war es in den Kellerräumen, wo man offensichtlich mit Arbeiten an der Zentralheizung beschäftigt war? Es war ein regelmäßiges Klopfen, dann wieder ein Gluckern in den Röhren.
»Fast, als würde uns jemand das Tempo vorgeben«, sagte Wernicke und lachte.
Alle hatten den Kopf erhoben, als wäre da etwas, das ihre Beachtung verdiente. Dann vertieften sie sich weiter in die Partitur. Draußen begann es zu regnen. Man hörte durch die geschlossenen Fenster hindurch ein Rauschen, das durch die Häuserwände, die den Hof umstellten, verstärkt wurde, und man hörte, wie der Regen gegen den Asphalt klatschte. Und wäre jetzt jemand aufgestanden, um ins Freie zu sehen, dann hätte er bemerkt, daß Berghoff vergessen hatte, an seinem Wagen die hintere Scheibe hochzukurbeln, so daß das Polster der Bank naß wurde. Ja, daß die Gefahr bestand, der Regen könnte, falls er länger andauern würde, den gesamten Boden unter Wasser setzen. Es war ein Caravan der Marke Audi. Die Streben auf dem Dach hatten hier und dort den Lack verloren, so oft war Berghoff mit der Familie in den Urlaub gefahren, und immer war alles vollbepackt. Meist ging es nach Frankreich an die Atlantikküste oder nach Italien. Etwa nach San Sepolcro, wo Berghoff, es war lange her, das Amadeus-Quartett in einem kleinen Theater gehört hatte. Was hatten sie gespielt?
Berghoff setzte die Geige ab, zog nochmals die CD aus der Aktentasche. Nicht, daß er das Kolisch-Quartett wieder als Vorbild zitierte, aber er meinte doch, man sollte wie auf dem Foto, das der Archivaufnahme beigefügt war, das Cello neben der ersten Violine plazieren.
»Vielleicht erreichen wir damit mehr Spannung«, sagte er, bestand aber nicht weiter auf seinem Vorschlag, weil er sah, daß von Rosen ein langes Gesicht machte.
2
Elisabeth Berghoff, geborene Ostermaier, war eine schöne Frau. Sie war schlank, hatte nach der Geburt ihrer beiden Kinder den Anflug von Magerkeit verloren. Sie hielt sich besonders aufrecht, erweckte dadurch den Eindruck, sie wäre größer als ihr Mann, was eine Täuschung war. Aber Berghoff sah es nicht gern, wenn Elisabeth hochhackige Schuhe trug, und wenn sie auch noch ihr Haar aufgesteckt hatte, dann konnte es vorkommen, daß er von dem Eindruck nicht loskam, er müsse zu ihr aufsehen.
›Ich sollte ihr wieder einmal Blumen mitbringen‹, dachte Berghoff, fuhr aber, als er an einem Laden vorbeikam, weiter.
Er hatte Elisabeth versprochen, die Kinder abzuholen, konnte sich nicht mehr an die Adresse, die sie ihm genannt hatte, erinnern, und so fuhr er ziellos und mit schlechtem Gewissen mehrere Nebenstraßen ab, bis er die Mohrenstraße erreicht hatte.
›Hier wohnt Stern‹, dachte er, als er den portalähnlichen Eingang eines Neubaus passierte.
Und war da nicht, es war nur für Sekunden, eine Gestalt zu sehen, offenbar eine Frau, die es eilig hatte, irgendwohin zu kommen? Berghoff mußte eine Vorfahrt beachten, und als er wieder in den Rückspiegel sah, war die Frau verschwunden. In seine Charlottenburger Wohnung zurückgekehrt, sah er, daß Elisabeth und die Kinder schon beim Mittagessen saßen. Er wußte, daß er sich jetzt entschuldigen mußte und daß dies zwecklos war, weil Elisabeth nicht antworten würde. Mit einem nachsichtigen Lächeln saß sie da und ließ die Kinder reden, die dem Vater sofort ihre Geschenke zeigten, die man ihnen dort, von wo er sie hätte abholen sollen, in buntes Papier eingewickelt und mitgegeben hatte. Es war nichts weiter, irgendwelche Phantasiefiguren aus Plastik. Trotzdem:
»Sehr schön«, sagte Berghoff, gab Elisabeth einen Kuß auf die Stirn, und dabei ließ man es für dieses Mal bewenden.
Eine Stunde später verhandelte Berghoff mit der Konzertagentur, und er versuchte, die geplante Tournee nicht in Kiel, sondern in München oder wenigstens in Salzburg beginnen zu lassen. Auch sprach er darüber, daß es schwierig sein würde, gewisse Kritiker, die unverzichtbar waren, in die norddeutsche, wie er sich ausdrückte, Einöde zu locken. Und besonders jener Kritiker, dem man regelmäßig einen Scheck für entstehende Unkosten zuschickte, ja, er hatte ihnen geraten, das neue Programm, koste es, was es wolle, erst einmal im Münchner Herkulessaal vorzustellen.
Leider war dies nicht möglich. Die Verträge waren abgeschlossen. Mißmutig blätterte Berghoff in dem Ordner, den man ihm überlassen hatte. Allerdings gab es eine erfreuliche Nachricht: Das Konzert war an die Firma Polydor verkauft. Man würde demnächst einen Fotografen für das Cover schicken.
»Wir fangen an berühmt zu werden«, sagte Berghoff am Abend.
Er hatte eine Flasche Rotwein geöffnet und darauf bestanden, mit Elisabeth, die Kinder waren schon im Bett, eine halbe Stunde beisammenzusitzen. Sie probierten den Wein, sprachen über dieses und jenes, und irgendwann versuchte Berghoff mit Elisabeth über Schönberg zu reden, und er wollte auch ihr, wie den anderen, die Archivaufnahme aus dem Jahr 1937 schmackhaft machen. Elisabeth winkte ab.
»Ich kann dem verkratzten Zeug nichts abgewinnen«, sagte sie. »Aber wenn ihr meint, dies unbedingt spielen zu müssen! Eure Aufnahme wird sicher um einiges perfekter sein.«
Berghoff war der Schlagfertigkeit seiner Frau nicht gewachsen.
›Es ist wie mit ihren blonden Haaren. Sie sind einfach überzeugend. Und wenn sie sie dann noch hochsteckt, hat sie schon gewonnen‹, dachte er. Und so wollte er, obwohl es Gründe gab, keinerlei Irritationen aufkommen lassen. Trotzdem: Wieso konnte Elisabeth wissen, daß die Archivaufnahme aus dem Jahr 1937 verkratzt war? ›Sie hat sie nie gehört‹, dachte Berghoff, griff zur Flasche und goß sich Wein nach, bis das Glas beinahe randvoll war.
3
Niemand machte den Versuch, von Rosen das Cello streitig zu machen, obwohl alle wußten, daß Stern dieses Instrument besser, genauer und einfühlsamer zu handhaben wußte. Auch Berghoff hatte in seiner Jugend Cello gespielt, sich aber anders entschieden, und Stern hatte sich damit abgefunden, daß er die zweite Violine spielte. Alles andere wäre auch albern gewesen, da Berghoff das Quartett gegründet hatte. Stern war der Kleinste der Gruppe, und er gab nebenbei, sozusagen als Rückversicherung, Privatunterricht. Sicher, das Quartett war etabliert, aber man konnte nie wissen, ob die Tourneen genügend Geld einbrachten oder ob jemand, zum Beispiel Wernicke, der unter Gelenkrheumatismus litt, irgendwann ausscheiden würde. Und Wernicke, das wußte jeder, war, falls die Sache ernster werden würde, schwer zu ersetzen. Er spielte die Viola, war der Älteste der Gruppe. Er wohnte wie Berghoff im Westteil der Stadt, in der Nähe des Lehniner Platzes. Von Rosen wohnte in Potsdam, und Stern war vor Wochen erst von Pankow in die Mohrenstraße umgezogen, in ebenjene Straße, in der Berghoff auch diesmal, als er wieder mit dem Auto unterwegs war, eine Frau auffiel, die es besonders eilig hatte.
›Es könnte die von gestern gewesen sein‹, dachte Berghoff, hatte aber keine Lust, weiter darauf zu achten.
Als er den Hof der Fabrikhalle erreicht hatte, kam ihm von Rosen entgegen, der erklärte, daß man nicht proben könne. Die Heizkörper waren kalt, und auch Wernicke, der offensichtlich fror, hatte seinen Mantel bis oben hin zugeknöpft. Für Augenblicke standen sie ratlos da.
»Manfred hat sich verspätet!« sagte von Rosen und sah auf die Uhr. »Vielleicht ist der Bus steckengeblieben.«
Berghoff zog sein Notizbuch aus der Aktentasche, suchte nach der Telefonnummer des Vermieters, und nachdem er sich mit diesem über sein Handy verständigt hatte, ging er in den Flur und stieß die Kellertür auf.
»Wir sollen am Brenner auf einen roten Knopf drücken«, sagte Berghoff, betrat die Treppe, die hinter der Tür sichtbar wurde.
Und nun begann ein umständliches Suchen nach dem Lichtschalter. Das heißt, Berghoff, die anderen blieben im Flur zurück, Berghoff war genötigt, da links und rechts nichts zu sehen war, die Treppe im Halbdunkel hinunterzusteigen, bis er einen Vorraum erreicht hatte, von dem mehrere Gänge abgingen, und nachdem er sich vier, fünf Meter in den rechten Gang, sozusagen in die Dunkelheit, hineingetastet hatte, fand er endlich, was er suchte. Er öffnete einen Kasten. Sekunden später war der gesamte Keller in ein viel zu helles Licht getaucht. Berghoff war überrascht, daß der Gang, in dem er sich befand, um einiges breiter war, als er in der Dunkelheit geglaubt hatte, und daß alles, so weit man sehen konnte, mit Gerümpel vollgestellt war. Da standen kreuz und quer Bettgestelle, Kühlschränke, Eimer, irgendwelche Bretter, die durch Eisenstangen miteinander verbunden waren. Auch Teppiche und durchlöcherte Gardinen konnte Berghoff auf den ersten Blick ausmachen, und er glaubte, daß hinter dieser unüberwindlich scheinenden Barriere ausrangierter Gegenstände die Heizungsanlage zu erkennen war. Aber er machte keine Anstalten, sich einen Weg zu bahnen, rief auch die anderen nicht herbei, mit deren Hilfe es ein leichtes gewesen wäre, dieses und jenes zur Seite zu räumen. Statt dessen stand er da und staunte. Es roch nach Staub und ranzigem Öl, und doch, vielleicht durch das viel zu helle Licht, wirkte die Unordnung, die er vor Augen hatte, gestochen scharf und irgendwie überzeugend.
›Wie ein raffiniert ausgetüfteltes Stilleben‹, dachte Berghoff. Die anderen warteten, stellten auch keine Fragen, als Berghoff, er hatte das Licht angelassen, endlich zurückkam, und da Stern, es war jetzt eine Dreiviertelstunde über der Zeit, immer noch nicht aufgetaucht war, riet er ihnen, erst einmal einen Kaffee zu trinken. Er selbst, erklärte er, würde mit dem Auto in die Mohrenstraße fahren. Unterwegs fiel ihm ein, wie unsinnig diese Absicht war und daß er, um Stern in dessen Wohnung zu erreichen, lediglich sein Handy hätte benutzen müssen. Aber gerade dies ließ er sein, um die Fahrt durch mehrere Baustellen hindurch von Moabit bis zur Mohrenstraße auf sich zu nehmen, und als er den portalähnlichen Eingang erreicht hatte, ließ er den Wagen mit eingeschalteter Blinkanlage in der zweiten Reihe stehen. Rasch, er mußte damit rechnen, einen Strafzettel zu bekommen, ging er die Treppe hinauf, und er wunderte sich, daß Stern, kaum daß er den dritten Stock erreicht hatte, schon in der offenen Wohnungstür stand.
»Warum läßt du uns warten!« rief Berghoff und ging, ohne auf die Antwort des anderen zu achten, über den Korridor hinaus in ein großes, quadratisches Zimmer, und mit einer Eile, als wollte er verhindern, daß, falls dort jemand anwesend war, dieser Zeit finden würde zu verschwinden.
Die Wohnung wirkte unaufgeräumt. Überall lose Notenblätter. Auf dem Teppich standen zwei leere Cognacgläser.
»Du trinkst neuerdings mit deinen Schülerinnen Schnaps?« fragte Berghoff.