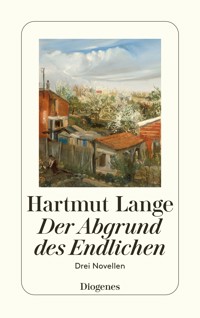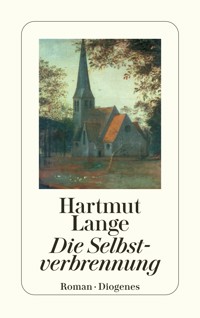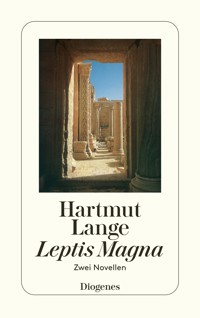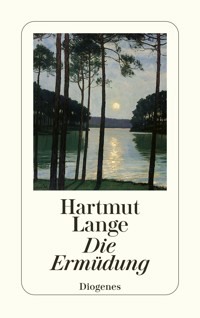Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Fröhliche Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch während seiner jugendlichen Begeisterung für den sozialistischen Gedanken erfuhr Hartmut Lange den mangelnden Glauben an die Kategorie der Notwendigkeit. Als er sich später von der Sozialutopie verabschiedete, um sich immer mehr den Existenzfragen zuzuwenden, die auch Heidegger beschäftigten, wurde er als Novellist zum Meister des Fachs. In diesem Band vollzieht er nun seine Auseinandersetzungen mit Heidegger, Nietzsche, und dem ›Transzendenzbegehren‹ nach, die sein Leben und Schreiben antreiben, berichtet von einer wegweisenden Begegnung mit Odo Marquard und liefert im Anschluss mit einer Theaterszene die düster-schillernde Illustration seiner Überlegungen und Erkenntnisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Poetische
Fröhliche Wissenschaft 116
Hartmut Lange
Über das Poetische
Inhalt
Über das Poetische
Braucht Wissenschaft Religion?
Über Odo Marquard
Die Poesie der Einfältigkeit
Brechts Wissenschaftsfrömmigkeit
Die Poetik des Bösen
Jenseits von Gut und BöseOderDie letzten Stunden der Reichskanzlei
Zu Gast in der Reichskanzlei
Heirate ihn nicht, Ariadne
Die Heirat
Die Waldsteinsonate
»… das absolute Verschwinden vor Augen« – Hartmut Lange im Gespräch mit Matthias Bormuth
Anmerkungen
Auswahlbibiographie
Über das Poetische
Die Poetik versucht, einen Bereich der Fantasie begrifflich dingfest zu machen, was nicht gelingen kann, denn vor allem die Kunst und damit auch die Poesie unterliegen dem ständigen Wechsel der Zeiten und sie sind und bleiben, auch wo ihnen strenge zivilisatorische Regeln auferlegt werden, subjektgebunden. Und dies ist ihre Freiheit. Kant definiert die Kunst als interesseloses Wohlgefallen.1 Was heißen soll: Sie verdankt ihren Ursprung weder der reinen noch der praktischen Vernunft. Sie ist weder erkenntnistheoretisch noch empirisch, noch durch irgendwelche zivilisatorische Absichten legitimiert. Sie ist evolutionstechnisch völlig irrelevant. Oder scheint es lebensnotwendig, dass sich ein Kind aus Holzklötzen oder Sand oder Papier eine imaginäre Welt errichtet?
Was hier auf infantile Weise beginnt, setzt sich bis ins hohe Alter fort. Der Wille zur Kunst ist ein Begehren, das ohne realbezogene Determinanten auskommt, ja das sich sogar im Erleben des eigenen Untergangs zur Geltung bringen kann. Wir kennen die Klaviersonaten, die Schubert komponierte, obwohl er wusste, dass er vom Typhus gezeichnet war, oder die verzweifelten Bemühungen Mozarts, vor dem Sterben mit einem Requiem zurechtzukommen, oder den unbedingten Willen der Pariser Boheme, lieber zu verhungern, als von der Malerei zu lassen. Modigliani war eben unfähig, den Pinsel aus der Hand zu legen, um mit irgendwelchen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dies wäre eine Forderung der praktischen Vernunft gewesen, und nach Maßgabe der reinen Vernunft ist der Wille zur Kunst sowieso eine Anomalie.
Der Mensch hat die Fähigkeit, der realen Welt die Welt seiner Vorstellungen entgegenzusetzen. Dies geschieht kontinuierlich und derart intensiv, dass es sich über Jahrtausende hinweg zur Kunst- und Kulturgeschichte verdichtet, eine Tatsache, die existentiell entbehrlich bleibt, denn die Kunst ist, nochmals gesagt, evolutionstechnisch ohne Belang. Aber sie entsteht trotzdem, und warum dies so ist, kann man nicht erklären. Man kann es nur beschreiben, wie jenen Bereich, den man erahnt, erleidet, aber objektiv nicht zu erfassen vermag, und den die Philosophie mit dem Begriff Metaphysik umschreibt. Dazu gehören auch Fähigkeiten, von denen man nichts wusste und die sich an einem selbst spontan und unwiderruflich vollziehen.
So bleibt mir bis heute unerklärlich, warum ich mit neun Jahren plötzlich damit begann, Gespenstergeschichten zu erzählen, und zwar derart spannend, dass man mich, wenn ein Lehrer krank war, vor die versammelte Schulklasse setzte, um für Ruhe zu sorgen. Als Zwölfjähriger begann ich zu reimen, etwa so:
»Mütterchen hält Märchenstunde,
sitzet traulich am Kamin
und erzählt vom goldnen Schlosse,
das der liebe Mond beschien.«
Es folgten Balladen und epische Versdichtungen, im gleichen naiven Stil. Jahre später, wenn wir mit Rädern Klassenfahrten unternahmen und in einer Scheune übernachteten, erzählte ich, damit alle besser einschliefen, Kriminalgeschichten, und zuletzt, ich war immerhin achtzehn Jahre alt, schrieb ich an einem Roman unter dem Titel Der ewige Jude.
Nun könnte man sagen: Das ist infantiler, jugendlicher Zeitvertreib, der sich spätestens dann erledigt, wenn man gezwungen wird, etwas Vernünftiges zu tun. Aber ich tat nichts Vernünftiges, denn als ich mich für ein Studium an der Filmhochschule in Babelsberg bewarb, war dies wieder der Wunsch, Dinge zu tun, die nicht der realen Welt, sondern der Welt meiner Vorstellungen geschuldet waren. Dies sollte nun professionell geschehen, und damit änderte sich der Horizont meiner Erfahrungen.
Das enge, kulturell analphabetische Milieu meiner Herkunft war aufgebraucht. Stattdessen gab es nun offiziöse Vorgaben. Anstatt voraussetzungslos Gespenstergeschichten zu erzählen, galt es nun, die erkannten und anerkannten Prinzipien der marxistisch-leninistischen Theorie in die Sphäre der Anschaulichkeit zu ziehen. Das große Vorbild war Bertolt Brecht. Er verstand es wie kein anderer, seine Poetik den gesellschaftspolitischen Gegebenheiten anzupassen. Das Ziel war vorgezeichnet: »Die kommunistische Produktionsweise«, schrieb Marx, sei »das aufgelöste Rätsel der Geschichte«2, und nun kam es darauf an, den Weg dahin möglichst bunt und eindringlich zu bebildern.
Marx war Hegelianer. Er überführte die Erkenntniseschatologie in die Soziallehre, und dies war das Verführerische am Begriff des Wissenschaftlichen Sozialismus, dass er vorgab, sich einzig und allein mit den Vorgaben der reinen Vernunft absichern zu können, und dass ihm die Risiken der praktischen Vernunft, die Kant mit dem Kategorischem Imperativ flach zu halten versuchte, gar kein Problem waren. Mit anderen Worten: Die psychopathologische Verfasstheit der Mächtigen, ansonsten immer ein Grund, sich zu rechtfertigen, blieb theoretisch vollkommen abgesichert. Der brutale Machtkampf, die blutigen Säuberungen, die millionenfachen Exekutionen galten als Einsicht in die Notwendigkeit, waren also im Sinne der marxistisch-leninistischen Erkenntnislehre, die den Klassenkampf propagierte, vollkommen legitim.
Aber für mich waren damit alle offiziösen Vorgaben aufgebraucht, für mich waren die Verbrechen der KPdSU, die man auf dem XX. Parteitag eingestand, völlig unakzeptabel. Ich hatte die Politische Ökonomie, wie sich zeigte, kantisch aufgefasst, und dies blieb auch so, nachdem ich die DDR, jenes Gebiet, in dem die stalinistische Diktatur herrschte, verlassen hatte.
In Westberlin war ich zunächst damit beschäftigt, eine Poetik zu entwickeln, in der das soziale Gewissen alle Verfehlungen, die in seinem Namen begangen wurden, von sich wies. Der Glaube an eine menschenfreundliche Erkenntniseschatologie blieb ungebrochen. Aber dies waren, wie sich herausstellte, Planspiele, wie wir sie von der Weimarer Klassik her kennen: Auch Schiller versuchte, die Bühne als moralische Anstalt zu nutzen, und für Goethe war die Dichtung eine Gelegenheit, sein pantheistisch untermauertes Weltverständnis zu humanisieren, und während ich mit dem Verfassen von Theaterstücken wie Hundsprozess – Herakles, Die Ermordung des Aias oder Trotzki in Coyoacan beschäftigt war, umklammerte mich eine Wirklichkeit, die nicht kulturpolitisch vorbestimmt, sondern von dem Versprechen der Meinungsfreiheit gekennzeichnet war.
Diese Kennzeichnung war aber, zumindest was die Maßgaben des Poetischen betrifft, ein falsches Versprechen. Etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts, seit sich die Sphäre der Kommunikation zu liberalisieren begann, waren auch die Druckerzeugnisse des Poetischen nicht mehr ausschließlich den Vorgaben des Absolutismus unterworfen. Es begann das Zeitalter der Öffentlichkeit, aber Öffentlichkeit ist den Maßgaben der Kunst nicht unbedingt förderlich.
»Wer übrigens nicht glauben will«, argumentierte Goethe, »dass vieles von der Größe Shakespeares seiner großen, kräftigen Zeit angehört, der stelle sich nur die Frage, ob er denn eine solch staunenerregende Erscheinung in dem heutigen England von 1824, in diesen schlechten Tagen kritisierender und zersplitternder Journale für möglich halte. Jenes ungestörte, unschuldige, nachtwandlerische Schaffen, wodurch allein etwas Großes gedeihen kann, ist gar nicht mehr möglich. Unsere jetzigen Talente liegen alle auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit.«3
Goethe warnte vor der aufkommenden Literaturkritik noch aus der Sicherheit eines intakten, die eigenen Zusammenhänge begreifenden Kulturbewusstseins, heute gewinnt der Kritiker immer mehr an Macht, der Schriftsteller verliert jeden markttechnischen Einfluss, und ob er auf einem Präsentierteller seine Leser erreicht, darüber entscheidet der Kritiker, dem allzu oft die Maßstäbe einer kritischen Selektion fehlen. Er formt zwar das aktuelle Literaturangebot in den Feuilletonspalten zur Kontinuität, indessen: Was er auch tut, er spekuliert immer über das Angebot am aktuellen Literaturmarkt, ansonsten bringt er nichts Neues ein. Aber er hat die Macht, und dies zwingt den Schriftsteller, sich mit dem Kritiker, damit er ihn protegiert, ins Einverständnis zu setzen.
Sicher, es gibt Ausnahmen, und man liest auch kompetente Rezensionen, aber ausschließlich von Leuten, die keine Meinungsführerschaft geltend machen können. Ansonsten gilt immer noch der bittere Satz von Nietzsche: »Talent haben ist nicht genug, man muss auch eure Erlaubnis dazu haben, – wie? Meine Freunde?«4 War es für Wagner oder Bruckner fast unmöglich, sich der Feindschaft Hanslicks zu entziehen, so beherrschte hundert Jahre später ein Feuilletongewaltiger wie Reich-Ranicki jahrzehntelang den deutschen Literaturbetrieb. An ihm kam kein Schriftsteller, wenn er Erfolg haben wollte, vorbei.
Auch in der Sphäre der Meinungsfreiheit muss sich der Künstler also offiziösen Vorgaben unterwerfen, und es wird ein Geheimnis bleiben, warum die Nachwelt jene, die sie als Mitwelt bis ins existentielle Elend hinein unbeachtet ließ, besonders feiert, warum man Literaturpreise im Namen von Kleist, Büchner, Hölderlin verleiht, obwohl allgemein bekannt ist, dass eben diese Dichter zu ihren Lebzeiten verkannt waren. Und wie wenig man bereit ist, die Selbstachtung und psychologische Verfasstheit lebender Schriftsteller in Rechnung zu stellen, zeigt die neuerliche Praxis, Long- und Shortlists für öffentliche Ehrungen zu lancieren, in denen ein Selektionsverfahren herrscht, das an Viehmärkte erinnert.
Nun könnte man sagen, dass Verkennung durch Zeitgenossenschaft, will man sie begrifflich fassen, zu den tautologischen Befunden gehört. Zeitgenossenschaft beinhaltet schon Verkennung, so wie sie auch Anerkennung beinhalten kann. Auch früher gab es im kulturhistorischen Geschehen so etwas wie eine Metaphysik der Umstände. Das Schicksal von Kleist wird immer wieder zitiert, aber auch die Erfolglosigkeit des Franzosen Stendhal bleibt letzten Endes rätselhaft. Hatte ihm der einflussreiche Balzac nicht mehrmals und ausdrücklich unter die Arme gegriffen?
Und wenn es wahr ist, was die Romanistik behauptet, dass Stendhal den realistischen europäischen Roman antizipierte und sowohl die Klassik als auch die Romantik tendenziell gegen sich hatte, warum wurde er dann von Flaubert, der nun wahrlich ein Realist war, so sehr verachtet? Stendhal fand mit seinem Roman Rot und Schwarz immerhin Beachtung, und doch reichte diese nicht aus, um ihn der immer wieder einsetzenden Unbekanntheit zu entreißen. Als er am 22. März 1842 an einem Schlaganfall starb, hatte er mit seiner Prosa, wie uns die Forschung versichert, 75 Centimes pro Tag verdient, und die Reaktion der Öffentlichkeit auf sein Verschwinden war kaum der Rede wert.
Stendhal war psychisch gefestigt, und er wusste, dass seine Zeit kommen würde. Aussichtsloser und erbärmlicher war das Schicksal des Amerikaners Herman Melville. Er debütierte mit zwei Prosabänden und wurde schlagartig bekannt. Zuversichtlich, ausreichend Geld zu verdienen, gründete er eine Existenz, schrieb weiter, konnte aber seinen Erfolg nicht wiederholen. Ich will hier Melvilles qualvollen Abstieg in die Bedeutungslosigkeit und sein Buchhalterdasein in einem elenden Zollhaus nicht nochmals erläutern. Hervorzuheben aber wäre, dass die literaturkritische Öffentlichkeit Melville zeit seines Lebens immer nur wie einen Underdog behandelt hat, den man, als er versuchte, seine unverkäuflichen Bücher auf eigene Kosten unter die Leser zu bringen, für geistesgestört erklärte.
Melville arbeitete für einen Hungerlohn, und alles, was er an charakterlichen Schwächen aufzuweisen hatte, seinen Stolz, sein Geltungsbedürfnis, seine Trunksucht, seine Neigung zu häuslicher Gewalt, all dies und vieles andere mehr wurde ihm in Rechnung gestellt, nur nicht, dass er den bedeutendsten amerikanischen Roman geschrieben hatte. Das übersah man. Aber wo Moby Dick an mangelndem Wohlwollen, an der Fahrlässigkeit im Umgang mit der künstlerischen Substanz scheiterte, wurde ein anderes Meisterwerk, nämlich Hawthornes Roman Der scharlachrote Buchstabe, über alle Maßen berühmt.
Auch hier also bleibt es unerklärlich, warum der eine Schriftsteller Erfolg hatte und der andere nicht. Das war so, das ist so, und das wird, fürchte ich, solange sich Zeitgenossenschaft geltend macht, immer so sein. Musil und Melville wären, da ihre Bücher unverkäuflich waren, verhungert, und doch haben sie die Voraussetzungslosigkeit ihrer Tätigkeit akzeptiert, anstatt sich einem lukrativen Broterwerb zuzuwenden. Dies wäre, nochmals gesagt, eine Forderung der praktischen Vernunft, und nach Maßgabe der reinen Vernunft ist der Wille zur Kunst sowieso eine Anomalie.
Aber der Künstler findet kein Genüge an der Vernunft. Er favorisiert, und dies bis zur Triebtäterschaft, die eigene Vorstellungswelt, und wer seine Haut als Poet, wie van Gogh als Maler, völlig ungeschützt und unaufgefordert und immer mit dem gleichen Risiko zu Markte trägt, der lässt mindestens drei Erfahrungshorizonte nicht außer Acht, die auch das Leben jedes anderen Menschen bestimmen, aber nicht zur erlösenden Selbstformulierung aufsteigen lassen. Erstens die sozialen gesellschaftspolitischen Verwicklungen, in die jeder von uns unauflösbar eingebunden ist; zweitens die durch keine gesellschaftliche Macht definierte oder verhängte existentielle Bedingung eines begrenzten Lebens; und drittens das unverwechselbar eigene und damit an sich ununterschiedene Ich.
Fehlt eine von diesen Erfahrungen, schrumpft die Totalität der poetischen Mitteilung. Wo die Erfahrung des Gesellschaftspolitischen fehlt oder nicht mit eingebracht wird, fehlt das soziale Gewissen, vor dem jede existentielle Bedürftigkeit zur metaphysischen Jammerei ausartet. Fehlt die existentielle Erfahrung, beginnt die soziale Frömmelei. Fehlt das Erlebnis des Ununterschiedenen am eigenen Ich, bleibt alles, was da geschrieben steht, zwar immer noch, auf die konkrete Welt bezogen, nachprüfbar, aber irritationslos.
Die Wissenschaften kennen diesen Zwang zur Selbstirritation nicht, ihnen ist der strikte Rationalismus das Hauptmittel zur Welterfahrung. Darum sind Politologen, Historiker, Germanisten sehr rasch geneigt, die irritierte Selbstentäußerung des Poeten als sinnloses Geraune abzutun. Und hier spätestens beginnt das Missverständnis zwischen Kunst und der Forderung nach striktem Rationalismus.
Der Historiker, der die Lebensumstände eines Landarztes um die Jahrhundertwende studieren will, kann über Kafkas willkürliche Prosastruktur nur den Kopf schütteln. Und ist es tatsächlich nötig, wenn man das Elend eines Handlungsreisenden beschreiben will, diesen vorher in einen Käfer zu verwandeln? Eine derartige Kunst bleibt völlig ungeeignet als Prämisse für die herkömmliche Gesellschaftsanalyse, da hier die »Unschärferelation«, eben das nicht überprüfbare subjektive Befinden Kafkas, mit unter die geschriebenen Zeilen geraten ist. Üblicherweise wird eine Öffentlichkeit, die nicht auf Kunst, sondern auf schlichte Klärung von Sachverhalten aus ist, damit spielend fertig. Man streicht den Erfahrungshorizont des Existentiellen und die Selbstbefindlichkeit des Schriftstellers und belässt es bei der Poetik, die eine Widerspiegelung der Wirklichkeit fordert.
Man rechnet die Widerspiegelungstheorie vor allem dem Marxismus zu. Aber ist das geläufige Verständnis von Kunst nicht auch sonst von dem Vorurteil geprägt, das künstlerische Schaffen sei vor allem und immer wieder ein Reflex auf Erfahrungen mit der Außenwelt?
Die Existenzphilosophie hat das Subjekt aus dieser Bevormundung herausgerissen und darauf verwiesen, dass sich einzelnes Dasein nicht in der Gelegenheit zur Erkenntnis erschöpft, dass Erkenntnisfähigkeit überhaupt keinen Grund für die Existenz des Menschen abgeben kann. Der Schriftsteller erfährt beim Schreiben nicht nur alles Objektive, also die Außenwelt, sondern auch sich selbst als ständigen Irrgarten und wird getrieben von der Sorge, darin nicht zu bestehen. Das kann auch gar nicht anders sein. Sonst wäre seine Poesie interpretierbar, auslotbar, der Unbestechlichkeit einer Analyse ausgeliefert. Kunst aber wirkt aus dem Unsichtbaren, sie gleicht einem Kreis, in dem sich jeder Deutungsversuch, wie das Endliche im Unendlichen, mühevoll, aber im Letzten ohne jede Bedeutung abarbeitet. Damit ist nicht gesagt, dass die Kunst sich ins Private, Unverbindliche zurückzieht. Sie wirkt gerade, wenn man sie in ihrem Geheimnis belässt, gesellschaftskritisch.
Schriftsteller, die sich ausschließlich gesellschaftskritisch motivieren lassen, unterwerfen sich einer nachprüfbaren Tendenz. Die Kunst aber hat ihre Wurzeln in den Untiefen der Subjektivität. Nach Nietzsche ist nur das Persönliche unerschöpflich, und dies ist ja auch die tröstliche Quadratur des Kreises aller Poesie: Sie lässt sich nur aus der Unverwechselbarkeit des Subjekts ins Allgemeine transformieren.
Auch die Kunst vermittelt Erkenntnisse, aber es ist eine ihrer Vorzüge, dass sie ihre Anschaulichkeit unangetastet lässt, und eines kann die Kunst ihrem Wesen nach nicht leisten: Eindeutigkeit. Sie ist entweder vieldeutig oder gar nicht. Die Wissenschaft findet ihre Phänomene vor, die Kunst muss sie sich erfinden, und die erste unter den Schwesterkünsten, die einer modernen Poetik Tür und Tor geöffnet hat, war die Malerei. Sie hat unter den drei Erfahrungshorizonten am konsequentesten auf das Unerlöste unserer Subjektverfasstheit verwiesen. »Denn das ›Ich‹ ist das größte und verschleiertste Geheimnis der Welt«5, diese Tagebucheintragung von Max Beckmann wirkt wie ein Motto zum aktuellen Seinsverständnis, und so sollte man, wenn man über die Belange des Poetischen redet, vor allem die Malerei zu Rate ziehen.
Die Malerei ist die anschaulichste aller Künste, was heißen soll: Wo in der Musik durch eine Anordnung unsichtbarer Töne, in der Literatur durch die Abstraktion des geschriebenen Wortes Assoziationen möglich gemacht werden, wirkt das gemalte Bild zunächst wie ein geschlossener Raum. Man sieht nur, was zu sehen ist, hier herrscht offenbar nicht die Freiheit, die dem Hörer einer, sagen wir, Schumannschen Klaviersonate durch die Form des Unanschaulichen gegeben ist. Niemand hindert mich daran, mit meinen Assoziationen hierhin und dorthin zu schweifen, auch in Bereiche, die der Stimmung des Dargebotenen widersprechen, und auch bei der Lektüre der Effi Briest von Fontane ist es jederzeit möglich, mittels der Abstraktion des geschriebenen Wortes eine eigene, ganz und gar ungebundene Empfindungswelt zur Kenntnis zu bringen. So verwandeln und bereichern sich die Schwesterkünste Musik und Literatur durch Assoziation, sie werden metamorphos, Rembrandts Mann mit dem Goldhelm dagegen bleibt, da er sich in seiner Anschaulichkeit nicht ändern kann, für den Betrachter immer nur der Mann mit dem Goldhelm.