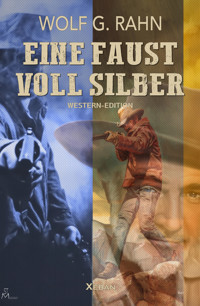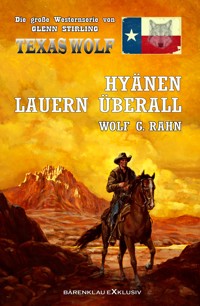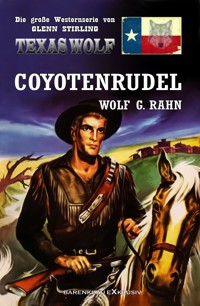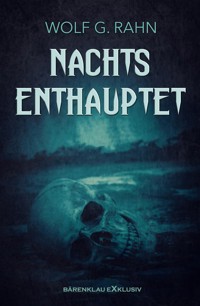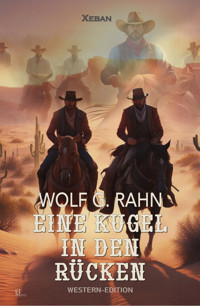
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nevis, der Halbindianer, rettet den Weißen Finchy uneigennützig vor den Indianern, bevor diese ihn skalpieren können und nimmt dankend dessen Freundschaft an. Doch schon an der nächsten gemeinsamen Station treffen Nevis erneut die Vorurteile gegenüber Halbindianern. Als er schließlich für einen Mord beschuldigt wird, schwindet seine Hoffnung auf Rettung innerhalb kürzester Zeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolf G. Rahn
Eine Kugel in den Rücken
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag
www.xebanverlag.de
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer, nach Motiven, 2024
Korrektorat: Sandra Vierbein
Dieser Roman erschien vormals in der Reihe Chaco.
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Eine Kugel in den Rücken
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Wolf G. Rahn
Das Buch
Nevis, der Halbindianer, rettet den Weißen Finchy uneigennützig vor den Indianern, bevor diese ihn skalpieren können und nimmt dankend dessen Freundschaft an. Doch schon an der nächsten gemeinsamen Station treffen Nevis erneut die Vorurteile gegenüber Halbindianern. Als er schließlich für einen Mord beschuldigt wird, schwindet seine Hoffnung auf Rettung innerhalb kürzester Zeit …
***
Eine Kugel in den Rücken
Western von Wolf G. Rahn
1. Kapitel
Er hatte einen langen Ritt hinter sich. Und eine Stadt, der er keine Träne nachweinte. Cadmore war eine Siedlung, in der das ungeschriebene Gesetz des Westens Gültigkeit hatte, dass nur der ein Mensch war, der sich nicht von der Norm unterschied. In Cadmore hatte man eine weiße oder eine rote Hautfarbe zu haben, am besten natürlich eine weiße, denn das waren unter den Menschen die besseren.
Aber Nevis war keins von beiden. Das Blut eines weißen Vaters und einer roten Mutter hatten sich in ihm vermischt, und es war sein Pech, dass man ihm das ansah.
Er schämte sich seiner Herkunft nicht, doch manchmal verfluchte er sie. Das passierte nicht dann, wenn ein paar Raufbolde Handel mit ihm suchten, um ihm seine Geringwertigkeit zu beweisen. Auch nicht dann, wenn man ihn einzig seiner Hautfarbe wegen zum Verbrecher stempelte. Nein, er fluchte immer dann, wenn sein Herz gekränkt wurde. Wenn er sich der schönen Illusion hingegeben hatte, auch einen winzigen Anspruch auf Zuneigung und Vertrauen zu haben, und zum hundertsten Mal bitter enttäuscht wurde.
Nevis, das Halbblut, hatte einen athletischen Körper, um den ihn so mancher Mann hätte beneiden können. Sein edles Gesicht mit den energischen, jedoch nicht harten Zügen, sein blauschwarzes Haar, das im Schein der untergehenden Sonne wie die Schwingen eines Raben glänzte, der kühne Oberlippenbart, das alles hätte eine Frau schon um den Verstand bringen können, doch kein Mann beneidete ihn, keine Frau vergaß sich so weit, einem Bastard Sympathie zu schenken.
Er hatte sich daran gewöhnt. Anfangs war er noch dem Irrtum erlegen, dass er die Menschen ändern könnte, dass er ihnen nur zu beweisen brauchte, dass er zu ihnen gehörte.
Aber durch seine Erfahrungen hatte er sehr schnell lernen müssen, dass die Menschen das gar nicht wollten. Die Weißen nicht und auch nicht die Roten. Er war ein Außenseiter und würde es ewig bleiben. So lange, bis es ihm eines Tages nicht mehr gelang, den auf ihn abgefeuerten Kugeln auszuweichen. Der Tag konnte schon morgen sein.
Nevis war müde und erschöpft. Er war weiter geritten, als er vorgehabt hatte. Es war nicht gut, sich so restlos zu verausgaben. Ein Mann in seiner Lage musste stets über ausreichende Kraftreserven verfügen, um einem unerwarteten Angriff erfolgreich begegnen zu können. Aber er hatte so weit wie möglich von Cadmore fortgewollt. Soweit es ging, fort von der zauberhaften, eiskalten Cecile …
Er suchte sich ein Lager in einer leichten Talsenke. Dort wurde sein Feuer nicht schon von weitem gesehen und sein wertvoller Morgan-Hengst konnte in Ruhe grasen, ohne einen zufälligen Pferdedieb auf dumme Gedanken zu bringen.
Nevis wusste, dass er sich auf Indianergebiet befand. Aber das besorgte ihn nicht. Für ihn war jede Begegnung, gleich welcher Art, ein Risiko.
Er schlief einige Stunden fest und wachte erfrischt und gestärkt auf.
An dem kleinen, aber sauberen Tümpel in der Nähe versorgte er seinen Rappen und wusch sich. Dann setzte er seinen Ritt fort.
Er hatte kaum die Talsenke verlassen, als seine Augen zu schmalen Schlitzen wurden. Er sah etwas, was ihm die Galle durcheinanderbrachte.
Eine Horde von Indianern, die keine Kriegsbemalung trugen, verfolgten einen Mann, der sich kaum noch im Sattel halten konnte. Nevis zählte sechs Rote, die alle für die Jagd bewaffnet waren.
Der Flüchtige dagegen trug dem Anschein nach weder ein Gewehr noch sonst ein Schießeisen bei sich. Er war seinen Verfolgern wehrlos ausgeliefert.
Das war der Grund, warum Nevis wieder mal seinem Grundsatz untreu wurde, sich nicht in die Angelegenheiten fremder Leute einzumischen. Schon so oft hatte er dabei draufgezahlt, doch wenn er eins auf den Tod nicht ausstehen konnte, dann war das ein ungleichgewichtiger Kampf. Das brachte sein Blut zum Kochen und in dieser Gegend hatte es häufig Gelegenheit zum Kochen.
Die Horde hatte Nevis noch nicht entdeckt. Sie schickte sich an, den Weißen einzukreisen. Die ersten Schüsse peitschten durch den jungen Morgen. Das Pferd des Verfolgten scheute. Es bäumte sich auf und versuchte, seinen Reiter abzuwerfen.
Dessen Kräfte reichten nicht mehr aus, den Kampf mit dem Tier aufzunehmen. Er glitt aus dem Sattel und im Nu waren die Rothäute heran.
Nun hielt es Nevis nicht länger an seinem Platz. Mit einem leichten Schlag trieb er seinen Morgan-Hengst an und dieser schoss gehorsam vorwärts.
Nevis zog seine Winchester aus dem Scabbard. Zwar war die Entfernung noch zu groß, um einen der Indianer treffen zu können, aber das hatte er auch gar nicht im Sinn. Er wollte keinen Menschen töten, wenn er noch eine andere Möglichkeit sah. Zudem wusste er noch gar nicht die Hintergründe für die ungleiche Verfolgungsjagd.
Er gab zwei Schüsse in die Luft ab und hielt genau auf die Gruppe zu.
Die Indianer stutzten, als sie ihn sahen. Einige von ihnen erwarteten ihn mit angelegten Gewehren. Doch dann überlegten sie sich die Sache anscheinend anders, denn sie machten plötzlich kehrt, schickten ein drohendes Geheul zu ihm herüber und verschwanden in einer langsam kleiner werdenden Staubwolke. Ihr Opfer ließen sie zurück.
Nevis’ Überzeugung verstärkte sich, dass die Roten kein gutes Gewissen gehabt hatten, denn wären sie von ihrem Recht überzeugt gewesen, hätten sie sich kaum von einem einzelnen Reiter verjagen lassen. Noch dazu auf ihrem eigenen Gebiet.
Der Mann war inzwischen aufgestanden. Er hatte die Hand über die Augen gelegt und blickte Nevis gegen die noch tiefstehende Sonne entgegen. Sein Gesicht zeigte einen maßlos überraschten Ausdruck.
»Bist du allein?«, fragte er ungläubig, als das Halbblut neben ihm aus dem Sattel sprang.
»Mein Pferd ist bei mir«, gab Nevis zurück.
»Das meine ich nicht«, sagte der Mann. Aus der Nähe sah er noch erschöpfter aus. Seine kupferroten Haare hingen ihm wirr in die Augen. Er trug keinen Hut und seine Kleidung sah ziemlich verwahrlost aus. Die Weste war kaum noch als solche zu erkennen. »Ich will sagen, wo sind deine Freunde?«
»Freunde?«, Nevis zog das Wort über die Zunge, als begriff er seinen Sinn nicht. »Sehe ich aus, als ob ich Freunde hätte?«
Der Rothaarige sah ihn genauer an. Dann huschte ein flüchtiges Grinsen über sein schmutziges Gesicht.
»Nein, Rothaut, so siehst du tatsächlich nicht aus. Da muss ich ja noch dankbar sein, dass mich Mutter Natur nur mit roten Haaren gestraft hat. Die sind immer noch besser als eine rote Haut.«
»Hast du eine Lieblingsfarbe?«, wollte Nevis wissen.
»Ich für mein Teil bevorzuge die weiße«, gab der Fremde zu. »Da ist man wenigstens vor Überraschungen sicher.«
»Ist man das?«, zweifelte Nevis.
»Diese roten Burschen eben sind jedenfalls nicht das, was ich mir jeden Morgen zum Frühstück wünsche.«
»Was war der Grund?«
»Ich hatte drüben in Hamstey einen Job. Aber der Rancher hatte Pech. Seine Rinder wurden von einer Krankheit befallen, und er musste schließlich alles verkaufen. Der neue Boss brachte seine eigene Mannschaft mit. Er konnte mich nicht mehr brauchen. Aber ich bin froh deswegen, denn es waren ziemlich üble Burschen. Gut auf der Weide, aber noch viel besser am Whiskyglas oder mit dem Schießeisen. Sie gingen keinem Streit aus dem Weg. Das ist nichts für den alten Finchy.«
»Und weiter?«
»Ich ritt also los, um mir einen neuen Job zu suchen. Und ich hätte wahrscheinlich schon längst einen, wenn mich nicht gestern die roten Teufel in ihre Finger gekriegt hätten. Sie nahmen mir alles ab, was ich bei mir trug und hatten für heute noch Schlimmeres mit mir vor. Aber glücklicherweise gelang es mir, in der Nacht abzuhauen.«
»Aber offenbar nicht unbemerkt.«
»Ganz und gar nicht. Die Kerle veranstalteten eine regelrechte Jagd auf mich, und alles Weitere hast du ja selbst miterlebt.«
»Es ist leichtsinnig, allein durch Indianergebiet zu reiten«, sagte Nevis. »Das Land gehört den Yemi-Sioux.«
»Es waren keine Yemi«, widersprach der rote Finchy. »Sie gehörten zum Stamm der Palshu.«
»Die auf fremdem Boden jagen«, ergänzte Nevis. »Das erklärt, warum sie sich so ohne weiteres vertreiben ließen. Was wirst du jetzt anfangen?«
»Ich sehe zu, dass ich schnellstens nach Garrystown komme. Dort finde ich bestimmt einen Job …«
»Ganz ohne Schießeisen lebt es sich ziemlich unsicher«, sagte Nevis grinsend und zeigte auf die leere Hüfte des Rotschopfes. »Besonders unter Indianern.«
»Du hast nicht zufällig denselben Weg?«
Das Halbblut sah den anderen forschend an. Normalerweise ritt er lieber allein. Da war er sicher, dass ihm niemand in den Rücken schoss. Aber was hätte es für einen Sinn gehabt, Finchy vor den Palshu zu retten, wenn er ihn jetzt unbewaffnet weiterschickte?
»Es ist gleich, ob ich nach Garrystown oder anderswo hinreite«, sagte er. »Ich finde doch überall dasselbe.«
»Danke. Wie heißt du eigentlich?«
»Nevis.«
»Verrückter Name. Verrückt wie dein Vater. Wie konnte er nur?«
Nevis hatte keine Lust, mit dem anderen über seine Familie zu philosophieren. Er stieg in den Sattel und brachte Finchys Pferd zurück.
Dann ritten sie nebeneinander weiter …
2. Kapitel
Gegen Mittag erreichten sie die erste Ranch von Garrystown.
»Von hier aus versuche ich allein mein Glück«, erklärte Finchy. »Wenn die Rancher mich mit dir zusammen sehen, jagen sie mich sowieso gleich davon.«
»Das täte mir leid«, meinte Nevis sarkastisch.
»Du solltest dir lieber selbst leidtun. Wünsche dir, dass du in Ruhe deinen Whisky trinken kannst, bevor du weiterreitest.«
»Das ist schon mehr, als ich erwarten kann«, sagte Nevis und überließ Finchy seinem Schicksal.
Die Stadt lag in träger Mittagshitze. Auf der Main Street räkelten sich ein paar Hunde. Vor dem Saloon lag ein Mann, den Hut so weit ins Gesicht geschoben, dass man nur die Ohren erkennen konnte, und schlief seinen frühen Rausch aus. Ein paar Häuser weiter spielte eine Gruppe von Kindern Banküberfall. Sie drückten sich scheu gegen die Hauswand, als Nevis vorüberritt, und feixten anschließend mutig hinter ihm her.
Vor dem Hotel hielt er. Es machte einen verwahrlosten Eindruck, aber Nevis war nicht verwöhnt. Die besseren Häuser hatten für ihn ohnehin keinen Platz.
»Du brauchst erst gar nicht abzusteigen, Roter«, empfing ihn eine schnarrende Stimme vom Fenster her. »Deinesgleichen bringt doch nur Ungeziefer in die Betten.«
Der Mann, der diese Nevis bereits bekannte Behauptung aufstellte, trug eine speckige Mütze auf seiner Glatze und war auch sonst gerade so sauber, dass er nicht am Fensterbalken kleben blieb.
»Sind Sie der Besitzer dieser Prachtstätte der Gastlichkeit?«
»Was dagegen?«
»Noch nicht. Erst, wenn Sie bei Ihrer Weigerung, mir ein Zimmer zu geben, bleiben, werde ich anfangen, mir zu wünschen, dass Sie der Teufel holen möchte.«
»Werde nicht unverschämt, Roter«, fauchte der Glatzköpfige. »Mit solchen Burschen wie dir machen wir hier in Garrystown kurzen Prozess.«
»Nicht nur hier, Mister«, erläuterte Nevis bereitwillig. »Nicht nur hier. Auch andere Städte in Wyoming sind voller überheblicher Narren.«
Der Mann am Fenster schnappte nach Luft. Seine kleinen Schweinsaugen traten gerade so weit vor, dass sie nicht auf die Straße rollten. Er schlug das Fenster empört zu und verschwand dahinter. Aber nur, um kurze Zeit später unter der Tür aufzutauchen.
Erst jetzt sah Nevis, dass der Glatzköpfige ein Mann von fast sieben Fuß war. Sein Genick hätte jedem Stier zur Ehre gereicht, und seine Arme mussten eine Kraft besitzen, dass er sie lieber nicht zum Gläserspülen benutzen sollte.
Um seinen prächtigen Eindruck noch zu unterstreichen, hielt er ein Gewehr mit einem ellenlangen Lauf in der Hand, dass er drohend dem Halbblut entgegenschwenkte.