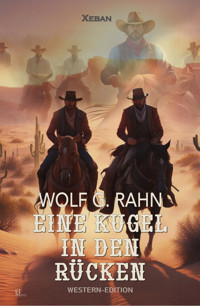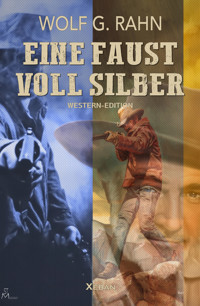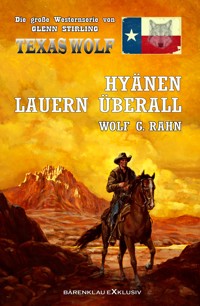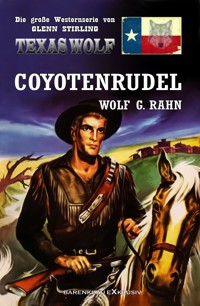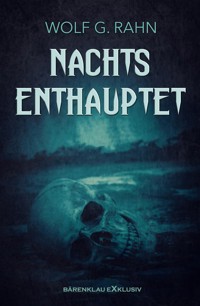3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Immer wieder verschwinden Menschen in den Höhlen des Kitos-Gebirges spurlos, auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz der Gnosser. Auf ihm soll ein Fluch liegen. Jeder, der sich auf die Suche begibt, bezahlt seine Gier mit dem Leben. Nur Wenige glauben daran. Jedoch kommt keiner zurück.
Acht Männer, die in ihrem Wesen nicht unterschiedlicher sein können, bekommen den Auftrag die Vermissten zu suchen. Kaum einer traut dem anderen. Nur die beiden Freunde, Roger Grey und Wu O’Ying, arbeiten wirklich zusammen. Doch richtige Feindschaft gibt es unter den Männern nicht. – Bis der Vater des Fluches erwacht und das Grauen seinen Anfang nimmt.
Plötzlich geschehen die grausamsten Dinge, Menschen stürzen sich grundlos in den Tod oder verschwinden einfach und werden nicht mehr gesehen. Finden die beiden Freunde noch rechtzeitig die Ursache für alles Geschehene, bevor auch der Letzte vom Tod geholt wird oder verfallen auch sie der Gier nach Reichtum?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolf G. Rahn
Vater des Fluches
Unheimlicher Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kathrin Peschel nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Vater des Fluches
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Eine kleine Auswahl der von Wolf G. Rahn veröffentlichten unheimlichen Romane und Grusel-Krimis
Das Buch
Immer wieder verschwinden Menschen in den Höhlen des Kitos-Gebirges spurlos, auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz der Gnosser. Auf ihm soll ein Fluch liegen. Jeder, der sich auf die Suche begibt, bezahlt seine Gier mit dem Leben. Nur Wenige glauben daran. Jedoch kommt keiner zurück.
Acht Männer, die in ihrem Wesen nicht unterschiedlicher sein können, bekommen den Auftrag die Vermissten zu suchen. Kaum einer traut dem anderen. Nur die beiden Freunde, Roger Grey und Wu O’Ying, arbeiten wirklich zusammen. Doch richtige Feindschaft gibt es unter den Männern nicht. – Bis der Vater des Fluches erwacht und das Grauen seinen Anfang nimmt.
Plötzlich geschehen die grausamsten Dinge, Menschen stürzen sich grundlos in den Tod oder verschwinden einfach und werden nicht mehr gesehen. Finden die beiden Freunde noch rechtzeitig die Ursache für alles Geschehene, bevor auch der Letzte vom Tod geholt wird oder verfallen auch sie der Gier nach Reichtum?
***
Vater des Fluches
Unheimlicher Roman von Wolf G. Rahn
1. Kapitel
Die Touristen kreischten erschrocken auf. Die zischende Schlange, die ihnen unerwartet entgegenzuckte, flößte ihnen ein Gefühl von Grauen und Ekel ein. Sie begriffen nicht, dass der Fakir beinahe zärtlich, auf alle Fälle aber respektvoll mit ihr umging. „Bei uns in den Staaten“, erklärte ein beleibter Amerikaner stolz, „bringt man solche Scheusale um. Hier werden sie anscheinend verehrt. Die Asiaten sind ein merkwürdiges Volk. Reichlich primitiv. Komm, Darling! Wir müssen noch den Tempel besuchen. Der Bus fährt in fünfzehn Minuten weiter.“
Er zog eine mit Schmuck behangene, doppelbekinnte Lady mit sich fort, die verzweifelt mit der Tücke ihres Fotoapparates kämpfte, um den Schlangenbeschwörer zur Erinnerung im Bild festzuhalten.
Der Fakir versteckte sein Gesicht unter der Kutte. Seine Augen funkelten höhnisch, als er die Kobra mit sicherem Griff packte und in den runden Korb zurückzwang. Er bedeckte den Behälter wieder mit dem schwarzen Tuch, erhob sich geschmeidig, nahm den Korb und ging damit davon.
Sein Gesicht war starr wie eine Maske. Lediglich die Mundwinkel zuckten ein wenig.
*
Er verließ den öffentlichen Platz vor dem Tempel und wandte sich einer dunklen Gasse zu, die vom Touristenstrom unbeachtet war. Er verschwand in einem Hauseingang, in dem es abscheulich nach allen möglichen Abfällen roch. Den Fakir schien das nicht zu stören.
Er eilte ein paar Stufen hinauf und befand sich danach in einem abgedunkelten Raum, in dem lediglich ein paar Kerzen flackerten.
Er stellte den Korb auf den Boden und ließ sich davor nieder. Aus der Kutte zog er eine kleine Bambusflöte, auf der er eigenartig disharmonisch zu spielen begann.
Es dauerte nicht lange, da bewegte sich der Korb, das Tuch hob sich, und die Brillenschlange züngelte heraus.
Der Fakir setzte die Flöte ab. Sein Gesicht nahm einen schwärmerischen Ausdruck an, als er hauchte: „Du hast mir ein Zeichen gegeben, Vater des Fluchs. Hast du einen Befehl für mich?“
Eine grelle Stichflamme schoss aus dem Korb. Die Schlange wuchs in riesenhaften Dimensionen daraus hervor. Im nächsten Moment verpuffte sie, und dafür stand eine düstere, unheimliche Gestalt vor dem Hockenden, der nur kurz zusammenzuckte.
Die Augen des Geistes glühten. Er stieß mit verkrümmten Fingern gegen seinen Diener vor und umklammerte dessen Hals. Der Fakir wagte kaum zu atmen.
„Ja, ich habe einen Befehl“, kam es krächzend. „Es ist ein wichtiger Auftrag, für dessen Zweck ich dich mit großer Macht und Ansehen ausstatten werde. Du wirst ein anderer werden, als du jetzt bist. Wie würde dir die Rolle eines anerkannten Wissenschaftlers gefallen?“
Der Fakir, der noch immer in der knöchernen Klammer hing, zeigte ein gieriges Lächeln. „Werde ich auch reich sein, Meister?“, wollte er wissen.
„Reich an Geist und Gütern.“
„Was habe ich zu tun?“
Der Geist löste seine Finger. „Komm mit mir, dann werde ich es dir offenbaren.“
Wieder blitzte eine Stichflamme auf. Sie erfasste nicht nur den Geist, sondern auch den Fakir. Beide verschmolzen ineinander und bildeten züngelnde, leckende Flammen, die laufend ihre Farben wechselten.
Sekunden später erloschen die Flammen. Statt ihrer wanden sich zwei Schlangen am Boden, eine große und eine kleinere. Die kleinere wollte vor der anderen zurückweichen, doch diese zuckte bereits mit aufgerissenem Rachen auf sie zu und verschlang sie. Träge kroch sie in den Korb zurück, und nach einem weiteren Blitz war der ganze Spuk verschwunden.
2. Kapitel
Die Laterne, die der einsame Mann trug, warf zitternde Schatten, auf die ihn umgebenden Felswände. Sie formten sich zu eigenartigen Gebilden, doch der Mann achtete nicht auf ihre Zeichen. Er hastete vorwärts. Etwas trieb ihn. Es war das Gefühl, bald am Ziel zu sein.
Seine Schritte klangen gespenstisch in dem riesigen Gewölbe, das kein Ende nehmen wollte. Er hatte sich den Weg gut gemerkt und immer wieder sorgfältige Eintragungen in einem kleinen Notizbuch vorgenommen. Er konnte den Rückweg nicht verfehlen. Das allerdings wäre sein Tod gewesen.
Keith Hennick verharrte. Seit Stunden befand er sich nun bereits in diesen Gängen, die seit Jahrhunderten keines Menschen Fuß mehr betreten hatte. Er war der Erste, und seine Funde würden die Welt in Aufruhr versetzen, dessen war er sicher.
Er hob die Laterne. Er hatte sich eingebildet, entfernte Stimmen zu hören, doch das war natürlich Unsinn. Niemand konnte hier unten leben, ja, man hatte auch ihn eindringlich vor diesem Unternehmen gewarnt, doch er war nicht der Mann, der sich vor der Einsamkeit fürchtete.
Da war wieder dieses unerklärliche Wispern. Vermutlich entstand es durch irgendwelche Luftbewegungen, die sich an Felskanten brachen, durch Gänge und Kamine getrieben wurden und schließlich wie in einer gewaltigen Orgelpfeife hörbar wurden. Kein Grund, sich zu entsetzen.
Er setzte seinen Weg fort. Das Wispern begleitete ihn unaufhörlich. Die kleine Flamme in seiner Laterne flackerte heftig, als wollte sie verlöschen.
Keith Hennick stellte sie auf den Boden, um den Docht etwas höher zu drehen.
Er stutzte.
Nur drei Schritte vor ihm blitzte etwas auf. Es war, als würde ihn ein Auge aus dem Fels anstarren.
Er holte tief Luft und zwang sich weiterzugehen. Natürlich wuchsen keine Augen im toten Gestein. Er war nicht so närrisch, das für möglich zu halten. Es konnte sich nur um einen glitzernden Stein oder um etwas Metallenes handeln.
Als er näherkam, konnte er nichts mehr entdecken, so gewissenhaft er auch suchte. Dafür schwoll das Wispern an, und es wurde zu einem Gelächter, das das ganze unterirdische Gewölbe füllte.
Keith hielt sich entsetzt die Ohren zu. Etwas Vergleichbares hatte er noch nie vernommen. Die Laterne fiel zu Boden. Ihr Glas zerbrach, das Petroleum lief aus und entzündete sich.
Der Mann wollte retten, was noch zu retten war, doch als er in die rötlichen Flammen starrte, zuckte er abermals zurück. In dem Feuer sah er ein Gesicht. Es gehörte ihm selbst. Er blickte wie in einen Spiegel, und doch war es eine Täuschung.
Das Flammenbild zerfloss. Es blieb nichts als ein wenig Rauch.
Da verlor Keith zum ersten Mal die Fassung. Er griff sich ans Herz und stammelte: „Ich werde diese Höhle nie mehr verlassen. So wie mein Flammenbild werde auch ich selbst vergehen. Ich muss sterben.“
Seine Beine versagten ihm den Dienst. Langsam glitt er zu Boden. Er fiel dorthin, wo sich eben noch das Feuer befunden hatte. Die Stelle war eiskalt.
Das gespenstische Gelächter ebbte ab, nur das Wispern um ihn her blieb. Es hüllte ihn ein und legte sich auf seine Stimme. Es drang in ihn ein und befahl ihm, sich wieder zu erheben, um den unausweichlichen Gang anzutreten.
3. Kapitel
Die Laterne war zerbrochen, aber seltsamerweise brauchte er sie nun nicht mehr. Um ihn her war ein eigenartiges Licht, das aus den Felsen quoll und ihn einen Weg leitete, den er gar nicht hatte einschlagen wollen.
Keith Hennick sträubte sich anfangs dagegen. Er erinnerte sich, dass er hier war, um ungeahnte Schätze aus längst versunkenen Epochen aufzuspüren. Viele flüsterten hinter verborgener Hand davon, manche sprachen ihre Vermutung auch laut aus, doch gewagt, den Reichtum zu heben, hatte seines Wissens vor ihm noch keiner. Er wollte es tun, doch nun lief er, bar jeden eigenen Willens und achtete nicht mehr auf die Richtung, die er als einzig erfolgversprechende erkannt hatte.
Längst war er von diesem Pfad abgewichen. Er befand sich in einem Teil dieses stummen Labyrinths, von dessen Existenz er nichts geahnt hatte, und doch bewegte er sich ganz selbstverständlich darin.
Sein Gesicht war verschlossen. Es verriet nichts über die Gedanken, die hinter seiner Stirn arbeiteten.
Das war kein Wunder, denn es gab dort keine Gedanken. Sein Gehirn war völlig leer. Es gehorchte willenlos einem Befehl, der unsichtbar auf ihn eindrang und ins Verderben lockte.
Der Mann nahm das Wispern längst nicht mehr wahr. Es gehörte zu diesem Gewölbe wie das ihn umflutende Licht und der Sog, der ihn vorwärtspeitschte.
Doch plötzlich kehrte das Bewusstsein in ihn zurück. Laut und vernehmbar hörte er Schritte. Anfangs glaubte er, dass es sich um sein eigenes Echo handelte, doch der Klang brach auch nicht ab, als er stehenblieb und lauschte.
In nicht allzu großer Entfernung musste sich jemand in ähnlicher Weise wie er selbst bewegen. Keith Hennick zögerte. Er überlegte, ob er den Fremden als Konkurrenz betrachten musste, als einen, der hier war, ihn um den alleinigen Ruhm zu bringen.
Doch dann siegte die Vernunft und er begriff, dass er keineswegs das Recht gepachtet hatte, den Hort allein zu plündern. Ja, wahrscheinlich würde er das ohne Hilfe gar nicht schaffen. So überkam ihn eine große Freude, dass er endlich auf einen Menschen stieß, mit dem er sich unterhalten konnte. Vielleicht nicht in seiner eigenen Sprache, doch er beherrschte viele Sprachen und würde sich auf irgendeine Weise verständigen können.
Die schlurfenden Schritte entfernten sich. Er musste sich beeilen, wollte er den Anschluss nicht verlieren.
„Holla!“, rief er aufgeregt. „Warten Sie, wer auch immer Sie sein mögen.“
Doch die Schritte stockten nicht. Sie schlurften weiter, und Keith Hennick wurde von einer panischen Angst gepackt, dass er plötzlich wieder allein sein würde.
Er setzte sich in Bewegung und geriet ins Stolpern. Entgegen aller Gewohnheit fluchte er. Er rannte gegen die Felsen und schrammte sich die Stirn auf. Er fühlte den brennenden Schmerz, doch viel stärker brannte die Sorge, es nicht zu schaffen.
„So warten Sie doch!“, rief er keuchend. „Ich bin ein Freund.“ Er versuchte es in allen Sprachen und Dialekten, deren er mächtig war, doch der Unbekannte ließ sich durch keine noch so eindringliche Beschwörung aufhalten.
Keith packte die Wut. Wenn der andere glaubte, unbedingt vor ihm bei dem Schatz sein zu müssen, dann sollte er sich gewaltig irren. Da hatte er schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Auch er trieb sich nicht seit Wochen in der abgeschiedenen Bergwelt herum, um hinterher das Nachsehen zu haben. Wenn es auf einen Wettlauf hinauslief, war er dabei. So viel Kraft besaß er noch allemal.
Er begann zu rennen und blieb nur hin und wieder stehen, um sich zu orientieren, aus welcher Richtung die Schritte klangen. Unbändiger Zorn schüttelte ihn, denn er fühlte sich genarrt. Mal waren die Geräusche fast zum Greifen nah, dann tönten sie wieder aus so weiter Entfernung, als trennten sie mehrere Meilen.
Natürlich waren das akustische Täuschungen. Hier unten in dem heillosen Wirrwarr von Gängen und Spalten, von Hallen und Nischen wurden Geräusche unkontrollierbar verschluckt oder verstärkt. Sie gehorchten keinen physikalischen Gesetzen mehr.
Keiths Herz schlug bis zum Hals. Er hatte sich schon ziemlich verausgabt und musste fürchten, dieses Tempo nicht mehr lange durchzustehen. Er war gezwungen, eine Pause einzulegen. Längst war ihm klar, dass der andere wesentlich jünger sein musste.
Schwer atmend lehnte er sich gegen eine der kühlen Felswände, die in den letzten Tagen seine Heimat gewesen waren. Das Blut tobte in seinen Schläfen. Ihm war schwindlig. Er hätte sich am liebsten fallen lassen, um auszuruhen, doch dann war der Unbekannte verschwunden. Er würde ihn nie wieder finden.
Der Mann strich sich müde über die Augen. Dann riss er sie weit auf. Das war doch ausgeschlossen!
Durch den Gang, der sich vor ihm erstreckte, schlich ein gebeugter Greis. Er war in ärmliche Lumpen gehüllt. Sein schulterlanges Haar war weiß und ebenso sein zerzauster Bart, der seine Brust bedeckte. Er schleifte etwas hinter sich her. Dem Klang nach mochten es Ketten sein. Schwere Ketten, die an seine Gelenke geschmiedet waren.
Keith Hennick schüttelte sich. Kein Zweifel! Er musste phantasieren. Die Erschöpfung hatte ihn so mitgenommen, dass ihn abenteuerliche Visionen überfielen. Er schloss die Augen und sagte sich, dass der Spuk vorüber war, wenn er sie wieder öffnete.
Doch er irrte sich. Der Greis wandte sich nun sogar zu ihm um und war über seine Gegenwart nicht im Geringsten überrascht.
Seine tiefliegenden, dunklen Augen waren in dem bleichen, von Falten durchfurchten Gesicht gut zu erkennen. Wie zwei Kohlestückchen im Kopf eines Schneemannes wirkten sie. Nur nicht so fröhlich, sondern von unendlichem Schmerz gezeichnet.
Nun hob er die rechte Hand und winkte Keith zu sich heran. Tatsächlich, es waren abgerissene Ketten, die an seinen Gelenken baumelten. Sie schwangen hin und her wie die Pendel einer Uhr, die eine grauenvolle Zeit maß.
Keith fragte nicht mehr nach Logik. Er musste der Aufforderung Folge leisten, ob er wollte oder nicht.
Müde erhob er sich, und er musste feststellen, dass seine eigenen Bewegungen kaum frischer waren als die des Greises.