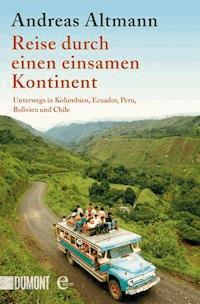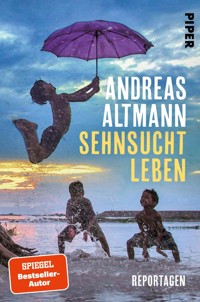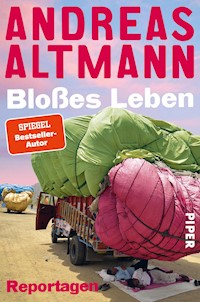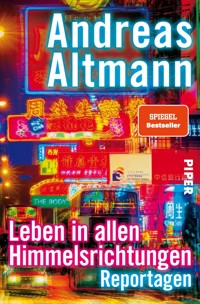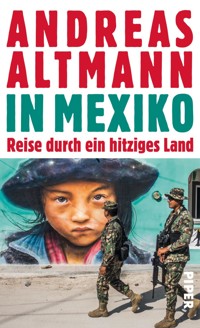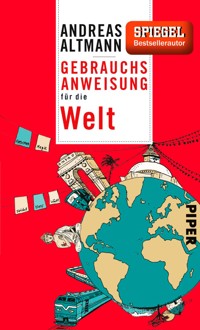7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann hat sich in Paris in den Zug gesetzt. Als er nach sechzig Tagen wieder dort ankommt, ist er auf allen Kontinenten gewesen, hat er sich abseits der großen Verkehrsadern rund um den Globus bewegt und die Welt mitgebracht. Altmann ist ein rastloser Reisender, und doch hat er mehr gesehen als viele vor ihm. Ob im Gewühl der Medina von Tunis, ob im altersschwachen Zug nach Varanasi, ob in der todessüchtigen Kokainmetropole Medellín – überall trifft Altmann auf Menschen. Er bringt sie alle zum Reden, selbst den taubstummen Junkie, mit dem er zu einer tollkühnen Motorradfahrt durch Vietnam aufbricht. Hier schreibt ein Reisender ohne Webcam und Handy, einer der hinschaut, einer der hinhört. «Wenn es ihn noch nirgendwo gibt, den einst von Egon Erwin Kisch verkörperten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Andreas Altmann
Einmal rundherum
Geschichten einer Weltreise
Für Silvana, das Mädchen aus dem Märchen
Für Stefan, den unverwandt Treuen
Birger Sellin
«Den Festlandmenschen Botschaften senden.»
Bruce Chatwin
«Meine Nationalität ist die eine Sache, aber mein Arsch ist international.»
Roland Topor
«Mir ist die Welt lieber als eine Beschreibung von ihr.»
Eins
Drei Ecken von meiner Pariser Wohnung entfernt haust ein Clochard. Wir kennen uns seit Jahren und er begriff rasch, dass ich ein schlechter Mensch bin. Denn jedes Mal, wenn er die Hand ausstreckt, muss er mir eine Geschichte erzählen. Erst dann bin ich bereit, mich von ein paar Francs zu trennen. Das folgende Märchen ist das Beste, was Thierry bisher produziert hat. Ausnahmsweise gab es dafür einen Schein:
Zwei Brüder begeben sich auf eine Weltreise. Eines Tages reist einer von ihnen ein Stück voraus und erreicht eine Stadt. Er fragt den Mann am Tor: «Wie sind die Leute hier?» Und der Alte fragt zurück: «Wie waren sie denn in der Stadt, aus der du kommst?» – «Nun, sie waren freundlich, redlich und hilfsbereit.» Da sagt der Alte: «Gut, so wirst du auch hier Freundliche, Redliche und Hilfsbereite finden.» Tage später kommt der andere Bruder, auch er fragt den Wächter: «Wie sind sie hier, die Menschen?» Der Alte stellt die gleiche Frage: «Wie waren sie in der Stadt, aus der du kommst?» Und der Bruder: «Sie waren bösartig, hinterlistig und faul.» – «Nun, so wirst du Frauen und Männer antreffen, die bösartig, hinterlistig und faul sind.»
Wir sitzen im Schnellzug, Richtung Süden. Neben mir Uli Reinhardt, der Fotograf, er übernimmt die Rolle des ersten Bruders, er trifft seit langem die Freundlichen und Geduldigen. Er kann das, er ist selber freundlich und geduldig. Ich bin der andere Bruder. Ich schaue zum Fenster hinaus und bilde mir ein, meine rechte Schuhsohle zu riechen. Dreißig Meter vor Erreichen des Bahnhofs trat ich in eine «déjection canine», so der offizielle Name für die Haufen «hündischer Absonderung», von denen täglich sechzehn Tonnen auf die französische Hauptstadt niedergehen. Als ich anschließend – mit Rucksack bepackt und auf einem Bein balancierend – die Sohle reinigte, wurde mir wieder klar, dass die Erde umrunden ein Traum ist und hundsgemeinen Stress verspricht. Von Anfang an.
So mancher Reisende kennt das Gefühl: wie begehrenswert seine Stadt plötzlich aussieht, wenn er sie verlässt. Dankbarkeit und Anhänglichkeit brechen aus. Ich sehe einen jungen Kerl – keine zehn Meter vom Zugfenster entfernt – seiner Freundin durchs Haar streichen. Und will mir einbilden, die zwei und die lausige Caféterrasse, auf der sie so nahe nebeneinander sitzen, gehören zum Bestaussehenden, was die Welt augenblicklich zu bieten hat. «Es gibt nur ein auserwähltes Volk», hat der englische Schriftsteller Graham Greene einmal behauptet, «ebenjenes, das in Paris lebt.»
Nach viereinhalb Stunden Ankunft in Marseille, zweitgrößte Stadt des Landes, größter Hafen. Seit Jahrhunderten schwemmen hier alle diejenigen an, die auch zu den Auserwählten gehören wollen. Und seit Jahrhunderten fegt der trockene, kalte Mistral durch die Straßen.
Auf dem Bahnhofsvorplatz rammeln zwei Hunde unter einem mittelmeerblauen Himmel, ein Hautkranker zerrt an meinem Ärmel und will Geld für seine kranke Haut, ein Mann fotografiert eine Frau, sie sagt: «Qu’estce qu’elle est belle, la France», mein Gott, wie schön ist Frankreich. Zwei Häuserwände weiter hängt ein feuerrotes Plakat: «Sicher waren Sie mal Anarchist in Ihrer Jugend? Nehmen Sie eine Spritze, um sich daran zu erinnern!»
Wer in Marseille bestehen, wer hier ein anderes Leben anfangen will, der muss jung sein, um auszuhalten, was ihm zugemutet wird. Seit langem hat man sich vor Ort darauf geeinigt, dass immer die Neuen als Sündenböcke herhalten müssen. Taugten dazu einst die Italiener, so haben seit zwei Generationen die Nordafrikaner aus den ehemaligen Kolonien die Rolle übernommen. «Interdit aux Arabes», verboten für Araber, hat jemand in eine Bank geritzt.
Rückblende, zehn Jahre: Ich war schon einmal in Marseille, recherchierte für eine Reportage über Jean-Marie Le Pen, den Parteivorsitzenden des ultrarechten Front National. An einem Montagmorgen war ich mit Abdelkadar verabredet. Er arbeitete als Arzt in einem Krankenhaus der Stadt. Wir hatten uns in Algerien, seiner Heimat, kennen gelernt. Ohne zu zögern, war er auf meinen Vorschlag eingegangen, uns beim Rekrutierungsbüro der Fremdenlegion vorzustellen. Hier in Marseille. Nicht als Arzt und als Reporter, nein, als arbeitslose Haudegen, die einen Job suchten. Ich verstand das Unternehmen als Test, ob ich doch noch einen Ort fände, an dem alle gleich behandelt würden. Diese Söldnerbande, hieß es, nähme jeden. Ohne Rücksicht auf die Visage.
Wir gingen hinunter zum Fort St.-Nicolas am Alten Hafen. «La Légion Etrangère» stand da und «Recrutement – jour et nuit». Wir stellten uns als zwei Versager im bürgerlichen Leben vor. Nun hätten wir Lust auf Abenteuer, auf ein Männerdasein, auf Kameradschaft. Dem Dienst habenden Offizier gefiel das, fest blickte er mich an: «Sie gehören der weißen Rasse an, dafür haben wir grundsätzlich Verwendung.» Mit Abdelkadar gab es Schwierigkeiten. Siebzig Prozent der freien Stellen waren für Weiße reserviert.
Während der Offizier mit der «Kommandantur» telefonierte, um nachzufragen, ob noch an einem Araber Bedarf bestünde, lächelten Abdelkadar und ich uns an. Er hatte die Wette verloren, er schuldete mir ein Mittagessen. Dieser unbelehrbare Optimist war tatsächlich überzeugt gewesen, hier ohne Gesichtskontrolle durchzukommen.
Rückblende, siebzig Jahre: Dass es kein Fremder hier leicht hatte, zeigt die Geschichte des kleinen Ivo Livi, der sein erstes Geld als Elfjähriger in einer Seifenfabrik verdiente. Und irgendwann zu singen begann und irgendwann seine Mutter vom Balkon runter «Ivo monta», Ivo, komm rauf, schreien hörte. Der Halbwüchsige hatte seinen Namen gefunden und wurde nicht viel später als Yves Montand berühmt.
Wir haben Glück, keiner stellt sich uns in den Weg, keiner zieht uns zur Rechenschaft. Als wüssten die Marseiller, dass Reisende eine Schonfrist verdienen, sprich, es immerhin einen Tag dauern darf, bis sie den Gang des Fremden verlernt haben und begreifen, wie umgehen mit der Fremde. Sogar der Mistral legt sich, die Aprilsonne blüht, in der Rue Thubaneau lächeln die Huren. Manche mit wurzelschwarzen Zähnen. Ich lächle zurück. Ich würde gern wissen, wie die Sehnsucht nach Sex und ein faules Gebiss zueinander kommen.
In der Bar du Soleil treffe ich Sohar. Er will nichts hören von leichtsinnigen Damen, er fastet gerade, trinkt in der verrauchten Kneipe einen Minztee. Der Marokkaner stammt aus Fes und erzählt mir von seiner Frau, die er von Herzen mag. Allerdings gäbe es vier Arten von Liebe. Die himmlischste wäre jene zu Allah, dann käme die zu Mohammed, dem Propheten. Auf dem dritten Platz folgten die Eltern und als Schlusslicht die Gattin. Allah hätte es so bestimmt, und das Weib wäre damit ganz einverstanden. Sohars Frau kann von Glück reden, bald werde ich einen verheirateten Herrn kennen lernen, der scheint inniger verliebt in kalt glänzende Eisenteile als in alles andere.
Unten am Fischmarkt lungert eine Gruppe Deutscher, zehn Männer, eine junge Frau, ein Hund. Alle augenblicklich friedlich, sie betteln. Die nasenberingte Ellen meint, das Tier wäre am wichtigsten, der Rottweiler errege Mitleid, wegen ihm fielen immer ein paar Francs ab. Der zwölfte Mann ist ein Franzose, Gilbert, er ist einunddreißig und sieht aus wie einundsechzig. Bei einem Banküberfall geriet er ins Kreuzfeuer, ein Querschläger landete in seinem Hintern, seitdem klappern die Beine beim Gehen. Er sagt den unglaublichen Satz: «Ich hab das Leben noch vor mir.»
Ich verschwinde in ein Café, habe ich mir doch geschworen, mich pro Tag mindestens eine Stunde zu verstecken und zu lesen. Treffen keine Buchstaben in meinem Kopf ein, fehlt ein Hauptnahrungsmittel. Dazu kommt die Gewissheit, dass gebundenes Papier in der Hand halten ein zutiefst ästhetischer Akt ist. Don DeLillo schenkte den Lesewütigen den maßgeschneiderten Satz: «Das Buch ist ein Wunder körperlicher und geistiger Annehmlichkeit.»
Als ich aufstehe, fällt mein Blick auf das Gesicht des Tischnachbarn, schönes Gesicht, elegante Züge. Ich erfahre, dass sein Vater Franzose, die Mutter Vietnamesin war. Wir kommen ins Gespräch, reden von den Träumen, die wir als Kinder spinnen, und dem tatsächlichen Leben, das wir als Erwachsene führen. Dass dafür oft Feigheit verantwortlich ist und die einen diese Feigheit sich leichter, die anderen sich nie vergeben. Was von Vorteil ist, denn die, die sich nichts verzeihen, sind zäher hinter ihren Träumen her. Beim Abschied frage ich ihn, was er verlangen würde, hätte er einen einzigen Wunsch. Und Daniel: «De l’amour.»
Einchecken am Hafen. Ein «écrivain public», ein öffentlicher Schreiber, bietet seine Dienste beim Ausfüllen der Papiere an. Piktogramme mahnen zur Bescheidenheit: Eine Tragetasche, einen Koffer, mehr darf keiner mitnehmen. Und alle rollen mit Tonnen von Gepäck an. Aber in diesem Moment beginnt Afrika, das nonchalante, das großzügige. Jeder kommt durch.
Wieder meldet sich die kleine Angst, wie immer, wenn man einen Ort verlässt. Erstaunlich, wir waren keine vierundzwanzig Stunden in Marseille, aber schon hat sich ein Gefühl von Vertrautheit eingestellt. Durch das Wandern entlang der Straßen, durch den Blick auf die Fassaden, durch die Nähe eines Mannes, der einem anderen Mann erzählt, dass ihm nichts fehle, nur Liebe. Aber diese Angst tut gut, sie macht wach.
Auf dem Dampfer teilen wir eine große Kajüte mit ein paar Tunesiern. «Classe Fauteuil», wir dürfen sitzen oder auf dem Boden schlafen. Wir kommen gut miteinander aus. Nur der Fernseher nervt. Von dem wollen sie nicht lassen. Stundenlang läuft eine amerikanische Serie mit einem halben Dutzend steil toupierter Idiotinnen. Meist in Begleitung von prachtvoll kalifornisch geklonten Boys. Bis ich selige Schnarchtöne vernehme. Sie kommen von Rachid. Neben ihm liegt eine winzige Batterie. Sie treibt sein Hörgerät an. Beneidenswert, drei Gramm – mehr wiegt der Zinkknopf nicht – entscheiden über Stumpfsinn oder Wohlleben. Auf Kommando nichts hören müssen, das ist Glück.
Das Schiff segelt unter tunesischer Flagge, doch nichts erinnert an den Kontinent, auf den wir zusteuern. Alles sieht aus und riecht und schmeckt wie im Land der Weißen. Die Farben der Möbel, die Nachrichten, die Musik, das Geschirr, die Getränke, die Restaurants. Löblicherweise gibt es eine «salle de lecture». Ich schaue dreimal vorbei, um jemanden beim Lesen zu ertappen. Vergeblich. Zuletzt bleibe ich und lege die Weltkarte auf den Boden. Durch die Luke fällt ein Sonnenstrahl, genau auf Afrika. Und ich sitze still und warte, bis sie nach Asien wandert. Schöne Augenblicke, wie sie ermutigen.
Zurück zur Kajüte, Rachid ist aufgewacht, er erzählt, dass er für zwei Monate nach Hause reist. Zu Frau und sieben Kindern. Die alle nicht arbeiten. Da es für keinen Arbeit gibt, sprich keinen Regen. Rachid zeigt mir seinen Lohnzettel, er arbeitet für einen gewissen Earl (Graf!) Pippin auf dessen Latifundien, nicht weit von Marseille entfernt. Für 750Euro pro Monat. Davon trägt er die Hälfte zur Post und schickt sie an seine Familie. Ich will ein Foto seiner Frau sehen und er sagt: «Ich habe keines, ich müsste nur heulen, wenn ich es ansähe.» Rachid, das Schlitzohr, er grinst, als ich ihn frage, warum er denn heulen müsse. Weil die Frau so weit weg sei? Oder weil ihn jeder Blick daran erinnere, dass er sich für die falsche entschieden hat?
Der Zustand seiner Zähne und Sandalen beweist, dass ihm nicht viel bleibt von der anderen Hälfte seines Lohns. Rachid grinst wieder. Ein bisschen bleibt immer, «pour les copines», für die Mädchen. Die ihn bisweilen trösten. Eine halbe Nacht, bis er wieder antreten muss beim Grafen.
Nachts, als alle schlafen und zwölf von sechzehn Füßen in die Höhe ragen, ausgestreckt auf der Rückenlehne des Vordersitzes, läuft der Fernseher noch immer. Ich schalte nicht aus, Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt werden vorgestellt. Unter anderem die Briefe, die Consuelo Suncin de Sandoval an ihren Mann, den Schriftsteller und Piloten Antoine de Saint-Exupéry schrieb: «Les lettres du dimanche», die Sonntagsbriefe. Da jeden Sonntag aufgesetzt. Oft verfassten beide Briefe, ohne sie abzuschicken. Um sie sich gegenseitig beim nächsten Wiedersehen vorzulesen. Noch viele Sonntage nach seinem Tod schrieb sie ihm. Ich schlafe schlecht, wer wünscht sich nicht eine Frau, die sich so innig an einen erinnert.
Am nächsten Morgen begegne ich Harun, dem Mann mit den leuchtenden Augen. Beim Frühstück erzählt er sein Leben. Tunesier, in Marseille geboren, Kleinkrimineller bis zu dem Tag, an dem ihn eine ambulante Missionarstruppe zum Islam bekehrte. Die Diebstähle hören auf, er lernt Arabisch, redet heute von Frieden und Toleranz und den rasenden Fundamentalisten, die morden und den Namen des Islam in den Dreck ziehen.
Ich weiß nicht, ob er meint, was er redet. Manchmal leuchten seine Augen, manchmal stechen sie. Alle, die neugieriger auf Gott sind als auf ihre Zeitgenossen, machen mir Angst. Jetzt kehrt er in seine Heimat zurück, um zu heiraten. «Fromm» sei die Frau, die er sich ausgesucht habe. Zudem trage sie keine Hosen, auch das beruhige ihn.
Mittags legen wir an in Tunis. Wir stürzen hinaus, um nichts zu versäumen. Denn gestern Nachmittag traf ich in der Cocktailbar Claude. Rentner, reich, sprühend, sympathisch. Einer von vierundsechzig Motorradfahrern an Bord, die vom französischen Harley-Davidson-Importeur eingeladen wurden, an einer Spritztour durch Tunesien teilzunehmen. Die meisten Teilnehmer sind ältere Herren, die inzwischen ein paar Jahre Zeit hatten, dickere Geldbündel auf die Seite zu schaffen. Der Film Easy Rider hat Claude seinerzeit umgehauen. Wenn auch heute nichts mehr easy ist: 350Kilo wiegt das Motorrad, 100Kilo der Fahrer, 50 das Gepäck, zusammen immerhin eine halbe Tonne.
Der ehemalige Unternehmensberater erlag dem amerikanischen Mythos von Weite und Abhauen: «Cruising», sagt er, cool über die Welt kreuzen. Cool mit Vollkasko: mit einem Mechaniker für den Platten, dem Onkel Doktor für die Bauchschmerzen, der Filmcrew für die Nachwelt. Tagsüber werden alle unter Polizeischutz ein paar Runden kurven, abends im sorgsam reservierten Five-Star-Bettchen einnicken. Eine Woche lang.
Während dieses Gesprächs beichtet Claude seine wachsend erotische Hingabe an Edelstahl: «Also, wenn ich’s recht bedenke, dann streichle ich häufiger meinen Motor als meine Frau.»
Seit dem Geständnis sind sechzehn Stunden vergangen, jetzt ist es kurz vor dreizehn Uhr und es kommt zu einem staunenswerten Bild: Nahe dem Zollgebäude hat sich Khaled aufgebaut, lebenslänglich gelähmt, im hölzernen Rollstuhl. Und die halbe Hundertschaft Maschinen, keine billiger als 10000 und keine teurer als 35000Euro kommt vor ihm zum Stehen. Die Erste Welt braust an. Und der Mann aus der Dritten Welt schaut zu. Links neben seiner Lenkstange hängt ein Plastikbecher für die Almosen. Der Kontrast ist so peinigend, dass ihn jemand aus dem Bild schiebt. Damit keiner den anderen stört. Ein Radio plärrt, Johnny Halliday singt «La musique que j’aime», die lieben Dicken machen sich auf ihre «route des mirages», die Route der Fata Morganas. Khaled lächelt. Wie macht er das?
Zwei
Wunderliches Tunis. Als wir unser Hotel betreten, warten Fatima und Karima auf uns. Nun, sie warten auf alle, die hier vorbeikommen. Das Haus ist offiziell ein «anständiges Haus», dennoch hat sich auch in dieser Weltgegend herumgesprochen, dass Reisende müde sind, einsam, nicht unempfänglich für die Wärme von Frauenhänden. Wie menschenfreundlich, wie weise sie hier handeln. Wie diskret sie in dieser Pension Widerstand leisten gegen die amtliche Moral. Wann immer die beiden herüberlächeln, bete ich leise: «Fatima und Karima sollen leben, dreimal hochleben.»
Noch einer soll hochleben, Nabil, der Junge an der Rezeption. Er spricht ein einfaches Französisch und möchte es verbessern. Er meint das todernst, geht mit mir die Konjugationen durch, bittet um ein Grammatikbuch aus Paris. Bewundernswert, wenn einer sich vornimmt, von allein aufzuholen. Man weiß dann wieder, wie unverschämt privilegiert das eigene Leben verläuft. Nabil muss kämpfen für das, was andere geschenkt bekommen haben.
Ein Zwischenruf: Das hier ist keine Weltreise, sondern die Beschreibung einer Weltreise. Wie die Pfeife auf dem berühmten Bild von Matisse keine Pfeife ist, sondern die Darstellung derselben. Sie ersetzt weder den schönen Dunst noch das Wohlgefühl der Entspannung, noch die Aussicht auf Lungenkrebs. Ähnlich hier. Wenn das Lesen dieser Seiten irgendeinen Sinn haben soll, dann den folgenden: den Leser mit Sehnsucht vergiften. Damit er den Mehlsack in sich vergisst, den Ranzen schnürt und losrennt. Erst ab diesem Augenblick besteht die Möglichkeit, dass auch ihn die Freuden und Niederlagen eines solchen Unternehmens einholen. Hautnah.
In der Medina treffe ich Hoshimo, Fotograf aus Japan. Heute Vormittag war er zum dritten Mal in Dougga, dem Ort mit den berühmten römischen Ruinen. Und zum dritten Mal musste er unverrichteter Dinge abreisen. Weil keine Sonne strahlte. Hoshimo arbeitet für einen Reiseveranstalter in Tokyo, und ein Himmel ohne Sonne kommt nicht infrage. Ein bewölktes Kapitol, wen soll das verlocken? Der Profi weiß es genau: «Ich verkaufe Träume, nicht die Wirklichkeit.»
Ein arabischer Souk funktioniert als Fundgrube. Zum Finden eigenartigster Wesen. Ich frage nach einer Buchhandlung, und Abdul will mich hinführen. Ich registriere, dass er seltsam langsam geht. Bis mir klar wird, dass er kaum sieht. Und wir anhalten, ich ihn bei der Hand nehme und in ein Café bringe. Der Mann ist fünfzig und ich bin froh, dass er mein überraschtes Gesicht nicht sieht. Wer in dem Alter so aussieht, muss ein schwieriges Leben hinter sich haben.
Während seines Jurastudiums legte sich Abdul mit dem Staat an, protestierte gegen die Politik von Präsident Bourguiba, rief nach mehr Gerechtigkeit und Freiheit, wurde verhaftet, hatte in monatelanger Dunkelhaft Gelegenheit nachzuprüfen, dass es beides nicht gab. Als er die Zelle verließ, sah er rechts nichts und links nur noch Schemen und Schatten. An ein Studium war nicht mehr zu denken, jahrelang musste er sich jede Woche bei der Polizei melden. «J’ai perdu ma vie», ich habe mein Leben verloren, sagt er ruhig. Im Eigenstudium brachte er sich Französisch und einen Grundwortschatz Deutsch bei. Er spart auf eine Operation, ein Auge wäre vielleicht noch zu retten. Er bereut nichts. An die göttliche Gerechtigkeit glaubt er noch immer: «Gott sieht mich, Gott wird sich meiner erinnern.»
Tunesien muss sich anstrengen. Noch immer steht es im Schwarzbuch der Menschenrechtsverletzungen. Ein Blick in die Presse zeigt, dass der Weg noch weit ist. Präsident Ben Ali, zuletzt im Oktober 1999 mit 99,44Prozent Jasager-Stimmen bestätigt, lässt regelmäßig eine Riege Journalisten antanzen, um sich jeden Tag eine Hymne schreiben zu lassen. Heute titeln sie: «Ben Ali gilt als Vorbild in der arabischen Welt.» Und Fotografen tanzen auch an. Damit sein Bild jeden Tag auf der ersten Seite landet. Seit vierzehn Jahren.
Mich lässt Ramsi antreten. Er sieht mich streunen und wickelt mich ein. Instinktiv fühlt er, dass ich nach Geschichten schnüffle, also auf jeden hereinfalle, der mit geheimnisvoller Miene «une belle histoire» ankündigt. Nach zwei (von mir bezahlten) Bier rückt er sein Geheimnis heraus: Er hätte gern ein Visum für Frankreich. Als ich darauf verweise, dass ich gerade keines bei mir habe, meint Ramsi treuherzig: «Dann eben eine Flasche Wein.» Das klingt absolut logisch, der Alkohol soll ihn über die Aussicht trösten, heute nicht nach Europa auswandern zu dürfen.
Anstrengendes Land. Ich sitze auf der Terrasse des Café des Cheminots, und drei Meter entfernt bricht ein Mann zusammen. Mitten beim Überqueren der Straße. Man trägt ihn auf den Bürgersteig, setzt ihn auf, lehnt ihn gegen eine Hausmauer. Ironischerweise neben einer (geschlossenen) Apotheke. Ein Kranker, meint jemand, irgendeine Attacke. Ich finde zwei Rezepte in seinen Taschen, leider nicht zu entziffern. Bald kann der Mensch reden, haucht den Namen seines Wohnorts, weit draußen. Außer den beiden Zetteln trägt er nichts bei sich. Auch keine Dinare, um ein Taxi nach Hause zu bezahlen. Eine Polizeistreife kommt vorbei, zufällig. Ich bitte den Fahrer, einen Krankenwagen zu schicken. Der Polizist nickt, fährt weiter und ein paar der Umstehenden lachen. Hier käme keine Ambulanz vorbei und der Kranke wäre nicht krank, sondern blau. Der erste Teil des Satzes stimmt, denn auch nach einer halben Stunde taucht kein Notarzt auf. Ob der Alte ein Alkoholiker ist – schwer zu sagen. Er riecht nicht. Ich führe ihn in eine Ecke des Cafés und bestelle einen Cappuccino für ihn. Bin nicht sicher, ob das genügt. Sicher nicht.
Dafür habe ich einen neuen Freund. Kellner Abdelasziz spielt mir seine Telefonnummer zu. Mit der Bitte, ihn morgen anzurufen. Für ein Rendezvous zu einem gemeinsamen Spaziergang. Was meine Stimmung eher drückt. Jetzt sind es zwei Männer, die ich enttäusche.
Abendessen mit Uli Reinhardt im Bella Italia, laute, enge Kaschemme. Und wieder nur Männer. Das Freitagsgebet hat heute offensichtlich nicht angeschlagen, zweimal gehen Raufbolde aufeinander los. Und immer sofort dazwischen der massige Patron. Souverän hält er den grimmigeren Wüstling fest und bietet ihm gleichzeitig an, sich auszusprechen. So schlägt der Grobian nichts zu Trümmern und verliert trotzdem sein Gesicht nicht.
Auf uns kommt Kadel zu, er liebt Deutschland und sagt immer: «Mein Deutschland.» Sechs Monate hat er dort verbracht. Gearbeitet?, frage ich und Kadel, der Poet: «Nein, nur spazieren gegangen.» Er lädt uns zu einem Glas Orangensaft ein, dazu bekommen wir Küsse auf Hals und Stirn und die unwiderrufliche Versicherung, dass er «sein Deutschland» liebt.
Eigenartig, Gleichgültigkeit will nicht aufkommen bei der Erwähnung von «Allemagne»: entweder Anbetung oder Verachtung. Zwischentöne gibt es nicht.
Bettlektüre, in «La Presse» steht: Timothy McVeigh, der Bombenleger von Oklahoma, hat den Wunsch geäußert, seine Hinrichtung solle weltweit übertragen werden. Noch im Augenblick des Todes will einer sich herzeigen, verlangt er den Zuschauer. Das Ende eines Herostraten: Ich morde, also bin ich berühmt, also bin ich.
Am nächsten Morgen auf nach Sidi Bou Saïd, keine zwanzig Kilometer westlich der Hauptstadt. Zuerst entdeckten es die Maler. Weil hier ein Blau vom Himmel fällt, das zu allen anderen Blaus inspiriert. Weil das Dorf noch «stimmt», die weißen Häuserwände, die griechisch blauen Fensterläden, das grüne Meer. Alles noch da. Auch wenn die Maler inzwischen geflüchtet sind, während nun im Zehn-Minuten-Rhythmus Großraumbusse anlanden und die Reichen aus den reichen Ländern abladen. Und ich die Herren Sabbatini und Tanaka und Pichler erwische, wie sie Quadratkilometer einer aberwitzig schönen Welt links und rechts liegen lassen, um stattdessen hartnäckig auf die winzige Mattscheibe ihres Camcorders zu starren. Hingerissen von einem Medium, das ihnen den Blick auf die Wirklichkeit raubt. Ich gäbe mein Abendessen, liefe jetzt ein Satz des englischen Nobelpreisträgers William Golding über ihren Bildschirm: